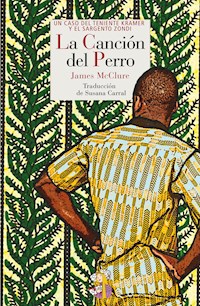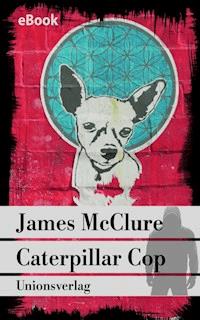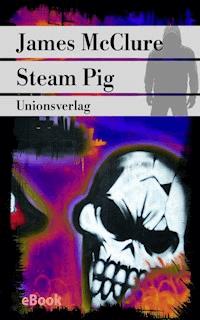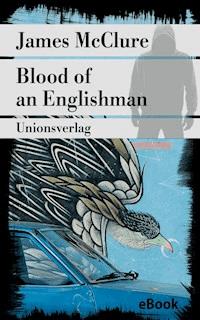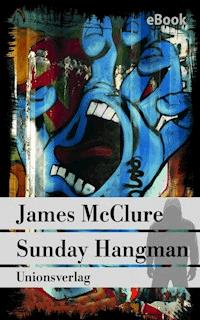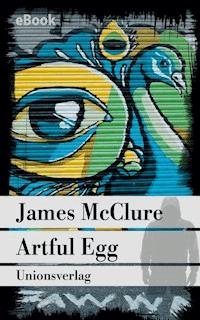9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Laut dem Dorfpfarrer hatte niemand einen Grund, Hugo Swart, den treuen und angesehenen Bürger, zu hassen. Doch am Weihnachtsabend liegt dieser niedergestochen in seiner Küche. Es sieht aus, als könnte das einzige Motiv Geld gewesen sein, und so verdächtigt man Swarts Diener, Shabalala, der mittlerweile aufs Land geflohen ist. Detective Michael Zondi verfolgt den Tatverdächtigen in entlegensten Dörfern, während Lieutenant Tromp Kramer mit einer anderen Angelegenheit beauftragt wird: einem Autounfall unter Alkoholeinfluss. Kramer zieht bald Parallelen zwischen beiden Fällen und versucht, den Bewohnern von Trekkersburg Informationen abzugewinnen. Die Behauptungen des Dorfpfarrers entpuppen sich langsam aber sicher als blanke Lügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Hugo Swart liegt erstochen in der Küche, verdächtigt wird sein Diener, Shabalala. Sergeant Zondi verfolgt den Tatverdächtigen bis in die abgelegensten Dörfer, während man Lieutenant Kramer mit der Untersuchung eines Autounfalls beauftragt. Bald ergeben sich gefährliche Parallelen zwischen beiden Fällen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
James McClure (1936–2006) lebte in Südafrika, bis er 1965 nach England zog. Seine Krimiserie rund um das Ermittlerduo Kramer und Zondi schildert die Jahre der Apartheid. Steam Pig wurde 1971 mit dem CWA Gold Dagger ausgezeichnet.
Zur Webseite von James McClure.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
James McClure
Gooseberry Fool
Südafrika-Thriller
Aus dem Englischen von Erika Ifang
Kramer & Zondi ermitteln (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel The Gooseberry Fool im Verlag Victor Gollancz Ltd, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1976 unter dem TitelGeheime Sünden, bar bezahlt im Scherz Verlag, Bern.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung nach dem Original durchgesehen.
Originaltitel: The Gooseberry Fool (1974)
© by The Estate of James McClure 1974
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Paula Vogg
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30953-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.07.2024, 16:31h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GOOSEBERRY FOOL
1 – Hugo Swart fuhr kurz nach neun in der …2 – Lieutenant Tromp Kramer vom Morddezernat Trekkersburg saß allein …3 – Dr. Strydom fuhr gut, allerdings schneller, als Kramer …4 – Das Frühstück bestand aus einem Riesenpaket durchwachsenem Speck …5 – Bruder Kerrigan und die sieben Nonnen teilten ihre …6 – Das Wort Jabula hat im Zulu mehr als …7 – Kramer ging gerade im Sturmschritt am Albert Hotel …8 – Zondi lag am Berghang mit Blick auf Jabula …9 – Der Weihnachtsmorgen war längst angebrochen, als Kramer mit …10 – Colonel Du Plessis wohnte mit seiner reizlosen Familie …11 – Aus war es mit den nutzlosen Fantasien …12 – Bob Perkins war über Weihnachten verreist. Kramer versteckte …13 – Zondi kam am 27. Dezember gegen sechs Uhr …14 – Das größte Leid, schlimmer als alles, was Kramer …Mehr über dieses Buch
Über James McClure
»Wenn meine Gedanken in Südafrika sind, höre ich immer Gelächter«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von James McClure
Zum Thema Südafrika
Zum Thema Afrika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Frances
1
Hugo Swart fuhr kurz nach neun in der heißesten Nacht des Jahres zur Hölle. Es kam völlig überraschend für ihn, wie sich auch seine Bekannten, die ihn als gottesfürchtigen jungen Mann ohne Anhang kannten, keinen Reim auf seine brutale Ermordung machen konnten.
Seine Überraschung war allerdings von anderer Art; bei ihm gab es keine Vermutungen, sondern nur die plötzliche, reale Todesqual, so wirklich wie die improvisierte Waffe, mit der die Tat begangen wurde. Und im letzten Aufflackern seines Bewusstseins erkannte er, dass ihm ein unerklärliches Versehen unterlaufen war.
Es war die Annahme, in seinem Haus bei abgeschlossener und verriegelter Vordertür und ebenfalls verschlossener Hintertür allein zu sein. Er hätte wahrhaftig die Möglichkeit in Betracht ziehen sollen, dass sich während seines abendlichen Kirchgangs ein Eindringling hereinstahl. Oder zumindest routinemäßig einen prüfenden Blick in die Zimmer werfen sollen, wie es jeder Wohnungsinhaber bei seiner Heimkehr tut, ganz zu schweigen von einem Mann in seiner Situation. Dann hätte er vielleicht einen Schatten davonhuschen sehen, als er sein Messbuch durch das abgedunkelte Arbeitszimmer auf seinen Schreibtisch warf. Aber nichts dergleichen. Er blieb an der Tür stehen und betrat das Arbeitszimmer nicht einmal.
Stattdessen begab er sich, den Sinn von angenehmen Gedanken erfüllt, geradewegs in die Küche, wobei er vor sich hin summte. Sein schwarzer Diener hatte das Deckenlicht und den Ofen angelassen. Der beißende Geruch des verbrannten Steaks stach ihm sofort in die Nase, aber seine einzige Reaktion war die, den Herd abzustellen. Er hatte eher Durst als Hunger.
Er machte den Kühlschrank auf und fand darin alles, was er für einen kalten Longdrink brauchte. Seine Wahl fiel auf Wodka, denn er glaubte, davon bekäme man keine Fahne – Wodka, Orange und viel Eis. Die einfache Zubereitung nahm ihn vollkommen gefangen. Zuerst maß er den Schnaps ab und legte die Flasche wieder in ihr Versteck im Gemüsefach zurück. Als Nächstes kamen zwei Fingerbreit unverdünnter Saft aus der Dose, dann drei Eiswürfel und als Abschluss Eiswasser. Das hohe Glas beschlug sofort, und Tropfen rannen an seiner dünnen Wand herab. Wenn es richtig kalt sein sollte, musste er allerdings noch warten, bis das Eis seine Wirkung tat.
Er schaltete das Radio neben dem Elektrokessel ein und hörte die Nachrichten. Der 23. Dezember war laut südafrikanischem Wetteramt der heißeste Tag des Jahres, was für niemanden eine Neuigkeit war. Aber sie hatten recht, wenn sie die Hitzewelle an erster Stelle brachten; es lag unzweifelhaft eine gewisse Befriedigung darin, zur Abwechslung einmal selbst Teil der Nachrichten zu sein, genau zu wissen, was für eine Tortur es gewesen war, und sich – wenn auch in Maßen – als Überlebender zu fühlen.
Hugo Swart war in jeder Hinsicht am Überleben interessiert, wie jeder, der eine strahlende Zukunft vor sich hat.
Der blöde Kessel fing an zu kochen. Zuerst dachte er, das Geräusch, ein merkwürdiges Pfeifen, ertöne hinter ihm, bis er das Flimmern über der Tülle bemerkte – es war einfach zu heiß und zu feuchtschwül, als dass sich Dampf hätte zeigen können. Kessel und Radio hingen an derselben Schalterdose; er hatte schon oft den Fehler gemacht, beide zusammen einzuschalten. Und tatsächlich gurgelte der Kessel nach einem Augenblick der Stille los und drohte durchzubrennen, wenn nicht schleunigst Wasser nachgefüllt wurde. Der verfluchte schwarze Affe hatte ihn mal wieder leer stehen lassen. Aber ein kurzer Ruck an der Schnur würde Abhilfe schaffen.
Er riss sie heraus, dann zog er sich die leichte Jacke aus, wünschte, er hätte das schon zehn Minuten früher getan, und legte sie mit allem Übrigen auf das Abtropfbrett.
Die überregionalen Nachrichten waren mittlerweile vorbei, es folgten die Lokalberichte. Ihnen war zu entnehmen, dass die Temperatur in Trekkersburg die Rekordhöhe von 45 Grad Celsius erreicht hatte.
»Im Schatten«, fügte der Nachrichtensprecher noch hinzu. Woraufhin Hugo Swart, der für solche Pedanterie nichts übrighatte, laut sagte: »Mir kommen die Tränen!«
Seine letzten Worte.
Einen Augenblick betrachtete er seinen Drink, dann entschied er sich, den Genuss zu steigern, indem er noch etwas länger wartete.
Also füllte er den Eiswürfelbehälter unter dem Wasserhahn und stellte ihn wieder ins Eisfach. Er schloss die Kühlschranktür. Machte sie wieder auf und schloss sie erneut, sinnend. Als Kinder hatten er und seine Schwester sich einmal heftig darüber gestritten, ob das Licht im alten General Electric ihrer Stiefmutter wohl ausging, wenn die Tür zugemacht wurde. Darauf waren sie durch die Behauptung eines fantasiereichen Freundes gekommen, der schwor, dass ein Elf, eine Art versklavtes Väterchen Frost, darin lebte und das Licht ausmachte, sobald es nicht mehr gebraucht wurde. Das war natürlich völliger Quatsch, aber die Frage blieb trotzdem ungeklärt. Er selbst hatte die Ansicht vertreten, es sei nur logisch, dass das Licht ausging, während seine Schwester – die Süßigkeiten besaß, von denen er etwas abhaben wollte – gemeinerweise von ihm verlangt hatte zu beweisen, dass es wirklich ausging. Dazu war er natürlich nicht in der Lage gewesen, und so hatte er schließlich ein Lippenbekenntnis zugunsten ihres irrationalen Standpunktes ablegen müssen. Er wusste zwar, dass das Licht mit Sicherheit ausging, aber darüber zu streiten war ebenso sinnlos, wie wenn ein Atheist und ein Priester über die Unsterblichkeit der Seele stritten: In beiden Fällen konnte auf dieser Seite der Tür nichts befriedigend geklärt werden.
Hugo Swart lachte leise. Es war schon etwas Wahres dran an dem Gerede von den prägenden Lebensjahren. Er hatte seit damals die Maxime befolgt, sich stets den Ansichten anzuschließen, die zum gegebenen Zeitpunkt seinen Zwecken am dienlichsten waren. Und das schien auch in dieser Sache genau das Richtige gewesen zu sein. Yes, Sir.
Sein Drink war fertig. Die Eiswürfel waren zur Hälfte getaut, und ein nasser Kranz hatte sich auf dem Frühstückstisch gebildet. Für diesen Augenblick hatte sich das Warten sicherlich gelohnt, aber er zögerte ihn noch länger hinaus: mit einem Toast auf seine Wohltäter.
Das Glas hoch erhoben, wandte er sich zum Fenster, in der Hoffnung, sich in dieser komischen, zynischen Pose im nachtdunklen Glas zu spiegeln. Leider waren die Jalousien herabgelassen, sodass er nichts sehen konnte.
Noch weniger, als er gedacht hatte.
Denn als er eben das Glas an die Lippen führen wollte, stach jemand von hinten mit einem Steakmesser auf ihn ein. Der erste Stich traf sein linkes Schulterblatt, die Klinge rutschte über den flachen Knochen und blieb zwischen zwei Wirbeln stecken. So stark war der Hieb, dass sich seine Kraft bis in die Gliedmaßen fortsetzte, sodass ihm das Glas, noch ehe es die Lippen erreichte, aus der Hand flog. Er sah, wie es zerschellte, und spürte den entsetzlichen Schmerz.
Seltsamerweise stand er einfach nur da; die Verschwendung war ihm zuwider, er fragte sich, was wohl mit ihm geschehen würde, hörte, dass der nächste Programmpunkt ein kurzes Zwischenspiel mit Kammermusik war. Er war verblüfft, als ihm schließlich bewusst wurde, dass noch jemand im Zimmer war, jemand, der keuchte und ihn sehr hassen musste.
Das war die erste Überraschung für ihn. Andere folgten.
Er taumelte herum und griff nach der Gabel, die noch auf dem für ein spätes Abendessen gedeckten Platz lag. Aber er verfehlte sie und konnte seinen Angreifer auch nicht mehr erkennen. Denn ehe er seinen schwankenden Kopf heben konnte, wurde er von seinem eigenen Blut geblendet – ein heftiger Stich mit dem Messer hatte die Wülste unter seinen Augenbrauen geöffnet.
Beim ersten Celloton traf ihn der tiefe Stich in die Brust, sodass er rückwärts gegen den Tisch fiel. Das war gar nicht gut, ihm blieb nichts anderes übrig, als sich auf den Glasscherben zu wälzen und sich etwas auszudenken, was er sagen könnte. Zum Beispiel: Ave Maria.
Dann, zwischen den zwei folgenden Takten Stille, vom Komponisten kunstvoll ersonnen, um die Zuhörer auf den vollen Schwall lebenspraller Klänge einzustimmen, wurde Hugo Swart der Adamsapfel durchbohrt, und ebenso schnell wie das Blut verrann sein Leben.
Es blieb ihm gerade noch genug Zeit, um zu hören, wie sein Hörgerät zertreten wurde – und darüber nachzudenken, was er doch für ein Narr gewesen war.
2
Lieutenant Tromp Kramer vom Morddezernat Trekkersburg saß allein in der Toilette im dritten Stock und fragte sich, ob ihm wohl irgendjemand ein Geburtstagsgeschenk machen würde. Er war splitternackt und hatte ein zerknülltes Stück Papier in der rechten Hand.
Mann, war es heiß. So heiß, dass es einem auf den Geist ging. Seiner hatte sich den ganzen Tag lang prickelnd kalte Gedanken gemacht, so weit entfernt von Mord wie ein Schwimmbad von einem Säurebad. Außerdem waren ihm noch ein paar außergewöhnliche Theorien eingefallen, die ebenfalls nichts mit der Arbeit zu tun hatten; zum Beispiel die, dass die Sonne nahe herankommen und – wie ein Junge mit einem Vergrößerungsglas – zuschauen würde, wie sie mit ihren Strahlen Löcher in die Landkarte brannte. Falls das nicht ganz stimmte, fühlte es sich immerhin so an – besonders in einem Loch wie Trekkersburg. Jetzt fing er an, sich über den schiefen Haken hinter der Tür zu ärgern und seine Kniekehlen zu hassen, die sich nicht an den kühlen Porzellansockel pressen ließen.
Die Außentür federte quietschend auf und knallte wieder zu. Das Wasser am Waschbecken wurde aufgedreht, und jemand ließ es laufen, in der vergeblichen Hoffnung, der lauwarme Strahl würde doch vielleicht noch kalt werden. Inzwischen widmete sich dieser Optimist der ortsüblichen Tätigkeit, dem Klang nach mindestens eine Gallone gefilterte Coca-Cola an die Wand zu befördern.
Kramer runzelte die Stirn, unangenehm berührt von dieser Störung seiner Privatsphäre. Er beschloss, sich auf kein Gespräch einzulassen und nicht einmal eine unflätige Bemerkung als Gruß loszulassen, sondern blieb vollkommen still. Er vermied auch sonst jedes Geräusch. Sogar dann, als etwa in der Höhe, in der seine Kleidung hing, flüchtig angeklopft wurde. Schade, denn als die Tür ein zweites Mal gequietscht hatte und zugeknallt war, ging das Licht aus.
Mistkerl. Jetzt war es nicht nur verflucht heiß, sondern auch noch stockfinster, und das war das Aus für die Lektüre, die er sich mitgebracht hatte. Er sog die Luft scharf ein. Auch das war ein Fehler, denn es war, als inhalierte er Stumpenqualm in dunkler Nacht: trocken und zum Ersticken unangenehm. Na ja, so weit brachten ihn seine genießerischen Anwandlungen eben immer – genau dahin, wo er jetzt hockte. In seinem stickigen Kämmerchen von Büro mit dem ewig nervenden Telefon und den Schlange stehenden Schwachköpfen, die sich nicht mal selbst die Nase putzen konnten, war ihm die Idee von einem Abstecher den Gang hinunter wie ein genialer Streich gegen alle Eventualitäten erschienen. Er hatte sich volle zehn Minuten in Gedanken ausgemalt, sich auszuziehen, einfach ungestört dazusitzen und ab und zu einen Becher voll aus dem Spülkasten über sich zu gießen, wenn er Lust dazu hatte. Doch schon zehn Minuten später stand fest, dass es nicht so sein sollte.
Mistkerl.
Er erhob sich, beugte sich vor, schob das Papier unter den Jackenaufschlag in die Brusttasche und begann, sich anzukleiden. Wieder kam ihm schlagend die Abwegigkeit von Konventionen in einem solchen Klima zu Bewusstsein, als ihn die Wärme seines Hemdes, seiner Hose und Strümpfe, an einem Wintermorgen gar nicht wahrnehmbar, einhüllte. Seine Schuhe, die hinter die Klobürste gewandert waren, schienen innen feucht zu sein, und das gefiel seinen Zehen. Aber sein purpurroter Schlips saß fest wie eine Aderpresse.
Aus. Die Langweiligkeit des Lebens – oder auch des Todes – konnte wieder beginnen. Um den Schein zu wahren, zog er an der Kette, eine alte Gewohnheit, die er nie hatte ablegen können, entriegelte die Tür, tastete sich in den Gang hinaus – und stieß auf Colonel Muller, den Finger auf dem Lichtschalter.
»Immer noch hier, Kramer?«
»Ja, Sir.«
»Zu viel Aufregung für Sie, was?«
»Klar, Sir. Aber ich bin schon auf dem Weg, keine Sorge.«
»Kramer!«
»Sir?«
»Doch eine Sorge – ich bin über Weihnachten im Freistaat, und dann übernimmt Ihr alter Kumpel Colonel Du Plessis das Regiment.«
Kramer entfuhr ein kurzes, hässliches Wort.
»Das hatte ich auch gerade im Sinn«, grinste der Colonel und verschwand durch die Tür.
Ganz wie es sich für einen netten, kleinen Schwarzen gehörte, stand der Bantubeamte Detective Sergeant Mickey Zondi mit dem Chevrolet, dessen Beifahrertür weit offen stand, startbereit genau vor dem Haupteingang des CID-Gebäudes.
»Ganz schön flott«, grunzte Kramer und schob sich neben ihn. Wie zum Teufel Zondi es schaffte, in dem zugeknöpften Anzug am Leben zu bleiben, überstieg sein Vorstellungsvermögen, Schwarzer oder nicht. Doch es tat eine Menge für sein Image.
Zondi lächelte und leckte sich Salzgeschmack von der Oberlippe. Sein Gesicht drückte leise kochende Langeweile aus und glänzte von Schweißbächen. Er ließ den Motor an, gab Gas, hielt das Auto aber mit der Handbremse im Stand – er brauchte Anweisungen.
»Auf der Notiz für mich stand, dass die Adresse vierzig-irgendwas Sunderland Avenue lautet.«
Es ist nicht einfach, Reifen auf weichem Teer zum Kreischen zu bringen, aber Zondi brachte das mit einer Kehrtwende fertig, die nur er selbst für möglich hielt. In Sekundenschnelle kam ein so starker Luftzug durch die beiden Seitenfenster herein, dass Kramer die Augäpfel austrockneten.
Er blinzelte ein wenig und sagte: »Ich bekomme meine Beerdigung gratis, du verrückter Bastard, vergiss das nicht.«
»Umso besser«, seufzte Zondi und drosselte die Geschwindigkeit vor der Ampel. Er streckte die rechte Hand aus dem Fenster, um den Wind, der keiner war, mit dem Ärmel aufzufangen.
»Die Nachricht«, begann Kramer in belehrendem Ton, »die Nachricht lautet, dass es sich bei dem Toten um einen gewissen Hugo Swart handelt, dreiunddreißig Jahre alt, ledig. Er lebte allein, arbeitete als technischer Zeichner bei der Bezirksverwaltung und war ein eifriger Kirchgänger.«
Zondi schnalzte mit der Zunge.
»Mehrere Stichwunden – kann sonst was bedeuten. Ist um 20.30 Uhr zuletzt lebendig gesehen worden.«
»Von wem, Boss?«
»Von seinem Pfarrer, Pater Lawrence, beim Verlassen der Kirche. Derselbe Pfarrer hat auch die Leiche entdeckt, als er gegen 21.30 Uhr kam, um mit Swart über irgendetwas zu sprechen. Ein Steakmesser, keine Fingerabdrücke.«
»Und wo war die Leiche, Boss?«
»In der Küche. Frag mich bloß nicht, wie der Pfarrer reingekommen ist, ich weiß es nämlich noch nicht.«
»War Boss Swart Katholik? Römische Gefahr?«
»Nicht jeder mit einem Burennamen ist niederländisch-reformiert, Mann.«
Zondi warf Kramer einen unverschämten Seitenblick zu und gab, während er geschickt den Boxhieb abwehrte, beim ersten Grün Gas. Sein Herr und Meister gab sich, wenn überhaupt, den Anschein eines nonkonformistischen Agnostikers.
»Irgendwelche Verdächtigen, Boss?«
»Die Polizeiwache vor Ort behauptet, es müsse ein Bantueinbrecher gewesen sein – was auch sonst, schließlich ist das ihre Lösung für alles, verflucht. Aber ich nehme mal an, sie könnten recht haben: Wann ist das letzte Mal wirklich etwas passiert in dem Dreckloch?«
»Als hier noch die Elefanten lebten, glaube ich.«
»Stimmt genau. Halt an, wenn du ein Café siehst, das geöffnet hat.«
Ein paar Häuserblocks weiter war ein Nachtcafé, und Kramer ließ ihn für sie beide Eis am Stiel holen.
»Ich nehme das mit Schokolade«, sagte er, als Zondi wieder ins Auto stieg. »Könnte nicht mit ansehen, wie du dich in irgend so einen verfluchten Kannibalen verwandelst.«
Diese Köstlichkeiten mundeten ihnen sehr gut und hielten den ganzen Weg zur Stadt hinaus, über die Nationalstraße hinweg bis in die südliche Vorstadt von Skaapvlei. Sie warfen die Stiele weg, als die Sunderland Avenue, von den allgegenwärtigen Jakarandabäumen gesäumt, links abzweigte.
Der Name der Straße hätte schon gereicht. Zondi brauchte gar nicht nach Hausnummern Ausschau zu halten: Die Adresse, die sie suchten, war deutlich zu erkennen an allerlei Fahrzeugen, vom Pontiac des Kreisarztes bis hin zum Wagen des Leichenschauhauses und zwei Fahrrädern, die wahllos vor dem Haus abgestellt worden waren. Außerdem war ein ganzer Schwarm von Dienstpersonal auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, die hinter vorgehaltener Hand flüsterten und kicherten – und ein paar Weiße, die sich offenbar plötzlich entschlossen hatten, ihre Hunde selbst auszuführen. Für das, was sonst nur im Film geschieht, werden Ausnahmen gemacht.
Bevor der Chevy ganz stand, war Kramer schon ausgestiegen und sah sich, die Daumen in die Hosentaschen gehängt, die Menge an. Das tat er mit Vorsicht, denn irgendjemand dort wusste vielleicht etwas Nützliches zu erzählen. Später. Zuerst musste er den Tatort inspizieren und sich ein Bild machen. Kramer drehte sich um und nahm in sich auf, was Hausnummer 44 außen zu bieten hatte, und nickte Zondi zu, ihm zu folgen.
Der Bungalow war ein lächerlicher Zwerg in der langen Reihe ansehnlicher Häuser. Jedes einzelne war das Ergebnis eines eigenen, bewussten Schöpfungsaktes und entsprang jener segensreichen Verbindung von Reichtum und architektonischem Können, die aufgrund des dominanten Erbfaktors Geld unweigerlich ein Geistesprodukt hervorbringt, das der Individualität seines Erzeugers in nichts nachsteht. Dass es Wiederholungen im Grundstil gab – spanischer Kolonialstil, früher kapholländischer Stil, kalifornische Stromlinienform und gaststättenhafter Tudorstil –, zeigte nur, dass niemand so sehr Individualist ist, wie er meint. Sie hatten jedoch nichts von dem schäbigen Gepräge eines Spekulantenbesitzes an sich, auch der Bungalow nicht. Seine Wachstumshemmung war sicher auf einen Schock in der Entstehungsphase zurückzuführen, vielleicht einen Krach an der Börse. Armes kleines Ding, denn wenn es ein Stockwerk höher geworden wäre, hätte sein Dach nicht so unnatürlich groß gewirkt und seine gedrungenen dorischen Stützpfeiler nicht so plump. Es musste sich vollkommen fehl am Platz gefühlt haben und trotzdem unfähig, anderen Umgang zu pflegen.
Als Wohnsitz war der Bungalow eine Sache für sich – ziemlich ungewöhnlich für eine einzige Person, gelinde gesagt, und noch dazu einen kleinen Beamten. Kramer erwartete, in seinem Innern ein erstes aufkeimendes Interesse an dem Fall zu verspüren, aber nichts geschah.
Er ging auf die andere Straßenseite hinüber und blieb stehen.
Stattdessen hatte er das deutliche Gefühl, sich auf irgendeine seltsame Weise selbst zu verachten. Sich ebenso zu verachten wie einen erschöpften Don Juan, der sich wie unter einem Zwang zum nächsten Bordell schleppt, zum nächsten fremden Körper, zum nächsten Akt professioneller Intimität, zum nächsten Höhepunkt und der Entspannung, und das alles ohne eine Spur von Gefühl. Nicht eine Spur. Nur zur Befriedigung einer Begierde, um gleich darauf wieder zu gehen. Vorbei an den Müßiggängern, die einen fassen und herausquetschen wollten, was man wusste und was man getan hatte, die zu viel Angst hatten, es selbst zu tun, und doch lüstern waren. Und wie müde man schon sein konnte, noch ehe alles angefangen hatte.
»Jesus, ich brauche Urlaub«, murmelte er und marschierte los. Verlangsamte seine Schritte, als er Sergeant Van der Poel sah, der mit zum Gruß ausgestreckter rechter Hand auf ihn zugetänzelt kam, Gott helfe ihm.
»Sind Sie das, Lieutenant?«
»Ich bins, Kumpel.«
»Dachte es, Sir. Habe Sie gleich erkannt. Sagte zu meinem Constable, dass Sie angekommen wären, und so war es auch.«
Der blöde Kerl hatte jetzt schon eine Menge über nichts gesagt. Mochte wohl den Klang seiner eigenen öligen Stimme, dieser Van der Poel. Liebte sich wohl von Kopf bis Fuß, sodass selbst sein Arsch denken musste, er sei etwas Besonderes. Ein komisches Leben für einen Arsch musste das sein.
»Irgendetwas los, Sir?«
Und ob was los war: Kramer misstraute eitlen Männern. Und es war ganz offensichtlich Eitelkeit, dass die Ringellocken so angeklatscht waren, um eine kahle Stelle zu verbergen, dass die Uniform so maßgeschneidert saß wie ein Kondom und der Oberlippenbart fast bis zur Unkenntlichkeit kurz geschnitten war.
»Was ist denn mit Ihren Schuhen los, Van der Poel?«
»Verzeihung, Sir?«
»Sie gehen ja wie ein verfluchter Zuhälter.«
Wie befriedigend diese Bemerkung doch war: Sie brachte ohne viel Federlesens die Dinge für beide ins Lot.
»Hier entlang, Lieutenant.«
»Danke, Kumpel.«
Drinnen im Haus waren in jedem Zimmer Menschen und besonders in der Küche. Auf Kramers Anordnung mussten sie alle hinaus, mit Ausnahme des Pfarrers, Pater Lawrence, und des Pathologen und Kreisarztes, Dr. Christiaan Strydom.
»Jetzt können wir endlich zur Sache kommen«, sagte er und hockte sich auf den Boden, um die Leiche zu inspizieren. Die vielen Stichwunden sprachen für sich und brauchten keine Erklärung vonseiten Strydoms. Zuerst ein Stich in den Rücken, der nächste in die Brust und dann einer in die Kehle. Ein kleinerer Schnitt über den Augen.
»Hat sich gerade einen Drink gemixt, als ihn irgendein Kerl von hinten erwischt hat«, folgerte er.
»Das scheint mir auch so«, pflichtete ihm Strydom bei. »Hat er lange hier gelegen?«
»In diesem Punkt bin ich mir ziemlich sicher«, erwiderte Strydom. »Seine Temperatur und andere Faktoren geben 21.15 Uhr als Todeszeit an.«
»Aha. Um wie viel Uhr waren Sie denn hier, Reverend?«
Pater Lawrence blickte von seinem Platz neben der Tür auf.
Für einen Mann, der beruflich mit der Vorbereitung auf den Tod zu tun hat, war er auf diesen hier miserabel vorbereitet. Seine Stimme zitterte.
»Ich – ich bin um zwanzig nach neun hier gewesen, Lieutenant. Ich weiß, dass ich zehn Minuten früher als erwartet kam, aber es sind um diese Zeit im Jahr so wenig Leute im Krankenhaus, die ich besuchen muss – wegen Weihnachten, müssen Sie wissen.«
»Weiß ich«, sagte Kramer.
»Entschuldigung. Nun, ich dachte – äh, dachte mir, Hugo hätte sicher nichts dagegen, und so bin ich hierhergekommen und habe geklopft. Ich habe gewartet, aber keine Antwort. Wir hatten uns für 21.30 Uhr verabredet, um noch letzte Vorbereitungen für die Mitternachtsmesse zu treffen. Er sollte den Transport für die älteren Gemeindemitglieder organisieren, die allein leben, müssen Sie wissen.«
Diesmal wusste Kramer es nicht und gab einfach auf.
»Weiter!«, drängte ihn Strydom sachte.
»Ist ja merkwürdig, dachte ich bei mir. Hugo war eigentlich immer pünktlich – und sein Wagen stand in der Einfahrt. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe ein bisschen gegen die Tür gedrückt, und da ist sie aufgegangen.«
»Die Zeit, Reverend?«
»Ich muss gestehen, dass ich nicht auf die Uhr geschaut habe, aber es war nur etwa eine Minute vergangen. Ich rief nach ihm, bekam jedoch keine Antwort. Das Radio war an, ich konnte klassische Musik hören. Ich rief noch einmal, lauter. Klopfte erneut. Hugo war nämlich außerordentlich schwach auf den Ohren, Lieutenant.«
»Taub, meinen Sie?«
»Völlig, aber er trug sein Kreuz sehr beherzt. Es ist schon traurig, wenn man so geboren wird, aber wenn es einem in der Blüte der Jahre passiert, ist es etwas ganz Anderes – irgendwie viel schlimmer.«
»Ach ja?« Jetzt war Strydoms berufliches Interesse geweckt.
»Ich kann Ihnen nicht sagen, was für eine Erkrankung es war, Doktor, ich weiß nur von einer Infektion. Das da drüben ist sein Hörgerät. Komisch, das kaputt zu machen, nicht wahr, Lieutenant?«
»Ich habe schon Komischeres gesehen, Mann, aber deshalb hat er wahrscheinlich den Mörder nicht von hinten kommen hören. Ich werde es vermerken. Ja, so weit, so gut.«
Kramer kroch wie eine Krabbe auf die andere Seite der Leiche. Er deutete auf zwei seltsame viereckige hellere Flecken in dem geronnenen Blut.
»Doktor?«
»Die hatte ich noch gar nicht bemerkt, um ehrlich zu sein.«
»Eis«, sagte Pater Lawrence, »ich habe mich auch gewundert, aber sie waren noch nicht ganz getaut, als ich hier ankam.«
»Hm, Sie haben scharfe Augen, Reverend. Haben Sie sonst noch etwas entdeckt?«
»Nein, nichts, Lieutenant.«
»Und Sie sagen, er war vorher an diesem Abend in der Kirche?«
»Wir haben um 19.30 Uhr Messe und ab 20 Uhr Holy Hour. Er war die ganze Zeit da, auf seinem gewohnten Platz auf der Bank im Seitenschiff, hinter dem Beichtstuhl.«
»Was, bitte, ist eine Holy Hour?«
»In erster Linie eine Zeit der Meditation. Wir beten jeder für sich, aber in regelmäßigen Abständen gemeinsam. Zum Beispiel den Rosenkranz. Zu Anfang nehme ich allerdings meist die Beichte ab.«
»Kommen viele Leute zur Holy Hour?«
Pater Lawrence zögerte, darauf bedacht, keinen falschen Eindruck zu vermitteln.
»Genügend Gläubige, dass es sich lohnt.«
»Und das sind wie viele?«
»Außer denen, die zur Beichte kommen? Im Allgemeinen etwa ein Dutzend, würde ich sagen.«
»Ich frage nur aus Neugier«, sagte Kramer. »Was können Sie mir über Mr Swart erzählen? Wie lange ist er schon in dieser Gegend? Welche Pläne hatte er?«
»Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Lieutenant – Pläne?«
»Na ja, ein junger Mann kauft nicht grundlos ein Haus wie dieses, das meine ich damit.«
»Oh, natürlich! Hugo hat es nur gemietet; der Eigentümer wohnt gleich um die Ecke – Mr Potter, 9, Osier Way.«
»Ganz schön groß für eine Person.«
»Er wollte bald heiraten.«
»Tatsächlich? Kennen Sie die Frau?«
»Nein, sie ist Krankenschwester in Kapstadt. Ihre Ausbildung ist Ostern beendet, und dann wollten sie …«
»Ihr Name, Reverend? Jemand wird sie benachrichtigen müssen, wenn sie seine Verlobte ist.«
»Judith Jugg – mit zwei g. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Krankenhaus. Vielleicht in einem kirchlichen, denn sie ist ebenfalls kath – «
»Keine Sorge, das klären wir schon. Mr Swart hatte also vor zu heiraten und hat deshalb dieses Haus gemietet. Ein bisschen teuer, nicht wahr?«
»Soweit ich weiß, hat Hugo es preiswerter bekommen als viele andere Häuser hier. Zwischen Mr Potter und ihm bestand irgendeine Verbindung. Schade, ich weiß nicht mehr, welche.«
»Ich will Ihnen nur noch zwei Fragen stellen, dann können Sie gehen. Okay?«
Pater Lawrence nickte. Im Grunde war er ein alter Mann mit grauem Haar, und sein Gesicht war inzwischen vor Erschöpfung ebenfalls grau geworden. Wäre er Großvater gewesen, hätten seine Kinder längst darauf bestanden, ihn zu Bett zu geleiten.
»Erstens: Fällt Ihnen ein Grund ein, warum jemand Mr Swart das antun würde?«
»Absolut keiner. In der verhältnismäßig kurzen Zeit, die ich ihn gekannt habe, habe ich ihn als einen der besten Laienchristen schätzen gelernt, denen ich je begegnen durfte. Hugo war still und bescheiden, aber stets hilfsbereit. Außerdem war er mit einer besonderen Macht des Gebetes gesegnet. Unsere Holy Hours nahmen einen …«
Pater Lawrence konnte sich kaum noch aufrecht halten. Strydom ging zu seiner Tasche hinüber und wühlte nach einem Medikament für ihn. Kramer hatte das Gefühl, als hätte er diese Szene schon einmal erlebt. »Noch eine Frage, Reverend, das wärs dann«, sagte er. »Hat Mr Swart alkoholische Getränke zu sich genommen?«
»Das verstößt nicht gegen die Gesetze der Kirche, Lieutenant.« Pater Lawrence lächelte schwach. »Tatsächlich wünsche ich selbst mir in diesem Augenblick nichts sehnlicher als einen Brandy in warmer Milch.«
Dann wurde er wieder ernst und schüttelte den Kopf.
»Hugo hat nie einen Tropfen angerührt«, setzte er hinzu. »Nicht aus Prüderie, wissen Sie. Schließlich hat unser Herr auch Wein getrunken. Er hat nie einen Grund genannt, ich glaube, es entsprach einfach nicht seinem Charakter, sonst nichts. Wir haben das natürlich trotzdem an ihm bewundert.«
Kramer erhob sich zum Händeschütteln, und dann begleitete Strydom den Pfarrer auf die Straße hinaus. Bei seiner Rückkehr in die Küche sah er Kramer einen Finger in die orange Flüssigkeit tauchen, die über die Anrichte gespritzt war. »Wodka«, bemerkte Kramer, als er daran leckte.
»Dann wird die Sache noch komplizierter. Hat Swart den Drink für jemand anders gemixt – zum Beispiel für einen Besucher?«
»Und der Mörder hat ihn wegen der Flasche umgebracht – denn wenn nicht, wo ist sie hingeraten? Jedenfalls in keins der Regale.«
Strydom sah sich um und nickte. »Stimmt, dann – «
»Dann nichts«, lachte Kramer, zog das Gemüsefach auf und enthüllte das Geheimnis des Toten.
»Ich will Ihnen mal was über unseren Mr Swart hier erzählen, Doktor: Er hat, wie die meisten Katholiken, in einer anderen Kirche gebeichtet. Die Wette gilt.«
Strydom wollte nichts dagegensetzen, er hatte schon mehr als einmal gegen den Lieutenant verloren. »Es braucht eigentlich niemand davon zu erfahren«, bemerkte er stattdessen.
»Einverstanden. Machen wir beide sie alle, wenn wir bei Ihnen sind. Haben Sie reichlich Eis?«
»Beweismittel vernichten? Na, hören Sie mal, Lieutenant!«
»Alles für einen guten Zweck.«
Es kam selten vor, dass Kramer eine gesellige Ader zeigte. Strydom musterte ihn mit einem langen Blick, ehe er antwortete.
»Also einverstanden. Aber zuerst müssen wir an die Arbeit.«
»Wohl wahr, Doktor, ich habe mich noch gar nicht richtig umgesehen – irgendwo müssen ja die Spuren eines Einbruchs sein, was immer Van der Poel auch sagt.«
»Und ich muss meine Jungs mit der Fleischbahre rufen. Bei diesem Wetter ist Mr Swart längst fällig für sein Gefrierfach.«
Nach genauester Überprüfung aller Möglichkeiten, ins Haus zu gelangen, musste Kramer schließlich zugeben, dass Van der Poel recht haben könnte. Niemand hatte sich gewaltsam Einlass verschafft; entweder hatten sie eine Tür oder ein Fenster offen gefunden, oder sie waren im Besitz eines Schlüssels gewesen.
»Ich behaupte immer noch, dass es der Diener war – er hatte nämlich einen«, erklärte Van der Poel.
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, erwiderte Kramer und zuckte die Achseln. »Haben Ihre Leute ihn noch nicht gefunden?«
»Nein, aber das werden sie schon. Wir haben seine Freundin in der Garage – Ihr Boy spricht mit ihr.«
»Zondi? Dann geht alles klar.«
»Ich wollte Sie eigentlich bitten, Sir, ob ich – «
»Lassen Sie Kaffern Kaffernarbeit tun, Van der Poel. Wo sind Sie denn aufgewachsen?«
Van der Poel besaß überraschenderweise die Geistesgegenwart, das als Scherz aufzufassen, was es zur Hälfte auch war. Sie wanderten ziellos durch ein paar Zimmer und blieben schließlich wieder im Arbeitszimmer stehen.
»Eine Menge Bücher, Sir.«
»Vielleicht sind ein paar Pornos darunter.«
»Nie im Leben!«
Kramer hätte beinahe seine Wodkaentdeckung preisgegeben, sah dann jedoch keinen Anlass, mit noch jemandem zu teilen. Es amüsierte ihn, wie Van der Poel sich an die Regale beugte und den Kopf schräg neigte, um einen schlüpfrigen Titel zu finden. Wenn der Mann auch nur etwas Verstand hatte, würde er hinter der dicken Bibel nachschauen.
»Du meine Güte, dieser Typ muss Professor gewesen sein«, rief Van der Poel am Ende einer unverständlichen Buchreihe aus. »Sonntags eine Stunde reicht mir – und das beileibe nicht jeden Sonntag. Ich mache immer Sonntagsdienst, wenn ich die Gelegenheit bekomme.«
»Hm? Wie das?«
Kramer hörte nicht zu. Er sah sich den Schreibtisch an und fand das ungefähr so spannend wie die Durchsuchung einer Schaufensterpuppe. Es gab alles in allem sechs Schubladen, fünf mehr, als andere Leute für den dürftigen Inhalt gebraucht hätten. Rechnungen oben links, Quittungen oben rechts; Wagenpapiere Mitte links; Briefpapier unten rechts – und nicht das kleinste Stäubchen, nicht eine einzige herumliegende Reißzwecke störten diese peinliche Ordnung. Er lag also falsch mit den Büchern – der Tote hatte nicht einmal genug Leidenschaft besessen, um Kauspuren an einem verfluchten Bleistift zurückzulassen.
»Sie hatten unrecht mit den Büchern, Sir.«
»Aha.«
»Haben Sie etwas gefunden?«
»Wie mans nimmt. Swart lebte seinen Verhältnissen entsprechend, hatte sein Geld vor allem auf der Bank und stellte nur kleine Schecks aus für seine jeweiligen Bedürfnisse – mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass hier eine Kasse mit Bargeld fehlt. Und glaube auch nicht, dass er genug hatte, um irgendetwas zu kaufen, was sich zu stehlen gelohnt hätte, den Gedanken an einen Diebstahl können wir also fallen lassen.«
»Es ist aber eine ziemlich feine Gegend hier, Sir – ein Einbrecher hätte nicht vorher wissen können, dass nicht viel zu holen war.«
»Haben Sie nicht gesagt, es sei der Diener gewesen?«
»Habe ich – ich meine …«
»Ihre Fäden verheddern sich, Van der Poel, stimmts? Gehen Sie nur immer einem Gedanken nach. Einbruch: Dieses Haus kommt aufgrund seiner Lage und da es abends leer stand, weil Swart in der Kirche war und der Diener freihatte, durchaus als Objekt infrage. Sagen wir, ein Schurke wäre irgendwie hereingekommen und hätte sich bei Swarts Heimkehr gerade umgeschaut. Wenn Swart ihm den Weg abgeschnitten und dabei die Stiche abbekommen hätte, könnte ich das verstehen. Aber Swart war dabei, sich in der Küche einen Drink zu mixen – der Einbrecher konnte also seelenruhig zur Eingangstür hinausspazieren. Sie werden mir nicht erzählen wollen, Swart wäre ermordet worden, damit der Schurke das Haus fertig inspizieren konnte. Jeder verfluchte Dummkopf konnte doch sofort sehen, dass es hier nichts gibt, was dieser Mühe wert gewesen wäre.«
Ein weißer Polizist klopfte an die Tür und trat ein.
»Entschuldigen Sie, Lieutenant, aber der Sergeant wird am Telefon verlangt.«
»Nur zu, Kumpel«, sagte Kramer und entließ sie beide. Dann setzte er sich an den Schreibtisch, fand auf der Schreibtischauflage einen guten Platz für seine Füße und machte sich daran, seine eigenen Fäden zu entwirren.
Am Ende blieb als einzig mögliches Motiv für Mord etwas Persönliches zwischen Swart und seinem Mörder. Etwas Persönliches, das wars, eine Beziehung, die eine tödliche Wende genommen hatte. Damit war es einwandfrei Mord und kein Totschlag – eine nützliche Unterscheidung, die Kramer nach Möglichkeit immer sofort traf. Denn Mord hatte ein bestimmtes Muster, und das war immerhin ein Anfang, wenn einem bei einem Fall nichts Anderes ins Auge sprang. Dieses Muster zeigte sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen und war statistisch belegt. Die genauen Zahlen waren unwichtig, wenn man einmal das Grundmuster erkannt hatte: Es bestand eine geringe Chance, von einem Arbeitskollegen, eine größere Chance, von einem Freund oder näheren Bekannten, und die größte Chance überhaupt, von einem Mitglied des eigenen Haushalts ermordet zu werden.
Pater Lawrence hatte klar ausgesagt, dass Swart in der Kirche bewundert worden und beliebt gewesen war, und es bestand Grund zu der Annahme, dass er auch in seinem Zeichenbüro nicht unangenehm aufgefallen war. Allerdings war die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass er auch außerhalb dieser Kreise Freunde und Bekannte gehabt hatte, aber bisher sprach alles dafür, dass er kein Doppelleben geführt hatte. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, dass Swart, weil er sich in seiner Vergangenheit einmal eines schweren Vergehens schuldig gemacht hatte, zum reuigen Sünder geworden war, um dann doch noch den Preis für dieses Unrecht zu zahlen, als es schließlich heimlich geahndet wurde. Auf ihre Art eine ganz ansprechende kleine Theorie, aber von der Sorte, die einen bei den Ermittlungen leicht in die Irre führte. Zuerst musste man bei den Nachforschungen naheliegenderen Dingen nachgehen.
Zum Beispiel der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass die Lösung in der häuslichen Situation zu suchen war. Der Pfarrer hatte vermutlich die Wahrheit gesagt, aber in der Geschichte gab es in Hülle und Fülle Beispiele von großen und kleinen Heiligen, die in ihren eigenen vier Wänden wahre Teufel gewesen waren. Alles schön und gut – nur, dass die Freundin tausend Meilen weit weg war, sodass als Einziges die Beziehung zum Diener blieb.