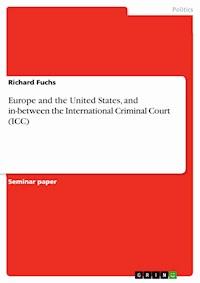Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Richard Fuchs, Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher, enthüllt in seiner Autobiografie Erziehungsmethoden einer strenggläubigen Familie und gewährt damit Einblicke in eine Welt, die der Öffentlichkeit allgemein verborgen bleibt. Als Sohn eines Predigers der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden beschreibt er einerseits die ethisch-moralischen Werte, die dort vermittelt wurden, andererseits auch die Schattenseiten des Dogmas, das da heißt: »Man muss die Bibel wörtlich nehmen.« Zum Beispiel: Züchtigung mit der Rute - Prügelstrafe - in Deutschland per Gesetz verboten; »seid untertan der Obrigkeit« - unter Umständen ein Freibrief für Kriegsverbrecher; Redeverbot für die Frau im Gottesdienst und Unterordnung unter dem Mann; nein zur Gleichstellung und Emanzipation. Obwohl nicht nur in evangelikalen Kreisen Sex als Synonym für Sünde gilt, hat gerade die Bibel in Sachen »Sex and Crime« dennoch viel zu bieten. Das Buch »Gott hat viele Fahrräder« - ein ambivalentes Originalzitat seines Vaters - bietet aber nicht nur einen Aspekt spezieller Religionsgeschichte, sondern auch ein breites Spektrum an Kindheitsgeschichten, Regionalgeschichte, Zeitgeschichte und Kulturgeschichte. Schließlich beschreibt das Buch den langen, aber gelungenen Weg einer Emanzipation zu einem selbstbestimmten, glücklichen und erfolgreichen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Fuchs
„Gott hat viele Fahrräder“
Kindheit in einer evangelikalen Familie im Dritten Reich und danach
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Titelseite, Foto der Familie Fuchs (1942) privat: oben unter den Eltern, v. l. n. r: Gustel, Gretel, Magdalene, unten, v. l. n. r: Richard, Mathilde, Gerda.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Fotos und Illustrationen © Richard Fuchs
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
In Liebe gewidmet meinen Eltern,
Gretchen Fuchs, geborene Schwarz, und Friedrich Ferdinand Fuchs,
meiner Frau Ursel Fuchs, geborene Mehmel,
mit besonderem Dank als Erstleserin,
unseren Kindern Kai Malte und Melanie Caroline,
den Enkelkindern Laura Swea, Tim und Tom,
Lars Benedikt und Anna Lisa,
besonders meiner Tante Lina Saßmannshausen, geborene Schwarz,
und nicht zuletzt meinen Geschwistern,
Magdalene, Gustel, Ferdinand, Gretel, Mathilde und Gerda,
denen ich für viele wertvolle Informationen zu Dank verpflichtet bin.
Mein Dank gilt außerdem meinem Vetter Walter Schwarz,
dem unermüdlichen Chronisten der Familie Schwarz,
für Informationen und einen Beitrag über die Sonntagsschule in Weidenau.
Dankend erwähnen möchte ich auch die gute Zusammenarbeit mit der
Lektorin Daniela Lorenz und dem Verleger Tino Hemmann
vom Engelsdorfer Verlag.
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Prolog
Gott hat viele Fahrräder
Eine Geburt unter Gottes Beistand
Mir waren die Hände gebunden
Homöopathie – wer heilt, hat recht
Der genormte Mensch
Nürnberger Gesetze
Antisemitismus im protestantischen Siegerland
Bis 1933 – 200 Juden im Siegerland
Brüderund das schwierige Verhältnis zu Juden
Rassenhygiene und Priester-Gen
Biblisch begründete Erklärungsversuche
Hierarchisches Gefälle – gefällige Bibelexegese
Vielfalt statt Einfalt
Wir und die anderen
Die unsichtbare Wand
Ein Zoo ohne Trennwand
Pietisten und Brüdergemeinden
Brüder im Herrn
Zwischen Thron und Altar
Du sollst nicht töten!
Ururgroßvater – der Kriegsdienstverweigerer
Brautschau in der Christlichen Versammlung
Tumulte und Razzien auf den Straßen
NSDAP: auf der Grundlage des Christentums
Siegen, An der Alche 21
Untergang mit Pauken und Trompeten
Krieg und Frieden
Wir haben einen Führer und keiner ist ihm gleich
Strafe wegen Verweigerung der NS-Frauenschaft-Mitgliedschaft
Bevölkerungszuwachs – Kindersegen für den Staat
Im Jungvolk wider Willen
Schulstart mit Hindernissen
Wie sollen wir den Nachbarn grüßen?
Beten im Luftschutzkeller
Permanente Angst
Vorletzte Etappe: Omas Häuschen durchgeblasen
Letzte Etappe: Der Tannenwald in Buchen
Der Körper vergisst nicht
Rute und Strafe gibt Weisheit
Muss man die Bibel wörtlich nehmen?
Mutterliebe – Mutterhiebe
Praxistest einer guten Erziehung
NS-Standardwerk der Kindererziehung
Ungewöhnliche Erziehungsmethoden
Wie die Alten so die Jungen
Eitelkeit ist Sünde
Die Sonntagsschule am Hermelsbacher Weg
Evangelisch-freikirchlich im Dritten Reich
Brüder unter dem Hakenkreuz
Verbotene Sekten
Schwarzer Sonntag
8. Mai 1945, der Krieg ist aus
Eine traurige Bilanz
Siegen zu 82 Prozent zerstört
Abenteuerspielplatz Trümmergrundstücke
Vaters Geschäft in Schutt und Asche
Existenzvernichtung und Nachkriegskarriere
Berufung zum Reisebruder
Arbeiten für einen Gotteslohn
Letzte Erinnerungen an Siegen
„Breitscheider Kreuz“
Der Mann – das Haupt der Familie
Ein Geheimdokument lüftet Geheimnisse
Glockenklang zum Gruß der Spätheimkehrer
Langzeitgedächtnis der Westerwälder
Pflichtfach Kartoffelkäfersammeln
Ackerbau und Viehzucht
Entscheidend ist, was hinten rauskommt
Geistig wie leiblich ernährt
Beten für Vater in der Ferne
Ecclesiogene Erkrankungen
Gott sieht alles
Psychosomatische Erkrankungen
Billy Graham: Erweckungsimport made in USA
Beten im Oval Office
Aus kleinen Verhältnissen
16 Quadratmeter für neun Personen
Die Kirche im Dorf
Alleinstellungsanspruch der bibeltreuen Christen
Der Tisch des Herrn
Vor Gott und dem Gesetz sind alle gleich, in Christlichen Versammlungen nicht
Glaubensgewissheit, Unbeirrbarkeit, Linientreue
Die Lehre der Väter
Anders als bei Schmetterlingen
Hände aus den Hosentaschen!
Onan, Namensgeber der Onanie
Die Vorhaut: Quelle ernsthaften Unheils
Biblischer Sexualunterricht
Sex – Synonym für Sünde
Da hat der Teufel sein Zelt aufgeschlagen
Kleine Fluchten
Wer wird Millionär?
Lichte Momente
Sie haben Ihr Ziel erreicht
Ist der Lehrherr ein gläubiger Christ?
Die Falle: Ausbeutung pur
Das Ende einer wunderbaren Freundschaft
Bier in den Genen
Letzter Rat eines Bruders im Herrn
Du hast keine Chance, nutze sie!
Mein Vater, der Reisebruder
1949: Ich bin dann mal weg
Der lange Arm der Erziehung
Brüderauf Reisen
Die Letzten werden die Letzten sein
Kapitaleinsatz des Freiberuflers: Die Bibel
Der innere und äußere Fahrplan
Brüderauf Akquisitionsreisen
Rekrutierung hauptberuflicher Boten und Lehrbrüder
Aus Glauben leben
Für den Führer beten
Düsseldorf, die große weite Welt am Rhein
Gastfreundschaft in Christlichen Versammlungen
Vaters mahnende Worte an den Sohn
Mutters wärmende Worte an den Sohn
Wenn das der Vater wüsste
Kann denn Liebe Sünde sein?
Kröten-Test in der Flamingo-Apotheke
Happy End
Träume können wahr werden
Mein lieber Mann – von Ursel Fuchs
Annäherungsversuche an die Christliche Versammlung – Erinnerungen von Ursel Fuchs
Epilog
Selbstbestimmt und fern der Heimat
Ein Blick hinter die Kulissen
Buchveröffentlichungen
Vorwort
Warum schon wieder eine Biografie, könnte mancher fragen, und dann auch noch von einer Person, die man weder aus Politik, Kultur oder Showbusiness kennt, allenfalls als Autor völlig anderer Bücher als dieses? Waren Biografien früher Menschen vorbehalten, die bekannt und/oder berühmt waren, wagen sich heute dennoch immer mehr unbeschriebene Frauen und Männer an eine zumeist authentische Betrachtung ihres Lebens, prägende Kindheitserlebnisse inklusive. Nachdem ich diverse Sachbücher zu den Themen Ernährung, Medizin, Gentechnik und Eugenik geschrieben habe, entstand auch mein Interesse an autobiografischem Schreiben, allerdings aus einer ganz bestimmten Perspektive. Der erste Impuls dazu entstand in Wirklichkeit viel früher, bereits 1987. Ich war fünfzig Jahre alt geworden, hatte einige Jahre einen Verlag betrieben und dann ertragreich verkauft. Damit beendete ich im zarten Alter von fünfzig Jahren meine Berufstätigkeit und genoss den Luxus, nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit zu haben.
Zu meinem Geburtstag bat ich meine sechs Geschwister, Geschichten aus unserer gemeinsamen Kindheit aufzuschreiben, sie mir zu schenken und uns allen bei Kaffee und Kuchen vorzulesen. Sie taten es zu meiner Freude ausgiebig. Danke nochmals allen! Es war ein wunderbares Erlebnis, welches meine Frau Uschi allerdings veranlasste, erstaunt zu fragen: „Seid ihr wirklich alle in derselben Familie aufgewachsen?“ So unterschiedlich waren die Wahrnehmungen der einzelnen Geschwister. Damit hatte ich einen beachtlichen Fundus an, bis dahin zum Teil auch unbekannten, Informationen aus meiner frühesten Kindheit, speziell von meinen älteren Geschwistern. In einer kleinen Auflage entstand so ein illustriertes Familienbuch für meine Geschwister, unsere beiden Kinder, vorauseilend auch für die zukünftigen inzwischen fünf Enkelkinder.
Nun frage ich mich nach nunmehr 27 Jahren immer noch: Warum kann es sinnvoll sein, ein paar Zeilen über mein Leben zu schreiben, das über die eigene Familie hinaus vielleicht sogar auch eine breitere Öffentlichkeit interessieren könnte? Wer je den preisgekrönten Film Das weiße Band von Michael Hanecke gesehen hat, wird ahnen, dass ein Leben nicht nur in einem evangelischen Pfarrhaus, sondern erst recht in einer evangelikalen Familie anders sein kann als in einer weltoffenen liberalen Familie. In einer solchen Familie mit strengen Regeln, Mutterliebe und Mutterhieben wuchs ich auf. Mein Vater, ein Prediger, zählte wie auch andere Geistliche zum Bodenpersonal Gottes und glaubte, dessen Weisungen für viele Lebensbereiche zu kennen. Die wurden uns verzehrfertig, mehr oder weniger gut verdaulich serviert. Vater hatte biblisch begründet eindeutige Erziehungs- und Lebenskonzepte und war damit unser Maßstab – unhinterfragt und unwidersprochen. Informationen zu dem, was wir durften oder unterließen, speisten sich fortan aus der von Gott inspirierten Normenquelle der Bibel. Zweifel an Vaters Deutungs- und Meinungshoheit hatten wir nicht. Wer sollte schon dem Wort Gottes und dem seines Interpreten widersprechen?
Unsere Eltern Gretchen Fuchs, geb. Schwarz, und Friedrich Ferdinand Fuchs, 1928
Wenn ich es heute als Erwachsener dennoch wage, kritisch, wahrheitsgetreu, aber subjektiv meine Erlebnisse aus der Sicht des Kindes zu thematisieren, ist es unumgänglich, auch ein Stück der Geschichte meiner Eltern und deren Erziehungsmethoden zu beschreiben und, wie sie selbst erzogen wurden. Bei der Retrospektive geht es mir weder um eine Anklage gegenüber meinen Eltern noch um eine Verherrlichung, sondern um Erinnerung an meine Gefühle von damals und um meine heutige Sicht der Vergangenheit.
Das Buch soll aber mehr sein als ein Stück Religionsgeschichte, sondern auch Kultur-, Regional- und Zeitgeschichte. Deshalb ist ein Blick auf die Erlebnisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre meiner Kindheit ebenso von Bedeutung. Abgesehen von den selbst erlebten und erlittenen Kriegsereignissen, interessiert mich heute ein spezielles Thema jener Zeit: Eugenik und Rassenhygiene wie auch deren Entstehungsgeschichte. Ich schrieb ein Buch darüber1 und stellte fest, dass jede Art von Ethnozentrismus, Lebenswert/-unwert-Kriterium und Diskussion, aber auch ein Alleinstellungsanspruch der großen monotheistischen Religionen, Konfessionen wie auch deren Untergruppierungen zu Ausgrenzung anderer führen können, wenn nicht sogar zu unausgesprochener oder offener Feindschaft. Ab- und Ausgrenzungen waren auch meinen evangelikalen Herkunftsgemeinden und meiner Familie nicht fremd. Wir waren anders als die meisten und pflegten unsere Exklusivität.
Bei allen, zum Teil auch den Zeitumständen geschuldeten, Belastungen und einer strengen Erziehung habe ich andererseits meinen Eltern wie auch meinen Geschwistern zu danken – im Übrigen auch den vielen Tanten und Onkeln des großen Clans der Familie Schwarz im Siegerland – für ihre Fürsorge, ihre Verlässlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ohne diese Erziehung wäre ich vielleicht nicht das geworden, was ich trotz ungünstiger Startbedingungen zu meinem eigenen Erstaunen doch noch geworden bin. Das mag dem Umstand zuzuschreiben sein, dass es sinnvoll ist, mit zunächst strengen Regeln aufzuwachsen, um sich dann teilweise davon zu verabschieden – ohne jedoch das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mangels Doppelblindversuch bleibt das allerdings nur graue Theorie, denn eine tolerante Erziehung, die Fehler verzeiht, habe ich nicht genießen können.
Die eigene Erziehung kann nicht losgelöst von dem beschrieben werden, was unsere Eltern erlebt haben, in welchem Zeitgeist sie selbst erzogen worden sind und was sie an uns weitergegeben haben. Während wir Kinder nur einen Weltkrieg und eine Nachkriegszeit ertragen mussten, erlebten und erlitten unsere Eltern den Ersten Weltkrieg, die Turbulenzen der Zeit zwischen den beiden Kriegen, Inflation, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Randale und Straßenkämpfe zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, das Dritte Reich, den Krieg und die Bombenangriffe, Existenzvernichtung und schließlich die karge Nachkriegszeit. Sie mussten ihre Existenz, ihren Alltag bewältigen und sieben Kinder großziehen in Zeiten und unter Bedingungen, von denen sich Nachgeborene keine Vorstellung mehr machen können: enge Wohnungen, keine Zentral-, nur Ofenheizung, kein Bad, WC im Treppenhaus oder später im Dorf sogar auf dem Hof, bei Eiseskälte, keine Waschmaschine, geschweige denn Spül- oder Küchenmaschinen, kein fließend heißes Wasser, keine Krankenkasse und auch sonst knappe Kasse. Luxusgüter wie Radio, TV oder Telefon, Handy, Computer, bequeme Sessel oder Sofas gab es ohnehin nicht. Doch – in den fünfziger Jahren hatten wir ein Radio, das aber nur auf Kurzwelle zu bestimmten Zeiten eingeschaltet wurde, um auf den Sendern Monte Carlo oder Luxemburg Evangeliums-Rundfunk zu hören. Was auf anderen Sendern zu hören gewesen wäre, weltliche Nachrichten oder gar Musik, war tabu.
Das vorliegende Buch, „Gott hat viele Fahrräder“ – ein Originalzitat meines Vaters –, bietet ein breites Spektrum an Kindheitsgeschichten, spezieller Religionsgeschichte, Regionalgeschichte, Zeitgeschichte plus Randbemerkungen und Kulturgeschichte, ungewohnte Einblicke in eine Welt, die den meisten Menschen verborgen ist. Schließlich beschreibt das Buch den langen, aber gelungenen Weg einer Emanzipation zu einem selbstbestimmten, glücklichen und auch erfolgreichen Leben, der anderen Mut machen könnte, erste Schritte zur Individuation zu unternehmen.
Die älteste Schwester Magdalene, die fleißigste Chronistin
Auch alle meine Geschwister sind erfolgreich durchs Leben gegangen – keine Selbstverständlichkeit nach dem schwierigen Start. Das wohltuende Zusammengehörigkeitsgefühl unter uns Geschwistern und der Austausch über die gemeinsame Vergangenheit sind bis heute geblieben. Dafür bin ich dankbar.
Wenn ich heute, mehr als sechzig Jahre später, aus der winterlichen Kälte in unsere rundherum zentralbeheizte Wohnung mit alten, dicken Mauern trete, tun und lassen kann, was ich will, überkommt mich auch dafür immer noch ein dankbar wohliges Gefühl. Das ist der Vorteil einer kargen Kindheit, dass ich heute alles, was mir geschenkt wurde und wir erarbeitet haben, dauerhaft, täglich und sehr bewusst genieße.
Richard Fuchs, Düsseldorf 2014
Familie Fuchs 1938, die Jüngste fehlt noch. Mutter mit kleinem Richard auf dem Arm. Kinder v. l. n. r.: Ferdinand, Magdalene, Mathilde, Gustel, Gretel.
Prolog
Am Sonntag um 10:15 Uhr am 18. April 1937
erblickte unser kleiner Richard
unter Gottes Beistand das Licht der Welt.
Mutter und Kind geht es gut.
Gretchen Fuchs (geb. Schwarz), Friedrich Ferdinand Fuchs.
Vaters handgeschriebene Geburtsanzeige, Siegen, An der Alche 21
1937, als ich in Siegen/Westfalen geboren wurde, war die Welt nicht in Ordnung, sondern bestimmt von Ausgrenzungen, sei es religiöser, ideologischer oder politischer Art, durch Bewertung von Menschen nach Wert und Unwert, nach Rasse, körperlicher Disposition und gesellschaftlicher Herkunft. 1934 – also drei Jahre vor meiner Geburt – begann man bereits mit Zwangssterilisation von Erbkranken im Stadtkrankenhaus Siegen. 1935 kam es gegen vierzehn Zeugen Jehovas vor dem Sondergericht Dortmund in Siegen zu einem Prozess. Jüdische Händler wurden vom Krombacher Viehmarkt ausgeschlossen. Eine Wanderausstellung in Berleburg und Laasphe zu Rassenbiologie und Erbhygiene stellte 1936 jüdische und zigeunerische Familien erbarmungslos bloß. Wittgensteiner Zigeuner und Zigeunermischlinge wurden 1937 durch eine Arbeitsgruppe der Rassenhygienischen und Bevölkerungspolitischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt rassenbiologisch erfasst.
1937 beschloss man die illegale Sterilisation aller farbigen deutschen Kinder, der sogenannten Rheinlandbastarde, und setzte sie in einer Nacht- und Nebelaktion um, obwohl diese Kinder laut Erbgesundheitsgesetz nicht hätten sterilisiert werden dürfen. Nach einem Besuch in Deutschland sagte der schwedische Pfarrer M. Liljeblad bereits 1919: „Diese Bastarde werden in Zukunft ein Fluch für ganz Europa sein.“2 In Mainz habe er ein solches Kind gesehen, mit schwarzen und weißen Streifen auf dem Rücken. Bei den farbigen Kindern handelte es sich um Nachkommen aus der Verbindung von deutschen Frauen und farbigen Besatzern der französischen Armee nach dem Ersten Weltkrieg.
Am 28. April 1937 überraschte ein Zeitungsartikel die Christen meiner Herkunftsgemeinde unter der Überschrift Verbotene Sekten mit der Mitteilung, dass durch Anordnung des Reichsführers SS und Chefs der Polizei die Gemeinden mit sofortiger Wirkung im gesamten Reichsgebiet aufgelöst und verboten seien. 1938 kam es zu Verhaftungen und KZ-Einweisungen einer nicht genannten Zahl von Siegerländern und Wittgensteinern im Zuge der Aktion gegen Volksschädlinge und Arbeitsscheue in Buchenwald und Dachau. Im selben Jahr brannte die Siegener Synagoge – vor den Augen aller. Männliche Mitglieder der regionalen jüdischen Gemeinde im Alter von vierzehn bis siebzig wurden in das KZ Sachsenhausen deportiert.3 1938 standen die Zeichen bereits auf Krieg. Im selben Jahr rückte unser Vater zu einer ersten Wehrübung aus, der mit Kriegsbeginn 1939 eine weitere folgte. Nun war er einfacher Soldat, was ihn schon im Ersten Weltkrieg nicht begeistert hatte.
Rassenhygiene und Ahnenforschung hatten im Dritten Reich Hochkonjunktur. Jeder deutsche Staatsbürger verpflichtete sich, einen Arier-Nachweis zu führen. Arier, eine nicht einfach zu identifizierende Rasse, sollten erhalten bleiben und vermehrt werden; Arier waren privilegiert, andere nicht. Die Ironie der Geschichte: Speziell die Führungselite des Dritten Reiches, Hitler, Goebbels und Göring etc., entsprach nicht prototypisch dem Bild des reinrassigen Ariers. Der Rassenhygieniker/Eugeniker Prof. Dr. Max von Gruber (1853–1927) urteilte 1923 in einem Gutachten über Adolf Hitler: „Gesicht und Kopf schlechte Rasse.“ Dennoch verfügte Hitler: Juden oder Zigeuner und auch Rassenmischungen mit Juden seien nicht nur unerwünscht, sondern sollten verfolgt werden. Juden liefen – wie die furchtbare Geschichte des Dritten Reiches zeigt – Gefahr, ermordet zu werden. Die Pseudowissenschaft Eugenik/Rassenhygiene – lange vor 1933 von der akademischen Elite im angelsächsischen Raum vorgedacht, in den USA, Europa, auch in Deutschland verbreitet – ging von der längst widerlegten These aus, der Mensch sei mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten im Wesentlichen das Produkt seiner ererbten Gene.
Anders als damals besteht mein heutiges Interesse an der in Verruf geratenen Ahnenforschung lediglich darin, zu wissen, was unsere Vorfahren den nachfolgenden Generationen weltanschaulich und religiös an Erziehungsmodellen vermittelt haben. In diesem Zusammenhang kann autobiografisches Schreiben Fragen beantworten wie: Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Was habe ich von meinen Eltern gelernt, was von einer strengen christlichen Erziehung übernommen, was kritisch hinterfragt und korrigiert, zum Beispiel im Verhalten den eigenen Kindern gegenüber? In welchen Zeiten und mit welchem Zeitgeist bin ich erzogen worden, in welcher Gesellschaft und mit welcher religiösen (früh-)kindlichen Indoktrination?
Kinder hatten damals bedingungslos zu gehorchen und wurden mit dem Ziel erzogen, schließlich so zu werden wie die Eltern – eine Art Selbstverdoppelung. Das setzt zunächst ein ungetrübtes Selbstbewusstsein der Erwachsenen voraus, überspitzt gesagt: Hybris. Denn woher sollen Eltern wissen, welche Persönlichkeit in ihrem Kind schlummert, die geweckt werden könnte oder aber durch falsche Erziehung unterdrückt wird? Warum gibt es nicht eine Alternative zu dem Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter, in der es heißen könnte: Ehret die Kinder! Jesus, unser Vorbild, zum Beispiel wurde von seinen Eltern sehr geehrt und geachtet.
Abgesehen von biblisch empfohlenen Erziehungsanweisungen unterschied sich christliche Erziehung wenig von der gesellschaftlich allgemein verbreiten Erziehung des 19. und 20. Jahrhunderts. Erziehungsbücher, wie die des deutschen Arztes Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808–1861), leisteten in Sachen Schwarzer Pädagogik ganze Arbeit. Seine Bücher mit den grausamen Erziehungsvorschlägen erreichten mit über vierzig Auflagen eine große Verbreitung. Die zum Erreichen des Gehorsams empfohlenen Schläge, wie sie auch die Bibel empfiehlt, konditionierten die Kinder so nachhaltig, dass sie im Erwachsenenalter dieselbe Art der Erziehung an ihren Nachwuchs weitergaben. Bis schließlich Generationen später die so dressierten Kinder als Erwachsene zu willigen Helfern Hitlers wurden. Obwohl Jean-Jacques Rousseau schon vor 300 Jahren mit seinem Erziehungsratgeber Emile das Kind als eigenes Wesen entdeckte, hatte sich diese Erkenntnis noch nicht in allen Gesellschaftsschichten herumgesprochen. Rousseau selbst wurde allerdings seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Er setzte seine eigenen fünf Kinder mit dem Argument im Findelhaus aus, sie würden sonst seine Karriere belasten.
Meine Familie und auch deren Vorfahren gehörten zu einer exklusiven christlichen Glaubensrichtung, die heute unter dem Namen Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde firmiert, früher auch unter Brüderbewegung (Elberfelder Brüder), Darbysten oder Christliche Versammlung, einer Bewegung, die im 19. Jahrhundert in England unter dem Reformer John Nelson Darby (1800–1882) seinen Ausgang nahm. Darby war Aristokrat, Jurist und vormals Priester der anglikanischen Kirche, bevor er dem Pomp der Hochkirche abschwor, sich dem vertieften Bibelstudium widmete und schließlich der geistige Führer und Kopf der Brüderbewegung wurde. Anfangs und im kleinen Kreis traf man sich privat, doch mit zunehmender Mitgliederzahl entstanden Versammlungsräume, oftmals in Hinterhöfen. Im Dritten Reich waren die Gemeinden vorübergehend verboten und ihre Vermögen beschlagnahmt, weil sie mangels straffer Organisation nicht dem Führerprinzip entsprachen und nur schlecht zu kontrollieren waren. In einer Verordnung des Reichsführers der SS hieß es, die Darbysten seien im gesamten Reichsgebiet aufgelöst und verboten, da sie jegliche positive Einstellung zu Volk und Staat verneinten. Als die christlichen Gemeinden unter bestimmten Bedingungen im Bund freikirchlicher Christen (BfC) wieder zugelassen wurden, erklärte ein Teil der Mitglieder sich mit den von oben verordneten Bedingungen nicht einverstanden. Sie sonderten sich ab, gingen in den Untergrund und riskierten sogar Gefängnisstrafen, wenn sie sich trotzdem „unter dem Wort Gottes“ versammelten. 1941/42 kam es zu einem Zusammenschluss zwischen dem BfC und den Baptisten unter der Bezeichnung Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.
Der Schock des überraschenden Verbots 1937 hielt die christlichen Brüder allerdings nicht davon ab, in aller Naivität für den „Führer, den wir ja alle so lieben“4, zu beten. Dass für den Führer und seine willigen Helfer gebetet wurde, war nicht außergewöhnlich, denn das forderte sogar die Bibel und die musste man in diesen Kreisen wörtlich nehmen. Sie mahnt, für alle zu beten, „die in Hoheit sind“5. Peinlich war nur, dass damals für einen Kriegsverbrecher gebetet wurde, wie später auch in den USA unter anderem für George W. Bush. Wer aber ein offizielles Schuldbekenntnis der Brüder nach 1945 – wie etwa das der evangelischen Kirche – erwartet hatte, sah sich getäuscht. Kein NSDAP-Mitglied wurde später von den Gemeinden ausgeschlossen.6
Kennzeichnend für diese Art der evangelikalen Theologie und Frömmigkeit sind die Zugangsrituale, wie Wiedergeburt durch Bekehrung, persönliche Glaubenserfahrung, Suche nach Heils- und Glaubensgewissheit und schließlich die Erwachsenentaufe. Wer wie ich in einer Familie mit strengem Verhaltenskodex, täglichen Gebeten und Bibellesungen aufgewachsen ist und einer Erwartungshaltung von Seiten der Eltern, sich bereits im Kindesalter zu bekehren, weiß nicht unbedingt, was das bedeutet. Um sicherzugehen, habe ich mich als Kind gleich zweimal bekehrt und wurde von meinem Vater als Halbwüchsiger in einer Badewanne getauft – nicht etwa mit ein paar Spritzern auf den Kopf, wie es bei Babys am kirchlichen Taufbecken geschieht, sondern mit Haut und Haaren ganz unter Wasser, wie es die Bibel lehrt. Die Taufe, in biblischen Zeiten von Johannes dem Täufer am Jordan eingeführt, war ein Novum. Johannes wies damit einen neuen Weg, sich von Sünden reinzuwaschen. Als Jesus von Johannes getauft wurde, hatte er ein ekstatisches Erlebnis. Es wird allerdings nirgends berichtet, dass Jesus selbst von dem magischen Ritus Gebrauch machte, indem er jemanden taufte, obwohl sich der See Genezareth als Arbeitsstätte dazu angeboten hätte. Überliefert ist jedoch, dass Jesus in seiner Abschiedsrede, bevor er emporgehoben in einer Wolke den Blicken seiner Anhänger entschwand, versprach: „Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden“7, was zu Pfingsten dann auch geschah.
Eine mir eng vertraute Person bekannte im hohen Alter, sie habe sich im Alter von neun Jahren zwar bekehrt, aber erst als Siebzehnjährige Heilsgewissheit erlangt. Das erklärt, wie schwierig es für Kinder ist, sich für die Nachfolge Jesu – wie es heißt – zu entscheiden. Eine Bekehrung beziehungsweise Umkehr setzt ja zunächst die Erkenntnis voraus, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte. Warum sollte ich sonst umkehren und einen neuen Weg einschlagen? Da Kinder unschuldig geboren werden, ein Kind also im Bewusstsein lebt, es sei eigentlich in Ordnung, muss das Bedürfnis, sich bekehren zu sollen, einen anderen Weg einzuschlagen, durch Erwachsene zunächst künstlich geweckt werden. Man möge mir den folgenden banalen Vergleich verzeihen: Ich war Jahrzehnte in der Werbung tätig. Da gab es Produkte und Dienstleistungen, für die ein Bedarf erst künstlich geweckt werden musste, und zwar durch einen hohen Aufwand an Werbung, damit die Konsumenten von dem Angebot Gebrauch machten. Auf die christlichen Zugangsrituale übertragen, bedeutet das, Kindern muss zunächst ein Schuldbewusstsein implantiert/suggeriert werden, damit die Bereitschaft entsteht, sich zu bekehren.
Ich fragte mich später: Bedeutet Bekehrung, die Ethik, die Jesus lehrte, zu verinnerlichen und danach zu leben, damit eine bessere Welt entsteht, oder im Erwachsenenalter seinem Vorbild folgend zunächst Vater und Mutter zu verlassen, den Tischlerberuf im väterlichen Betrieb an den Nagel zu hängen, Jünger zu animieren, es ihm gleichzutun, um dann bedürfnislos, von Almosen lebend, predigend auf Wanderschaft zu gehen? Die Geschichte, in der die Jünger ihr gewohntes Leben, wie etwa die familiären Verpflichtungen, fristlos und gänzlich aufgaben, um Jesus zu folgen, spiegelt einerseits die Labilität des Charakters solcher Schüler wider, andererseits die Sogwirkung, die von dem charismatischen Lehrer ausging.
Einer, der es Jesus gleichtun wollte – allerdings unter Verzicht einer Schar von Jüngern, aber mit Unterstützung seiner familiären Fan-Gemeinde – war mein Vater, nachdem 1945 seine Existenz als Inhaber eines Schreibwarengeschäfts in Siegen durch Bomben vernichtet war und eine krankheitsbedingte Kündigung ein Intermezzo in einem ihm fremden Beruf beendete. Ab 1949 fühlte er sich berufen, wie Jesus predigend auf Wanderschaft zu gehen. Er war einerseits Prediger in der örtlichen Gemeinde, jetzt im tiefen Westerwald, andererseits Reisebruder, so die offizielle Berufsbezeichnung dieser Freiberufler. Im ersten Fall zum Nulltarif, als Reiseprediger mit einem mäßigen, ungeregelten Einkommen. Das Einstandskapital war die Bibel, die Finanzierung der neunköpfigen Familie von nun an ungewiss.
Nicht erst jetzt waren wir arm. Obwohl ich mir dafür nichts kaufen konnte, war ich aber mit gewissem Stolz The Son of a Preacher Man, wie es 1968 in dem Song von Dusty Springfield heißt. Das verpflichtete zum Wohlverhalten. Jeder Fehltritt seiner sieben Kinder hätte dem Prediger einen Image-Schaden zufügen können, wie etwa die Heirat mit einem Partner einer anderen Glaubensrichtung. Der lange Arm der strengen Erziehung reichte wirkmächtig auch noch bis in die Ferne, als die Kinder weit weg in anderen Städten wohnten und arbeiteten. Gefordert wurde außerdem, vor jeder richtungweisenden Entscheidung zu beten. Da auf direktem Wege keine Weisung von oben einzuholen war, mussten sogenannte Zeichen Antwort geben – mit anderen Worten, eine Art Wink des Himmels.
Von dem für mein Lebensgefühl zu eng gewordenen Gemeindeleben habe ich mich später, im Alter von 28 Jahren, emanzipiert. Was ich gewonnen habe? Eine neue innere und zeitliche Freiheit und die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit elterlichen und geistlichen Instanzen wie deren Lehren. Was mir bleibt, ist das Bewusstsein für eine christliche Ethik der Nächstenliebe, die Anders- oder Nichtgläubige nicht ausgrenzt, nicht missioniert, auch nicht ungefragt bedrängt. Das tat Jesus auch nicht. Er half denen, die freiwillig zu ihm kamen und ihn um Hilfe baten. Er lehrte Gewaltfreiheit und Nächstenliebe, kümmerte sich um Menschen am Rande der Gesellschaft. Man könnte auch sagen: Er war ein Mann in schlechter Gesellschaft, mit Zöllnern und Sündern ohne Berührungsängste. Im Gegensatz dazu haben es Christen jeder Konfession oder Glaubensrichtung immer wieder verstanden, sich abzugrenzen, auf Andersgläubige oder Ungläubige herabzusehen. Bei dem Bemühen, den biblischen Missionsauftrag zu erfüllen, spielen Vokabeln wie du sollst oder wenn du nicht, dann droht oftmals eine entscheidende Rolle.
So sehr der Glaube orientierungsstiftend, lebensspendend und befreiend ursprünglich gedacht war und heute auch noch sein kann, so sehr kann Religion auch destruktiv sein. Sie kann missbraucht werden zur Ausübung von Autorität, Macht, Druck (Gruppendruck) und Gewalt. Die Geschichte des Christentums ist außer allem Positiven auch eine Geschichte der Abspaltung, der Verfolgung und Verteufelung.8 Speziell fundamentalistische Christen haben eine „besonders große Neigung, menschliches Verhalten durch Strafe und Gewalt zu kontrollieren und Konflikte autoritär zu lösen. Sie werten Zwang, Gewalt und deren rechtfertigende Autorität positiv.“9 Das Drehbuch dafür liefert die Bibel in gewissem Umfang selbst mit vielen Beispielen von Gewalt. Was im ungünstigsten Fall für die davon Betroffenen bleibt, sind Zweifel, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle, Unfreiheit und Abhängigkeit, bis hin zu Neurosen. Wer kann schon ein Selbstbewusstsein entwickeln, der mit der sogenannten Erbsünde geboren sein soll? Nach meinem Verständnis kann man eher von Erbsünde sprechen, wenn ein destruktives Verhalten der elterlichen Gewalt – das heißt Züchtigung – von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Gott hat viele Fahrräder
Und mögen die Alten auch schelten,
So laßt sie nur toben und schrei’n,
Und stemmen sich gegen uns Welten,
Wir werden doch Sieger sein.
Wir werden weiter marschieren,
Wenn alles in Scherben fällt;
Denn heute da hört uns Deutschland
Und morgen die ganze Welt.
Text aus dem Jahr 1932 von Hans Baumann (1914–1988), Sohn eines Berufssoldaten, seit 1933 NSDAP-Mitglied und Jungvolkführer. Ab 1934 zählte das Lied Es zittern die morschen Knochen zum Standardrepertoire der NSDAP, SA und Hitlerjugend.
Um es gleich vorwegzunehmen: Der Titel des Buches Gott hat viele Fahrräder entspringt nicht dem Hirn eines Kreativen nach einer fiebrigen Nacht, sondern ist ein wörtlich und auch ernst zu nehmendes Zitat aus dem Munde meines Vaters, wie am Ende dieses Kapitels zu lesen ist.
Mein Vater Friedrich Ferdinand Fuchs (1898–1977), verheiratet mit seiner Frau Gretchen, geborene Schwarz (1905–1971), Vater von sieben Kindern, Inhaber eines kleinen Schreibwarengeschäftes in der vor dem Krieg so wunderschönen Kleinstadt Siegen/Westfalen, war ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann, Mitglied der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, auch Brüdergemeinde genannt. 1928 heiratete er seine um sieben Jahre jüngere Frau. 1933 zog die junge Familie aus dem Ruhrgebiet nach Siegen. Kurz vor Ende des Krieges 1945 rückte unser Vater noch einmal aus – unfreiwillig –, um in sprichwörtlich letzter Minute den Feind, der bereits bis tief ins Ruhrgebiet vorgerückt war, aufzuhalten oder ihn sogar zu besiegen. Vater war 47 Jahre alt. Lust auf das letzte Gefecht verspürte er nicht, wie er auch generell keine Neigung verspürte, als Soldat zu dienen.
Vater im Alter von siebzehn Jahren im Ersten Weltkrieg
Bereits im Ersten Weltkrieg war er als Siebzehnjähriger zur Front in die Vogesen abkommandiert worden. Bis auf ein paar Wehrübungen und Ersatzdienste hatte er sich im Zweiten Weltkrieg dem Wehrdienst – Gott sei Dank – weitestgehend entziehen können. Darüber freuten sich Gretchen, seine Ehefrau, und natürlich auch wir Kinder. Als er eingezogen werden sollte, verwies er auf seinen Kinderreichtum, sieben an der Zahl. Es würde teuer werden für den Staat, wenn er fiele, so die verharmlosende Bezeichnung für den Tod im Gefecht an der Front. Dennoch musste Vater – wie viele andere ältere und junge Männer auch – ganz am Ende des Krieges zum Deutschen Volkssturm ausrücken, obwohl nichts mehr zu retten war.
Zunächst sammelten sich die Siegener Männer und halbwüchsigen Jugendlichen in dem kleinen Dorf Alchen, unweit von Siegen. Dann galt es für Vater und seine Mitstreiter, den Feind im Sauerland aufzuhalten.
Ein Führererlass vom 25.09.1944 sah vor, alle noch in der Heimat verbliebenen Männer im Alter zwischen sechzehn und sechzig Jahren zur Verteidigung des Heimatbodens einzuziehen. Betroffen waren insgesamt sechs Millionen Männer, die bisher aus Altersgründen oder aus beruflichen Gründen verschont geblieben oder noch zu jung waren. Es gab aber Probleme. Neben vielen anderen Mängeln fehlten inzwischen Waffen und Munition, Kleidung und eine Ausbildung. Die Tapferkeit des Einzelnen ließ auch zu wünschen übrig. Es hatte sich längst herumgesprochen, dass der Krieg für die Deutschen an allen Fronten verloren war. Die politische Führung litt an Realitätsverlust und Kadavergehorsam. Gefährlich war das Himmelfahrtskommando dennoch, weil die Männer des Volkssturms Kombattantenstatus10 hatten. Deswegen teilten sie bei Gefangennahme das Schicksal des regulären Soldaten. Es war ein unsinniger und unverantwortlicher Einsatz, der noch viele Menschen das Leben kostete. Zehntausende fielen, 175.000 wurden nach dem Krieg in den Vermissten-Karteien geführt, viele überlebten als Krüppel.11
Bereits am 23. und 24. März 1945 überquerten die alliierten Truppen den Rhein und drangen schnell vom Norden und Süden zum Ruhrgebiet vor. Die Sprengung der Brücke bei Remagen durch die Deutschen hatte nicht funktioniert und so konnten die amerikanischen Streitkräfte den Rhein überqueren, bis die Brücke unter der Last der Panzer doch noch zusammenbrach. Die Rheinfront war damit zerstört. Dennoch ließen die Generäle weiterkämpfen. Aber der totale Zusammenbruch im Westen war nicht mehr aufzuhalten. Was dann folgte, wird als Kesselschlacht bezeichnet und hatte zum Ziel, das gesamte Ruhrgebiet einzukesseln. Das gelang schließlich am 1. April 1945. Am 4. April folgten Angriffe der amerikanischen 9. Armee auf die eingekesselten deutschen Streitkräfte. Im Westen bildete der Rhein die natürliche Grenze und im Süden die Sieg. Eingeschlossen waren über 300.000 deutsche Soldaten und Millionen von Zivilisten in einem durch vorausgegangene Bombenangriffe teils völlig zerstörten Gebiet. Die Strategie der Alliierten war zunächst, den Kessel auf wenige Kilometer zusammenzudrängen und ihn auch noch zu teilen. Das geschah am 15. April 1945 in einer schnellen Operation, vom Süden kommend, durch das Sauerland bis nach Hagen. Dabei gab es etwa 10.000 gefallene deutsche Soldaten, Angehörige des Volkssturms und der Waffen-SS sowie Zivilisten und 1.500 gefallene US-Amerikaner.12 Die Truppen im Ruhrgebiet konnten nur noch aus der Luft versorgt werden. Mit Rückendeckung führender Industrieller, unterstützt von Sozialdemokraten, Kommunisten und anderen regimefeindlichen Gruppen, die nach Jahren der Unterdrückung wieder auftauchten, boten die Bürgermeister verschiedener größerer Städte die Kapitulation an. So fielen Duisburg, Essen, Solingen, Bochum und Mühlheim an den Feind ohne weiteres überflüssiges Leid für die Bevölkerung, die in Kellern, Bunkern und ausgebombten Häusern kauerte und so schon die schlimmsten Entbehrungen zu tragen hatte.13 Im Bergischen Land hatten Mitte April Soldaten ihre Waffen weggeworfen und von der Bevölkerung Zivilkleidung erhalten. Die Alliierten waren unter anderem vom Süden her angerückt.
Vater Fuchs zur Wehrübung 1938 mit Schnauzer. Ein Kommandant hatte gesagt: „Dem alten Mann geben wir den lahmen Gaul.“
Vater Fuchs zur Wehrübung 1939 ohne Schnauzer
Vaters Einsatz endete in Altena, kurz vor Hagen, als sich die Kompanie auflöste. Das war auch das Ende seiner Kriegsdienste. Als am 17. April 1945 die Kämpfe um das Ruhrgebiet endeten und die Lage der Truppen hoffnungslos war, löste der Oberbefehlshaber Feldmarschall Model seine Heerestruppe auf. Eine förmliche Kapitulation unterzeichnete er aber nicht. 317.000 deutsche Soldaten und dreißig Generäle gerieten in Gefangenschaft. Model entfernte sich von der Truppe und erschoss sich wenige Tage später am 21. April 1945 in einem Wald nahe Duisburg.
Vater Fuchs befreite sich von seiner Uniform, lieh sich – offenbar von einem Mitglied der örtlichen christlichen Brüdergemeinde – Zivilkleidung und fand ein herrenloses Fahrrad. Den Anzug gab er später wieder zurück, das Fahrrad nicht, denn er kannte dessen rechtmäßigen Besitzer nicht. Noch während seines Einsatzes beim Volkssturm scheute er keine Mühe, einen Kontakt zu seiner Familie herzustellen. Unsere Tante Lina in Buchen – dem kleinsten Dorf des Siegerlandes, in das wir Kinder nach dem großen Angriff auf Siegen am 16. Dezember 1944 auf Umwegen geflohen waren – berichtet, sie habe einen Brief von unserem Vater in Empfang genommen. Vaters Heimkehr schließlich, ausgerechnet an meinem 8. Geburtstag am 18. April 1945, wurde nicht nur für mich ein unvergessenes Erlebnis. Wie schon gesagt, galten die Kämpfe um das Ruhrgebiet einen Tag vor seiner Heimkehr am 17. April als beendet.14 Das Timing hätte nicht besser sein können. Dank des Fahrrads aus dem großen Fuhrpark Gottes schaffte Vater die Strecke ins Siegerland in nur einem Tag. Dennoch muss es für ihn ein ebenso gefährliches wie mutiges Unternehmen gewesen sein, sich aus dem Staub zu machen. Denn der Krieg war zwar inoffiziell längst verloren, offiziell aber noch nicht beendet, als er nach Hause radelte. Überall konnte der Feind lauern, sowohl der deutsche, als auch der ehemalige Feind, der jetzt für viele Befreier hieß. Zum Glück besaß Vater einen Wehrpass mit einem Entlassungsvermerk vom 13. Dezember 1944, den er bei insgesamt drei Kontrollen vorzeigen konnte. Im Nachhinein verdeutlichen diese Ereignisse einmal mehr den groben Unfug des letzten Einsatzes und das große Glück, unseren Vater, zwar sehr abgemagert, dennoch unversehrt, wiederzusehen.
Da stand er nun ganz unvermittelt, aber pünktlich zu meinem Geburtstag vor der Haustür, ausgestattet mit einer runden, rot-weißen Blechdose Scho-Ka-Kola. Ob zu Wasser, in der Luft oder zu Land an der Front, wo immer Soldaten im Einsatz waren, gab es zusätzlich zur normalen Verpflegung die koffeinhaltige Zartbitterschokolade, sogar noch in der letzten Etappe des Volkssturms. Das im Zweiten Weltkrieg auch als Fliegerschokolade bezeichnete Produkt wurde unter anderem von dem Schokoladenhersteller Sprengel in Hannover hergestellt, der deshalb 1936 als wehrwirtschaftlich wichtiger Betrieb anerkannt wurde. Obwohl Vater sehr abgemagert nach Hause kam, hatte er dennoch die Scho-Ka-Kola als Geburtstagsgeschenk für mich aufbewahrt. Das spricht für Liebe und Fürsorge.
Ich hatte später als Erwachsener zwar noch deutliche Erinnerungen an das Erlebnis als Achtjähriger, bat dennoch meine Tante Lina, mir auf Tonbandkassetten ihre Erinnerungen aus dieser Zeit zu erzählen. Sie war, wie die meisten der vielen Tanten und Onkel des großen Clans unserer mütterlichen Familie Schwarz, eine gläubige, sehr fürsorgliche Frau und konnte gut erzählen.
Die freudige Überraschung der Heimkehr meines Vaters beschreibt sie so: „[…] In dieser Zeit, als ihr bei mir wart, ging ich eines Morgens zur Haustür raus, um im Garten etwas zu ernten. Auf einmal steht dein Vater vor mir. Ich traue meinen Augen nicht. Er lächelte mich an. Wir waren zunächst stumm, und dann fragte ich: ‚Kommst du vom Gretchen?‘ (Mutter Gretchen war noch in Siegen geblieben, d. V.) ‚Nein‘, entgegnete er, ‚ich komme direkt von der Front hierher, weil ich angenommen habe, auch einige von meiner Familie bei dir zu finden.‘ Und wie recht er hatte. Er war mit einem Fahrrad da und stützte sich darauf. Ich frage: ‚Wie kommst du denn zu einem Fahrrad und mit dem hierher?‘ Da lächelt er und antwortet: ‚Gott hat viele Fahrräder, und eins davon gehört jetzt mir. Das hat an einem Wegrand gelegen.‘ Er habe sich wirklich erst umgeschaut, ob da nicht jemand in der Nähe war, dem das Fahrrad gehören könnte.“ Wie Tante Lina weiter feststellt, habe er sehr dürftige Zivilkleidung angehabt.
Das weggefundene Fahrrad schrieb weiter Geschichte. In der Nachkriegszeit – die Wohnung und Vaters Schreibwarengeschäft in Siegen waren zerstört – diente es Vater dazu, fünf Monate lang wöchentlich von Siegen nach Herborn zu seiner neuen Arbeitsstelle zu fahren beziehungsweise ohne Gangschaltung über die Berge zu schieben. Montags in der Früh fuhr er los und samstags kam er wieder zurück, zuweilen bepackt mit einem Sack Kartoffeln auf dem Gepäckträger. Bis ich das alte Fahrrad für mich entdeckte, stand es wenig beachtet auf dem Speicher. Das große Herrenrad war aber viel zu groß für mich. Deshalb trat ich mit einem Bein schräg unter der Querstange in die Pedalen, danach im Stehen über der Stange, bis ich endlich groß genug war, um auf dem Sattel sitzen zu können. Nun hatte ich nicht nur Fahrradfahren gelernt, sondern auch die Erkenntnis gewonnen, dass man mit dem Hinweis auf die höhere Instanz gute Argumente finden kann. Auf Gott war Verlass, vor allem in ausweglosen Situationen. Das wurde uns mit täglichen Bibellesungen und Gebeten zu Tisch und auch abends vor dem Schlafengehen vermittelt.
Das freudige Ereignis von Vaters Heimkehr in Buchen wurde allerdings überschattet von dem Verlust des Mannes meiner Tante Lina. Er hatte an der Front in Russland gekämpft. Obwohl ich jeden Abend für ihn gebetet hatte, er möge doch unversehrt nach Hause kommen, war er gefallen. Während ich ursprünglich guter Hoffnung gewesen war, Gott möge meine Gebete erhören und meine Wünsche erfüllen, war ich nun enttäuscht. Mein Glaube an die Allmacht Gottes bekam kleine Risse. Als Erwachsener wurde mir allerdings bewusst, dass nicht alle menschlichen Schicksale Gott zu verantworten hat, sondern nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip seine irdischen Geschöpfe, denen er den freien Willen gab, zu entscheiden.
Vater Fuchs 1945, abgemagert nach Rückkehr vom Volkssturm
Eine Geburt unter Gottes Beistand
Wir kommen weit her
liebes Kind
und müssen weit gehen
keine Angst
alle sind bei Dir
die vor Dir waren
Deine Mutter, Dein Vater
und alle, die vor ihnen waren
weit, weit zurück
alle sind bei Dir
keine Angst
wir kommen weit her
und müssen weit gehen
liebes Kind
Heinrich Böll an seinen Enkel Samay
Nun bin ich der Geschichte vorausgeeilt, denn mein ereignisreiches Leben begann bereits acht Jahre zuvor, soeben noch in Friedenszeiten. An einem Sonntag um 10:15 Uhr am 18. April 1937 „erblickte unser kleiner Richard unter Gottes Beistand das Licht der Welt“, hieß es in der Geburtsanzeige. „Mutter und Kind geht es gut.“ Ich kam in unserer Wohnung in Siegen, An der Alche 21, zur Welt, während andere meiner Geschwister in der benachbarten Klinik Stähler entbunden worden waren, soweit sie nicht schon in Wattenscheid – dem früheren Wohnort unserer Familie – geboren worden waren.
Meine Eltern nannten mich Richard – ein Name, mit dem ich mich nur zögernd anfreunden konnte. Außer dem einen Namen gab es kein erweitertes Sortiment an Vornamen für eine spätere andere Wahl. Richard soll ein germanischer Name sein und so viel heißen wie mächtiger Herrscher. Einige davon gab es tatsächlich, zum Beispiel in England: Richard I. Wenn damals die Namen der Eltern für die Erstgeborenen bereits verbraucht waren, mussten Tanten oder Onkel als Namensgeber herhalten. Immerhin gab es in der näheren oder angeheirateten Verwandtschaft dreimal den Namen Richard. Einen davon – ursprünglich ein Schmied, später Fabrikant und begnadeter Techniker – habe ich sehr geschätzt und auch er mochte mich. Obwohl aus streng christlichem Haus, blieb Onkel Richard den Gottesdiensten fern. Dennoch praktizierte er das Gebot der Nächstenliebe, indem er den Haushalt seiner verwitweten Mutter mit zwei ledigen Schwestern mitfinanzierte. Er war nicht nur Anhänger der Freikörperkultur, sondern hatte auch eine heimliche Liebe, die er erst heiratete, als seine Mutter gestorben war.
Meine Eltern – mit inzwischen fünf Kindern – machten sich zwar Gedanken über Familienplanung, das Zählen klappte aber nicht so recht – für mich zum Glück, sonst gäbe es weder mich, noch meine jüngste Schwester Gerda. Großmutters heißer Tipp, den sowohl Mutter als auch Vater als reine Wahrheit einer erfahrenen Frau ernst nahmen, war: „Solange Mütter stillen, werden sie nicht schwanger.“ Meine zweitälteste Schwester Gustel, die schon dreizehn Monate nach Magdalenes Geburt zur Welt kam, bewies das Gegenteil. Als sich die letzten Kinder ankündigten, war Mutter etwas überrascht und vielleicht auch der großen Verantwortung wegen besorgt, denn die Zeiten, kurz vor Ausbruch des Krieges, verhießen nichts Gutes. In zwei Jahren würde der Krieg beginnen und verheerende Folgen nicht nur für die sogenannten Feinde, sondern auch für das eigene deutsche Volk haben.
Dennoch hatten meine Eltern Gottvertrauen. Oft hörte ich den zuversichtlichen Satz: „Gibt Gott Häschen, gibt Gott Gräschen.“ Das heißt, Gott als Allesversorger würde niemanden im Stich lassen. Auch die Bibel verbreitet unbekümmerte Zuversicht, wenn es dort heißt: „Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sehet hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen und ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie. […] Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. […] So seid nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich selbst sorgen.“15 Das biblische Rundum-Sorglos-Paket ist allerdings, wie es später heißt, an folgende Bedingung geknüpft: „Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden.“