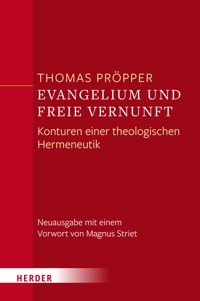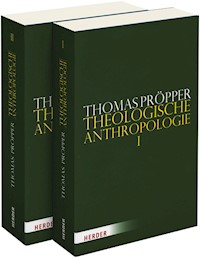Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pustet, F
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gottes Freundschaft - das ist eines der Schlüsselworte in Thomas Pröppers Denken. Er hat diesen Gedanken nicht nur in seiner theologischen Arbeit verfolgt, sondern auch zum Kern seiner Predigten gemacht, indem er "die so menschliche Sehnsucht nach Freundschaft, welche diesen Namen verdient, auch als die so menschliche Sehnsucht nach einem Gott, der dem Menschen Freund sein möge, ausgearbeitet hat" (Magnus Striet). Über zehn Jahre predigte Thomas Pröpper in der Münsteraner Dominikanerkirche. Das, was ihn mehr als alles andere bewegte, war: das Evangelium glaubhaft ins Heute der Spätmoderne zu überSetzen. Dabei legte er nicht nur Wert auf die theologische Stringenz seiner Gedanken, sondern er feilte so lange an seinen Predigten, bis er, der Sohn eines Musikers, auch eine "stimmige Musikalität" des Textes erreicht hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buchinfo
Haupttitel
Impressum
Vorwort
Zum Geleit
Heimgekommen (Joh 14,1–6)
Gottesfreundschaft (1 Kor 15,1–20; Joh 15,9–17)
Leitstern des Gottdenkens (Mt 11,25–30)
Predigten, geistliche Gedanken und Gebete von Thomas Pröpper
Wir alle sind Geistliche (1 Kor 12,4–30)
Die Seligpreisung der Armen und Weinenden (Lk 6,17.20–26)
Feigenbaum und Weinberg (Lk 13,1–6)
Der Weg nach Emmaus (Lk 24,13–25)
Dass uns nichts trennen kann von Gottes Liebe (Röm 8,31–39)
Pfingsten für alle (Apg 2,1–11)
Liebhaber des Lebens (Weish 1,13f; 11,21–26)
Über den Urlaub, die Arbeit und das Glück (Mk 6,30–32)
Die Predigt des Amos (Am 6,1.4–7; 7,10–15)
Über die Schwäche Gottes (Joh 18,33–37)
Die Umkehrpredigt des Täufers (Lk 3,10–18)
Die Versuchung Jesu (Lk 4,1–13)
Gottes Sonne über Böse und Gute (Mt 5,38–48)
Das Glaubensbekenntnis
Auferstehung der Toten (Totennacht)
Was steht ihr da und schaut in den Himmel? (Apg 1,1–11)
Erinnerung an Johannes XXIII.
Unser Glaube an den dreieinigen Gott
Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1–16)
Liebe deinen Nächsten, er ist wie du (Mt 22,34–40)
Leben aus Gottes Nähe (Phil 4,4–7)
Die Taufe Jesu (Mk 1,7–11; Jes 42)
Ohne Leiden leben (Joh 12,20–33; Hebr 5,7–9)
Gründonnerstag (Joh 13,1–15)
Die Jünger nach Ostern – Zweifel und Nachfolge
Dreifaltigkeit – Der Mensch und die Gegenwart Gottes
Alles ist dem möglich, der glaubt (Mk 1,32–34; 9,14–29)
Wer ist ein Christ? (Gal 5,5–7; 6,14–18)
Schenken und sich schenken lassen (Mt 18,21–35; Eph 4,22–5,29)
Franz von Assisi (Mk 10,17–27)
Über die Tugend, Erwartungen zu haben, und die Kunst, Ansprüche zu stellen
Das Geheimnis des ersten Schrittes – Über Konflikt- und Friedensfähigkeit des Christen
Glaube in der Passion – Zum Gedenken an Reinhold Schneider
Er aber lacht, der in den Himmeln wohnt (Lk 6,39–45) – Karneval
Offenbarung am Dornbusch (Ex 3,1–15)
Gott hat auf uns gehofft – Karfreitag
Geistesgegenwart (Röm 8,26)
Lilien und Vögel (Lk 12,15–31)
Teresa von Ávila
Menschlich den Weg des Lebens bestehen (Joh 14,1–14)
Schwierigkeiten mit der „heiligen Kirche“ (Eph 4,1–6)
Es geht so, man lebt so
Der Schaden der Schuld und der Anfang der Gnade (Röm 7 – Hochfest der Unbefleckten Empfängnis)
Erscheinung des Herrn (Mt 2,1–12)
Todesschrei ohne Antwort? – Karfreitag
Erfahrung des Geistes (Röm 5,5–8)
Wider den allgegenwärtigen Zynismus (1 Kön 17,10–16)
Prophetenberufung (Jer 1,4–5.17–19; 20,7–9)
Schwierigkeiten mit dem Auferstehungsglauben (2 Makk 7,1f.9–14; 2 Thess 2,16f; 3,3–5; Lk 20,27–38)
Der Abend vor seinem Leiden (Joh 13,1–15)
Hindernisse der Nachfolge (Lk 9,51–62)
Das Wort, das wir uns schulden (Röm 16,25–27)
Ein Land, das von Milch und Honig fließt (Jos 5,6–12)
Kierkegaard über das Christwerden und die Nachfolge (Mt 10,37–42)
Hoffnung für die Entschlafenen (1 Thess 4,13f)
Gott angetraut auf ewig (Hos 2,16f.21f)
Menschlicher Herrschaftsauftrag und Bundestreue (Gen 9,1–15)
Autor und Herausgeber
Anmerkungen
Zum Buch
Gottes Freundschaft – das ist eines der Schlüsselworte in Thomas Pröppers Denken. Er hat diesen Gedanken nicht nur in seiner theologischen Arbeit verfolgt, sondern auch zum Kern seiner Predigten gemacht, indem er „die so menschliche Sehnsucht nach Freundschaft, welche diesen Namen verdient, auch als die so menschliche Sehnsucht nach einem Gott, der dem Menschen Freund sein möge, ausgearbeitet hat“ (Magnus Striet). Über zehn Jahre predigte Thomas Pröpper in der Münsteraner Dominikanerkirche. Das, was ihn mehr als alles andere bewegte, war: das Evangelium glaubhaft ins Heute der Spätmoderne zu übersetzen. Dabei legte er nicht nur Wert auf die theologische Stringenz seiner Gedanken, sondern er feilte so lange an seinen Predigten, bis er, der Sohn eines Musikers, auch eine „stimmige Musikalität“ des Textes erreicht hatte.
Der Autor
Thomas Pröpper, Dr. theol., Dr. h. c., 1941–2015, war Professor für Dogmatik und theologische Hermeneutik an der Universität Münster. Als Prediger war er über viele Jahre in der Dominkanerkirche Münster (katholische Universitätskirche) tätig. Thomas Pröpper war Mitbegründer und -herausgeber der Reihe ratio fidei. Beiträge zur philosophischen Rechenschaft der Theologie.
Klaus Müller, Dr. phil., Dr. theol. habil., geboren 1955, ist Professor für Philosophische Grundfragen der Theologie an der Universität Münster und seit 1999 Rektor ecclesiae der Dominikanerkirche. Er ist Mitbegründer und -herausgeber der Reihe ratio fidei. Beiträge zur philosophischen Rechenschaft der Theologie.
Thomas Pröpper
Gottes Freundschaft suchen
Predigten, geistliche Gedanken und Gebete
Verlag Friedrich Pustet
Regensburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eISBN 978-3-7917-6082-7 (epub) © 2016 by Verlag Friedrich Pustet, Regensburg Gestaltung und Satz: Martin Vollnhals, Neustadt a. d. Donau Umschlaggestaltung: Martin Veicht, Regensburg Umschlagbilder: © Shahid Alam 2011. Vorderseite: Gottes Wort. Rückseite: Gottes Geist (Goldtusche, Ol und Tinte auf Holz) eBook-Produktion: Friedrich Pustet, Regensburg
Diese Publikation ist auch als Printprodukt erhältlich: ISBN 978-3-7917-2733-2
Weitere Publikationen aus unserem Verlagsprogramm finden Sie unter www.verlag-pustet.de
Vorwort
Am 10. Februar 2015 verstarb Thomas Pröpper nach einer mehr als zehnjährigen Erkrankung, die ihn gezwungen hatte, 2003 vorzeitig aus dem aktiven Dienst als Direktor des Seminars für Dogmatik und theologische Hermeneutik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität auszuscheiden. Lange war Thomas Pröpper – nicht zuletzt aufgrund der verhältnismäßig schmalen Zahl seiner Veröffentlichungen – unter den spekulativ Ambitionierten der deutschsprachigen Theologenzunft ein Geheimtipp gewesen. Aber dann gelang es ihm, in der Zeit seiner Krankheit aus den Ressourcen jahrzehntelangen Nachdenkens und Studierens sein Opus Magnum zu Papier zu bringen: seine zweibändige Theologische Anthropologie1. Dieses Werk gehört zu den Meilensteinen der katholischen Theologie nach dem II. Vatikanischen Konzil, nicht zuletzt deswegen, weil es den Begriff der Freiheit zum Dreh- und Angelpunkt eines theologischen Ansatzes macht, der zu den ganz wenigen gelungenen Brückenschlägen der letzten Jahrzehnte zwischen dem Denken der Moderne und der katholischen Tradition zu zählen ist.
Wem die Möglichkeit oder auch nur Zeit fehlt, sich durch dieses 1534-Seiten-Opus zu arbeiten, bekommt mit der vorliegenden Publikation eine attraktive Alternative geboten: Thomas Pröpper war neben seiner akademischen Dozententätigkeit ein begnadeter Prediger. Über viele Jahre bis zu seiner Erkrankung hat er darum bei der Münsteraner Katholischen Universitätsgemeinde in der Dominikanerkirche St. Joseph als Zelebrant und Prediger mitgewirkt. Nahezu alle Predigten aus dieser Zeit (von ca. 1992 bis 2000) wurden als Audiodateien registriert. Ergänzt um ganz wenige Homilien, die anderswo gehalten wurden, werden sie hier in der Abfolge ihrer Erarbeitung vorgelegt, weil sie auf ganze andere – oft poetisch durchformte, aber deswegen begrifflich nicht weniger präzise – Weise in die Herzmitte von Thomas Pröppers theologischer Grundüberzeugung geleiten. Auch für ihn gilt wie für so manchen anderen großen Theologen und Philosophen von Origenes über Johann Gottlieb Fichte bis Alfred Delp und Karl Rahner, dass ihm das Genre der Predigt zu einem qualifizierten Ort des Durchbruchs leitender Gedanken wurde. Wer sich in diese Texte vertieft, wird zudem merken, dass es kein Klischee ist, Thomas Pröpper als einen großen spätmodernen christlichen Existenzialisten zu titulieren.
Ich danke Frau Kunigunde Pröpper, Thomas’ Schwester, für die Genehmigung zur Veröffentlichung der Predigten. Um die Transkription der Aufzeichnungen haben sich Frau Monika Epping und Frau Inga Markert höchst verdient gemacht. Die nötigen Korrekturaufgaben waren wieder einmal den Schwestern des Klarissenkonvents am Dom zu Münster anvertraut. Der Verlag Friedrich Pustet aus Regensburg hat, ohne eine Sekunde zu zögern, die Realisierung dieses Projekts zugesagt, wesentlich getragen vom Engagement seines Theologie-Lektors Dr. Rudolf Zwank, für das ich ihm (ich weiß nicht, zum wievielten Male) von Herzen danke.
Eines Wortes bedarf es zu den Titelbildern des Buches. Es handelt sich um zwei Kalligraphien des pakistanischen Künstlers muslimischen Glaubens Shahid Alam, der seit 1973 in Deutschland lebt und mit vielen seiner Werke dem Dialog der Kulturen und besonders der Religionen zuarbeitet. Das Diptychon ist im Zuge einer Ausstellung des Künstlers in der Dominikanerkirche zu Münster entstanden. In das Namenszeichen Jesu („Isa“) sind in einer die Unendlichkeit vergegenwärtigenden Endlosschleife die Worte „Gottes Wort“ (Vorderseite) und „Gottes Geist“ (Rückseite) eingeschrieben. Die Universitätsgemeinde, die sich in dieser Kirche zum Gottesdienst versammelt, war von den beiden Werken so beeindruckt, dass sie – gerade auch durch die Mithilfe von Thomas Pröpper – erworben werden konnten und damit jetzt auch an ihn erinnern.
Anstelle einer Biographie oder Laudatio (die Thomas Pröpper kaum goutiert hätte) stehen seinen Predigten diejenigen zweier anderer voran: Sein enger Freund und Weihekurskollege Dr. Gotthard Fuchs hat bei Thomas Pröppers Begräbnis in Balve (Sauerland) gepredigt, ich selbst beim Requiem in seiner Heimatgemeinde St. Mauritz in Münster sowie beim Gedenkgottesdienst der Katholisch-Theologischen Fakultät. Alle drei Predigten suchen so etwas wie ein geistliches Porträt dessen zu zeichnen, dessen Stimme die beiden Predigenden zusammen mit vielen anderen gern noch länger vernommen hätten.
Münster, den 15. Oktober 2015, am Fest der hl. Teresa de Jesús, von der jener Gedanke stammt, der für Thomas Pröpper so leitend war, dass er den Titel dieses Vermächtnis-Bandes prägt
Zum Geleit
Heimgekommen
Joh 14,1–6
Predigt von Klaus Müller beim Begräbnisgottesdienst in Münster-St. Mauritz
Alle, die ihn näher kannten, wussten es. Wussten es schon länger: Thomas Pröpper hat nicht mehr so furchtbar lang zu leben. Zu sehr hatten ihn die über ein Jahrzehnt anhaltende Erkrankung und die endlosen Behandlungen geschwächt. Er konnte nicht mehr. Am 10. Februar um 10.30 Uhr hat er sein Leben in die Hand dessen zurückgelegt, der es ihm gab. Zuletzt hatten wir uns am 1. Februar getroffen, einem Sonntag. Thomas wollte in die Dominikanerkirche kommen. Er schaffte es nicht bis dorthin. Hernach traf ich ihn auf der Straße. Er sah elend aus. Als wir uns verabschiedeten, sagte er zu mir: „Denk an mich, mir geht’s nicht gut.“
Jetzt ist es gut. Thomas Pröpper ist daheim. Jetzt weiß er unvergleichlich mehr als die ganze lebende Theologen- und Theologinnenzunft. Der Weg dahin war nicht geradlinig. Angefangen hat Thomas Pröpper – was das Intellektuelle betrifft – als Germanistikstudent in München. Dann erst wechselte er in die Theologie. Über etliche Zwischenstationen wurde der heutige Kardinal Walter Kasper sein Doktorvater. Aber das war nicht das Ende, sondern der Anfang eines Abenteuers. Die ursprünglich in Angriff genommene Doktorarbeit über den späten Fichte wurde nie fertig, da war Thomas einfach zu skrupulös. Freunde und Kollegen damals entrissen ihm deshalb eine nebenher erstellte Gelegenheitsschrift und reichten sie als seine Dissertation ein. 1988 kam er nach Münster. Zeitzeugen erzählten mir, dass er anfangs im kleinsten Kreis in Kellerräumen Seminare abhielt, schweißtriefend vor Aufregung, um die jungen Leute ja auf rechte Weise zum Selbstdenken zu motivieren. Und dann, Jahr um Jahr mehr, wurde sichtbar, dass dieser Dozent, der manchmal so zögerlich und unsicher wirkte, auf eine Weise Theologie betrieb, wie sie schon lange nicht mehr zu hören gewesen war. Derzeit kann man öfter lesen, die katholische Theologie der Gegenwart habe keine Leitfiguren mehr wie einen Guardini oder Rahner und sei deshalb auf ein mediokres Niveau abgesunken. Falsch. Thomas Pröpper war eine solche Leitfigur. Ich zögere nicht, ihn einen Jahrhundertdenker zu nennen. Endgültig bewiesen hat er das zuletzt durch die Publikation seiner zweibändigen Theologischen Anthropologie, die er sich noch in der Zeit seiner Erkrankung abgerungen hat.
Ich erinnere mich noch an unsere allererste Zusammenarbeit: Ich war noch nicht hier in Münster und bereitete gerade anlässlich des 60. Geburtstags meines Habil.-Vaters und Thomas’ Freundes Hansjürgen Verweyen eine Streitschrift vor. Ich hatte Thomas als Autor und Mitherausgeber gewinnen können. Ich rief ihn an, weil ich noch ein paar Fragen hatte. Er war erschüttert, weil sich in seinem Text noch drei kleine Druckfehler und Wortauslassungen gefunden hatten: „Verdammt, verdammt noch mal, Sie haben recht, da fehlt was! Bitte sofort verbessern!“ Das führte aber dann dazu, dass wir am Telefon den gesamten Text Satz für Satz durchgingen und die Formulierungen auf ihre – wie er wörtlich sagte – „stimmige Musikalität“ hin abhörten. Stundenlang.
Später, nachdem ich in Münster sein Kollege geworden war, haben wir dieses Arbeiten an der Stimmigkeit von Gedanken sozusagen im Großformat fortgesetzt und 1999 die Buchreihe ratio fidei: Beiträge zur philosophischen Rechenschaft der Theologie begründet. Entgegen dem Mainstream in Sachen theologischer Fachbücher wurde die Reihe ein großer Erfolg: Mittlerweile sind fast 60 Bände erschienen. Ein prominenter Kollege hat die Reihe einmal „Beletage der systematischen Theologie“ genannt. Das hat uns beide gefreut.
Dieses Bemühen um äußerste Genauigkeit in der Sache, die zugleich eine ästhetische Dimension mit einbezieht, hat aber keineswegs dazu geführt, dass Thomas Pröpper zu einem Produzenten elitärer Textsorten geworden wäre. Im Gegenteil: Schon zu seiner Tübinger Assistentenzeit hat ihn nicht nur das arrivierte Publikum im Kurort Baiersbrunn gern predigen hören, sondern genauso die sogenannten einfachen Landleute aus Oberndorf und Wendelsheim. Dass da zumal die Landfrauen gern lauschten, wie mir einer von Thomas’ Freunden erzählte, hatte natürlich nicht zuletzt mit dem Charme des jungen Priesters zu tun, ein Charme, den er übrigens auch in späteren Jahren besaß, als er hier in der Dominikanerkirche zelebriert hat und ein gern gehörter Prediger war. Einmal – ich war noch nicht so lange da – war er verhindert. Ich habe ihn vertreten. Eine Münsteraner noble Dame sieht mich aus der Sakristei kommen, reißt die Augen auf: „Ist Herr Pröpper heute nicht da?“ „Nein“, sag ich. Macht die Dame doch stante pede kehrt, packt ihre Tasche und schleicht sich – von Säule zu Säule huschend – wieder raus.
Thomas wäre das peinlich gewesen. Ihm lag nichts ferner, als sich bei der Messe selbst in den Mittelpunkt zu rücken und für den Fanclub eine Performance abzuliefern. Im Gegenteil: Einmal hat er mich wörtlich gefragt: „Du, passiert dir das auch, dass du dir manchmal beim Predigen über die Schulter schaust und denkst: Was sag ich da überhaupt?“ – Ja, ich kannte und kenne das auch, mit zunehmenden Jahren immer mehr sogar. Wir waren uns in diesen Dingen, und nicht nur in diesen, sehr nah.
Darum bin ich ihm für diese Frage unendlich dankbar. Da geschieht, wenn man ernst nimmt, was der evangelische Homiletiker Ernst Christian Achelis meinte, als er 1890 schrieb: „Predige nicht dich selbst, sondern zuerst dir selbst.“ Dann erst stellt sich jene Transparenz in der Ausübung des geistlichen Amtes ein, die aus der Verschränkung von Subjektsein und Demut erwächst. Klerikalismus in welcher Form auch immer war Thomas vom Wesen her fremd.
Jetzt ist Thomas tot. Wir trauern um ihn. Die katholische Theologie deutscher Sprache und namentlich unsere Fakultät hat eine Stimme verloren, die es so nie mehr geben wird. Dieses bohrende Nachfragen, das doch niemals vergessen hat, auch selbst nochmals in Frage gestellt werden zu können – das werden wir schmerzlich vermissen.
Und doch gibt es noch etwas, das darüber hinausführt. Dieses Darüber-hinaus spiegelt sich nicht zuletzt im Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi, dem Urpatron derjenigen Theologie, der sich Thomas Pröpper mit seinem entschiedenen Votum für den Franziskanertheologen Duns Scotus am engsten verbunden wusste.
Gelobt seist du, Herr,
mit allen Wesen, die du erschaffen,
der edlen Herrin vor allem,
Schwester Sonne,
die uns den Tag heraufführt und Licht
mit ihren Strahlen, die Schöne, spendet;
gar prächtig in mächtigem Glanze:
Dein Gleichnis ist sie, Erhabener.
Aus Glauben und Gnade ganz eins geworden mit seinem Gott, erfühlte der Poverello – übrigens gerade in einer Zeit schweren Leidens – die abgründige Geborgenheit seines ganzen Daseins; aus allen Geschöpfen leuchtet ihm Gottes Güte entgegen. So singt er aus befriedetem Herzen von der Mutter Erde, von Bruder Wind und Schwester Quelle. Ist das Naturromantik? Die letzte Strophe des Sonnengesangs belehrt uns eines Besseren:
Gelobt seist du, Herr,
durch unsern Bruder, den leiblichen Tod;
ihm kann kein lebender Mensch entrinnen …
Lobet und preiset den Herrn,
danket und dient ihm in großer Demut.
Kann man Gott auch preisen für den Tod? Was muss mit einem Menschen geschehen sein, der diesseits aller Todesangst und jenseits krankhafter Todessehnsucht so gelöst vom Sterben redet, dass er sogar für den Tod noch Gott danken kann – diesen Augenblick, der ein Leben beendet und darin verendgültigt?
Das Evangelium ist viel zu menschlich, als dass es nicht wüsste um die Unruhe, die der Tod uns einflößt. Manchmal greift sie sogar noch unter der Maske kalter Gleichgültigkeit nach einem Menschen, manchmal als quälende Frage, die einen mit Gott hadern lässt wie Ijob. Warum hat gerade der sterben müssen, den ich liebe? Warum hat das ausgerechnet mich getroffen? Diese Erschütterung des Herzens, die Anfechtung durch den Zerfall von Leben und Glück verharmlost das Evangelium nicht, es anerkennt das vielmehr. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Aus dem Mund Jesu hören wir vielmehr ein Wort, das sich der Erschütterung des Herzens entgegenstellt: Es gibt solche Anfechtung, sagt er, aber: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Wie steht es aber dann mit diesem Interesse Gottes für uns und unser Leben im Augenblick des Todes, diesem absoluten Gegensatz des Lebens, der dennoch untrennbar unserem Wesen zugehört? Jesus zögert nicht mit der Antwort: Wenn Gott wirklich der Ich-bin-da-für-euch ist, wie ich es mit Leib und Leben bezeuge, dann ist er das auch bei unserem Sterben. Da kann der Tod der Zuneigung Gottes nicht einfach eine Grenze setzen, sonst wäre Gott nicht mehr der bedingungslos für den Menschen Daseiende und ihm Zugewandte, wie sich Jesus für ihn verbürgt. Im Sterben stürzt du nicht ab, sagt uns Jesus, sondern da trittst du ein in das, was die Suche deines Lebenshungers erfüllt: in die Gemeinschaft mit Gott, die allein groß genug ist, die Unendlichkeit deines sehnsüchtigen Herzens zu befrieden. Das Haus des Vaters – das ist Gott selbst. In ihm gibt es viele Wohnungen, sagt Jesus. Da wird also keiner gleichgeschaltet und nichts gleichgemacht. Das Glück des Herzensfriedens ist nie allgemein, sondern immer konkret. Jede und jeder findet in Gott das, was ihr und ihm ganz entspricht, das, worauf er und sie im irdischen Leben durch Geschick und Geschichte gerichtet waren. Ganz sie und er selbst dürfen sie endlich sein in Gott – und so sich selber finden in ihm.
Selbst sein dürfen. Genau dafür hat sich Thomas Pröpper in Denken und Leben verbürgt. Wollte man sein denkerisches Anliegen auf den Nenner einer Formel bringen, so müsste man sagen: Er war der Theologe der Freiheit. Moderner konnte ein katholischer Theologe eigentlich gar nicht sein. Und genau das war es, was ihn mehr als alles andere bewegte: das Evangelium glaubhaft ins Heute der Spätmoderne zu übersetzen. Wir werden seine Stimme schmerzhaft vermissen.
Anlässlich des Erscheinens der Theologischen Anthropologie hat Thomas Pröpper ein Interview gegeben. Da wurde er gefragt: Wenn er Erstsemestern drei Ratschläge erteilen müsste, welche wären das? Da hat er geantwortet:
„Der erste würde lauten: ‚Vertrauen Sie stets Ihren eigenen Fragen und trauen Sie sich auch, sie – notfalls hartnäckig – zu stellen.‘ Und der zweite: ‚Behalten Sie bei der Ausbildung Ihres theologischen Denkens und der entsprechenden Lebenspraxis immer im Blick, dass es zwischen dem Menschsein (bzw. Menschwerden) und dem Christsein (bzw. Christwerden) keinen Widerspruch geben kann.‘ Schließlich der dritte: ‚Suchen Sie von Beginn an aufrichtige und verlässliche Freundschaften zu schließen und sprechen Sie auch über Ihren Glauben, damit dieser die Irritationen, die das Studium mit Sicherheit bringen wird, besser bewältigt und vor Vereinsamung – auch der kirchlichen – bewahrt bleibt.‘“2
Der erste dieser Ratschläge befeuerte die Leidenschaft der Debatten, die Thomas geführt hat. Den zweiten teilten wir auf Punkt und Komma – dass es zwischen dem Menschsein und dem Christsein keinen Widerspruch geben kann. Und was den dritten Ratschlag betrifft – das Freundschaftschließen, das auch über den Glauben zu sprechen wagt –, so hat ihn mir die Begegnung mit Thomas Pröpper seit 20 Jahren bewahrheitet. Dafür danke ich ihm von Herzen über das Grab hinaus! Ich werde ihn, meinen Freund, der mich nach Münster geholt hat, bitter vermissen.
Gottesfreundschaft
1 Kor 15,1–20; Joh 15,9–17
Predigt von Gotthard Fuchs bei der Grablegung in Balve
Eines trieb ihn zeitlebens um: der Bruch zwischen Evangelium und Vernunft, zwischen Kirche und Moderne. Dass der lebendige Gott in Konkurrenz zum Menschen geriet, so als störe einer den anderen, war ihm das Ärgernis schlechthin. Dass die Weisungen Gottes, seine wunderbaren Gebote, zur moralischen Last wurden, mit denen man das ohnehin nicht leichte Leben von uns Menschen nur schwerer, unerträglich schwerer machte, empörte ihn und machte ihn traurig. Die ganze Leidenschaft seines theologischen Denkens erwächst aus dem Sinn für die Freiheit; deshalb sein Leiden, seine Empörung über diese weithin kirchlich hausgemachten Differenzen und Entzweiungen. Wie viel Denkfaulheit in der kirchlichen Verkündigung, wie viel Sprachnot und Fremdworterei – nein, er wollte gerade den Gebildeten unter den Verächtern des kirchlichen Christentums, aber nicht zuletzt den Mitchristen theologisch dadurch dienen, dass er im Geheimnis des lebendigen Gottes den Menschen in seiner Würde so groß wie möglich machte. Und in eins damit war es ihm wichtig, im Geschöpf den Schöpfer zu loben, in jedem Menschen den Menschen aus Nazareth zu feiern. Nicht zufällig war sein erstes Buch der Jesusgestalt gewidmet, aber nicht in der kirchlichen Überlieferung, sondern im zeitgenössischen Denken atheistischer und agnostischer Philosophen und Schriftsteller. Es war sein eigenes intellektuelles und spirituelles Leben, das da mit zur Debatte stand: Aufklärung und Glaube, Kritik und Gebet, Argument und Anbetung zusammenzudenken und nicht gegeneinander, im wechselseitigen Respekt- und Resonanzverhältnis, ja in wechselseitig sich freigebender Begrüßung und Hochschätzung; darin wurde ihm und durch ihn so vielen, auch von uns, Gott groß und der Mensch. Im Geheimnis wechselseitig freigebender Freiheit war es das Geheimnis der Gottesfreundschaft und dessen Glutkern die Auferstehung Jesu Christi. Als ich Thomas in unserem letzten Gespräch fragte, welches sein Lieblingslied sei, antwortete er sofort und spontan: „Christ ist erstanden“. Deshalb heute die Lesung, deshalb die Feier des Abschieds im österlichen Weiß trotz aller Trauer des Hinübergangs, in tiefer Dankbarkeit und Freude.
Mitten im Scharnier seiner theologischen Anthropologie, exakt am Ende des ersten Bandes, steht, in fast poetischer und hymnischer Sprache, Thomas’ Kommentar zum heutigen Evangelium – einer seiner kostbarsten und typischen Texte. „Freundschaft mit Gott. Ich wüsste keinen Gedanken, der den Glauben verlässlicher tragen und ihm größere Freude sein kann. Dass er, der alles uns gibt, uns die Würde eigener Zustimmung lässt. Unsere Freude, dass er uns wählte, und seine Freude, wenn er zu uns gelangt.“ Nicht Last und Belästigung prägen hier das Glaubensverständnis, sondern, wie es einzig sich gehört, das Kernwort des Osterevangeliums: Nichts als Freude, und die im Komparativ. Und das, so die entscheidende Pointe, in wirklicher Wechselseitigkeit, ja auf gleicher Augenhöhe zwischen Gott und Mensch. Gott ehren heißt eben, den Menschen groß zu machen und als Mitmenschen zu erkennen. Und die Größe des Menschen erkennen heißt, ihn als gottesbedürftig und gottesfähig zu begreifen mit der „Würde eigener Zustimmung“. Wo beide sich finden, wie in dem Unvergesslichen aus Nazareth, da ist nichts als Freude, unvermischt und ungetrennt, in heiliger Kommunion. „Dass unser Denken, unsere Rede vor ihm freimütig sein soll und er auf uns achtet, selber uns anspricht und seine Nähe uns freigibt, aber nicht fallen lässt.“ Was gehörte zur Freundschaft, zusammen mit dem Wohlwollen für- und miteinander, nicht mehr dazu als die Treue? Thomas war für viele ein treuer Freund, eine westfälische Eiche in Sachen Verlässlichkeit. Was ihm sozusagen naturwüchsig zukam, hatte seinen tiefsten Grund in der unbedingten Bejahung im Geheimnis Gottes. Benedictio heißt ja nichts anderes als Gut-heißen. Aus solcher Gutheißung heraus freimütig sein und nicht duckmäuserisch, den klaren Gedanken lieben und das offene Wort – und in alldem die Antwort auf ihn, der „auf uns achtet, selber uns anspricht“. Treu in seiner Lust am Anderssein und in jener „Nähe, die uns freigibt, aber nicht fallen lässt“.
„Gewiss auch eine mühsame Freundschaft. Ganz sicher für ihn, denn er kann leiden durch uns. Doch ebenso wir: wenn wir ihn nicht mehr verstehen, uns wie Abgeschriebene fühlen.“ Ja, wie gut, dass Thomas auch dies ins Wort brachte. Wer sich wirklich am Geheimnis des lebendigen Gottes zu orientieren vermag und sich wirklich in Freiheit gebunden hat, lebt in gewisser Weise schwieriger als jene, die das Wagnis des Gottesglaubens nicht eingehen. Der Beziehungsraum des Unbegreiflichen wird größer, kann gespannt sein bis zum äußersten Punkt. „Nun verfährt Gott wunderbar mit mir, da mir seine Entfremdung lieber ist als er selbst.“ Dieser Gründungssatz christlicher Mystik bei Mechthild von Magdeburg bringt es wie im Portal zur Neuzeit auf den Punkt: Unbegreiflich bin ich nicht nur mir selbst gegenüber, sondern gerade im treuen freundschaftlichen Mitgehen und auch Ertragen des geliebten Freundes. Noch im tiefsten und fröhlichsten Verstehen ist der Abgrund der Differenz und des Andersseins, der freilich seinerseits auch die Lust der Freundschaft vertieft und einmalig erhöht. Das Leiden aneinander, das Ertragen der Fremdheit – es gehört dazu. Nicht zufällig hat sich Thomas Pröpper wie so viele von uns mit der sogenannten Theodizeefrage herumgeschlagen. Warum das Leid, die Gewalt, die Schuld, warum die Unbegreiflichkeit des lebendigen Gottes? Warum der Mensch so und diese Welt so? Aber nie ist Thomas in die Falle getappt, bei der Frage nach dem Bösen die andere Theodizeefrage zu vergessen: Warum das Gute, woher das Schöne?
„Nie aber zu vergessen, was er (Gott) getan hat, um sich verständlich zu machen und uns zu gewinnen. Der Erweis seiner Freundschaft, die alles vollbrachte – wie sollte auf sie nicht Verlass sein auf immer?“ Im Zentrum seiner Anthropologie, wie könnte es anders sein, steht das Geheimnis Jesu Christi – aber eben nicht isoliert, auch nicht kirchlich vereinnahmt und doktrinal verschlossen. Nein: Er steht im Zentrum als der Erstgeborene vieler Brüder und Schwestern. Was in ihm definitiv – Thomas prägte die Formulierung: „endgültig, aber vorläufig“ – schon geglückt ist, soll in jedem Menschen wahr werden: die Christusgestalt, das unterschiedene In-eins von Gott und Mensch. Denn der Freund aus Nazareth, der erwählende Auferstandene sagt im heutigen Osterevangelium: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ Das ist nie zu vergessen, diese Treue zu ihm. Zweimal fällt im Text von Thomas das Wort vom „gewinnen“. Die Jesus-Geschichte als ein einziger förmlich lustvoller Versuch des lebendigen Gottes, den Menschen zu gewinnen – eben nicht durch Zwang und Einschränkung, sondern in werbender Freiheit und durch gelebte Freundschaft bis zuletzt und in allem. „Wie sollte auf sie nicht Verlass sein auf immer?“ Rhetorisch ist diese Frage nicht, sie behält zwar etwas Beschwörendes. Denn Anfechtungen und Zweifel gehören zur Beziehungsgeschichte gerade auch des Glaubens. Aber aus ihr spricht dankbare Gewissheit trotz allem. „Erfüllte Zeit, da wir seiner gewiss sind. Und ein entschiedenes Einverständnis mit ihm, die Angst, den Schmerz und die Kosten der Freiheit, damit Liebe sein kann, zu übernehmen.“ Ja, mein Gott, wie sehr hatte Thomas in den letzten Jahren und erst recht in den letzten Monaten am eigenen Leibe noch zu spüren und zu bestehen, was er da geschrieben hat: die Angst und den Schmerz und die Kosten der Freiheit, damit Liebe sein kann, damit Gottesfreundschaft gelingt. Schmerzhaft wurde ihm seine Anthropologie auf den eigenen Leib geschrieben; mit beeindruckender Geduld stieg er hinab in den Abgrund der Inkarnation, in das göttliche Ja zum sterblichen Leben. Welche langen Tage und vor allem Nächte, um darauf mit der Würde eigener Zustimmung doch zu antworten, nicht zuletzt in der Sprache des Leidens. „Dieses teure Geschenk unserer Freiheit: erhöhend, gefährdet, beglückend – für uns doch ein Gewinn, doch auch für ihn.“ Ja, unfassbar der Gedanke: Der Deus semper maior et minor gewinnt auch durch uns, je mehr wir uns auf ihn einlassen und das werden, was wir sein dürfen: Menschen seiner Gnade, einmalig, unverwechselbar, in seiner Erwählung und mit der Würde eigener Zustimmung.
Das gesamte Denken und Leben von Thomas kreiste um dieses Geheimnis wechselseitig sich freigebender Freiheit, diese Beziehungsgeschichte zweier Freiheiten. Es ist auch lesbar als eine einzige Empfehlung und Ermutigung, endlich im Glauben erwachsen zu werden und aus den Kinderschuhen herauszutreten. Das Wirken von Thomas ist fast zeitgleich mit der bisherigen Wirkgeschichte und Wirkung des letzten Konzils, und nicht zufällig ist dessen mystischer Glutkern nichts anderes als das, was Thomas bedachte: die Gottesfreundschaft. So sagt es ausdrücklich die Offenbarungskonstitution Dei verbum. Nicht zufällig ist das Lebenswerk von Thomas verstehbar als ein wichtiger Beitrag, die Perspektiven des Konzils dialogisch ins Gespräch zu bringen mit dem Wahrheitsbewusstsein der Aufklärung und dem Kulturbewusstsein der Gegenwart. Das Denken von Thomas ist durch und durch kirchlich. Er sprach und schrieb nicht oft explizit von Kirche, zu brennend steht ihm das Geheimnis Gottes und des Menschen im Mittelpunkt. Aber Thomas wusste, was er dem Reichtum der Kirchen- und Glaubensgeschichte verdankte, er war seiner Heimatdiözese und seinem Weihekurs tief verbunden. Bisweilen, gerade in den letzten Wochen, kam auch der Stoßseufzer: „Die Paderborner könnten sich ja auch mal melden.“ Die oft schwierige Situation jener, die theologisch und priesterlich außerhalb ihrer Diözese tätig sind und in deren Normalbewusstsein kaum vorkommen, prägte und schmerzte auch ihn. Wie sehr hoffte und wünschte er, dass sein Denken bis in die Pastoral hinein auch wahrgenommen und umgesetzt würde. Sind wir doch gerade erst dabei, eine Kultur gelebter Gottesfreundschaft kirchlich zu entfalten und zu realisieren, zwischen Frauen und Männern, zwischen Laien und Priestern, überhaupt zwischen drinnen und draußen. Zu diesem geerdeten Denken und Leben von Thomas gehört natürlich fundamental seine Heimatverbundenheit. Nicht zufällig bestatten wir ihn heute in der Mutter Erde von Balve. Wie blühte er auf, wenn er uns Freunden sein geliebtes Sauerland zeigen konnte. Ich, ein Flüchtling durch und durch, habe es immer bewundert, wie genau Thomas, dieser verschämte Romantiker, wusste, wo er heimatlich herkommt und hingehört, trotz aller Welt- und Gottesreisen der Reflexion und des Eingedenkens und dank ihrer erst recht.
Aber auch dies sei dankbar und würdigend nicht vergessen: Im Kern war Thomas ein Künstler. Unvergessen, wie wir vor 48 Jahren in der Wiener Oper die „Zauberflöte“ hörten. In der Pause sprach er ganz begeistert, sagte dann aber: „Bei der Flöte stimmt der Ton nicht ganz.“ Er hatte das absolute Gehör, oft auch für Nichtmusikalisches. Er spielte sehr gut Geige, gab dies leider dann zugunsten der alles bestimmenden theologischen Reflexionsarbeit auf. Aber wie sehr hat er an der Musikalität seiner Texte gearbeitet, wie wichtig war ihm die Einheit von Gestalt und Gehalt, von Form und Inhalt! Nicht wenige Predigten und Aufsatzfragmente haben diese tiefe, oft mühsam erarbeitete Stimmigkeit und Musikalität. Thomas konnte großzügig schenken und war – der große Kreis der anwesenden Schülerinnen und Schüler bezeugt es – ein leidenschaftlicher Glaubenslehrer. Denken, Sprechen und Schreiben mussten genau sein, kein Schnörkel, kein Klischee und Jargon, geschliffen das Argument und präzise der Gedanke.
Was das Evangelium von Gottes Freundschaft in Jesus Christus sagt, ist an Thomas’ Leben sichtbar geworden und möge sich nun endgültig bewahrheiten: „Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“
Leitstern des Gottdenkens
Mt 11,25–30
Predigt von Klaus Müller beim Gedenkgottesdienst der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der Dominikanerkirche zu Münster
Die Stimme eines der ganz Großen in der Geschichte der Münsteraner Katholisch-Theologischen Fakultät und weit darüber hinaus ist verstummt. Am 10. Februar verstarb Thomas Pröpper, von 1988 bis 2001 Professor für Dogmatik und theologische Hermeneutik bei uns. Am 19. Februar wurde er in seinem Geburtsort Balve im Sauerland zu Grabe getragen. Die schwere Erkrankung, die ihn 2001 gut acht Tage vor seinem 60. Geburtstag und unmittelbar am Ende seines Dekanats niederwarf, zwang ihn, 2003 in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Was ihn daran am meisten schmerzte, waren nicht die körperlichen Unbilden, die er nun zu erdulden hatte. Weit mehr litt er daran, je länger je weniger an den theologischen Debatten teilnehmen zu können, die ausgerechnet zu jener Zeit begannen, sich um die Glutkerne seines eigenen Denkens herum zu entwickeln.
Mit so etwas hatte er eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Denn seit seinem Antritt 1988 in Münster war er so etwas wie ein Geheimtipp gewesen: wenig publiziert, kaum groß aufgetreten, nie medienwirksam in Szene gesetzt. Und doch hatte er von Anfang an junge Menschen durch sein so bohrendes wie behutsames Fragen, seine Bereitschaft zur Selbstkorrektur, die Prägnanz und Überzeugungskraft seiner Argumente in Bann gezogen. Jahr um Jahr wurde da mehr spürbar, dass da einer Ernst machte mit dem alten Programm des fides quaerens intellectum – also Zeugnis zu geben für einen Glauben, der sich nicht erspart, für die ihn beseelende Hoffnung Gründe aufzubieten, die auch auf dem Forum der kritischen Vernunft standhalten und die entsprechenden Zumutungen aushalten. Insofern war Thomas Pröpper ein 68er par excellence. Dass er damit kulturell gesehen eigentlich 20 Jahre zu spät kam, hat der Triftigkeit seiner Argumente keinen Abbruch getan (und katholisch wird ohnehin nicht so schnell gegessen wie gekocht, in diesem ältesten global player der Welt). Stattdessen hat er so der damals modisch werdenden Postmoderne, die sich so gern an der Verschiedenheit der Verschiedenheiten delektierte, schon früh gezeigt, wo der Hammer des genauen Denkens hängt.
Seine Art zu denken, differenziert und gerecht zu urteilen, mit Rücksicht auf die Eigenheit der anderen und immer im Habitus des Bescheidenen, der nichts für sich herausschinden will, das hat ihn nicht nur zum beliebten Kollegen, sondern während der Zeit seines zweijährigen Dekanats zum ruhenden und ausgleichenden Pol der Fakultät gemacht. Als dann sein Lehrstuhl als erster der Verfügungsmasse der damals laufenden Sparrunde der Hochschule zugeschlagen wurde, hat ihn das sehr getroffen. Denn dadurch wurde auch ein Loch in das systematische Profil der Fakultät gerissen, das durch die quälend langen Berufungsverfahren bei der Besetzung des einzigen verbliebenen Lehrstuhls für Dogmatik und Dogmengeschichte und jetzt erst recht durch die tragischerweise notwendig gewordene Frühpensionierung des jungen Dogmatik-Kollegen Andreas Müller ein nachgerade gefährliches Ausmaß angenommen hat. Thomas wusste um all das bis in seine letzten Tage im Detail. Und es hat ihn gequält und traurig gemacht.
In der Zeit nach dem Ende seines aktiven Dienstes haben wir manche Woche um ihn gebangt. Mehrmals war er dem Tod nahe. Trotzdem hat er sich nicht zurückgezogen und den Hypochonder gegeben. Im Gegenteil: Als ich selbst einmal Knall auf Fall ins Krankenhaus musste, stand er, selbst angeschlagen, wenige Stunden später an meinem Bett. Und als ich 2007 mit ihm den Ostersonntag in der Herzklinik von Oeynhausen verbrachte, wo er zur Reha war, da hab ich mit eigenen Augen und Ohren erlebt, wie er mit Humor und manchmal feiner Ironie, die meist Selbstironie war, das Pflegepersonal zum Schmunzeln brachte, obwohl seine eigene Erkrankung alles andere als zum Lachen war.
Vielleicht war es eben dieser feine selbstironische Zug, der ihn gerade als Dogmatiker zum Philosophen gemacht hat. Kein Zufall, dass einer seiner philosophischen Lieblinge, Sören Kierkegaard, in seiner Dissertation von 1841 in der zehnten These geschrieben hat: „X. Sokrates hat als Erster die Ironie eingeführt.“3
Ironie nimmt nichts zurück, verharmlost und relativiert auch nicht. Eher im Gegenteil: Sie gibt dem, worauf sie sich bezieht, noch eine besondere Note, eine „Spitze“, wie man so sagt. Wer das Seine ironisch vertritt, möchte doppelt treffen: natürlich die Sache, aber auch kritisch sein Gegenüber. Zugleich aber erhebt sie oder er dennoch nicht den Anspruch, mit der Stellungnahme die zu verhandelnde Angelegenheit wie den Disput kategorisch und definitiv erledigt zu haben. Ironie bringt die Kommunikationssituation und das, worauf sie sich bezieht, in Schwebe: Indem sie das Ihre mit einer Gewissheit vorbringt, die sich insofern bescheidet, als sie keinerlei kategorischen Geltungsanspruch mit sich führt, appelliert sie an die Freiheit (!) ihres Adressaten, sich doch noch einmal zu überlegen, ob sich die Sache wirklich so verhält, wie er oder sie behauptet. Die Appellation geschieht dabei nicht durch eigens dafür bestimmte Worte, sondern durch die Wirkung der ironischen Redeform. Gleichzeitig signalisiert, wer eine so eng mit der Freiheit verknüpfte Gewissheit bekundet, dass sie oder er sich unter Voraussetzung entsprechend triftiger Argumente durchaus eines Besseren belehren ließe. Das ist der sachliche Kern des sprichwörtlich gewordenen, aber übrigens wörtlich nicht zu belegenden sokratischen „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Im Original, der Apologie, sagt Sokrates über sich selbst im Vergleich zu einem, der als weise gilt und sich auch dafür hält: Dieser andere wisse zwar nichts, halte sich aber für wissend; er, Sokrates wisse genauso wenig, halte sich aber auch nicht für wissend, weshalb er doch ein wenig weiser als der andere sei4, was natürlich seinerseits einen Paradefall von Ironie darstellt.
So schützt Ironie vor dem Schein, schon der ganzen Wahrheit teilhaft geworden zu sein. Gleichzeitig bleibt allein so das Streben nach Wissen, die Liebe zur Weisheit überhaupt virulent. Hätte ich nichts mehr an Wahrheit zu gewinnen, weil ich ohnehin schon über alles verfüge, brauchte ich nach nichts mehr zu streben. Ironie ist tatsächlich so etwas wie die Grenzwacht gegen einen Totalitarismus von Geltungsansprüchen, ohne deshalb den Gedanken der Gewissheit als solchen abweisen zu müssen.
Eben dieser sein Wesenszug der gerade auch selbstbezüglichen Ironie war es nicht zuletzt, der Thomas und mich – ich darf das so persönlich sagen – bei allen Unterschieden niemals hat zu Gegnern werden lassen. Denn unbeschadet all des sehr Persönlichen, was ich soeben erzählt habe: Harmoniesüchtig waren Thomas und ich nie, wirklich nicht. Wir haben uns, immer fair, aber beinhart in der Sache, so manchen Schlagabtausch geliefert, meist bei Pasta und Pannacotta. Ich weiß noch gut: Unseren ersten Zoff hatten wir, als wir mit anderen Kollegen zur Partnerfakultät in Oppeln fuhren. Dort im Schloss Steins sind wir uns in die Haare geraten, ob es nach Fichte noch einen wirklichen philosophischen Fortschritt gegeben habe und ob man denn die analytische Sprachphilosophie wirklich brauche etc. Ich dafür, er dagegen, allenfalls den guten Hermann Krings hat er noch gelten lassen. Früh um drei sind wir dann aufs Zimmer geschlichen, keiner vom andern überzeugt. Aber selbstverständlich haben wir bei der Frühmesse nicht gefehlt.
Vermutlich lag das Verbindende hinter all diesen Sachkonflikten, das diese entschärfte, auch ja ganz woanders, jenseits von Theologie und Philosophie. Denn Thomas Pröpper frönte – und das wussten nur seine engen Freunde – zwei Leidenschaften: Musik und Literatur. In der Musik war ich der absolute Laie, obwohl ich gern in Konzerte gehe. Thomas war es in die Wiege gelegt. Sein Vater war ein Kirchenmusiker und Komponist des Formats, dass man ihm in seinem Heimatort Balve ein lebensgroßes Denkmal aufstellte. Die Mutter war dem nicht fern. Und Thomas’ Liebe zur Klassik entsprach, dass er selbst ein begnadeter Pianist war, ohne das je über einen engsten Kreis Vertrauter hinaus preiszugeben. Gefragt, was denn seine Favoriten in musicis seien, hat er geantwortet:
Das ist eine harte Frage, weil ich zu vieles zurücklassen müsste. In die engste Wahl kämen jedenfalls: von Bach die Goldberg-Variationen und die Motette „Jesu, meine Freude“; von Beethoven die späten Streichquartette; von Schubert die Klaviertrios oder die letzten Klaviersonaten (mit Alfred Brendel); von Schumann die Eichendorff-Lieder; von Bruckner die achte und von Mahler die fünfte Symphonie; dazu noch Orgelmusik von Olivier Messiaen und das Violinkonzert von Alban Berg.
Diese Auswahl erzählt gleichsam einen Roman von der Innenwelt dessen, der sie formuliert.
Und was die Literatur betrifft: In den Jahren seines Ruhestandes hat Thomas Pröpper das meiste an theologischer Fachpublikation beiseitegelassen und sich in das Abenteuer der Begegnung mit den Großen der Literatur des 19. Jahrhunderts gestürzt: die Russen, die Franzosen, die Deutschen sowieso, auch manch andere. Stundenlang haben wir uns da über Bücher unterhalten, bisweilen gestritten. Auch da hat Thomas ein paar Titel genannt, weil sie ihm das eigene theologische Nachdenken wesentlich vertiefen: so „Die Krankheit zum Tode“ von Kierkegaard; von Nietzsche „Zur Genealogie der Moral“; Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“; von Camus „Die Pest“ oder „Der Fall“ und von Simone Weil „Das Unglück und die Gottesliebe“. Manchmal hat er sich aber auch auf ganz andere Bahnen locken lassen, zu englischen, amerikanischen und osteuropäischen Autoren der Gegenwart. Im Blick auf sein Belletristik-Regal konnte man ahnen: Thomas Pröpper war zutiefst ein christlicher Existenzialist.
Und noch eines ist ihm in der Begegnung mit den Poeten zugewachsen: Es hat ihn zum Psychologen und Psychagogen im buchstäblichen Sinn werden lassen – zum Seelenkenner und Seelenführer. Jemand, der sich hineinzudenken und hineinzufühlen vermochte in die Abgründe menschlichen Daseins und eben darum fähig wurde, einer oder einem anderen in der Stunde dunkler Not ein Wort der Ermutigung und des Tröstens zuzusprechen. Nirgends anders war das mehr spürbar als in den Predigten, die er hier in der Dominikanerkirche gehalten hat. Bis zu seiner Erkrankung hat er insgesamt 62 Mal an diesem Ort Gottesdienst gefeiert und gepredigt. Seine homiletische Sternstunde war dabei immer der Karfreitag. Da haben ihm das Wort der Schrift und die liturgischen Gesten die – so seine sprichwörtlich gewordene Formulierung – unbedingt für den Menschen entschiedene Liebe Gottes auf eine Weise zugesprochen, dass er daraus den Mut fasste, sich unverlierbar in Gottes Hand gehalten zu wissen, also einem Ostermorgen entgegenzugehen – und das der anwesenden Gemeinde zu bezeugen.
Jetzt glauben wir Thomas Pröpper dort daheim, wovon er in seinen österlichen Predigten gesprochen hat. Und wir danken Gott, dass wir ihn so lange gehabt haben – als Lehrer und Forscher, als Priester und Freund und einfach als jemanden, der diejenigen, die ihm nahe waren, ermunterte, trotz mancher Stunde des Zweifels, der Not und der Dunkelheit an das Gute zu glauben.
In Hollywood gibt es den berühmten Walk of Fame, den Bürgersteig des Ruhmes, in den goldene Sterne für die überragenden Größen vor allem des Film-Business eingelassen sind. Gäbe es auf den Fluren unserer Fakultät etwas Vergleichbares, so gebührte Thomas Pröpper ein besonders glänzender Stern. Sein denkerisches Vermächtnis wird noch lange ausstrahlen. Wir werden ihn nicht vergessen.
Predigten, geistliche Gedanken und Gebete von Thomas Pröpper
Wir alle sind Geistliche
1 Kor 12,4–30
Was man gewöhnlich so Christsein, Glauben und Religion nennt, das ist für viele nur noch eine Wirklichkeit am Rand ihres Lebens – eine Anzahl traditioneller Meinungen, die man für den Notfall und für gewisse Rätsel des Daseins bereithält. Eine Reihe frommer Gewohnheiten, die irgendwie zu einem anständigen Menschen gehören und an bestimmten Stationen des Lebens immer noch zum Zweck der Verschönerung und Vertiefung in Anspruch genommen werden. Dass der Glaube eine Perspektive bedeutet, die bei wirklich relevanten Entscheidungen etwa ins Gewicht fällt, ein Geschenk sogar, durch das man sich bereichert und dann auch verpflichtet fühlt, das können nur noch wenige von sich behaupten. Und noch weniger, dass sie Verantwortung spürten für die Kirche, die ja eben dazu da ist, dass sie diesen Glauben gestaltet und ihn anderen bezeugt und vermittelt.
„Ich pflege“, so las ich einmal den Brief eines Mannes, der sich mit etwas Selbstironie, aber doch ganz offen und unverblümt darüber aussprach, „ich pflege meine Wohnung und meine geistige Inneneinrichtung etwas mit Religion zu parfümieren. So wie meine Frau ihre Abendgarderobe. Aber ein solcher Duft muss diskret sein, denn ich habe öfters die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich zu viel mit religiösen Dingen abgeben und gar auf den Gedanken kommen, darüber zu reden und andere mit ihren diesbezüglichen Entdeckungen zu beglücken, in Gesellschaft sehr unangenehm auffallen können. Und weil dies etwas ist, was ich um jeden Preis vermeiden möchte, werde ich mich zu derartigen Peinlichkeiten erst gar nicht hinreißen lassen. Religion ist eine berufliche Angelegenheit des Klerus, ich jedenfalls werde mich hüten, klerikale Allüren anzunehmen.“
Trotz der vielbeschworenen und inzwischen auch schon wieder angestaubten Rede vom Erwachen der sogenannten Laien und ihrer Mitverantwortung für die Kirche: Für den Großteil von ihnen ist die Kirche nach wie vor nur eine Art Konsumgesellschaft, in der theologische Profis bei bestimmten Gelegenheiten ihre religiösen Bedürfnisse erfüllen. Die Mehrzahl der Gläubigen begnügt sich mit der Rolle, Adressat der sogenannten Seelsorge zu sein, die besonders Beauftragte an ihnen üben. Geistliche nennen wir diese Leute manchmal noch und haben uns daran gewöhnt, damit bloß die Amtsträger zu meinen. Eine Auffassung, die zu tief sitzt, als dass sie in wenigen Jahren überwunden werden könnte. Jahrhundertelang ist sie ja eingeübt worden.
Das begann damit, dass zu Anfang des 4. Jahrhunderts durch die Entscheidung des Kaisers Konstantin das Christentum die maßgebliche Religion im Römischen Reich wurde und sich nun das Heidentum bedrängt und verfolgt sah. Da wurde es auf einmal nützlich, Christ zu sein, und in die Kirche, die bis dahin eine Kirche der Bekenner und Märtyrer gewesen war, strömten die heidnischen Massen nur so herein. Natürlich gab es viel lasche und gedankenlose Mitläufer darunter, sodass nun diejenigen, die in alter und strenger Weise ihren Glauben bekennen und verwirklichen wollten, sich von den Lauen trennten und sich selbst die Geistlichen nannten. Sie meinten es ernst mit ihrem Versuch, im Geist Christi zu leben, und der Titel, den sie sich zulegten, gewann hohes Ansehen und einen anspruchsvollen Klang. Oft wurden diese Geistlichen Mönche und gingen aus den üppigen Städten in die Kargheit der Wüste.
In immer mehr Fällen aber übernahmen sie auch das Amt des Gemeindeleiters, des Bischofs und des Priesters. Und so kam es, dass man schließlich nur noch die Amtsträger Geistliche nannte. Für die Stabilität und Ordnung der Kirche, das muss man sehen, hatte es natürlich enorme Vorteile, wenn der Heilige Geist so ausdrücklich und fast ausschließlich an die Amtsträger gebunden war. Denn es gab von Anfang an auch Gruppen, die ebenfalls nach Vollkommenheit strebten, sich dabei aber von der übrigen Kirche absonderten und den Anspruch erhoben, allein im Besitz des Geistes zu sein. Es waren nicht die Schlechtesten, voller Leidenschaft für eine Reform der fett gewordenen Kirche und begeistert für das Ideal einer heiligen Kirche, nur eben hatten sie bei diesem Ziel vor allem sich selbst im Auge. Eine Heiligung der Kirche ohne die vielen. Und sie vergaßen dabei, dass die Kirche eben nicht nur für die Vollkommenen, sondern auch die Fußlahmen und Mittelmäßigen da ist.
Hätte es bei den Konflikten, die darüber entbrannten, nicht das kirchliche Amt gegeben, das entschied, dass alle zur Kirche gehören sollten, und damit festhielt an ihrer sichtbaren Einheit, dann wäre diese Kirche längst hoffnungslos in tausend Gruppen und Grüppchen zersplittert, vielleicht schon in der Gemeinde von Korinth oder zur Zeit Augustins oder im hohen Mittelalter und auch noch später. Dies sollte man sehen und einräumen, bevor man dann zu Recht den unerträglichen Klerikalismus verurteilt. Denn auf der anderen Seite ist ja ebenso wenig zu leugnen, zu welchen Einseitigkeiten, ja Verzerrungen diese Entwicklung geführt hat: dass der Kleriker nämlich immer mehr als der eigentliche Christ galt, im Bewusstsein vieler sogar mit der Aura des Heiligen umgeben, abgehoben und Abstand gebietend. Dass er faktisch immer mehr Aufgaben an sich zog, auch solche, die ihm eigentlich gar nicht zukamen, und damit die Aktivität der anderen erstickte. Dass er eine sublime, höchst zweideutige Macht über fast alle Lebensbereiche ausübte, über das Innere und die Gewissen der Menschen und über das Äußere vom privaten, intimsten Bereich bis hin zur Politik. Dass er vielfach als sakrosankt und unangreifbar galt und man ihm unbesehen abnahm, was er von sich gab, zumal er lange der Einzige war, der im Glauben gebildet oder überhaupt gebildet war. Schuldig an dieser Klerikalisierung der Kirche sind freilich beide Seiten zu nennen, weil sie beide sich mit dieser Verteilung ganz gut arrangierten.
Der Priester mit den Vorteilen seiner Würde, die ihn für die Verantwortung und spezifischen Entbehrungen seines Standes belohnten. Der Gläubige mit der religiösen Untertanenrolle, in der er nur die gebotenen Christenpflichten zu erfüllen hatte und dabei nicht weiter zu überlegen und zu entscheiden brauchte – im Zweifelsfalle waren ja die Priester da, die ihm Sicherheit gaben und ihm sagten, wo es langgeht. Aber diese Zeiten, so heißt es seit langem, die sind ja nun endgültig vorbei. Die neuzeitliche Bewegung zur Mündigkeit habe schließlich, wenn auch mit der üblichen Verspätung, die Kirche erreicht und zum Selbstbewusstsein der Laien geführt. Oft genug waren es zwar wiederum nur die Priester, welche die Laien aktiv machen mussten, aber das war nicht überall so. Vor allem: Was sich an neuem Leben in den Kirchen Süd- und Westeuropas, Lateinamerikas und anderswo regte, gab neuen Mut, an das Wirken des Geistes in der Kirche zu glauben.
Bei uns in Deutschland sind freilich die vielfach abgesicherten Strukturen so fest, dass neues Leben nur zähflüssig in Gang kam. Nach dem Konzil war zwar auch hierzulande viel von pfingstlicher Erneuerung die Rede, es gab die Hoffnung stiftende Würzburger Synode. Aber die folgenden Jahre machten mit Ernüchterung deutlich, wie stark Amtsträger und Gemeinden an ihrer überkommenen Rolle hängen und sich eher von Vorsicht als von Zuversicht leiten lassen. Nicht wenige erwecken den Eindruck, dass ihnen der Status quo durchaus recht ist und dass sie vor allem seine Konsolidierung anstreben. Die restriktiven Tendenzen der kirchlichen Großwetterlage – nicht wenige auch unter den Laien begrüßen sie – fordern sie sogar. Andere dagegen leiden darunter, und viele, die sich als Mitarbeiter auf zahlreichen Feldern schon engagiert hatten, haben sich inzwischen wieder zurückgezogen, sehr oft resigniert, manchmal auch bitter.
Sicher hat ihnen zuweilen der lange Atem gefehlt, die nötige Geduld für einen realistischen Umgang mit einer so traditionsreichen Institution wie eben der Kirche. Und doch hatten sie nicht ganz unrecht, wenn sie sich in ihrem guten Willen oft ausgenützt fühlten, weil sie immer nur die Lücken stopfen und die Aufgaben erfüllen sollten, welche die Priester auch bei größtem Einsatz allein nicht mehr schafften. Ohne dass sie zugleich die Anerkennung und die Rechte erhielten, die mit solchen Aufgaben nun einmal verbunden sein müssen. Viele, die sich eingesetzt haben, sind enttäuscht, dass sie nicht wirklich mitreden dürfen und die wichtigen Entscheidungen ohne sie fallen. Lang ist die Liste derjenigen, die Theologie studiert haben, vergeblich auf eine kirchliche Beauftragung warten und sich nun unerwünscht fühlen. Und die Frauen sind zwar wie immer willkommen, wenn sie in der Caritas oder anderswo helfen, in zentralen Bereichen des kirchlichen Lebens jedoch müssen sie wie eh und je schweigen.
Es ist bedrückend, in welchem Maß die Kirche gerade ihre kritischen Geister verliert. Nicht etwa nur die nörgelnd Distanzierten, sondern eben auch die, die solidarisch zu ihr gehören wollten. Die lang schon schwelende Krise schwelt weiter, und wenn die Befürchtungen, zu denen sie Anlass gibt, nicht eintreffen sollen, dann müssen sich alle besinnen. Die sogenannten Laien, damit sie ihr kirchliches Selbstbewusstsein finden, es authentisch wahrnehmen und sich nicht entmutigen lassen. Und die Amtsträger, damit sie die gegebene Situation ernst nehmen, den tiefsitzenden, oft nur freundlich kaschierten Klerikalismus in sich selbst überwinden und erneut suchen und dann auch anerkennen, was der Geist heute wirkt und wirken will. Zugleich müssen beide Seiten das Umgehen immer neu miteinander lernen. Passagen aus dem ersten Korintherbrief könnten uns dafür, meine ich, ein paar Hinweise geben.
Erstens erfahren wir da: Wir alle sind Geistliche. Denn alle haben wir den Geist Christi empfangen, und zwar ursprünglich durch Christus selbst, den Herrn der Kirche. Und jeder hat ihn empfangen auf seine besondere Weise. Die muss er entdecken und dann persönlich realisieren. Wir müssen endlich von der Vorstellung abkommen, als sei der Christ ein Mensch, den man schon von weitem erkennt. Ewig fades Abziehbild, immer der gleiche Typ. Als bestehe unser Christsein darin, durch einen feststehenden Katalog gehalten zu sein, bestimmte Dinge zu tun und andere eben lassen zu müssen. Nein, die eigentliche Aufgabe besteht darin, dass wir herausbekommen, jeder für sich, was er positiv an seiner Stelle zu tun hat, was kein anderer für ihn tun kann und was gerade seine Begabung ausmacht. Dass wir aufhören, uns gängeln zu lassen und auf Anleitung zu warten, sondern selbst hinsehen, urteilen und dann handeln. Also Initiativen entwickeln und zur eigenen Verantwortung stehen. Dazu braucht es nicht die Erlaubnis von oben. Dazu braucht es allein den eigenen Entschluss.
Zweitens ist ein Missverständnis zu beseitigen, was die Geistesgaben selber angeht. Als könnte es sich dabei nur um sensationelle Dinge handeln, die sofort in die Augen springen. Ekstatisch reden, prophezeien, Heilungen bewirken, davon spricht Paulus oft. Das scheint in den ersten Gemeinden häufig gewesen zu sein. Aber er spricht auch von den gewöhnlichen Gaben, die mindestens ebenso notwendig sind. Von der Aufgabe zu lehren, zu raten, zu erziehen, von Pflege- und Krankendiensten, Verwaltungsarbeit, technischer Arbeit. Alles, so kann man sagen, was anderen tatsächlich hilft und aus der Bereitschaft des Glaubens geschieht, ist Gabe und Auftrag des Geistes. Also kann auch das gewöhnlichste Leben sein Wirken bezeugen. Durch unbeachtete Treue zu übernommenen Pflichten, alltägliche Wahrhaftigkeit, Großzügigkeit, unaufdringliche Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit trotz eigener Überarbeitung, Eintreten für Schwächere, für Fremde, Bemühen um Verständigung unter Zerstrittenen, taktvolle Zurechtweisung, Begleitung von Niedergedrückten, Aufmerksamkeit für verschwiegene Not. Das schließt auch heute hervorstechende Gnadengaben nicht aus. Weitschauende Initiative, eindrucksvolle Rede, exemplarisches Engagement, couragierter Protest gegen Unrecht und Lüge, beispielhafte Heiligkeit. Jeder muss sehen, was er tun kann, aber er muss es auch tun. Von der Größe der Gnadengabe hängt der Wert nicht ab. Über ihn entscheidet allein, wie der Einzelne sie verwirklicht, ob es nämlich in Liebe geschieht.
Damit ist nun drittens der Maßstab genannt. Grundsätzlich kann alles Gnadengabe sein, aber Paulus wird nicht müde einzuschärfen, die schönsten und großartigsten Begabungen nützten nichts, wenn sie nicht eingesetzt werden. Geben für andere, in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Denn niemand hat den Geist Christi für sich selbst empfangen, und auch die Gemeinde ist nicht nur um ihrer selbst willen da. Im Grunde gibt es nur eine Gabe des Geistes, die Liebe, die, etwas altmodisch ausgedrückt, zum Dienen bereit macht, konkreter: die uns die dauernde Besorgnis um uns selbst vergessen und auf andere uns einstellen lässt. Und dann die Energie zum Entschluss und zur realen Tat gibt. Zu einem Handeln, in dem ich selbst als ich selbst dabei bin und den anderen als ihn selbst meine.
Viertens wird die richtige Physiognomie der Kirche erkennbar, sie soll eben nicht ein Mammutgebilde aus lauter Schablonen sein, eine Herde von Schafen, die den Mund nur noch zum Amen aufmachen, vielmehr denkt sie sich Paulus als eine Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen, die alle ihr Besonderes zu tun haben, ohne deshalb schon zu meinen, etwas Besonderes zu sein. Die es nicht nötig haben, sich über den anderen zu erheben, an ihm sich zu stoßen, ihn zu beneiden oder gar zu verketzern. Die nicht bloß tolerant sind, sondern sich anerkennen können und freuen über das, was ein anderer einbringt und ihm gelingt. Über die zuverlässige Mitarbeit des einen ebenso wie die freimütige Kritik des anderen, auch wenn sie wehtut. Es ist immer ein Zeichen von Schwäche, wenn die Kirche und die Gemeinden damit beginnen, einen Kritiker ins Abseits zu drängen und die Sache dann eskalieren zu lassen, statt zunächst einmal auf seine berechtigte Sache zu achten. Nur in der Lebendigkeit ihrer Glieder gibt es die Kirche des Geistes. Und nur so kann sie ihren Aufgaben treu sein, die sie über sich noch hinausführen. Dabei ist auf die Bedeutung des Amtes keineswegs zu verzichten. Es ist ja ebenfalls eine besondere Gabe, eben die der Leitung. Und es gehört zu diesem Dienst, dass er in Beauftragung und mit Vollmacht geschieht. Damit sage ich nicht, dass über seine Gestaltung und Bedingungen, auch über seine Auffächerung nicht diskutiert werden könnte und müsste. Was sich geschichtlich herausgebildet hat, bleibt auch geschichtlich veränderbar. Aber wie auch immer in Zukunft das Leitungsamt aussehen mag, es steht unter dem Gesetz der Liebe wie alle anderen. Ohne sich einzubilden, er habe die Wahrheit gepachtet und sei Fachmann für alles, hat der Amtsträger die Aufgabe, zusammenzuführen, auszugleichen, zuzuhören, anzuregen, zu ermutigen und zu verbinden und so der Einheit zu dienen.
Das Bild von der Kirche als dem einen Leib, dessen Haupt Christus ist und dessen verschiedene Glieder durch den Geist lebendig gemacht und zusammengehalten werden, das ist schon sehr alt und vielleicht auch ein bisschen erbaulich. Wie weit es für die Kirche der Zukunft noch als Modell gelten kann, wäre im Einzelnen genau zu erörtern. Ein Missverständnis wäre jedenfalls die Deutung, als sei jedem seine Stelle von Natur aus schon bestimmt und damit ein für alle Mal festgelegt. Und noch auf einen weiteren Punkt wäre zu achten: Ein Leib, solange er gesund ist, funktioniert ja sozusagen von selber. In der Gemeinschaft jedoch geht nichts ohne die Freiheit. Erst wenn jeder Einzelne erkennt, was er den anderen verdankt, und gleichzeitig einsieht und konsequent danach handelt, dass die anderen auch ihn brauchen, erst dann kann Leben in die Kirche einziehen. Karl Rahner hat in seinem Alter öfter von einer winterlichen Kirche gesprochen, und manchmal überkommt mich der Eindruck, als befänden wir uns jetzt mittendrin. Ob und wann wieder ein neuer Frühling anbrechen wird – wer kann das sagen? Er wird sich weder von oben dekretieren lassen noch etwa kann eine Predigt wie diese ihn herbeireden. Sie kann allenfalls eine Aufforderung an jeden Einzelnen sein, auf das Drängen des Geistes in sich selber zu achten.
Die Seligpreisung der Armen und Weinenden
Lk 6,17.20–26
Die Worte, die wir eben im Evangelium gehört haben, sind uns von Kindheit an vertraut. Sie gehören zur Mitte der Verkündigung Jesu, überliefert von Matthäus und Lukas. Seligpreisungen gab es allerdings auch sonst in der antiken Literatur. Da werden Menschen glücklich gepriesen, denen eine tugendsame Frau, wohlgeratene Kinder, Erfolg und ein günstiges Geschick beschieden sind. Oder auch Verstorbene, die ihren Weg glücklich und angesehen vollendet haben. Der Unterschied zur Verkündigung Jesu springt sofort in die Augen, wenn wir auf die Angeredeten achten.
Die erste Seligpreisung nennt sie, und sie schließt alle Folgenden mit ein. „Wohl euch, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ Die Armen und Niedrigen sind es, ganz wörtlich verstanden, diejenigen also, die von der Welt nichts zu erwarten haben und deshalb vielleicht noch am ehesten bereit sind, etwas von Gott zu erwarten. Menschen jedenfalls, die entweder durch ihr Schicksal an den Rand gedrängt wurden oder sich auch ganz bewusst mit ihrer Hoffnung auf das Kommen der neuen Welt richten. Ebenso die Weinenden, für die niemand einen Trost hat. Die Hungernden, die Not und Benachteiligung erfahren und Unrecht, das Menschen nicht wiedergutmachen und vielleicht nicht einmal wiedergutmachen können – hungernd nach Brot und menschenwürdigem Leben und nach einer Gerechtigkeit, von der niemand mehr ausgeschlossen ist.
Matthäus nennt außerdem die Demütigen, denen man jede Achtung versagt oder die auch freiwillig kein weltliches Ansehen suchen. Die Aufrichtigen reinen Herzens, die sich auf die Verschlagenheit der Erfolgreichen nicht verstehen und deren raffinierte Spiele nicht mitmachen wollen, aber auch die Barmherzigen, die um ihr eigenes Recht nicht besorgt sind und das Nächstliegende tun: ihr Herz dem anderen öffnen. Dann die Friedensstifter, die den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt, von Hass, Verwundung und Rache durchbrechen und mit der Versöhnung anfangen. Und endlich bei Lukas und Matthäus die Verfolgten, die so unbeirrt waren in ihrer Zugehörigkeit zu Jesus und in ihrem Einsatz, dass sie nach Konflikten und Nachteilen nicht fragten. Sie also sind es, die selig genannt werden, weil Gott für sie einsteht. Aber dies nicht so, dass ihre Bedrängnis und Armut nun einfach Glück genannt wird, und auch nicht nur, weil Gott jenseits der Welt auf die wartet.
Jesu Wort vertröstet nicht auf ein besseres Jenseits, so wenig es die gegenwärtige Armut um ihrer selbst willen Seligkeit nennt. Heil euch, das heißt nicht: Ihr kommt in den Himmel, auch nicht ihr seid schon, wenn ihr es nur recht versteht, im Himmel, sondern: Zu euch, die ihr Gott braucht und auf ihn wartet, ist er schon unterwegs. Und dies sagt Jesus nicht nur, sondern er beginnt auch in seinem Wirken damit und tut, was er sagt. Darum ist Freudenzeit, und die Zeit der Trauer vorbei.
Eine frohe Botschaft also ganz ohne Frage – und trotzdem ein ziemlich unangenehmes Thema, vor dem man sich am liebsten drücken möchte. Können wir uns so ohne weiteres zu den Angesprochenen zählen? Müssen wir nicht eher rot werden, wenn wir die Seligpreisungen hören? Und wenn wir dann am Ende doch bloß wieder verlegen dastehen, sollte ich uns das nicht lieber von vornherein ersparen? Aber darf man das andererseits denn mit dem Evangelium machen? Einfach weglassen, was uns nicht passt? Ich meine, wir müssten wenigstens verstehen, was Jesus uns da gesagt hat. Deshalb bitte ich Sie, mit mir zu fragen, wen Jesus meinte, als er diese Worte sagte, wen Matthäus und Lukas meinten, die sie in ihr Evangelium schrieben – und wie es schließlich mit uns steht.