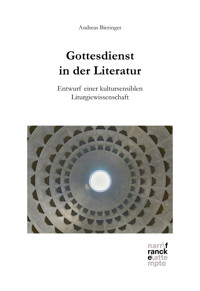
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Pietas Liturgica Studia
- Sprache: Deutsch
Liturgie und Leben driften immer weiter auseinander. Während die Bedeutung des Christentums massiv zurückgeht, sind Gottesdienste und kirchliche Rituale in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur äußerst präsent. Diese Konstellation greift A. Bieringer auf, indem er liturgischen Spuren bei P. Handke, H.-J. Ortheil, C. Ransmayr, A. Stadler, P. Morsbach und C. Lehnert nachgeht. Mit Hilfe poetischer Analysen legt er einen kultursensiblen Ansatz für die Liturgiewissenschaft vor, in dessen Mittelpunkt zentrale Begriffe wie Raum, Klang, Erfahrung, Körper und Wandlung stehen. Methodisch geht es um die Erschließung zeitgenössischer Literatur als Ort liturgiewissenschaftlicher Erkenntnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Bieringer
Gottesdienst in der Literatur
Entwurf einer kultursensiblen Liturgiewissenschaft
Umschlagabbildung: Kuppel des Pantheons (Santa Maria ad Martyres); Architas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
DOI: https://doi.org/10.24053/9783772057885
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1862-2704
ISBN 978-3-7720-8788-2 (Print)
ISBN 978-3-7720-0240-3 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Die vorliegende Studie wurde im Sommersemester 2022 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Paris Lodron Universität Salzburg als Habilitationsschrift angenommen. Für die Drucklegung wurde sie nochmals gründlich durchgesehen und teilweise ergänzt. Die Bearbeitung eines Habilitationsthemas abseits etablierter Themen erfordert neben etwas Mut und Durchhaltevermögen vor allem eine umsichtige Begleitung. Sie geht in meinem Fall vor allem auf zwei Personen zurück: Ich danke Alexander Zerfaß, Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der Universität Salzburg, der mir während des gesamten Arbeitsprozesses beratend zur Seite stand. Seine fachliche Expertise sowie seine zwischenmenschliche Umsicht waren mir stets Ansporn, die Arbeit trotz so mancher Schwierigkeiten zu einem guten Ende zu bringen. Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus dem Benediktinermönch und langjährigem Professor in Rom, Elmar Salmann OSB. Schon während meines Dissertationsstudiums weckte er mein Interesse für literarische Fragestellungen im Kontext der Liturgie. Von Anfang an begleitete er die Habilitation tatkräftig und teilte selbstlos sein reiches Wissen mit mir. Mehr noch als die inhaltlichen Gespräche prägte mich freilich sein origineller Stil, Glaube, Theologie und Leben fruchtbar aufeinander zu beziehen.
Für die Erstellung der drei Gutachten sei Rudolf Pacik (Universität Salzburg), Ansgar Franz (Universität Mainz) und Isabella Guanzini (Katholische Privatuniversität Linz) ebenfalls herzlich gedankt. Über die Aufnahme in die Reihe „Pietas Liturgica Studia“ freue ich mich und danke den beiden Herausgebern Ansgar Franz und Alexander Zerfaß.
Danken möchte ich ferner meinen alltäglichen Begleitern und Begleiterinnen, die mir während des gesamten Arbeitsprozesses eine große Stütze waren: Dieter Böhler SJ, Franz Xaver Brandmayr, Jakob Deibl OSB, Bernhard A. Eckerstorfer OSB, Hans-Jürgen Feulner, Leopold Fürst OSB, Erich Garhammer, Alexander Löffler SJ, Claudia Jurt-Steiger, Benjamin Leven, Andreas Liebl, Erwin Rauscher, Hans Weyringer und Ansgar Wucherpfennig SJ. Als Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen hielt mir Thomas Meckel während arbeitsintensiver Phasen stets den Rücken frei, sodass eine uneingeschränkte Arbeit an der Habilitation immer wieder möglich war. Für seine freundschaftliche Begleitung und zahlreiche Hilfestellungen sei ihm daher ganz besonders gedankt.
Zwischen Familie und Arbeitsplatz suchte ich immer wieder Orte auf, die mir ein konzentriertes Arbeiten ermöglichten. Den Verantwortlichen des Klosters Gerleve und der römischen Benediktinerhochschule Sant’Anselmo gilt für ihre großzügige Gastfreundschaft ebenso mein Dank.
Das Büchermachen ist eine eigene Kunst. Lisa Neubauer und Franz-Jakob Quirin gebührt mein Dank, da sie mit großer Sorgfalt und Verlässlichkeit den Band druckfertig machten. Dem Narr Francke Attempto Verlag, namentlich Herrn Stefan Selbmann, danke ich wiederum für die kompetente und reibungslose Zusammenarbeit bei der Drucklegung. Für die Gewährung großzügiger Druckkostenzuschüsse bin ich den (Erz-)Bistümern Salzburg, Limburg und Linz, sowie der Stiftung der Hochschule Sankt Georgen von Herzen dankbar.
Am Ende war es aber vor allem meine Frau Hanna, die mit ihrer Geduld und Unterstützung diese Arbeit ermöglichte. Ihr und unseren beiden Kindern Maximilian und Josefine ist dieses Buch gewidmet.
I Einleitung
1Antiliterarische Affekte
Jahrhundertelang hegte die Theologie Vorbehalte gegenüber profaner Literatur und dem Theater.1 Von der Spätantike bis ins frühe 20. Jahrhundert stand für viele Theologen und Kirchenvertreter die weltliche Dichtung im Widerspruch zur göttlichen Offenbarung und wurde daher nicht selten als „lügnerische Erfindung“ abgewertet. Die Liste theologischer Autoren mit „antiliterarischem Affekt“ ist lang und reicht von Cyprian und Augustin über die mittelalterlichen Päpste bis hin zu Martin Luther oder Jacques Bossuet, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.2 Paradoxerweise lehnten vor allem jene Theologen profane Literatur und das Theater ab, die selbst für ihr Schaffen auf literarische Formen zurückgriffen.3 Ein frühes Beispiel für die ablehnende Haltung sind die bis heute geläufigen Invektiven Tertullians († um 220). Trotz seiner rhetorischen Bildung bezeichnete der Kirchenlehrer das Theater als lasterhaftes „Heidenspektakel“ und „Götzendienst“.4 Für Tertullian war es ein Ausdruck des Teufels, dem jeder Christ in der Taufe abzuschwören hatte („diabolo et pompae et angelis eius renuntiare“).5
Von einem mittelalterlichen Beispiel berichtet der Germanist Meinolf Schuh-macher. Im Apokalypse-Kommentar des Rupert von Deutz (†1129/30) findet sich eine bis heute bekannte Fabel, die das schwierige Verhältnis von Theologie und Literatur anschaulich macht.6 An ihr lässt sich zeigen, warum die Theologie Dichtung lange Zeit ablehnte und welche Missverständnisse, ja Verwerfungen damit verbunden waren. Sie endet mit folgender Pointe:
Rana rupta et bos
Der zerplatzte Frosch und der Ochs
Inops, potentem dum vult imitari, perit.
In prato quondam rana conspexit bovem
Et tacta invidia tantae magnitudinis
Rugosam inflavit pellem: tum natos suos
Interrogavit, an bove esset latior.
Illi negarunt. Rursus intendit cutem
Maiore nisu et simili quaesivit modo,
Quis maior esset. Illi dixerunt bovem.
Novissime indignata, dum vult validius
Inflare sese, rupto iacuit corpore.7
Ein Armer, der dem Reichen nachahmt, geht zugrunde.
Auf einer Weide sah ein Frosch einst einen Ochsen,
Und, neidisch auf des Tieres majestät’sche Größe,
Bläht er die Haut. Darauf fragt er selbstbewußt die Kinder,
Ob er den Ochsen nicht an Größe überrage.
Doch jene sagten: „Nein!“ Er mühte sich wieder ab, Die Haut zu dehnen, und tut dann dieselbe Frage, Wer größer wäre. Jene nannten ihm das Rind.
Als er zuletzt in vollem Zorn noch versuchte,
Sich mehr aufzublähen, stürzt’ er mit zerplatztem Körper.8
Niemand soll etwas vortäuschen, was er in Wirklichkeit nicht ist, lautet die Pointe. Die Fabel mahnt zudem, mit dem eigenen Geschick zufrieden zu sein und warnt vor Neid und Habsucht. Doch warum taucht gerade diese Fabel in einem mittelalterlichen Apokalypse-Kommentar auf? Im 16. Kapitel der Offenbarung des Johannes ist von Fröschen die Rede: „Dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen.“ (Offb 16,13) Rupert erkennt in den Fröschen die weltlichen Dichter:
„[…] ‚die Dichter, die Großes zu verkünden meinen, deren Erzählgegenstände aber aus bloßem Dreck bestehen und deren Größe nichts anderes als Aufgeblasenheit ist.‘ Auf sie passe jenes ‚Fabelchen Äsops‘ von einem, der sich zur Größe eines Ochsen aufblasen wollte, statt dessen [sic!] aber zerplatzt.“9
Am Ende seines Kommentars fragt Rupert, wo sich die Dichter nun befänden, um sogleich mit einem Psalmenzitat zu antworten: „Periit memoria eorum cum sonitu, et Dominus eorum in aeternum permanet“ (Ps 9,7–8). Damit lässt er seinen Lesern bzw. Leserinnen keinen Zweifel, welchem Schicksal die Poeten anheimfallen.
SchumacherSchumacher, Meinolf weist in seinem Beitrag nach, dass Rupert bereits auf eine lange Tradition theologischer Froschdeutungen zurückgreifen konnte. Schon Origenes verband Platons Topos der lügenden Dichter mit dem Bild der aufgeblasenen und quakenden Frösche.10 Zunächst verwundert die Heftigkeit, mit der Rupert in seinem Apokalypse-Kommentar gegen die weltlichen Dichter vorging, zumal es zu seinen Lebzeiten kaum weltliche Literatur gab, die man auf diese Weise hätte bekämpfen müssen. Hinter den Attacken wird Kritik an der christlichen Lesart („interpretatio christiana“) heidnischer Klassiker wie Homer, Ovid, Horaz oder Vergil vermutet. Für Rupert ging von der Dichtung eine Gefahr für das Seelenheil aus, wenn er die poetischen Erfindungen als geschwätzige Lügen abqualifizierte und sie zur Sünde erklärte. Dichter wurden mit solchen und ähnlichen Vergleichen in die Nähe von Schwätzern und Heuchlern gerückt, wenn nicht gar von Ketzern. Es erstaunt aber auch, dass Rupert für sein vernichtendes Urteil ausgerechnet auf ein Stück weltliche Literatur zurückgriff. Schumacher mutmaßt, dass er die Dichter mit ihren eigenen Waffen schlagen wollte, indem er ihnen den Spiegel vorhielt.11 Rupert verfügte über kein Verständnis von „literarischer Fiktionalität“ und setzte Fiktion (im Sinn einer poetischen „Erfindung“) mit Lüge gleich, eine christliche Hermeneutik profaner Dichtung lehnte er ab.12 Spätestens seit Jean Leclercq wissen wir jedoch, dass es im Mittelalter sehr wohl Theologen gab, die es trotz der erwähnten Vorbehalte wagten, das poetische Erbe der Antike für die christliche Verkündigung nutzbar zu machen und damit der weltlichen Literatur einen Eigenwert zumaßen.13
Auch wenn die Konkurrenz zwischen weltlicher Literatur und Offenbarung, wie sie bei Rupert offen zu Tage trat, mittlerweile obsolet geworden ist, gibt es auch in der zeitgenössischen Theologie Vorbehalte gegenüber profaner Literatur als theologischer Quelle.14 Die Kritiker und Kritikerinnen mahnen an, dass trotz der vorhandenen Schnittmengen die Grenzen zwischen Fiktionalität und Offenbarung nicht unscharf werden dürfen. Ein rein poetisch konstruierter Gott oder ein fiktional gestalteter Christus würden im Nichts verlaufen. Bei aller historischen Engstirnigkeit, die mit den oben angedeuteten Einwänden gegen die profane Dichtung einherging, wollten schon die mittelalterlichen Theologen auf diese Differenz aufmerksam machen. Auf diesem Hintergrund will diese Untersuchung einen Beitrag zur theologischen bzw. liturgiewissenschaftlichen Lesbarkeit von moderner Literatur leisten.15 Sie ist bemüht, die Grenzen beider Größen zu respektieren und simplen Vereinnahmungen aus dem Weg zu gehen, auch wenn das Verhältnis von Theologie und Literatur bis heute komplex ist: Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass Religion und Literatur nicht mehr als zwei getrennte Größen wahrgenommen werden und Grenzen sich verschieben:
„Literatur und Religion – das meint weder, dass es sich hier um zwei distinkte Bereiche handelt, die nebeneinanderstehen und sich gegenseitig ‚beeinflussen‘, noch geht es (ausschließlich) um Religion in der Literatur, also um Religion als Thema oder Kontext von Literatur, noch um den ‚Beitrag‘ der Literatur(-wissenschaft). Vielmehr muss die enge Verflochtenheit und Durchdringung von Literatur und Religion deutlich werden.“16
Den hier genannten Anforderungen im Austausch von Literatur und Religion gerecht zu werden, ist im Rahmen einer liturgiewissenschaftlichen Untersuchung kein leichtes Unterfangen, zumal die Liturgik noch kein spezifisches Instrumentarium entwickelt hat, wie sie mit den mannigfachen liturgischen Spuren in der Gegenwartsliteratur umgehen soll bzw. will. Die Arbeit muss daher zuerst aufzuzeigen, wo und in welchem Kontext liturgische Spuren in der deutschsprachigen Literatur sichtbar werden und welche Konsequenzen daraus für das Fach folgen. Trotz dieser Unsicherheit will sie sich auf die „enge Verflochtenheit und Durchdringung“ von Ritual und Literatur einlassen, indem sie die Schnittmengen zur Sprache bringt.
2Literarische Wende am Zweiten Vatikanischen Konzil
Im 20. Jahrhundert änderte die katholische Theologie ihre Position gegenüber der profanen Literatur. Wesentliche Impulse für die neue Standortbestimmung gingen zunächst von Romano GuardiniGuardini, Romano (1885–1968) und Hans-Urs von BalthasarBalthasar, Hans Urs von (1905–1988) aus.1 Auch wenn ihr literarisch inspiriertes Werk mittlerweile als überholt gilt, ist ihr Beitrag rückblickend dennoch zu würdigen.2 So sehr sich ihr Zugriff auf Literatur auch unterschied, inhaltlich verband sie das Anliegen, die katholische Theologie nach der langen Periode der Neuscholastik in die Moderne zu führen. In der weltlichen Literatur fanden sie jene unverfälschte Sprache und prophetische Haltung, die sie bei ihren Zeitgenossen vergeblich suchten.
Der endgültige Durchbruch im Verhältnis von Theologie und Literatur wurde erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) vollzogen. Die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ sprach den modernen Künsten nicht nur Autonomie zu, sie betonte zugleich ihren Erkenntniswert für die Theologie. Wenn der Eindruck nicht täuscht, wurde Artikel 62, der den etwas irreführenden Titel „Das rechte Verhältnis der menschlichen und mitmenschlichen Kultur zur christlichen Bildung“ trägt, bisher für den Dialog zwischen Liturgiewissenschaft und Gegenwartsliteratur noch kaum rezipiert.3
Suo quoque modo litterae et artes pro vita Ecclesiae magni sunt momenti.
Indolem enim propriam hominis, eius problemata eiusque experientiam in conatu ad seipsum mundumque cognoscendum et perficiendum ediscere contendunt; situationem eius in historia et in universo mundo detegere necnon miserias et gaudia, necessitates et vires hominum illustrare atque sortem hominis meliorem adumbrare satagunt. Ita vitam humanam, multiplicibus formis secundum tempora et regiones expressam, elevare valent.
Auf ihre Weise sind auch Literatur und Kunst für das Leben der Kirche von großer Bedeutung.
Denn sie bemühen sich um das Verständnis des eigentümlichen Wesens des Menschen, seiner Probleme und seiner Erfahrungen bei dem Versuch, sich selbst und die Welt zu erkennen und zu vollenden; sie gehen darauf aus, die Situation des Menschen in Geschichte und Universum zu erhellen, sein Elend und seine Freude, seine Not und seine Kraft zu schildern und ein besseres Los des Menschen vorausahnen zu lassen. So dienen sie der Erhebung des Menschen in seinem Leben in vielfältigen Formen je nach Zeit und Land, das sie darstellen. (GS 62)
Die sonst oft spröde klingende Konzilsprosa wird an dieser Stelle durch einen gefälligeren Ton unterbrochen, der sich am Auftakt der Pastoralkonstitution orientiert.4 Kunst und Literatur kommt eine „pastorale Autorität“ zu, weil sich in ihr „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute“ (vgl. GS 1) ausdrücken.5 Solche Formulierungen wären noch wenige Jahre vor dem Konzil undenkbar gewesen, wenn man bedenkt, dass unzählige Werke der sog. „schönen Literatur“ bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil auf dem sog. Index Librorum Prohibitorum landeten.6 Der Text appelliert nicht nur, alte Konflikte zurückzulassen, sondern aktiv Kontakt mit zeitgenössischen Kunstformen zu suchen.7 Zu lange hat sich die Kirche in eine selbst gewählte „Isolation“ begeben und sich von der weltlichen Kultur abgeschottet. Wiederständiges und Anstößiges in der Kunst, so lässt sich Artikel 62 weiter interpretieren, soll den Austausch der beiden Größen nicht mehr blockieren, sondern als Herausforderung gesehen werden. „Es ist keine immer einfache Angelegenheit, sich auf ein Außen einzulassen, aber ohne den Mut zu dieser Begegnung wird das, was Kirche sagt, belanglos und bleibt hinter dem zurück, was sie von der Substanz ihrer Botschaft her zu sagen hätte.“8 Mit diesem Blick „ad extra“ werden die Weichen neu gestellt, um auf „die Welt von heute“ zu hören, sie im Licht des Evangeliums zu deuten und ihre Botschaft in eine moderne Sprache zu fassen.9 Die weltliche Literatur wird damit endgültig aus dem Käfig der „ancilla theologiae“ befreit und zur autonomen Vermittlungsinstanz zwischen heutiger Welt und Kirche erhoben. Das hermeneutische Interesse der Pastoralkonstitution beschränkt sich nicht bloß auf die christliche oder europäische Literatur, mit dem Verweis auf die Kunst „der verschiedenen Völker und Länder“ soll ebenso der folgenschwere Eurozentrismus durchbrochen werden.
Darüber hinaus schlägt Artikel 62 eine Brücke zur Liturgie. Der dort erhobene Appell, moderne Kunst in den heiligen Raum (in sanctuario) der Liturgie aufzunehmen, ist zu diesem Zeitpunkt innovativ. In einer Fußnote zum Artikel findet sich jedoch ein nicht unproblematischer Verweis auf die Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium“.10 Die zu Beginn des Konzils verabschiedete Liturgiekonstitution (04.12.1963) kannte im Unterschied zur späteren Pastoralkonstitution (07.12.1965) noch kein „partnerschaftliches“ Verhältnis von Kirche und Kunst. Albert GerhardsGerhards, Albert zählt Kapitel VII (Art. 122–130), das den bezeichnenden Titel „Die sakrale Kunst. Liturgisches Gerät und Gewand“ trägt, zu den „problematischsten der Konstitution“11, weil den Künsten dort nur dann Freiheit zugestanden wird, wenn sie sich in den Dienst der Liturgie stellen. Doch auch für den Bereich der Liturgie muss gelten, was „Gaudium et spes“ über das Verhältnis zwischen Kirche und Kunst festgelegt hat. Der Dialog muss auf Augenhöhe geführt werden und auf einem partnerschaftlichen Verhältnis beruhen. Nur so kann die Kunst die existentiellen Erfahrungen der Menschen für die Kirche sichtbar machen und zugleich ihre kritische Funktion ausüben.12 Im Unterschied zur Pastoralkonstitution wird die profane Literatur in „Sacrosanctum Concilium“ mit keinem Wort erwähnt. Es gehört zu den Zielsetzungen der Arbeit, das einseitige Kunstverständnis der Liturgiekonstitution zu überwinden, indem sie sich den Auftrag der Pastoralkonstitution zu eigen macht (vgl. GS 62) und die zeitgenössische Literatur als Gesprächspartnerin für Liturgiewissenschaft gewinnt. Dieses Anliegen scheint berechtigt, da in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein ausgeprägtes Interesse für liturgische Formeln und Feiern besteht, das bis dato in der Liturgiewissenschaft noch kaum Widerhall findet.13 Wenn hier wiederholt von den Schnittmengen zwischen Liturgie und Literatur gesprochen wird, ist damit aber nicht gemeint, weltliche Literatur unmittelbar in den Gottesdienst zu integrieren, wie dies etwa in sog. Literaturgottesdiensten geschieht.14 Es wird vielmehr untersucht, wie liturgische und rituelle Spuren in der Literatur auf den gefeierten Gottesdienst zurückwirken könnten. Damit ist eine wichtige Hypothese dieser Schrift formuliert, da sie davon ausgeht, dass die in und mit der Literatur gemachten Erfahrungen ein neues Licht auf den Gottesdienst werfen.
3Liturgiewissenschaft und Literatur – Zum Stand der Forschung
3.1Balthasar Fischer
Es ist bereits angeklungen, dass sich die nachkonziliare Liturgiewissenschaft in den letzten Jahrzehnten kaum mit zeitgenössischer Literatur beschäftigt hat.1 Dies trifft grosso modo sowohl auf die katholische als auch auf die evangelische Liturgik zu. Auf katholischer Seite ist als eine der wenigen Ausnahmen ein beachtenswerter Beitrag des ehemaligen Trierer Liturgiewissenschaftlers Balthasar FischerFischer, Balthasar (1912–2001) zu nennen, der sich 1969 mit Gottfried BennsBenn, Gottfried (1886–1956) berühmtem Gedicht „Verlorenes Ich“ (1943) auseinandersetzte.2 Wie ungewöhnlich der Rückgriff eines renommierten Liturgikers auf eine poetische Quelle war, geht bereits aus der Einleitung des Beitrags hervor, den FischerFischer, Balthasar anlässlich des 80. Geburtstags von Josef Andreas JungmannJungmann, Josef A. (1889–1975) im Liturgischen Jahrbuch veröffentlichte: „Es muß auf den ersten Blick einigermaßen verwegen erscheinen, im modernen Gedicht nach einem so tief in der Herzmitte des Glaubens gelegenen Thema wie der Eucharistie suchen zu wollen […].“3 FischerFischer, Balthasar ist sichtlich erstaunt, dass ein von den Wirren des 20. Jahrhunderts so gezeichneter Dichter wie Benn, über den Otto Söhngen auf der Beerdigung sagte, dass ihm „das Geschenk des Glaubens versagt geblieben ist“4, das Mysterium der Eucharistie in einem modernen Gedicht so treffend in Worte fassen konnte. Benn ist in literaturtheologischen Diskursen vor allem wegen seines legendären Diktums von Gott als „schlechte[m] Stilprinzip“5 präsent. Den existentiellen Fragen nach Leben und Glauben ging er in seinen Gedichten und Essays dennoch nicht aus dem Weg. In einem Brief an seine Tochter Nele schrieb er: „Für mich ist das Diesseits und das Jenseits dasselbe. Ich glaube nicht an das Jüngste Gericht, nicht an Vergebung und Strafe. Glaube ich also nicht an Gott? Das möchte ich bestreiten.“6 Wenn der Eindruck nicht täuscht, steht BennsBenn, Gottfried Umgang mit der Religion exemplarisch für eine ganze Generation von Autorinnen und Autoren der späten Moderne, die sich zwar aufgrund der historischen Ereignisse im 20. Jahrhundert oder biographischer Verstrickungen nicht mehr zur offiziellen Religion bekennen wollten bzw. konnten, das Christentum als wichtige Bezugsgröße in ihren Werken aber präsent hielten.
„Verlorenes Ich
Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären,Opfer des Ion −: Gamma-Strahlen-Lamm −,Teilchen und Feld −: Unendlichkeitschimärenauf deinem grauen Stein von Notre-Dame.
Die Tage gehn dir ohne Nacht und Morgen,die Jahre halten ohne Schnee und Fruchtbedrohend das Unendliche verborgen −,die Welt als Flucht.
Wo endest du, wo lagerst du, wo breitensich deine Sphären an −, Verlust, Gewinn −:ein Spiel von Bestien: Ewigkeiten,an ihren Gittern fliehst du hin.
Der Bestienblick: die Sterne als Kaldaunen,der Dschungeltod als Seins- und Schöpfungsgrund,Mensch, Völkerschlachten, Katalaunenhinab den Bestienschlund.
Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeitenund was die Menschheit wob und wog,Funktion nur von Unendlichkeiten −,die Mythe log.
Woher, wohin – nicht Nacht, nicht Morgen,kein Evoë, kein Requiem,du möchtest dir ein Stichwort borgen −,allein bei wem?
Ach, als sich alle einer Mitte neigtenund auch die Denker nur den Gott gedacht,sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten,wenn aus dem Kelch das Blut sie rein gemacht,
und alle rannen aus der einen Wunde,brachen das Brot, das jeglicher genoß −o ferne zwingende erfüllte Stunde,die einst auch das verlorne Ich umschloß.“7
Die beiden eucharistisch imprägnierten Schlussstrophen von BennsBenn, Gottfried Gedicht „Verlorenes Ich“ geben bis heute Anlass zur Spekulation. Balthasar FischerFischer, Balthasar vertritt in seiner liturgisch gefärbten Analyse eine „klassische“ Lesart, nach der eine klare Dichotomie zwischen den ersten sechs Strophen und den beiden Schlussstrophen besteht. Der erste Teil des Gedichts spricht in eindringlichen Bildern und Metaphern vom existentiellen Orientierungsverlust und Entfremdungserfahrungen in der Moderne, die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs verfasst wurden. In einer von Technik, Naturwissenschaft und Ökonomie geprägten Welt ist das „Ich“ verloren gegangen. Der Fortschritt führte zwangsweise auch zur Auflösung der Religion (Strophe 1–6). Der zweite Teil des Gedichts, der im Kontext dieser Einleitung relevant ist, spricht dagegen von einem untergegangenen christlichen Zeitalter, in dem das „Ich“ noch ganz bei sich war, weil sich die Menschen um eine intakte „Mitte“ versammeln konnten (Strophen 7–8). Die beide letzten Strophen beschwören die Einheit der christlichen Welt, die sich in der gemeinsamen Feier des Abendmahls ausdrückt. Fischer interpretiert sie als „wehmutsvolle[n] Rückblick [BennsBenn, Gottfried] auf unwiederbringbar Verlorenes“8.
Seit den späten sechziger Jahren hat sich der Blick auf BennsBenn, Gottfried Gedicht mehrfach verändert. Mittlerweile kann man von drei voneinander abweichenden Lesarten des Gedichts sprechen, die exemplarisch an den Beginn dieser Arbeit gestellt werden, da sie in wenigen Absätzen umreißen, wie heute häufig mit religiösen und damit auch liturgischen Spuren in der Gegenwartsliteratur verfahren wird.9 Der klassische Zugriff auf „Verlorenes Ich“ wurde unter Berufung auf Fischers Analyse bereits vorgestellt. Er geht davon aus, dass sich die untergegangene religiöse und die „moderne“ Welt stumm gegenüberstehen. Während das „Ich“ in früheren Zeiten aufgrund der sinn- und einheitsstiftenden Religion noch intakt war, ging es im Laufe der Geschichte unwiederbringlich verloren. Mit Hilfe einer verklärenden Nostalgie sind die Leser und Leserinnen zwar in der Lage, auf die vergangene Zeit zurückzublicken, ihre versunkene Wirklichkeit lässt sich jedoch nicht mehr ins Heute hinüberretten. Jeder Versuch, die Religion auf diese Weise für Zeitgenossen und Zeitgenossinnen fruchtbar zu machen, kommt einer Refundamentalisierung gleich, die weder der Gegenwart noch der Vergangenheit gerecht wird.
Die beiden Schlussverse des Gedichts („O ferne zwingende erfüllte Stunde, / die einst auch das verlorene Ich umschloß“) bringen die „traditionelle“ Deutung jedoch ins Wanken, weil sie glaubhaft suggerieren, dass bereits das frühere „Ich“ den Verlust des eigenen Selbst hinnehmen musste. Während Fischer und viele andere diese Verse noch kommentarlos übergingen, gaben sie in späteren Analysen Anlass für eine zweite, „ironische“ Lesart des Gedichts, die jede religiöse Vereinnahmung zurückweist. Die Dichotomie zwischen alter und neuer, moderner und religiöser Welt wird bei dieser Deutung ironisch aufgelöst. Das poetisch gedeutete Bild der Eucharistie, das bei der traditionellen Auslegung noch für ein ganzheitliches Weltbild stand, kehrt sich ins Gegenteil: Die christliche Welt taugt nicht als Ideal, da schon früher das „Ich“ verloren war, wie die ausdrückliche Anspielung in den letzten Versen auf das verlorene „Ich“ klarmacht. Sind modernes und religiöses „Ich“ nun doch identisch? Das Gedicht scheint mit dieser Lesart jede Hoffnung auf Erlösung zu negieren – selbst die Utopie auf eine sinnstiftende Welt wird ironisch begraben. Bereits das christliche „Ich“ stellt in dieser Lesart keinen Widerhall des Göttlichen mehr dar, da es immer schon verloren war. Die Anliegen einer solchen Ironisierung und Bloßstellung des Religiösen sind in diesem Kontext nicht unbegründet, ihre Schwäche liegt aber in der Verkürzung des Gedichts auf eine einseitige Kritik an der nostalgischen Verklärung der Religion. Sie nimmt nicht mehr wahr, dass der Grundtenor des Textes von einer authentischen Verlusterfahrung und einer existentiellen Entfremdung in der Moderne geprägt ist.
Der in den USA lehrende Germanist und Philosoph Mark W. RocheRoche, Mark W. schlägt daher einen „dritten“ Weg vor, BennsBenn, Gottfried berühmtes Gedicht zu deuten, dem ebenso ein exemplarischer Charakter für diese Untersuchung zukommt: Roche nennt ihn die „transzendente“ Lesart. Damit meint der Literaturwissenschaftler nicht, dass das Gedicht eine „wörtliche Darstellung“ einer religiösen Wahrheit sei. Er beharrt aber darauf, dass es insgesamt eine „höhere Wahrheit“ beschwört:
„Es tut dies zu Beginn, indem es den Verlust dieser Wahrheit negiert, d. h. indem es das Funktionale, Profane und Bestialische kritisiert, das durch den Verlust einer höheren Transzendenz und Orientierung in die Welt gekommen ist. Darüber hinaus verweist das Gedicht auch durch seine Form und die Beschwörung von Transzendenz (unabhängig vom spezifischen christlichen Mythos) auf eine höhere Wahrheit. BennBenn, Gottfried nimmt zentrale Aspekte des christlichen Weltbildes auf: die Kritik an der Moderne wie auch die Beschwörung eines höheren Sinns, wenngleich er diesen höheren Daseinszweck nicht in der Religion, sondern in seiner dichterischen Sinnstiftung sehen würde.“10
RocheRoche, Mark W. verwirft damit den „traditionellen“ Zugang nicht, mahnt aber unter Bezugnahme auf die letzten beiden Verse des Gedichts an, dass religiöse Nostalgie zum Scheitern verurteilt ist, da auch im christlichen Zeitalter das „Ich“ Anfeindungen ausgesetzt war, die in bestimmten Situationen sogar bis zum Verlust des Selbst führen konnten. Das Christentum ist von seiner Grundidee her keine lebensferne Utopie, in der jede Mühsal und alle Schwierigkeiten ausgetilgt werden müssten; es will vielmehr einen realistischen Blick auf Leben der Menschen werfen, in dem auch Anfeindungen und Schwierigkeiten ihren Platz haben. BennBenn, Gottfried spielt in den letzten beiden Strophen geschickt mit der Mehrdeutigkeit des verlorenen „Ich“: Zunächst deutet er an, dass das christliche „Ich“ ebenso angefochten ist wie das moderne, auch wenn ersteres in der Religion noch Geborgenheit und Gemeinschaft findet. Zugleich stellt Benn eine direkte Verbindung zu Leiden und Sterben Christi her, da auch Jesus am Kreuz Ohnmacht und Hilflosigkeit erfuhr („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Mt. 27,46 parr). Die Mehrdeutigkeit der letzten beiden Strophen bezieht sich aber auch auf die Botschaft Jesu an sich, die in Vergessenheit geraten ist und unter deren Verlust wir heute wie damals leiden.
Balthasar FischerFischer, Balthasars liturgisch motivierte Gedichtanalyse stellt in seinem Œuvre eine einmalige Ausnahme dar. Er deutete darin weder eine spezifische Methode an, wie literarische Zeugnisse für die Liturgiewissenschaft erschlossen werden könnten, noch hat er seine Überlegungen in späteren Abhandlungen fortgeführt. BennsBenn, Gottfried Gedicht diente ihm vielmehr als unerwarteter Augenöffner, wieviel liturgische Erschließungskraft in einem Gedicht „unseres Jahrhunderts“ steckt.11 Als bloße Illustrationsfolie eines liturgiewissenschaftlichen Sachverhalts kann sein Beitrag aber dennoch nicht abgetan werden. Fischer erkennt die Qualität des Gedichts, da es auf außergewöhnliche Weise das Mysterium der Eucharistie in zeitgemäße Worte fasst. Den Inhalt liest er als Kritik an den herkömmlichen Methoden der Liturgiewissenschaft, die existentielle Befindlichkeiten der Zeitgenossen bzw. Zeitgenossinnen zu selten in ihre Überlegungen miteinbezieht. Vielleicht klingt hier sogar die vier Jahre vor der Gedichtinterpretation verabschiedete Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (1965) nach, die einen Dialog mit der Literatur einforderte, da sich in ihr das Wesen heutiger Menschen mit ihren Höhen wie Tiefen spiegelt (vgl. GS 62). FischersFischer, Balthasar „traditionelle“ Lesart führt uns aber noch einen Schritt weiter: Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist dann erreicht, wenn sie einen Beitrag zur „transzendenten“ Lesart moderner Literatur leistet, wie RocheRoche, Mark W. sie für das Gedicht „Verlorenes Ich“ vorschlägt. Auf der Suche nach liturgischen Spuren in der Gegenwartsliteratur tappt man schnell in die Falle der nostalgischen Verklärung, da viele der Autorinnen und Autoren liturgische Erfahrungen ihrer Kindheit literarisch verarbeiten. Aus der Mehrdeutigkeit liturgisch inspirierter Texte wird so schnell eine zweifelhafte Eindeutigkeit, die zwar zu den Überlegungen des Theologen passt, der Literatur aber nicht gerecht wird. Die Gefahr der „traditionellen“ Lesart besteht in der Wiederholung oder gar Verklärung liturgischer Erfahrungen ohne Bezug zu aktuellen Herausforderungen. Umgekehrt ist aber auch die ironische oder gar zynische Brechung religiöser Spuren und Bekenntnisse in der Gegenwartsliteratur eine Versuchung, der sowohl die Literaturwissenschaft als auch Theologie erliegen.
3.2Peter Cornehl
Auf evangelischer Seite bemüht sich vor allem der Hamburger Liturgiker Peter CornehlCornehl, Peter (1936–2022), die zeitgenössische Literatur als Quelle für die Liturgiewissenschaft zu erschließen.1 CornehlsCornehl, Peter liturgisch-poetische Überlegungen beschränken sich allerdings – wie bei Fischer – auf einen einzigen Beitrag. Im Vergleich zu Fischer fallen sie ergiebiger aus, weil er sie im Rahmen eines bereits etablierten Ansatzes verortet. Die Beiträge von FischerFischer, Balthasar (1969) und CornehlCornehl, Peter (2000) sind nicht miteinander vergleichbar, stammen sie doch aus ganz verschiedenen Epochen und verfolgen je eigene Ziele. Beide Liturgiker erkennen jedoch das ungenutzte Potential, das literarische Zeugnisse für die Liturgiewissenschaft bereithalten. Vor dem Hintergrund seines Selbstverständnisses als praktischer Theologe analysiert CornehlCornehl, Peter literarische Gottesdienste rezeptionsästhetisch. Im Unterschied zur katholischen Liturgiewissenschaft, die bis heute mehrheitlich historisch bzw. systematisch geprägt ist, rezipiert die evangelische Liturgik kommunikationstheoretische und rezeptionsästhetische Theorien für ihre Anliegen seit über vier Jahrzehnten.2 Unter dem Titel „Gottesdienst als offenes Kunstwerk“ übernahmen Liturgiker wie Karl-Heinrich BieritzBieritz, Karl-Heinrich oder Rainer VolpVolp, Rainer eine an Umberto Eco orientierte Semiotik bzw. Zeichentheorie für die evangelische Gottesdienstlehre.3 Die Rezeptionsästhetik beruht auf der Annahme, dass Sinnzuschreibungen eines Kunstwerkes nicht nur von den Produzenten ausgehen, sondern ebenso von den Rezipienten erfolgen.4 Der Ansatz bringt für den Gottesdienst eine Aufwertung der feiernden Gemeinde mit sich, die als selbstständige und aktive „Sinnproduzentin“ neu entdeckt wird.5 Damit gehen wichtige Fragen einher: Welche Erwartungen und Empfindungen haben Menschen, wenn sie heute Rituale begehen und Liturgie feiern? Unter welchen – wenn auch nur schwer zu beschreibenden – Voraussetzungen kann Kommunikation im Gottesdienst überhaupt gelingen? Wie rezipiert und deutet die Gemeinde das liturgische Geschehen als „offenes Kunstwerk“? CornehlCornehl, Peter stimmt zwar mit der Grundidee der Rezeptionsästhetik überein, dass der Gottesdienst sowohl aus dem „Konzept der Gottesdienstproduzenten“ als auch aus den „Perzepten der Rezipienten“ besteht, unterstellt dem Ansatz aber zugleich, dass er zu sehr auf das „Gesamtkunstwerk Gottesdienst“ fokussiert ist, die Rezeption durch die Gemeinde aber letztlich doch vernachlässigt.6 Um die Wahrnehmungen der feiernden Menschen noch präziser in den Blick zu nehmen, ergänzt CornehlCornehl, Peter seinen rezeptionsästhetischen Ansatz um die theologische Biografieforschung, weil sie nach der lebensgeschichtlichen Verankerung von Liturgie und Frömmigkeit fragt.7 Das Material für diesen Ansatz wird mit Hilfe von qualitativen Erzählinterviews gewonnen, bleibt aber nicht darauf beschränkt, wie Projekte aus der jüngeren Zeit belegen.8 Mittlerweile hat die Biografieforschung ihre Quellen erweitert und beschäftigt sich mit schriftlich fixierten Textkörpern wie Tagebüchern, Briefen oder anderen persönlichen Dokumenten.9 CornehlCornehl, Peter hält literarische Zeugnisse über Gottesdienstbesuche ebenso für derartige Quellen. Bis dato würden sie aber weder von der Biografieforschung noch von der Liturgiewissenschaft berücksichtigt oder gar gewürdigt. Dieser Lücke will sich die vorliegende Arbeit stellen, indem sie mit CornehlCornehl, Peter für die Erweiterung des Quellenspektrums plädiert und erstmals eine größere Studie wagt, um Liturgie und Literatur zusammenzubringen.
Für seine eigene Auswertung literarischer Zeugnisse wählte CornehlCornehl, Peter zwei historische und einen zeitgenössischen Text aus, in deren Zentrum evangelische Predigtgottesdienste stehen: Den Anfang macht CornehlCornehl, Peter mit einem Auszug aus „Anton Reiser“ (1785/86; 1790) von Karl Philipp MoritzMoritz, Karl Philipp, dann geht er zu LudwigLudwig, Heiner Tiecks „Franz Sternbalds Wanderungen“ (1798) über und schließt mit Walter Kempowskis „Uns geht’s ja noch gold“ (1972).10 Die Leitfrage für alle drei Zeugnisse lautet, was in den Rezipienten, die Gottesdienste feiern, konkret vorgeht, welche Gefühle und Stimmungen sie empfinden und ob daraus Schlussfolgerungen für die liturgische Praxis gezogen werden können.
Es lohnt hier nicht, die Ergebnisse der einzelnen Analysen im Detail zu rekapitulieren, da sie aufs Ganze gesehen zu unspezifisch bleiben. Dennoch lassen sich neben der Forderung, die Quellen zu erweitern, drei weitere Punkte identifizieren, die CornehlsCornehl, Peter Analysen zusammenfassen: 1.) Hohe Aufmerksamkeit für Sekundäres, 2.) Die Fremdheit der Liturgie gegenüber dem Leben eingestehen, und 3.) Literatur als Liturgie- und Kirchenkritik. Die Chance CornehlsCornehl, Peter Ansatzes liegt im Perspektivenwechsel, der das Erleben des einzelnen Menschen wie der feiernden Gemeinde ins Zentrum rückt und davon abgeht, die Liturgie nur von autoritativ gesetzten Texten, Gebeten und Zeichen her zu verstehen. „Menschen erleben etwas im Gottesdienst. Sie nehmen mehr wahr, als wir [= Liturgen, AB] oft meinen. Teils sind es Einzelheiten, teils ist es die Atmosphäre. Sie haben ihre eigene, je besondere Wahrnehmung. Sie ist situativ, subjektiv bedingt, biographisch gefärbt.“11 Zu den Wesensmerkmalen liturgisch-literarischer Zeugnisse gehört die Verschränkung von äußerlichen Eindrücken (Stimmungen und oberflächliche Emotionen) und innerem Erleben. Viele literarisch dokumentierte Eindrücke wirken vorderhand sekundär und haben nur vereinzelt mit dem theologischen Gehalt des Gottesdienstes zu tun.12 Doch gerade die Aufmerksamkeit für Unscheinbares kann bei Teilnehmenden eine zunächst vielleicht völlig unerwartete Resonanz auslösen. Es reichen ein Wort, eine unscheinbare Geste oder ein paar Takte Musik, um eine eingefahrene Situation zu lösen und damit eine Wandlungserfahrung zu ermöglichen. Umgekehrt können Nichtigkeiten die Atmosphäre im Gottesdienst ebenso schnell zerstören und jede Andacht verunmöglichen. Das fragmentarisch Wahrgenommene wird – das scheint eine weitere Besonderheit von diesen Zeugnissen zu sein – auf ungewöhnliche Weise ganzheitlich erlebt. CornehlCornehl, Peter vergleicht dieses Spezifikum mit der diffusen Atmosphäre einer gotischen Kathedrale. Beim Betreten ist das menschliche Auge nicht sofort in der Lage, das Ausmaß des Raumes mit einem Blick zu erfassen. Die bruchstückhaften Sinneseindrücke zwischen Licht und Schatten, Höhe und Tiefe reichen aber aus, um die Atmosphäre insgesamt zu ermessen.13 Die Menschen im Gottesdienst „ergänzen in ihrer Weise das Gesagte, Erlebte, die einzelnen Splitter, die sie wahrnehmen, zu einem eigenen Ganzen. Natürlich nehmen sie selektiv wahr, hören manches, was nicht gesagt wurde, geben dem Gehörten eine ganz eigene Bedeutung.“14
Ein an den Rezipierenden orientierter Zugang bietet lehrreiche Einsichten, bringt aber auch Nachteile mit sich. Durch den Fokus auf die „Rezeption“ im Unterschied zur „Produktion“ wird die Möglichkeit der antizipierten Rezeption seitens des Produzierenden vorschnell ausgeblendet.15 Die im ersten Hauptteil dieser Arbeit analysierten Texte werden zeigen, dass gerade die Literaturschaffenden den postulierten Gegensatz zwischen „Hersteller“ und „Produzenten“ überwinden, wenn sie in einigen Fällen beide Rollen einnehmen. Sobald sich die Liturgie zu sehr an den vordergründigen Bedürfnissen der Menschen orientiert, besteht die Gefahr, dass sie nur mehr Erwartungen erfüllt und keine Geheimnisse mehr feiert.16 Dem schließt sich CornehlCornehl, Peter an, wenn er in seinem Beitrag betont, dass die „offene“ Rezeption der Teilnehmenden zwar unbedingt respektiert werden muss. Zugleich warnt er aber davor, die Bedürfnisse der Menschen – die wirklichen wie vermeintlichen – im Gottesdienst nur oberflächlich zu befriedigen. Liturgische Rituale bejahen nicht bloß, was die Menschen bereits sind, sie teilen ebenso Fremdes mit. „Zuerst muss man die Fremdheit der Liturgie gegenüber dem Leben eingestehen. Sie ist ein hochstilisierter, verfremdender und fernliegender Vollzug. Ein Vollzug, der nur in dieser Ferne zum Leben gehört und für das Leben bedeutsam ist.“17 Die Perzepte der Gottesdienstbesucher und -besucherinnen eignen sich daher nicht, um eine Art Marktanalyse durchzuführen, wie die „Kunden“ bestmöglich zufriedengestellt werden können. Für CornehlCornehl, Peter ist die Liturgie zuerst ein umfassendes Dialoggeschehen, das die Menschen mit Gott in Verbindung bringen will: „Der Gottesdienst sollte Raum geben für Begegnung, er sollte Räume öffnen, in denen die Menschen Gott, dem Heiligen, der Wahrheit begegnen können.“18
Im Rahmen dieser Arbeit darf ebenso wenig verschwiegen werden, dass die Literatur nicht nur beseelende Verwandlungserfahrungen tradiert, sondern ebenso Verletzungen und Traumata dokumentiert, die im Namen der Religion begangen werden und sich mitunter im Gottesdienst und in der Liturgie spiegeln. Noch lange bevor Tilmann Moser 1976 in seiner „Gottesvergiftung“19 ekklesiogene Neurosen in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit rückte, griff die profane Literatur die Auswirkungen einer oft zerstörerischen Verquickung von Erziehung, Machtmissbrauch und religiösen Ritualen auf. CornehlCornehl, Peter nennt „Anton Reiser“20 als erstes Beispiel für eine „aufklärerische Kirchen- und Predigtkritik, die mit psychologischen Kategorien arbeitet“21 in der deutschsprachigen Literatur. Karl Philipp MoritzMoritz, Karl Philipp schildert in seinem Buch, das er im Untertitel „ein psychologischer Roman“ nennt, wie verheerend sich das liturgisch inszenierte Zusammenwirken von Gesetz und Evangelium, Gericht und Gnade auf die Seele eines sensiblen jungen Mannes auswirkte. Anton Reiser gerät durch die überwältigenden Predigten seines Pastors in eine verworrene Traumwelt, die seine Phantasie völlig in Beschlag nimmt. Immer mehr steigert er sich selbst in die Rolle eines Predigers hinein und leidet schlussendlich unter einem „krankhaften pastoralen Größenwahn“:
„So war Anton nun in seinem dreizehnten Jahre, durch die besondre Führung, die ihm die göttliche Gnade, durch ihre auserwählten Werkzeuge hatte angedeihen lassen, ein völliger Hypochondrist geworden, von dem man im eigentlichen Verstande sagen konnte, daß er in jedem Augenblick lebend starb. – Der um den Genuß seiner Jugend schändlich betrogen wurde – dem die zuvorkommende Gnade den Kopf verrückte.“22
In typisch aufklärerischer Manier gelingt es dem jungen Anton Reiser schlussendlich doch, von seinen pastoralen Neurosen loszukommen. Die im Frühling hereinbrechende Natur heilt, was Frömmigkeit und „Gnade“ zuvor verdorben haben.23 Es liegt nahe, Bücher wie diese als autobiographische Zeugnisse zu studieren, um unterdrückende Strukturen in religiösen Erziehungssystemen aufzudecken.24 „An dieser Stelle gehört Religionskritik zur Grundausbildung derjenigen, die auf die Wirkung ihrer Verkündigung zu achten bereit sind“25, schreibt Peter CornehlCornehl, Peter. Zum anderen sind sie aber auch faszinierende Zeugnisse, wie Gebet und Liturgie im Sinn eines künstlerischen Transfers in die Literatur eingingen. Oft sind es gerade die Erfahrungen von Schmerz, Trauer oder Beziehungslosigkeit, die zunächst jede Sprache rauben, dann aber ein umso nachdrücklicheres Ringen um Sprache freisetzen. Beide Zugänge werden in dieser Arbeit aufgegriffen und weiterentwickelt, um die vielschichtige Wechselwirkung zwischen Liturgie und Leben besser zu verstehen.
Insgesamt zeigen die Auswertungen CornehlsCornehl, Peter, dass sich historische Texte für eine Analyse besonders gut eignen, da man rasch zeittypische und epochenspezifische Merkmale in den literarischen Zeugnissen wiedererkennt. Obwohl zunächst bloß subjektives Erleben, Gefühle und Atmosphären geschildert werden, hinterlassen die großen Epochen wie Aufklärung („Anton Reiser“) oder Frühromantik („Franz Sternbalds Wanderungen“) oder Kriegserfahrungen („Uns geht’s ja noch gold“) eindeutige Muster, Figuren und Wendungen, mit denen wir bis heute vertraut sind. Viel schwieriger ist es, liturgische Erfahrungen von heutigen Menschen zu analysieren, da hier meist klare Muster oder klassische Prägungen fehlen. Die vorliegende Arbeit will sich dieser Herausforderung dennoch stellen und greift für ihre Analysen ausschließlich auf Texte zeitgenössischer Autorinnen und Autoren zurück und fragt nach der anthropologischen Relevanz von Gottesdienst im Leben der Menschen von heute. Balthasar FischerFischer, Balthasar und Peter CornehlCornehl, Peter erkannten das Potential, das sich hinter literarischen Zeugnissen für die Liturgiewissenschaft verbirgt. Sie haben erste Spuren hinterlassen, um das schillernde Verhältnis für die Liturgiewissenschaft aufzubereiten, einen eigenständigen Ansatz gilt es aber erst zu entwickeln. Die vorliegende Untersuchung schließt sich den Erkenntnissen der beiden Liturgiker an und möchte ihre Bemühungen in einem umfassenderen Sinn fortführen.
„Also, fangen wir an zu sammeln und zu sichten und zu interpretieren, nach allen Regeln der Kunst. Wir stehen bei der Auswertung dieser Quellen erst am Anfang. Hier warten viele kleine und größere Aufgaben auf eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern.“26
4Zielsetzung und Methode
Am Ende seines Lebens verfasst Romano GuardiniGuardini, Romano einen berühmt gewordenen Brief, der mit dem Beginn der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils zusammenfällt. Am 1. April 1964, nur vier Monate nach Verabschiedung von Sacrosanctum Concilium, spricht GuardiniGuardini, Romano von einer Entfremdung zwischen Liturgie und modernem Menschen:1
„Ist vielleicht der liturgische Akt, und mit ihm überhaupt das, was ‚Liturgie‘ heißt, so sehr historisch gebunden – antik, oder mittelalterlich –, daß man sie der Ehrlichkeit wegen ganz aufgeben müßte? Sollte man sich vielleicht zu der Einsicht durchringen, der Mensch des industriellen Zeitalters, der Technik und der durch sie bedingten psychologisch-soziologischen Strukturen sei zum liturgischen Akt einfach nicht mehr fähig? Und sollte man, statt von Erneuerung zu reden, nicht lieber überlegen, in welcher Weise die heiligen Geheimnisse zu feiern seien, damit dieser heutige Mensch mit seiner Wahrheit in ihnen stehen könne?“2
Der Kulturphilosoph zweifelt nicht nur die Liturgiefähigkeit des modernen Menschen an, er stellt auch die tradierten Feierformen der kirchlichen Liturgie zur Disposition.3 Zugleich zielt seine Anfrage ins Zentrum der liturgischen Reform, wenn er nach den anthropologischen Bedingungen gottesdienstlichen Tuns fragt. Der Glaube und seine Feier müssen einen Sitz in der Erfahrungswirklichkeit des Menschen haben. Mensch und Lebenswelt bestimmen durch die konziliare Forderung der „tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern“ (SC 14) die Bedingungen des Gottesdienstes.4 Doch wie ist dieser Erfahrungsbezug heute einzuholen, wenn die Kluft zwischen Liturgie und Leben seit GuardinisGuardini, Romano Brief noch größer geworden ist? Antworten darauf zu finden, gehört zu den Aufgaben der Liturgiewissenschaft. Oder mit anderen Worten: Die Disziplin sucht nach „den Bedingungen [des Gottesdienstes] zwischen traditionellen Vorgaben und neuzeitlichen Herausforderungen“5. Die vorliegende Arbeit greift diese Konstellation auf und postuliert, dass der Dialog mit der modernen Kunst und hier im Besonderen mit der zeitgenössischen Literatur eine passende Gelegenheit bietet, nicht nur die anthropologischen Grunderfahrungen heutiger Menschen einzuholen, sondern sie zugleich mit den tradierten Formen des Glaubens bzw. der Liturgie zu verbinden
Der hier skizzierte Zugang wird ebenso durch Überlegungen des Augsburger Theologen Georg LangenhorstLangenhorst, Georg gestützt, der für die Verhältnisbestimmung von Literatur und Religion das Konzept der „Korrelation“6 ins Spiel bringt. Dafür greift er nicht auf das an anderer Stelle bereits auf die Literaturtheologie angewandte Konzept Paul TillichsTillich, Paul (1886–1965) zurück, sondern orientiert sich an einem religionspädagogischen Entwurf.7
„Dort versteht man unter ‚Korrelation‘ eine kritische und zugleich produktive Wechselbeziehung zwischen dem Geschehen, dem sich der überlieferte Glaube verdankt auf der einen und dem Geschehen, in dem Menschen heute ihre Erfahrungen machen, auf der anderen Seite.“8
Dieser Leitgedanke lässt sich in modifizierter Weise auf die Liturgiewissenschaft übertragen, gehört es doch wie schon erwähnt, zu ihrem Proprium, die Bedingungen des Gottesdienstes zwischen traditionellen Vorgaben und neuzeitlichen Herausforderungen immer neu auszuloten.9 Die eben zitierte Definition stützt sich im Rahmen der hier präsentierten Arbeit auf die Wechselseitigkeit zweier Angelpunkte: Die „geronnene Erfahrung“ in den tradierten Ritualen muss mit den Erfahrungen der Menschen von heute, wie sie u. a. in den literarischen Texten der Gegenwart zur Sprache kommen, in Kontakt gebracht werden.10
Dem Erbe GuardinisGuardini, Romano verpflichtet, versteht sich die vorliegende Arbeit daher als Beitrag, die Ursachen für das anhaltende Auseinanderdriften von Liturgie und Leben unter säkularen Bedingungen aufzuzeigen und konkrete Konsequenzen für die liturgische Praxis zu benennen.
Die Besonderheit der Arbeit liegt in der Erschließung zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur als Ort liturgiewissenschaftlicher Erkenntnis. Profane Literatur darf aber nicht bloß als (sekundäre) Quelle im philologischen Sinn verstanden werden. Sie fungiert vielmehr als Gesprächspartnerin, um zwischen Praxis, Theorie und Geschichte einerseits und Ritual und sozialer wie subjektiver Erfahrung anderseits zu vermitteln. Als Resonanz hält sie inspirierende Einblicke bereit, wann Liturgie und Leben heute übereinstimmen, aber auch, wann sie aneinander scheitern. Darüber hinaus liefert sie einen reichen empirischen Erfahrungsschatz sprachsensibler Subjekte, der für die Liturgiewissenschaft eine inspirierende Anregung sein kann, schon vorreflektiert und doch immer genuin.11 Nach Innen geschieht dies, indem das „Quellenspektrum“ der Liturgiewissenschaft auf die Literatur ausgeweitet wird, weil sie über das Verhältnis von heutigem Leben und Liturgie Auskunft gibt. Nach Außen will die Arbeit unter Rückgriff auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, die Brechungen der (Post-)Moderne, wie sie besonders in der Literatur artikuliert werden, in ihre Überlegungen miteinbeziehen, ohne die klassischen Aufgaben der Liturgiewissenschaft zu vernachlässigen.
Mit Fischer und CornehlCornehl, Peter wurde bereits festgehalten, dass die Liturgiewissenschaft derzeit über keine Methode verfügt, um die zahlreichen liturgischen Spuren in der Gegenwartsliteratur innerhalb ihres Quellenspektrums zu verorten.12 Aufgrund der noch geringen Erfahrung der Disziplin mit fiktionalen Texten wäre es an dieser Stelle vermessen zu behaupten, der Autor könnte im Rahmen einer solchen Arbeit bereits einen umfassenden Zugang zum Verhältnis von Liturgie und Literatur vorlegen.13 Vielmehr will diese Arbeit erste Tendenzen, Beobachtungen und Einsichten, die aus Einzelanalysen literarischer Texte gewonnen werden, für den liturgiewissenschaftlichen Diskurs aufbereiten, um einen fruchtbaren Dialog zwischen beiden Größen in Gang zu bringen. Vor dem Hintergrund des bereits Gesagten geht die Arbeit anthropologisch, hermeneutisch und rezeptionsästhetisch vor:
1) Anthropologisch, weil sie nach universalen Grundvollzügen fragt, die sich in liturgischen Ritualen widerspiegeln. Jan-Heiner TückTück, Jan-Heiner vertritt in seinen literaturtheologischen Beiträgen einen anthropologischen Zugang, der nicht auf die sonst üblichen motivgeschichtlichen Untersuchungen abhebt oder vorschnell nach expliziten religiösen Aussagen in der Literatur sucht. Der Wiener Dogmatiker fragt vielmehr „auf der anthropologischen Ebene danach […], wie Erfahrungen von Freundschaft und Liebe, aber auch von Leid, Trauer und Tod literarisch implizit mit Sinn- und Glaubensdiskursen verbunden werden.“14 Sein Zugang ist davon geprägt, dass sich gläubige wie nicht gläubige Menschen über ihre existentiellen Erfahrungen produktiv austauschen können, da beide Anfechtungen und Erschütterungen ausgesetzt sind. Liebe und Tod, Krankheit und Heilung, Schuld und Verzeihung entbinden starke Emotionen, die die eigenen wie fremden Überzeugungen hinterfragen lassen.15 Diese Überlegungen lassen sich indirekt auch für die vorliegende Untersuchung fruchtbar machen, da sie nach Ritualen und Liturgien sucht, die mit anthropologischen Grenzerfahrungen verbunden sind, auch wenn sie vordergründig vielleicht nicht mehr als christliche Liturgien erkennbar sind oder in Kernbereichen von ihr abweichen.16
2.) Hermeneutisch, weil die vorliegende Arbeit fragt, wie literarische Protagonisten die Liturgie mit ihrem eigenen Geschick in Verbindung bringen. In einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ wurde Papst FranziskusFranziskus (Papst) gefragt, was Glaube heute bedeute.17 Der Pontifex bleibt zunächst vage: Glaube ist Freude, Licht, ja ein Gnadengeschenk. Der Journalist gab sich damit aber nicht zufrieden und hakte nach, bis FranziskusFranziskus (Papst) schließlich vom Glauben als „Hermeneutik des Lebens“18 sprach, als Fähigkeit, das eigene Leben im Licht des Evangeliums zu deuten. Wenn der Eindruck nicht täuscht, gibt es in der hier zu analysierenden Literatur eine gesteigerte Aufmerksamkeit für liturgische Rituale, die eine hermeneutische Grundmotivation vermuten lassen. Peter HandkeHandke, Peter gibt in einem Notizbuch Auskunft darüber: Der Mensch von heute kann in der Liturgie wie in der Bibel seine eigene Geschichte aufspüren, „er kann sie da entdecken, dann sie verstehen, dann sich ihr stellen. […] [E]r ist gezwungen, zu sehen, wie es, in der Tiefe, mit ihm steht, dem Sterblichen.“19 Liturgie wird in der Literatur so begangen, dass Zeitgenossen und Zeitgenossinnen ihr Leben im Ritual erkennen. Im (symbolischen) Tun der Liturgie soll das so Erfahrene wieder auf die jeweilige Lebensbedingung hin verflüssigt werden. „Es geht […] darum, in fremden Erfahrungen eigene wiederzuerkennen. Damit entsteht etwas Neues, das alte Ritual wird ,modern‘.“20 Eben darin ereignet sich der „Einbruch der Transzendenz Gottes“ als neue Deutung der Lebensgeschichte von Gott her.21 In der Liturgie knüpft der Mensch seine Erfahrungen an die Glaubenserfahrung der Kirche. Hat jedoch das eigene Leben keinen inneren Ort mehr in der Liturgie, kann der Mensch sich auch nicht von der Transzendenz Gottes berühren lassen.
3.) Rezeptionsästhetisch, weil die Arbeit nach der emotionalen und gedanklichen Wahrnehmung bei der Erschließung von Liturgie fragt, ohne dabei das „Gesamtkunstwerk Gottesdienst“ aus den Augen zu verlieren.22 Methodisch schließt die Arbeit damit an CornehlsCornehl, Peter Überlegungen an, weil auch sie ihren Fokus auf die subjektive Erschließung liturgischer Feiern legt. CornehlCornehl, Peter würdigt zwar die rezeptionsästhetischen Zugänge innerhalb der (evangelischen) Praktischen Theologie, nennt seinen eigenen Ansatz jedoch „rezeptionsgeschichtlich“. Damit ist bei ihm nicht nur die Suche nach „Langzeitwirkungen“ bestimmter Deutungsmuster, Figuren oder Wendungen des literarisch-liturgischen Rezeptionsprozesses in historischen Texten verbunden, sondern ebenso das Interesse für die „biographische Dimension gelebter Religion“23. In Analogie dazu wird bei den hier vorgestellten Autorinnen und Autoren immer auch nach ihrer Biographie gefragt, um zu untersuchen, welchen Einfluss die religiöse Sozialisierung auf die Wahrnehmung von Liturgie nimmt. Wenn CornehlsCornehl, Peter These zutrifft, dass literarische Figuren in der Liturgie nach subjektiven Empfindungen streben und dabei liturgische Details (welche Texte, Gebete oder Lieder verwendet werden) vernachlässigen, stellt sich unweigerlich die Frage, wie es um das Verhältnis zwischen Subjektivität und Objektivität der Liturgie bestellt ist.24 Daraus resultiert der Auftrag, die individuellen Perzepte der Teilnehmenden ausreichend zu würdigen, das objektive Konzept der Liturgie aber nicht zu vernachlässigen. Dabei geht die Arbeit von der Prämisse aus, dass die objektive Liturgie nicht ohne die subjektiven Brechungen vollzogen werden kann.
5Aufbau und Struktur
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, gliedert sich die Arbeit in zwei große Abschnitte, die von einer Hinführung eingeleitet und einem Epilog abgeschlossen werden. Den inhaltlichen Auftakt macht Teil B („Liturgische Spuren in der zeitgenössischen Literatur“), in dessen Zentrum die zu untersuchende Literatur steht. Dass ihr und nicht liturgiewissenschaftlichen Theorien der Vorrang gilt, ist historisch bedingt, wurde sie doch über lange Zeit hinweg von Theologie und Lehramt abgewertet. In diesem Sinn spiegelt sich der am Zweiten Vatikanum vollzogene Paradigmenwechsel (vgl. GS 62) auch strukturell wie methodisch in der Arbeit wider.1 Die prioritäre Behandlung der Literatur soll zugleich vorschnelle Lesarten verhindern, die sich ausschließlich auf liturgiewissenschaftliche Fragestellungen fokussieren. Inhaltlich besteht Teil B aus sechs Einzelanalysen literarischer Texte (hauptsächlich Prosa, ab und an auch Lyrik), die von fünf zeitgenössischen Autoren und einer Autorin stammen. Die Auswahl der Texte bzw. Autoren/Autorin folgt unterschiedlichen Parametern: Zuerst zielt die Arbeit auf ein möglichst breites Spektrum in Bezug auf Herkunft und Umgang mit der Liturgie ab. Mit Peter HandkeHandke, Peter (geb. 1942) und Christoph RansmayrRansmayr, Christoph (geb. 1954) stammen zwei der vier Autoren aus Österreich, Arnold StadlerStadler, Arnold (geb.1954) wurde in Oberschwaben geboren und Hanns-Josef OrtheilOrtheil, Hanns-Josef (1951) verbrachte seine Kindheit und Jugend in Köln bzw. dem Westerwald. Die hier vorgestellten Autoren verbindet, dass sie noch vor dem Zweiten Vatikanum (1962–1965) sozialisiert wurden und innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zur „Ministrantenfraktion“ zählen.2 Erzogen wurden sie überwiegend in vormodernen, meist ländlich geprägten Dorfmilieus, in denen die katholische Kirche beinahe alle Lebensbereiche dominierte. Mit Ausnahme von Stadler mussten sie – meist mangels Alternativen – wenigstens zeitweise katholische (Internats-)Schulen besuchen. Grosso modo werden die genannten Autoren der sog. 68er Bewegung zugerechnet, die teils radikal mit der eigenen Herkunft brach und jede Form der (religiösen) Bevormundung ablehnte. Wie ambivalent das Verhältnis zu den eigenen Wurzeln mitunter war (oder immer noch ist), lässt HandkeHandke, Peter in einem seiner Journalbände anklingen: „Das Fette, an dem ich würge: Österreich.“3 Trotz aller biographischen Verwerfungen mit der Religion pflegen alle vier bis heute (meist nach längerer Absenz) Kontakt zur ihrer Herkunftsreligion, besuchen selbst regelmäßig Liturgien oder schicken wenigstens die Protagonisten ihrer Romane, Erzählungen und Gedichte in den Gottesdienst.4 So groß die Gemeinsamkeiten in Bezug auf Religion und Herkunft auch sind, so unterschiedlich bzw. eigenständig ist ihr Zugriff auf den katholischen Gottesdienst. Pointiert wie vorläufig lässt sich der Umgang an dieser Stelle mit folgenden Prädikaten versehen: künstlerisch (HandkeHandke, Peter), biographisch (OrtheilOrtheil, Hanns-Josef), archaisch (RansmayrRansmayr, Christoph) und spirituell (StadlerStadler, Arnold). Als weiteres Auswahlkriterium fungierte zudem das hohe Renommee und internationale Ansehen der Autoren, das sich in unzähligen Auszeichnungen widerspiegelt. Mit HandkeHandke, Peter ist sogar ein (wenn auch umstrittener) Nobelpreisträger ausgewählt. Die Reihung der ersten vier Schriftsteller wurde alphabetisch vorgenommen, folgt chronologisch aber auch dem Geburtsdatum.
Ergänzt wird die erste Autorengruppe um die Starnberger Autorin Petra MorsbachMorsbach, Petra (geb. 1956) und den evangelischen Pfarrer und Dichter Christian LehnertLehnert, Christian (geb. 1969). MorsbachMorsbach, Petra kommt als Nichtkatholikin, die zwar protestantisch getauft wurde, sich heute aber keiner Denomination zugehörig fühlt, von außen. Mit ihrer Perspektive als areligiöse Frau und unabhängige Beobachterin durchbricht sie den oft von Männern dominierten Blick auf die katholische Sakralwelt. Aus konfessioneller Sicht ergänzt Christian LehnertLehnert, Christian die Spannweite der Arbeit um einen evangelischen Zugang. LehnertLehnert, Christian wuchs in der DDR ohne Bezug zur Religion auf und entschied sich erst als Jugendlicher, Kontakt mit der Kirche aufzunehmen. Auch wenn er als Autor und evangelischer Geistlicher in einer langen Tradition dichtender Pfarrer steht, ist er derzeit wohl der einzige seiner Zunft, der jenseits des kirchlichen Binnenmilieus als Schriftsteller vom Literaturbetrieb wahrgenommen wird. LehnertLehnert, Christian wurde mit seinem Buch „Der Gott in einer Nuß“5 ganz bewusst an das Ende des ersten Teils gestellt. Mit seinem eigenwilligen Prosawerk schlägt er eine direkte Brücke zum zweiten Teil der Arbeit, weil er darin die Messe sowohl mit theologisch-religionswissen-schaftlichen Reflexionen als auch mit autobiographischen Erfahrungen aus seiner Zeit als Pfarrer poetisch erschließt.6
Literatur und Liturgie sind etymologisch zwar nicht miteinander verwandt, dennoch stellt sich im Rahmen einer solchen Studie die Frage, ob sich hinter der semantischen Ähnlichkeit nicht doch eine gewisse Verwandtschaftsbeziehung im Namen der Litterae, der Buch- und Blätterkunde (LehnertLehnert, Christian), der Freude am Buchstaben und der damit verbundenen Sprache verbirgt. In der Bibel kommen beide Größen jedenfalls häufig zusammen, und gerade da wird Leben erschlossen, gehoben und gerettet. In diesem Sinn liefert die Literatur Erfahrungsberichte, wie sie sonst für die Liturgiewissenschaft kaum zugänglich sind. Beide haben zudem mit ästhetischer Form und Dynamik zu tun. Von daher kann die Literatur für Liturgiewissenschaft Inspiration, Korrektiv und Anregung sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, werden in Teil C der Arbeit vier Bereiche der Vermittlung zwischen Literatur und Liturgie benannt, die das Gespräch zwischen Literatur und Liturgie in Gang bringen sollen: 1.) Raum, 2.) Stille – Klang – Gesang, 3.) Erfahrung und 4.) Körper.
Als Querschnittsmaterie dienen sie als Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Einzelanalysen ebenso wie der inhaltlichen Verbindung untereinander. Vor allem aber sind sie Bindeglieder zur Liturgiewissenschaft und bewusst allgemein gehalten, damit der Erfahrungsschatz aus der Literatur nicht vorschnell und einseitig auf liturgiewissenschaftliche Theorien übertragen wird. Um zu unterstreichen, dass es sich bei den vier Bereichen über die Liturgiewissenschaft hinaus um zentrale Schnittstellen von säkularer Gesellschaft und Religion handelt, werden Sozialwissenschaftler und Philosophen wie Marc AugéAugé, Marc (Nicht-Orte), Hartmut RosaRosa, Hartmut (Resonanz), Charles TaylorTaylor, Charles (Säkularisierung) und Hans JoasJoas, Hans („Selbsttranszendenz“) als Gewährsmänner in die Überlegungen miteinbezogen. Die Arbeit mündet schließlich in das Schlusskapitel („Wandlung und Polarität als Grundprinzipien von Liturgie, Leben und Literatur“), das bewusst auf eine klassische Zusammenschau aller Ergebnisse verzichtet. Stattdessen werden die Erkenntnisse aus beiden Teilen in dem Begriff „Wandlung und Polarität“ gebündelt, um nochmals aufzuzeigen, wie eng Literatur, Liturgie und Leben miteinander verknüpft sind.
II Liturgische Spuren in der zeitgenössischen Literatur
Menschensohn, schau mit deinen Augen und mit deinen Ohren höre und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeige!
(Ezechiel 40,4)
1Peter Handke – „Weltöffnender Katholizismus“1
„Was bleibt von Peter HandkeHandke, Peter?“, fragte Botho StraußStrauß, Botho in einer Glosse für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, als 2006 die Wogen über HandkesHandke, Peter Haltung zu Serbien hochgingen, nachdem er am Begräbnis von Slobodan Milošević eine Rede gehalten hatte.2 „Nicht nur der sprachgeladenste Dichter seiner Generation“, hielt StraußStrauß, Botho den Kritikern damals entgegen, „sondern […] eine Wegscheide des Sehens, Fühlens und Wissens in der deutschen Literatur.“3 Dass ausgerechnet der so gerühmte wie geschmähte Autor trotz seiner damaligen Haltung im Balkan-Konflikt 2019 den Literaturnobelpreis erhielt, kam selbst für eingeschworene HandkeHandke, Peter-Verehrer überraschend, obgleich er schon lange als Anwärter für die höchsten Ehren der Literaturwelt galt.4 Es wunderte daher weiter nicht, dass die Preisvergabe alte Konflikte wachrief. Die Heftigkeit, mit der die Debatte über die politischen Äußerungen des Schriftstellers geführt wurde, überschritt jedoch das sonst übliche Maß.5 Die einen sahen in der Preisverleihung eine „schallende Ohrfeige für die politische Korrektheit“6, die anderen wiederum die unbotmäßige Huldigung eines „Apologeten des Völkermords“7. Das Ausmaß der medialen Empörung ließ Handkes „Friedensepik“, wie der Germanist und Schriftsteller Leopold FedermairFedermair, Leopold die ethisch motivierte Ästhetik im Werk des Österreichers charakterisiert, fast vollständig in den Hintergrund treten.8 Jene Stimmen, die die Vergabe des Nobelpreises an Handke verteidigten, konnten sich kaum gegen die „Anti-Handke-Propaganda“9 Gehör verschaffen. Erfreut zeigte sich etwa Elfriede JelinekJelinek, Elfriede, Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2004, dass die Wahl zum zweiten Mal in der Geschichte des Preises auf einen Schriftsteller aus dem kleinen, aber literarisch äußerst produktiven Österreich fiel. Handke, der für sie der „lebende Klassiker“ schlechthin ist, mit der hohen Auszeichnung zu bedenken, sei längst überfällig gewesen, ließ die sonst so öffentlichkeitsscheue Feministin wissen.10 Die Büchner-Preis-Trägerin Sibylle LewitscharoffLewitscharoff, Sibylle (1954-2023) verneigte sich anlässlich der Nobelpreisverleihung ebenfalls vor dem „hochmögenden Werk“ und mahnte zugleich an, den Autor und seine politischen Äußerungen nicht mit dem erzählerischen Werk zu verwechseln, da sonst zwei Drittel des bedeutendsten Literaturkanons entfallen würden.11 Der Dichter selbst – HandkeHandke, Peter lebt seit über dreißig Jahren in einem südwestlichen Vorort von Paris – nahm die Kunde von der Ehrung mit freudiger Gelassenheit entgegen. Nachdem ihn der Anruf der Schwedischen Nobelpreis-Akademie ereilte, flanierte er wie üblich durch Chaville: „Ich bin durch die Wälder geeiert, wie ich es eigentlich vorhatte.“12 In der inhaltlich wenig beachteten Nobelvorlesung reagierte der Laureat auf die Kritik an seinen politischen Äußerungen, indem er aus seinem Stück „Über die Dörfer“ zitierte: „Beweg dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird.“13 HandkeHandke, Peter beugte sich dem medialen Druck, seine Serbien-Äußerungen vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu widerrufen, nicht. Er zitierte abermals aus dem dramatischen Gedicht „Über die Dörfer“, das 1982 in Salzburg uraufgeführt wurde, aber so klingt, als hätte der Nobelpreisträger die Zeilen für seine Kritiker geschrieben:14
„Die Verneigung vor der Blume ist möglich. Der Vogel im Gezweig ist ansprechbar. So sorgt in der mit künstlichen Farben fertiggemachten Welt für die wiederbelebenden Farben einer Natur. Das Bergblau ist – das Braun der Pistolentasche ist nicht; und wen oder was man vom Fernsehen kennt, das kennt man nicht. Unsere Schultern sind für den Himmel da, und der Zug zwischen der Erde und ihm läuft nur durch uns. Geht langsam und werdet so selber die Form, ohne die keine Ferne Gestalt annimmt. […] Verwandelt eure unerklärlichen Seufzer in mächtige Lieder. Unsere Kunst muß aus sein auf den Himmelsschrei! Laßt euch nicht die Schönheit ausreden – die von uns Menschen geschaffene Schönheit ist das Erschütternde.“15
HandkesHandke, Peter Œuvre ist zu reich, ausdifferenziert und vielfältig, um es in ein paar wenigen Schlagwörtern auf den Punkt zu bringen.16 Seit 1965 veröffentlichte er über siebzig Werke, neben Prosaerzählungen auch Theaterstücke, Gedichte, Journale, die bislang in über siebzig Sprachen übersetzt sind.17





























