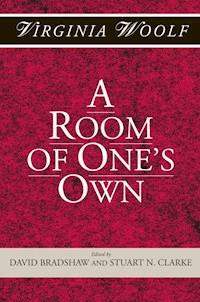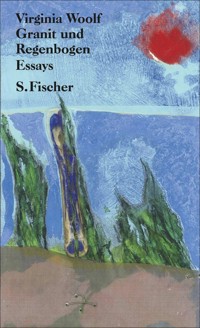
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Virginia Woolf, Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Virginia Woolfs Gedanken zu Literatur und Leben Ihre Romane gehören zur Weltliteratur, ihre Tagebücher und autobiographischen Schriften sind berühmt. Aber als glänzende, höchst anregende Essayistin ist Virginia Woolf immer noch zu entdecken. Die leidenschaftliche Leserin schrieb viele ihrer Rezensionen und Betrachtungen für das renommierte ›Times Literary Supplement‹ und andere Zeitschriften. Mit schwebender Aufmerksamkeit widmet sie sich den Themen, die Literatur, Kunst und Leben ihr stellen, und offenbart dabei den ganzen Reichtum ihres Wissens und Denkens, die Vielfalt ihrer gestalterischen Möglichkeiten und den Zauber ihrer Prosa. Die beiden Textsammlungen ›Granit und Regenbogen‹ (Bd. 092568) und ›Das Totenbett des Kapitäns‹ (Bd. 092560), ausgewählt aus dem immensen essayistischen Werk, bilden den Abschluss der Ausgabe der Gesammelten Werke von Virginia Woolf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Virginia Woolf
Granit und Regenbogen
Essays Nach der englischen Ausgabe von Leonard Woolf herausgegeben von Klaus Reichert Deutsch von Brigitte Walitzek und Heidi Zerning
FISCHER E-Books
Inhalt
I Die Kunst des Romans
Die schmale Brücke der Kunst
Weitaus die meisten Kritiker kehren der Gegenwart den Rücken zu und blicken unverwandt in die Vergangenheit. Aus zweifellos klugen Gründen beziehen sie keine Stellung zu dem, was gerade jetzt geschrieben wird; sie überlassen diese Aufgabe der Spezies der Rezensenten, deren Berufsbezeichnung bereits auf das Vergängliche ihres Tuns und der Gegenstände ihrer Betrachtung hinzudeuten scheint. Aber manchmal fragt man sich doch, ob ein Kritiker immer nur der Vergangenheit verpflichtet, sein Blick immer nur rückwärts gerichtet sein muß? Kann er sich nicht hin und wieder umdrehen, die Augen mit der Hand abschirmen wie Robinson Crusoe auf der einsamen Insel und in die Zukunft spähen, um in ihrem Nebel die schwachen Umrisse des Landes auszumachen, das wir vielleicht eines Tages erreichen werden? Das Richtige solcher Spekulationen kann natürlich nie bewiesen werden, aber in einer Zeit wie der unseren ist die Versuchung groß, sie anzustellen. Denn es ist offenkundig eine Zeit, in der wir keineswegs fest vor Anker liegen; alles um uns bewegt sich; auch wir bewegen uns. Ist es nicht die Pflicht des Kritikers, uns zu sagen oder wenigstens Vermutungen anzustellen, wohin wir gehen?
Es liegt auf der Hand, daß diese Untersuchung eng begrenzt sein muß, aber vielleicht können wir auf kleinem Raum ein Beispiel für das Unbefriedigende und Schwierige herausgreifen und sind, wenn wir es geprüft haben, womöglich eher in der Lage, die Richtung zu vermuten, in die wir nach dessen Überwindung gehen werden.
In der Tat können wir nicht viel moderne Literatur lesen, ohne uns darüber klar zu sein, daß etwas Unbefriedigendes, etwas Schwieriges sich uns in den Weg stellt. Allenthalben versuchen Autoren etwas, was sie nicht vollbringen können, zwingen der Form, die sie benutzen, eine Bedeutung auf, die ihr fremd ist. Viele Gründe dafür könnten angeführt werden, aber hier wollen wir nur einen auswählen, nämlich das Versagen der Poesie, uns so zu nützen, wie sie so vielen Generationen unserer Vorfahren genützt hat. Die Poesie gewährt uns ihre Dienste nicht annähernd so bereitwillig wie früher jenen. Der mächtige Strom des Ausdrucks, der so viel Kraft, so viel Genie mit sich trug, scheint sich verengt zu haben oder anders zu verlaufen.
Das trifft natürlich nur innerhalb gewisser Grenzen zu; unsere Epoche ist reich an Lyrik; vielleicht reicher als jede andere Epoche zuvor. Aber für unsere Generation und für die kommende ist der lyrische Aufschrei der Ekstase oder Verzweiflung, der so intensiv, so persönlich und so begrenzt ist, nicht genug. Der Geist steckt voller ungeheuerlicher, widersprüchlicher, unregierbarer Emotionen. Daß das Alter der Erde 3000000000 Jahre beträgt; daß das Menschenleben nur eine Sekunde währt; daß die Fähigkeiten des menschlichen Geistes trotzdem grenzenlos sind; daß das Leben unendlich schön, doch auch widerwärtig ist; daß unsere Mitmenschen bezaubernd, aber auch abscheulich sind; daß Wissenschaft und Religion miteinander den Glauben zerstört haben; daß alle einenden Bande zerrissen zu sein scheinen, es aber ein gewisses Reglement geben muß – in dieser Atmosphäre des Zweifels und des Konflikts müssen Autoren heute schreiben, und das zarte Gewebe eines lyrischen Gedichts ist ebensowenig geeignet, diese Sicht der Dinge zu umfassen, wie sich ein Rosenblatt dazu eignet, einen riesigen, zerklüfteten Felsen zu umhüllen.
Aber wenn wir uns fragen, was in der Vergangenheit dazu gedient hat, eine solche Haltung auszudrücken – eine Haltung, die voller Gegensätze und Widersprüche steckt; eine Haltung, die, so scheint es, nach dem Konflikt einer Person mit einer anderen verlangt und gleichzeitig eines gestalterischen Willens bedarf, eines Entwurfs, der dem Ganzen Harmonie und Kraft verleiht –, dann müssen wir antworten, daß es eine solche Form einst gab, und es war nicht die Form der lyrischen Dichtung; es war die Form des Dramas, des elisabethanischen Versdramas. Und das ist die einzige Form, die heutzutage so tot anmutet, daß jede Auferstehung außerhalb des Möglichen liegt.
Denn wenn wir uns den Zustand des Versdramas anschauen, müssen wir ernsthaft bezweifeln, daß irgendeine Macht auf Erden es jetzt wiederbeleben kann. Autoren von höchstem Genie und Ehrgeiz haben es aufgegriffen und tun es bis heute. Seit dem Tod von Dryden hat so gut wie jeder große Dichter sich daran versucht. Wordsworth und Coleridge, Shelley und Keats, Tennyson, Swinburne und Browning[1] (um nur die toten zu nennen), alle haben Versdramen geschrieben, aber keinem war Erfolg beschieden. Von all den Stücken, die sie schrieben, werden wahrscheinlich nur Swinburnes Atalanta und Shelleys Prometheus noch gelesen, und das seltener als andere Werke derselben Autoren. Alle übrigen sind auf die obersten Borde unserer Bücherregale geklettert, haben den Kopf unter die Flügel gesteckt und sind eingeschlafen. Niemand mag ohne Not diesen Schlummer stören.
Doch es ist verlockend, nach einer Erklärung für dieses Scheitern zu suchen, falls dadurch die Zukunft erhellt wird, um die es uns geht. Der Grund, warum Dichter keine Versdramen mehr schreiben können, liegt vielleicht irgendwo in dieser Richtung.
Es gibt ein vages, geheimnisvolles Ding namens Lebenseinstellung. Wir alle kennen Menschen – wenn wir uns von der Literatur für einen Augenblick dem Leben zuwenden –, die mit dem ihren hadern; unglückliche Menschen, die nie bekommen, was sie wollen; die enttäuscht sind, sich ständig beklagen, in einem unbequemen Winkel dastehen, aus dem sie alles schief sehen. Dann wieder gibt es welche, die zwar vollkommen zufrieden wirken, aber jede Verbindung zur Wirklichkeit verloren zu haben scheinen. Sie verschwenden all ihre Zuneigung an kleine Hunde und altes Porzellan. Sie interessieren sich für nichts anderes als die Wechselfälle ihrer eigenen Gesundheit und das Auf und Ab in ihren versnobten Gesellschaftskreisen. Es gibt jedoch andere, die auf uns den Eindruck machen – warum genau, läßt sich schwer sagen –, daß sie von Natur aus oder durch die Umstände in der Lage sind, ihre Fähigkeiten zur Gänze auf Dinge von Belang zu richten. Sie sind nicht unbedingt glücklich oder erfolgreich, aber sie haben etwas Schwungvolles in ihrem Wesen, ein Interesse an ihrem Tun. Sie wirken ganz und gar lebendig. Das mag teilweise das Ergebnis der Umstände sein – sie sind in eine Umgebung hineingeboren worden, die zu ihnen paßt –, aber weitaus mehr ist es das Ergebnis eines glücklichen Gleichgewichts ihrer Eigenschaften, so daß sie die Dinge nicht aus einem ungünstigen Winkel sehen, völlig schief; auch nicht verzerrt durch einen Nebel; sondern klar und deutlich, im richtigen Verhältnis; sie erfassen etwas Festes; wenn sie handeln, bewirken sie etwas.
Auch Autoren haben eine Lebenseinstellung, obwohl es ihnen um ein anderes Leben geht. Auch sie können in einem unbequemen Winkel dastehen; können verwirrt, verbittert sein, außerstande, das zu erreichen, was sie als Schriftsteller anstreben. Das trifft zum Beispiel auf die Romane von George Gissing[2] zu. Oder sie ziehen sich in die Villenviertel zurück und verschwenden ihr Interesse an Schoßhündchen und Herzoginnen – Koketterien, Sentimentalitäten, Snobismen, und dies trifft auf einige unserer erfolgreichsten Romanciers zu. Aber es gibt andere, die von Natur aus oder durch die Umstände in der Lage sind, ihre Fähigkeiten uneingeschränkt auf belangvolle Dinge zu verwenden. Nicht, daß sie schnell oder leicht schreiben oder sofort erfolgreich sind oder berühmt werden. Man ist vielmehr bemüht, eine Eigenart zu ergründen, die in den meisten der großen Literaturepochen vorhanden ist und im Werk der elisabethanischen Dramatiker am deutlichsten hervortritt. Sie scheinen eine Lebenseinstellung zu haben, eine Haltung, die es ihnen erlaubt, ihre Glieder frei zu bewegen; eine Sichtweise, die zwar aus vielerlei verschiedenen Dingen besteht, ihnen aber für ihre Zwecke die richtige Perspektive gewährt.
Zum Teil war das natürlich das Ergebnis der Umstände. Der Hunger der Menschen nicht nach Büchern, sondern nach dem Drama, die Kleinheit der Städte, die Entfernungen, die die Menschen trennten, das Unwissen, in dem damals sogar die Gebildeten lebten, durch all das war es für die elisabethanische Vorstellung ganz natürlich, sich mit Löwen und Einhörnern zu füllen, mit Herzögen und Herzoginnen, Bluttaten und Geheimnissen. Dies wurde noch verstärkt durch etwas, was wir nicht so einfach erklären, aber deutlich spüren können. Sie hatten eine Lebenseinstellung, die sie befähigte, sich frei und uneingeschränkt auszudrücken. Shakespeares Stücke sind nicht das Werk eines verwirrten und verbitterten Geistes; sie sind die vollkommen elastische Hülle seiner Gedanken. Reibungslos wechselt er von Philosophie zu einer betrunkenen Rauferei; von Liebesliedern zu einem Streit; von schlichtem Ulk zu tiefsinniger Betrachtung. Und für alle elisabethanischen Dramatiker gilt, daß sie uns zwar langweilen mögen – und das tun sie –, uns aber nie das Gefühl geben, daß sie Angst haben oder befangen sind, oder daß irgend etwas den freien Fluß ihres Geistes hemmt, hindert oder aufhält.
Unser erster Gedanke jedoch, wenn wir ein modernes Versdrama aufschlagen – und dies trifft auch auf einen Großteil der modernen Lyrik zu –, ist, daß der Autor sich in seiner Haut nicht wohl fühlt. Er ist verängstigt, er ist angespannt, er ist gehemmt. Und aus guten Gründen!, mögen wir ausrufen, denn wer von uns fühlt sich vollkommen wohl in Gegenwart eines Mannes in einer Toga namens Xenokrates oder einer Frau in einem Bettlaken namens Eudoxa? Doch aus irgendeinem Grunde handelt das moderne Versdrama immer von Xenokrates und nicht von Mr Robinson; es handelt von Thessalien und nicht von der Charing Cross Road.[3] Als die Elisabethaner ihre Stücke in fremden Gefilden spielen ließen und ihre Helden und Heldinnen zu Prinzen und Prinzessinnen machten, da verlegten sie den Schauplatz nur von der einen auf die andere Seite eines sehr dünnen Schleiers. Es war ein üblicher Kunstgriff, der ihren Gestalten Tiefe und Ferne gab. Aber das Land blieb englisch; und der böhmische Prinz war identisch mit dem englischen Edelmann. Unsere modernen Versdramatiker jedoch scheinen den Schleier der Vergangenheit und der Ferne aus einem anderen Grund zu suchen. Sie wollen keinen Schleier, der steigert, sondern einen Vorhang, der verbirgt; sie verlegen ihren Schauplatz in die Vergangenheit, weil sie Angst vor der Gegenwart haben. Ihnen ist bewußt, wenn sie versuchen würden, die Gedanken, die Visionen, die Sympathien und Antipathien auszudrücken, die sich gegenwärtig, in diesem Jahr des Heils 1927, in ihrem Hirn tummeln, dann würde der poetische Anstand verletzt werden; sie könnten nur stammeln und stolpern und müßten sich vielleicht hinsetzen oder das Zimmer verlassen. Die Elisabethaner hatten eine Haltung, die ihnen völlige Freiheit gestattete; der moderne Dramatiker hat entweder überhaupt keine Haltung oder eine so angestrengte, daß sie seine Gliedmaßen verkrampft und seine Sehweise verzerrt. Er muß deshalb Zuflucht zu Xenokrates nehmen, der nichts sagt oder nur das, was Blankverse mit Anstand sagen können.
Aber können wir das ein wenig gründlicher erläutern? Was hat sich verändert, was ist geschehen, was hat den Autor jetzt in eine solche Schräglage versetzt, daß er seinen Geist nicht mehr geradewegs in die Flußbetten der englischen Poesie gießen kann? Eine Art von Antwort mag sich ergeben aus einem Gang durch die Straßen irgendeiner großen Stadt. Die langen Zeilen aus Ziegeln sind in Kästen aufgeteilt, und jeder davon wird von einem anderen Menschen bewohnt, der Schlösser an seinen Türen und Riegel an seinen Fenstern angebracht hat, um für sich zu sein, jedoch mit seinen Mitmenschen durch Drähte verbunden ist, die hoch über ihm verlaufen, durch Schallwellen, die ins Dach eindringen und laut zu ihm sprechen von Schlachten und Morden und Streiks und Revolutionen überall auf der Welt. Und wenn wir hineingehen und mit ihm reden, werden wir feststellen, daß er ein scheues, unzugängliches, argwöhnisches Tier ist, außerordentlich gehemmt, außerordentlich darauf bedacht, nichts von sich preiszugeben. Dabei gibt es im modernen Leben nichts, was ihn dazu zwingt. Es gibt keine Gewalt im privaten Miteinander; wir sind höflich, tolerant und umgänglich, wenn wir uns begegnen. Sogar Krieg wird eher von Firmen und Gesellschaften geführt als von Einzelnen. Das Duellwesen ist ausgestorben. Das Band der Ehe kann sich unendlich dehnen, ohne zu zerreißen. Der normale Mensch ist ruhiger, ausgeglichener, beherrschter als früher.
Aber dann wiederum, sollten wir einen Spaziergang mit unserem Freund unternehmen, würden wir feststellen, daß er außerordentlich empfänglich ist für alles – für Häßlichkeit, Verkommenheit, Schönheit, Vergnügen. Er folgt jedem Gedanken ohne Rücksicht darauf, wohin er ihn führen könnte. Er spricht offen über Dinge, die früher nicht einmal im privaten Kreis erwähnt wurden. Und eben diese Freiheit und Neugier sind vielleicht die Ursache für das, was sein hervorstechendstes Merkmal zu sein scheint – die seltsame Art, in der Dinge, die keine offensichtliche Verbindung haben, in seinem Kopf miteinander verknüpft sind. Gefühle, die früher einzeln und getrennt voneinander auftraten, tun das nicht mehr. Schönheit ist teils Häßlichkeit; Vergnügen teils Ekel; Freude teils Schmerz. Empfindungen, die früher als ein Ganzes den Kopf betraten, werden jetzt auf der Schwelle zerstückelt.
Zum Beispiel: Es ist eine Frühlingsnacht, der Mond scheint, die Nachtigall singt, die Weiden beugen sich über den Fluß. Ja, aber gleichzeitig sitzt eine kranke alte Frau auf einer häßlichen eisernen Bank und wühlt in ihren schmierigen Lumpen. Sie und der Frühling dringen gemeinsam in seinen Kopf; sie vermengen sich, verschmelzen aber nicht. Die beiden Empfindungen, so disparat gepaart, gehen einhellig mit Bissen und Tritten aufeinander los. Aber das Gefühl, das Keats empfand, als er den Gesang der Nachtigall[4] hörte, ist ein einziges und ganzes, auch wenn es sich von Freude an der Schönheit zu Trauer über das unglückliche Menschenschicksal wandelt. Er schafft keinen Gegensatz. In seinem Gedicht ist Trauer der Schatten, der die Schönheit begleitet. Im modernen Geist wird Schönheit nicht von ihrem Schatten, sondern von ihrem Gegensatz begleitet. Beim modernen Dichter singt die Nachtigall »jug jug to dirty ears«.[5] An der Seite unserer modernen Schönheit tänzelt ein spöttischer Kobold einher, der die Schönheit verhöhnt, weil sie schön ist; der den Spiegel umdreht und uns zeigt, daß die andere Seite ihrer Wange blatternarbig und entstellt ist. Es ist, als habe der moderne Geist, der beständig seine Gefühle verifizieren möchte, die Kraft verloren, irgend etwas einfach für das zu nehmen, was es ist. Zweifellos hat diese skeptische und prüfende Haltung zu einer starken Erfrischung und Belebung der Seele geführt. Es ist eine Freimütigkeit, eine Ehrlichkeit in der modernen Literatur, die heilsam, wenn nicht sogar höchst erfreulich ist. Die moderne Literatur, die mit Oscar Wilde und Walter Pater ein wenig schwül und parfümiert geworden war, lebte augenblicklich auf aus ihrer Lethargie zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als Samuel Butler und Bernard Shaw[6] begannen, ihre Federn zu versengen und ihr als Riechsalz unter die Nase zu halten. Sie erwachte; sie setzte sich auf; sie nieste. Natürlich verscheuchte das die Dichter.
Denn selbstverständlich stand die Poesie immer ganz und gar auf der Seite der Schönheit. Sie hat immer auf bestimmten Rechten beharrt, als da sind Reim, Metrum und poetische Sprache. Sie ist nie für den Alltag des Lebens benutzt worden. All diese Drecksarbeit hat sich die Prosa aufgeladen; hat Briefe beantwortet, Rechnungen bezahlt, Artikel geschrieben, Reden gehalten und sich in Dienst nehmen lassen von Geschäftsleuten, Ladenbesitzern, Anwälten, Soldaten und Bauern.
Die Poesie wahrte Abstand und blieb im Besitz ihrer Priester. Vielleicht ist sie zur Strafe für diese Abgeschiedenheit ein wenig steif geworden. Ihr Auftreten mit all ihrer Ausstattung – ihren Schleiern, ihren Girlanden, ihren Erinnerungen, ihren Assoziationen – berührt uns, sobald sie spricht. Wenn wir daher von der Poesie verlangen, all das auszudrücken, diesen Widerspruch, diese Unvereinbarkeit, diesen Hohn, diesen Gegensatz, diese Neugier, die lebhaften, kuriosen Gefühle, die in kleinen, geschlossenen Zimmern hervorgebracht werden, die umfassenden, allgemeinen Ideen, die die Zivilisation lehrt, so kann sie sich nicht rasch genug, nicht einfach genug oder weit genug bewegen, um das zu tun. Ihr Tonfall ist zu akzentuiert, ihre Manier zu emphatisch. Stattdessen bietet sie uns lockende lyrische Schreie der Leidenschaft; mit einer majestätischen Armbewegung bedeutet sie uns, zur Vergangenheit Zuflucht zu nehmen; aber sie hält nicht Schritt mit dem Geist, wirft sich nicht geschickt, rasch und leidenschaftlich in seine diversen Leiden und Freuden. Byron wies in Don Juan[7] den Weg; er zeigte, welch ein anpassungsfähiges Instrument die Poesie werden könnte, aber niemand ist seinem Beispiel gefolgt oder hat sein Werkzeug weiter in Gebrauch genommen. Wir bleiben ohne ein Versdrama.
So kommen wir zu der Überlegung, ob die Poesie zu der Aufgabe fähig ist, die wir ihr jetzt stellen. Es mag sein, daß die hier so grob umrissenen und dem modernen Geist unterstellten Gefühle sich eher der Prosa fügen als der Poesie. Es mag sein, daß die Prosa einige der Pflichten übernehmen wird – ja, schon übernommen hat –, die einst der Poesie oblagen.
Wenn wir nun kühn sind und es riskieren, uns lächerlich zu machen, und zu sehen versuchen, in welche Richtung wir, die wir uns so schnell zu bewegen scheinen, gehen, können wir vermuten, daß wir in die Richtung der Prosa gehen und daß in zehn oder fünfzehn Jahren die Prosa für Zwecke benutzt werden wird, für die sie noch nie benutzt worden ist. Dieser Kannibale, der Roman, der schon so viele Kunstformen verschlungen hat, wird dann noch weitere verschlungen haben. Wir werden gezwungen sein, neue Namen für die verschiedenen Bücher zu erfinden, die sich hinter der Maskerade dieses einen Titels verbergen. Und es ist möglich, daß unter diesen sogenannten Romanen einer sein wird, den wir kaum zu taufen wissen werden. Er wird in Prosa geschrieben sein, aber in einer Prosa, die viele der Merkmale der Poesie hat. Er wird etwas von der Erhabenheit der Poesie haben, aber viel von der Gewöhnlichkeit der Prosa. Er wird dramatisch sein und doch kein Theaterstück. Er wird gelesen, nicht gespielt werden. Mit welchem Namen wir ihn belegen, ist nicht von sehr großer Wichtigkeit. Wichtig ist, daß dieses Buch, das wir am Horizont sehen, vielleicht dazu dienen wird, einige jener Gefühle auszudrücken, denen sich gegenwärtig die reine Poesie verweigert und denen sich das Drama ebenso ungastlich zeigt. Also wollen wir versuchen, näher darauf einzugehen und uns vorzustellen, was sein Bereich und seine Natur sein mögen.
Vor allem kann man annehmen, daß er sich von dem Roman, wie wir ihn jetzt kennen, hauptsächlich darin unterscheiden wird, daß er größeren Abstand zum Leben hält. Er wird, wie es die Poesie tut, eher den Umriß als die Einzelheit bieten. Er wird wenig Gebrauch machen von der fabelhaften Kraft, Fakten festzuhalten, die eines der Kennzeichen der Romanliteratur ist. Er wird uns sehr wenig über die Häuser, die Einkommen, die Berufe seiner Personen erzählen; er wird wenig Verwandtschaft mit dem Gesellschaftsroman oder dem Milieuroman haben. Mit diesen Einschränkungen wird er die Gefühle und Ideen der Charaktere genau und lebendig ausdrücken, aber aus einem anderen Blickwinkel. Er wird der Poesie darin ähneln, daß er nicht nur oder hauptsächlich die Beziehungen der Personen untereinander und ihre gemeinsamen Aktivitäten schildern wird, wie es der Roman bisher getan hat, sondern er wird die Beziehungen des Geistes zu allgemeinen Ideen und sein einsames Selbstgespräch wiedergeben. Denn unter der Herrschaft des Romans haben wir einen Teil des Geistes genau untersucht und einen anderen unerforscht gelassen. Wir haben inzwischen vergessen, daß ein großer und wichtiger Teil des Lebens aus unseren Gefühlen zu Dingen wie Rosen und Nachtigallen, der Morgenröte, dem Sonnenuntergang, Leben, Tod und Schicksal besteht; wir vergessen, daß wir viel Zeit mit Schlafen, Träumen, Nachdenken und Lesen verbringen, allein; wir gehen nicht völlig in persönlichen Beziehungen auf; nicht all unsere Kräfte werden von unserem Lebensunterhalt verbraucht. Der psychologische Romancier hat zu sehr dazu geneigt, die Psychologie auf die Psychologie der privaten Beziehungen zu beschränken; wir sehnen uns manchmal danach, ihr zu entkommen, dieser unaufhörlichen, gnadenlosen Analyse des Verliebens und Entliebens, dessen, was Tom für Judith empfindet und was Judith ebenso oder doch nicht ganz so für Tom empfindet. Wir sehnen uns nach einer unpersönlicheren Beziehung. Wir sehnen uns nach Ideen, nach Träumen, nach Phantasievorstellungen, nach Poesie.
Und es ist eine der Ruhmestaten der elisabethanischen Dramatiker, daß sie uns dies geben. Der Dichter ist stets fähig, über die Eigenart von Hamlets Beziehung zu Ophelia hinauszugehen und uns an seinen Fragen nicht nur zu seinem eigenen Schicksal, sondern zum gesamten menschlichen Dasein teilnehmen zu lassen. In Measure for Measure zum Beispiel sind Passagen von äußerster psychologischer Feinheit untermischt mit tiefsinnigen Gedanken und ungeheuerlichen Phantasievorstellungen. Doch bemerkenswert ist, daß Shakespeare uns zwar diese Tiefe, diese Psychologie bietet, aber gleichzeitig keinen Versuch unternimmt, uns bestimmte andere Dinge zu bieten. Als »angewandte Soziologie« sind die Stücke von keinerlei Nutzen. Wären wir auf sie angewiesen, um Kenntnis von den sozialen und ökonomischen Bedingungen des elisabethanischen Lebens zu erhalten, dann würden wir im Dunkeln tappen.
In dieser Hinsicht also wird der Roman oder die Spielart des Romans, die in künftiger Zeit geschrieben werden wird, einige der Eigenschaften der Poesie annehmen. Er wird die Beziehungen des Menschen zur Natur, zum Schicksal wiedergeben; seine Phantasie; seine Träume. Aber er wird auch den Hohn wiedergeben, den Gegensatz, die Frage, die Nähe und Vielschichtigkeit des Lebens. Er wird die Gußform annehmen von jenem kuriosen Gemisch unvereinbarer Dinge – dem modernen Geist. Deshalb wird er die kostbaren Vorrechte an seine Brust drücken, die der demokratischen Kunst der Prosa eigen sind; ihre Freiheit, ihre Furchtlosigkeit, ihre Flexibilität. Denn die Prosa ist so bescheiden, daß sie überall hingehen kann; kein Ort ist ihr zu niedrig, zu verkommen oder zu gemein. Sie ist unendlich geduldig, auch in aller Bescheidenheit von einnehmendem Wesen. Sie kann mit ihrer langen klebrigen Zunge die kleinsten Bruchstückchen der Wirklichkeit auflecken und sie zu den raffiniertesten Labyrinthen fügen und still an Türen horchen, hinter denen nur ein Murmeln, ein Flüstern zu hören ist. Mit all der Geschmeidigkeit eines Werkzeugs, das ständig in Gebrauch ist, kann sie den Windungen folgen und die Veränderungen aufzeichnen, die so typisch sind für den modernen Geist. Dem müssen wir, mit Proust und Dostojewski im Rücken, zustimmen.
Aber kann Prosa, fragen wir uns, so geeignet sie auch ist, mit dem Gewöhnlichen und dem Vielschichtigen umzugehen – kann Prosa die einfachsten Dinge sagen, die so ungeheuerlich sind? Die plötzlichen Gefühle wiedergeben, die so überraschend sind? Kann sie eine Elegie anstimmen oder die Liebe besingen oder Entsetzensschreie ausstoßen oder die Rose preisen, die Nachtigall oder die Schönheit der Nacht? Kann sie mit einem Sprung zum Kern des Themas vordringen, wie es der Dichter tut? Ich glaube nicht. Das ist die Strafe, die sie dafür zahlt, auf die Beschwörung und das Mysterium, auf Reim und Metrum verzichtet zu haben. Es stimmt, daß Prosaschriftsteller kühn sind; ständig zwingen sie ihr Instrument, sich daran zu versuchen. Man hat jedoch immer ein Gefühl von Unbehagen angesichts eines Purpurflickens oder eines Prosagedichts. Der Einwand gegen den Purpurflicken ist nicht, daß er purpurn ist, sondern daß er ein Flicken ist. Erinnern wir uns zum Beispiel an Merediths ›Zwischenspiel auf der Weidenpfeife‹ in Richard Feverel.[8] Wie ungeschickt, wie emphatisch beginnt es mit gebrochenem Metrum: »Golden lie the meadows; golden run the streams; red-gold is on the pinestems. The sun is coming down to earth and walks the fields and the waters.« Oder man erinnere sich an die berühmte Beschreibung des Unwetters am Ende von Charlotte Brontës Villette.[9] Diese Passagen sind ausdrucksvoll, lyrisch, glänzend; herausgeschnitten und in eine Anthologie gesteckt lesen sie sich sehr gut; aber im Zusammenhang des Romans bereiten sie uns Unbehagen. Denn sowohl Meredith als auch Charlotte Brontë nannten sich Romanciers; sie traten nah ans Leben heran; sie gaben uns Anlaß, den Rhythmus, die Beobachtungskraft und die Sehweise der Poesie zu erwarten. Wir spüren den Ruck und die Anstrengung; halb werden wir geweckt aus dieser Trance von Zustimmung und Illusion, in der unsere Unterwerfung unter die Macht der Einbildungskraft des Autors am vollständigsten ist.
Aber lassen Sie uns jetzt ein anderes Buch betrachten, das zwar in Prosa geschrieben ist und gemeinhin als Roman bezeichnet wird, aber von Anfang an eine andere Haltung einnimmt, einen anderen Rhythmus, das vom Leben ein Stück zurücktritt und uns Anlaß gibt, eine andere Sehweise zu erwarten – Tristram Shandy.[10] Es ist ein Buch voller Poesie, was uns aber gar nicht auffällt; es ist ein tief in Purpur getauchtes Buch, jedoch gänzlich ohne Flicken. Bei allem ständigen Stimmungswandel weckt uns hier kein Ruck, kein Holpern aus den Tiefen der Zustimmung und des Glaubens. Sterne gelingt es, in ein und demselben Atemzug zu lachen, höhnisch zu feixen, einen unanständigen Witz zu reißen und eine Passage wie diese anzuschließen:
… die Zeit schwindet zu rasch davon; jeder Buchstabe, den ich hinschreibe, sagt mir, mit welcher Schnelligkeit das Leben meiner Feder folgt; seine Tage und Stunden, die köstlicher sind, liebe Jenny!, als die Rubinen um deinen Hals, sie fahren über unsern Häuptern dahin gleich leichten Wolken an einem windigen Tag, ohne Wiederkehr – ein Jegliches dränget voran – während du noch diese Locke ringelst, – siehe! sie ist grau geworden; und jeder Kuß, den als Adieu auf deine Hand ich hauche, und jeder Abschied, so darauf folgt, sind Präludien jener ew’gen Trennung, die uns bald kommen muß. –
– Der Himmel erbarme sich unser!
KAP. IX.
Nun, was die Welt von diesem Stoßseufzer wohl vermeinet – keinen Groschen gäb’ ich drum.[11]
Worauf er sich Onkel Toby, dem Korporal, Mrs Shandy und allen übrigen wieder zuwendet.
Hier, wie man sieht, verwandelt sich Poesie flugs und ganz natürlich in Prosa, Prosa in Poesie. Ein wenig abseits stehend, legt Sterne die Hände leicht auf Phantasie, Witz und Einfallsreichtum; und so, hoch hinauflangend zwischen die Zweige, wo solche Dinge wachsen, begibt er sich selbstverständlich und zweifellos absichtlich seines Rechts auf die nahrhafteren Feldfrüchte, die am Boden wachsen. Denn leider stimmt es wohl, daß irgendein Verzicht unvermeidlich ist. Man kann die schmale Brücke der Kunst nicht überqueren mit allen ihren Werkzeugen in den Händen. Einige muß man zurücklassen, sonst läßt man sie mitten über dem Fluß fallen oder, was noch schlimmer ist, verliert selbst das Gleichgewicht und ertrinkt.
Diese namenlose Spielart des Romans wird also aus einem gewissen Abstand zum Leben geschrieben werden, denn das ermöglicht eine umfassendere Sicht auf einige seiner wichtigen Eigenheiten; sie wird in Prosa geschrieben werden, denn Prosa, von der Lasttierarbeit befreit, die ihr so viele Romanciers unvermeidlich aufbürden, von den Fudern an Einzelheiten, den Scheffeln an Fakten – Prosa, so gewendet, wird sich fähig zeigen, sich hoch vom Boden zu erheben, nicht pfeilgerade, aber doch in Bögen und Kreisen, und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben mit den Belustigungen und Eigentümlichkeiten des Menschen im täglichen Leben.
Es bleibt jedoch eine weitere Frage. Kann Prosa dramatisch sein? Gewiß, Shaw und Ibsen haben Prosa dramatisch benutzt, und das mit dem größten Erfolg, aber sie sind der dramatischen Form treu geblieben. Diese Form, das läßt sich prophezeien, ist nicht diejenige, die der Versdramatiker der Zukunft als die für seine Bedürfnisse geeignete betrachten wird. Ein Prosadrama ist für seine Zwecke zu starr, zu begrenzt, zu emphatisch. Es läßt die Hälfte der Dinge, die er sagen will, durch seine Maschen schlüpfen. All die Beobachtungen, all die Darlegungen, all den Reichtum, den er geben will, kann er nicht in Dialoge pressen. Dennoch gelüstet es ihn nach der explosiven emotionalen Wirkung des Dramas; er will seine Leser zur Ader lassen und nicht nur ihre intellektuelle Erregbarkeit streicheln und kitzeln. Die Lockerheit und die Freiheit von Tristram Shandy, so wunderbar sie solche Gestalten wie Onkel Toby und Korporal Trim umkreisen und zum Schweben bringen, versuchen nicht, diese Personen in dramatischem Kontrast aufzustellen und gegeneinander antreten zu lassen. Deshalb wird der Autor dieses schwierigen Buches auf seine tumultuarischen und widersprüchlichen Gefühle die verallgemeinernde und vereinfachende Kraft einer strengen und logischen Einbildungskraft einwirken lassen müssen. Tumult ist übel; Verwirrung ist abscheulich; alles in einem Kunstwerk sollte gebändigt und geordnet sein. Das Bemühen des Autors wird sein, zu verallgemeinern und aufzuspalten. Statt Einzelheiten aufzuzählen, wird er Blöcke formen. Seine Charaktere werden daher eine dramatische Kraft haben, die bei den minutiös ausgeführten Charakteren zeitgenössischer Romane häufig im Interesse der Psychologie geopfert wird. Und dann, obwohl das kaum sichtbar ist, so weit entfernt liegt es am Rande des Horizonts – kann man sich vorstellen, daß er seinen Interessenkreis weit genug vergrößert haben wird, um einige jener Einflüsse zu dramatisieren, die im Leben eine so große Rolle spielen, dem Romancier jedoch bislang entgangen sind – die Macht der Musik, der Reiz des Sichtbaren, die Wirkung der Form von Bäumen oder des Spiels von Farben auf uns, die Regungen, die Menschenmengen in uns hervorrufen, die dunklen Angst- und Haßgefühle, die so unerklärlich an bestimmten Orten oder in Gegenwart bestimmter Menschen in uns aufsteigen, die Freude der Bewegung, die berauschende Wirkung des Weins. Jeder Augenblick ist der Mittelpunkt und Treffpunkt ungeheuer vieler Wahrnehmungen, die noch nie ausgedrückt worden sind. Das Leben ist immer und zwangsläufig viel reicher als wir, die wir versuchen, es auszudrücken.
Aber es bedarf keiner großen Gabe der Prophetie für die Gewißheit, daß jeder, der zu tun versucht, was hier umrissen worden ist, all seinen Mut brauchen wird. Die Prosa wird nicht auf Geheiß des Erstbesten, der daherkommt, einen neuen Tanzschritt lernen. Doch wenn die Zeichen der Zeit irgend etwas wert sind, dann empfindet man allgemein das Bedürfnis nach neuen Entwicklungen. Sicher ist, daß es in England, Frankreich und Amerika vereinzelt Autoren gibt, die versuchen, sich aus Fesseln zu befreien, die ihnen lästig geworden sind; Autoren, die versuchen, ihre Haltung zu korrigieren, so daß sie wieder eine gelassene und natürliche Stellung einnehmen, in der sie ihre Kräfte voll entfalten und belangvollen Dingen zuwenden können. Und wenn uns ein Buch nicht durch seine Schönheit oder seinen Glanz beeindruckt, sondern als Ergebnis dieser Haltung, dann wissen wir, es trägt in sich die Saat fortdauernden Lebens.
Deutsch von Heidi Zerning
Anmerkungen
Der Essay erschien unter dem Titel ›Poetry, Fiction and the Future‹ in zwei Teilen am 14. und 21. August 1927 im New York Herald Tribune. Der Titel ›The Narrow Bridge of Art‹ stammt von LW.
Stunden in einer Bibliothek
Beginnen wir damit, daß wir der alten Verwechslung von Menschen, die die Gelehrsamkeit lieben, mit solchen, die das Lesen lieben, ein Ende bereiten und konstatieren, daß zwischen beiden keinerlei Zusammenhang besteht. Ein gelehrsamer Mann ist ein meist sitzender, konzentrierter, einsiedlerischer Enthusiast, der Bücher nach irgendeinem speziellen Körnchen Wahrheit durchsucht, an das er sein Herz gehängt hat. Sollte ihn die Leseleidenschaft überwältigen, schrumpfen seine Gewinne und zerrinnen ihm zwischen den Fingern. Ein Leser dagegen muß seinen Wunsch nach Wissen von Anfang an zügeln; falls Wissen an ihm kleben bleibt, schön und gut, aber sich auf die Suche danach zu begeben, nach einem System zu lesen, ein Spezialist oder eine Koryphäe zu werden, würde aller Voraussicht nach vernichten, was wir gern als die humanere Liebe zum reinen, auf keinen Gewinn bedachten Lesen betrachten.
All dem zum Trotz können wir mit Leichtigkeit ein Bild heraufbeschwören, das auf den bücherbesessenen Menschen zutrifft und ein Lächeln auf seine Kosten hervorruft. Wir sehen eine bleiche, hagere Gestalt im Morgenmantel, in Grübeleien versunken, unfähig, einen Kessel vom Herd zu heben oder eine Dame anzusprechen, ohne rot zu werden, ahnungslos, was die Tagesereignisse angeht, aber wohlvertraut mit den Katalogen der Antiquare, in deren dunklen Räumlichkeiten er die Stunden des Sonnenlichts verbringt – ein liebenswerter Charakter, ohne jeden Zweifel, mit seiner griesgrämigen Naivität, doch ohne die geringste Ähnlichkeit mit jenem anderen, auf den wir die Aufmerksamkeit lenken möchten. Denn der wahre Leser ist im wesentlichen jung. Er ist ein Mann von intensiver Neugier; voller Ideen; offen und mitteilsam, für den das Lesen eher so etwas wie ein flotter Spaziergang an der frischen Luft denn ein Aufenthalt in der Zurückgezogenheit eines Arbeitszimmers ist; er stapft über Landstraßen, klettert immer höher in die Berge hinauf, bis die Luft fast zu dünn ist, um noch atmen zu können; für ihn ist es überhaupt keine sitzende Beschäftigung.
Aber von allgemeinen Aussagen einmal abgesehen, wäre es nicht schwer, durch eine Zusammenstellung von Fakten zu beweisen, daß die große Zeit des Lesens das Alter zwischen achtzehn und vierundzwanzig ist. Allein die Liste dessen, was während dieser Zeit gelesen wird, erfüllt das Herz älterer Menschen mit Verzweiflung. Nicht nur, daß wir so viele Bücher gelesen haben, sondern daß wir solche Bücher zum Lesen hatten. Nehmen wir uns, um unsere Erinnerungen aufzufrischen, eines der alten Notizbücher hervor, die wir alle zu irgendeinem Zeitpunkt mit solcher Leidenschaft zu führen begannen. Die meisten Seiten sind leer, das ist wohl wahr; aber am Anfang finden wir eine gewisse Anzahl, die sehr schön mit auffallend leserlicher Schrift gefüllt sind. Hier haben wir die Namen großer Schriftsteller in der Rangfolge ihrer Verdienste aufgelistet; hier haben wir wundervolle Passagen aus den Klassikern abgeschrieben; hier sind Listen zu lesender Bücher; und hier, am interessantesten, Listen von Büchern, die tatsächlich gelesen wurden, wie der Leser mit einem gewissen Maß an jugendlicher Eitelkeit durch ein Häkchen in roter Tinte bezeugt. Wir wollen eine Liste der Bücher zitieren, die jemand in irgendeinem vergangenen Januar im Alter von zwanzig Jahren gelesen hat, die meisten davon wahrscheinlich zum ersten Mal. 1. Rhoda Fleming. 2. The Shaving of Shagpat. 3. Tom Jones. 4. The Laodicean. 5. Psychology von Dewey. 6. Das Buch Hiob. 7. Webbes Discourse of Poesie. 8. The Duchess of Malfi. 9. The Revenger’s Tragedy.[12] Und so geht es Monat um Monat weiter, bis die Listen, wie es bei solchen Listen oft der Fall ist, im Monat Juni plötzlich aufhören. Doch wenn wir dem Leser durch die Monate folgen, wird klar, daß er praktisch nichts anderes getan haben kann als lesen. Die elisabethanische Literatur wurde mit einiger Gründlichkeit durchgegangen; er las eine Menge Webster, Browning, Shelley, Spenser und Congreve; Peacock las er von Anfang bis Ende; und die meisten Romane Jane Austens zwei- oder dreimal.[13] Er las den ganzen Meredith, den ganzen Ibsen, und ein wenig Bernard Shaw. Wir dürfen zudem ziemlich sicher sein, daß die Zeit, die nicht mit Lesen verbracht wurde, irgendeiner hitzigen Debatte gewidmet war, in der die Griechen gegen neuzeitliche Autoren ins Feld geführt wurden, die Romantik gegen den Realismus, Racine gegen Shakespeare, bis man bemerkte, daß der Lichtschein der Lampen in der Morgendämmerung verblaßt war.
Die alten Listen sind dazu da, uns lächeln und vielleicht ein wenig seufzen zu lassen, aber wir würden viel dafür geben, wenn wir auch die Stimmung zurückholen könnten, in der diese Orgie des Lesens stattfand. Zum Glück war unser Leser kein Wunderkind, und mit ein bißchen Nachdenken können sich die meisten von uns zumindest an die Phasen unserer eigenen Initiation erinnern. Die Bücher, die wir in der Kindheit lasen, nachdem wir sie heimlich von irgendeinem Regal stibitzt hatten, das für uns als unerreichbar galt, besitzen etwas von der Unwirklichkeit und Erhabenheit einer heimlichen Betrachtung der Morgendämmerung, die über stillen Feldern hereinbricht, während der Rest des Hauses schläft. Durch die Vorhänge spähend sehen wir die fremdartigen Umrisse nebelverhangener Bäume, die wir kaum erkennen, obwohl wir sie vielleicht unser ganzes Leben lang in Erinnerung behalten; denn Kinder haben seltsame Vorahnungen dessen, was kommen wird. Das spätere Lesen dagegen, für das die oben angeführte Liste ein Beispiel sein mag, ist etwas völlig anderes. Vielleicht zum ersten Mal sind alle Einschränkungen weggefallen, wir können lesen, was wir wollen; Bibliotheken stehen uns zur Verfügung und, was das Beste ist, Freunde, die sich in derselben Lage befinden wie wir. Tagelang tun wir nichts anderes als lesen. Es ist eine Zeit außergewöhnlicher Erregung und Verzückung. Wie im Rausch scheinen wir überall Helden zu entdecken. In uns ist eine Art Staunen, daß wir das alles wirklich selbst tun, und, damit vermischt, eine absurde Arroganz und der Wunsch, unsere Vertrautheit mit den großartigsten Menschen kundzutun, die je auf dieser Welt wandelten. Die Gier nach Wissen ist zu dieser Zeit am leidenschaftlichsten oder zumindest am selbstbewußtesten, und zudem besitzen wir ein intensives Gefühl der Einzigartigkeit, das die großen Schriftsteller bestätigen, indem sie den Anschein erwecken, als stimmten sie in ihrer Einschätzung all dessen, was im Leben gut ist, mit uns überein. Und da es unabdingbar ist, uns gegen jemanden zu behaupten, der sich beispielsweise Pope statt Sir Thomas Browne[14] zum Helden erkoren hat, empfinden wir eine tiefe Zuneigung zu diesen Männern und haben das Gefühl, sie nicht so zu kennen, wie andere Menschen sie kennen, sondern ganz persönlich, für uns allein. Wir kämpfen unter ihrer Führung und sozusagen unter ihren Augen. Und so geistern wir durch die Antiquariate und schleppen Folio- und Quartbände nach Hause, Euripides zwischen Holzdeckeln und Voltaire in neunundachtzig Oktavbändchen.
Diese Listen sind jedoch insofern seltsame Dokumente, als sie kaum einen der zeitgenössischen Schriftsteller zu enthalten scheinen. Meredith und Hardy und Henry James waren zwar noch am Leben, als unser Leser sie entdeckte, galten jedoch bereits als Klassiker. Es gibt niemanden seiner eigenen Generation, der ihn so beeinflußt, wie Carlyle oder Tennyson oder Ruskin[15] die jungen Leute ihrer Zeit beeinflußten. Und das, so glauben wir, ist sehr charakteristisch für einen jungen Menschen, denn sofern es keinen anerkannten Giganten gibt, will er nichts mit unbedeutenderen Geistern zu tun haben, obwohl sie sich mit der Welt befassen, in der er lebt. Lieber geht er zurück zu den Klassikern und verkehrt ausschließlich mit Denkern von allererstem Rang. Für den Augenblick steht er über allen menschlichen Aktivitäten und beurteilt sie, aus seiner Distanz heraus, mit erlesener Strenge.
Eines der Anzeichen schwindender Jugend ist in der Tat die Geburt eines Gefühls der Verbundenheit mit anderen menschlichen Wesen, unter denen wir allmählich unseren Platz einnehmen. Wir würden gern denken, daß wir unseren Maßstab ebenso hoch ansetzen wie eh und je; doch interessieren wir uns zunehmend für das, was unsere Zeitgenossen schreiben, und verzeihen ihnen ihren Mangel an Eingebung, weil sie etwas besitzen, was sie uns näherbringt. Es ist sogar denkbar, daß die lebenden Autoren uns tatsächlich mehr geben als die toten, obwohl sie ihnen vielleicht weit unterlegen sind. Zunächst einmal kann keine heimliche Eitelkeit damit verbunden sein, unsere Zeitgenossen zu lesen, und die Art der Bewunderung, die sie in uns wecken, ist äußerst herzlich und echt, denn um Glauben an sie zu fassen, müssen wir oft irgendein sehr respektables Vorurteil aufgeben, das uns zur Ehre gereicht. Außerdem müssen wir unsere eigenen Gründe dafür finden, was wir mögen oder nicht mögen, was Ansporn für unsere Aufmerksamkeit und der beste Beweis dafür ist, daß wir die Klassiker mit Verstand gelesen haben.
In einer großen Buchhandlung zu stehen, die bis unter die Decke mit Büchern vollgepackt ist, die so neu sind, daß ihre Seiten fast noch zusammenkleben, und auf deren Rücken das Gold noch ganz frisch ist, erfüllt uns daher mit einer Erregung, die genauso herrlich ist wie die alte Erregung am Stand mit gebrauchten Büchern. Vielleicht ist sie nicht ganz so erhebend. Aber der alte Hunger, zu wissen, was die Unsterblichen dachten, hat der weit toleranteren Neugier Platz gemacht, zu erfahren, was unsere eigene Generation denkt. Was fühlen lebende Männer und Frauen, wie sehen ihre Häuser aus und welche Kleider tragen sie, wieviel Geld besitzen sie und welche Speisen nehmen sie zu sich, was lieben und was hassen sie, was sehen sie von der Welt um sie herum, und welcher Traum füllt die Lücken in ihrem aktiven Leben aus? All das erzählen sie uns in ihren Büchern. Darin können wir ebensoviel vom Geist und vom Körper unserer Zeit entdecken, wie wir mit den Augen sehen können.
Wenn dieser Geist der Neugier uns ganz ergriffen hat, sammelt sich der Staub bald schon dick auf den Klassikern, es sei denn, irgendeine Notwendigkeit zwingt uns, sie zu lesen. Denn die lebenden Stimmen sind schließlich die, die wir am besten verstehen. Wir können sie behandeln, wie wir unseresgleichen behandeln; sie erraten unsere Rätsel und, was vielleicht wichtiger ist, wir verstehen ihre Witze. Und bald entwickeln wir eine weitere Vorliebe, die von den Großen nicht befriedigt wurde – vielleicht keine wertvolle Vorliebe, aber auf jeden Fall eine sehr angenehme –, wir finden Geschmack an schlechten Büchern. Ohne die Indiskretion zu begehen, Namen zu nennen, wissen wir, bei welchen Schriftstellern wir darauf vertrauen können, daß sie jährlich (denn zum Glück sind sie sehr produktiv) einen Roman, einen Gedichtband oder eine Essaysammlung hervorbringen, die uns unbeschreibliches Vergnügen bereiten. Wir verdanken schlechten Büchern ungemein viel; tatsächlich fangen wir irgendwann an, ihre Verfasser und ihre Helden zu den Personen zu zählen, die eine große Rolle in unserem stillen Leben spielen. Etwas Ähnliches geschieht im Fall der Memoirenschreiber und Autobiographen, die in unserer Zeit fast einen neuen Zweig der Literatur geschaffen haben. Nicht alle von ihnen sind bedeutende Persönlichkeiten, aber seltsamerweise sind nur die bedeutendsten, die Herzöge und die Staatsmänner, wirklich langweilig. Jene Männer und Frauen, die sich vielleicht nur mit der Begründung, daß sie den Herzog von Wellington einmal zu Gesicht bekamen, daran machen, uns ihre Überzeugungen anzuvertrauen, ihre Streitigkeiten, ihre Sehnsüchte und ihre Krankheiten, verwandeln sich normalerweise irgendwann, zumindest für den Augenblick, in Darsteller in jenen privaten Dramen, mit denen wir uns unsere einsamen Spaziergänge und unsere schlaflosen Stunden verkürzen. Filterte man das alles aus unserem Bewußtsein heraus, wären wir in der Tat arm. Und dann gibt es die Sach- und die Geschichtsbücher, Bücher über Bienen und Wespen und Industrien und Goldminen und Kaiserinnen und diplomatische Intrigen, über Flüsse und wilde Eingeborene, Gewerkschaften und Gesetzesvorlagen, die wir ständig lesen und, ach ja, ständig vergessen. Vielleicht tun wir der Sache der Buchhandlungen keinen Gefallen, wenn wir zugeben müssen, daß sie so viele Sehnsüchte erfüllen, die anscheinend nichts mit Literatur zu tun haben. Aber wir müssen auch bedenken, daß wir es hier mit einer Literatur im Werden zu tun haben. Unter diesen neuen Büchern werden unsere Kinder das eine oder die zwei auswählen, anhand deren man uns für immer kennen wird. Hier liegt, wenn wir es nur erkennen könnten, irgendein Gedicht, ein Roman, eine Erzählung, die aufstehen und sich mit anderen Zeitaltern über unser Zeitalter unterhalten werden, wenn wir selbst so starr und stumm daliegen, wie die Menschen aus Shakespeares Zeit verstummt sind und nur auf den Seiten seiner Dichtung für uns weiterleben.
Das halten wir für die Wahrheit; und doch ist es im Fall neuer Bücher eigenartig schwierig zu wissen, welches die wahren Bücher sind und was sie uns sagen, und welches die aufgeblasenen, die in sich zusammenfallen werden, wenn sie ein oder zwei Jahre herumgelegen haben. Wir sehen, daß es viele Bücher gibt, und hören oft, daß heutzutage jeder schreiben könne. Das mag stimmen; und doch bezweifeln wir nicht, daß im Inneren dieser immensen Beredsamkeit, dieses Flutens und Schäumens der Sprache, dieser Geschwätzigkeit und Vulgarität und Trivialität, die Hitze einer großen Leidenschaft liegt, die nur der Zufälligkeit eines Geistes bedarf, der glücklicher veranlagt ist als der Rest, um eine Form anzunehmen, die die Zeiten überdauern wird. Es sollte uns ein Vergnügen sein, diesen Tumult zu beobachten, uns mit den Ideen und Visionen unserer eigenen Zeit auseinanderzusetzen, uns anzueignen, was wir verwenden können, zu vernichten, was wir als wertlos erachten, und vor allem zu erkennen, daß wir großzügig gegenüber den Menschen sein müssen, die, so gut sie können, den Gedanken, die in ihnen stecken, Form verleihen. Kein Zeitalter der Literatur beugt sich der Autorität so wenig wie unseres; keines scheint so frei von der Vorherrschaft der Großen, keines so unberechenbar darin, wem es Respekt zollt, oder so unstet in seinen Experimenten. Selbst aufmerksamen Beobachtern mag es scheinen, als gebe es keine Spur von einer Schule oder einem Ziel in den Werken unserer Dichter oder Romanschriftsteller. Allerdings ist der Pessimist überall anzutreffen, doch soll er uns nicht davon überzeugen, daß unsere Literatur tot ist, oder uns daran hindern zu fühlen, wie wahr und lebhaft Schönheit aufleuchtet, wie die jungen Schriftsteller, um ihre neue Vision zu schaffen, die uralten Wörter der schönsten aller lebenden Sprachen um sich sammeln. Was immer wir aus der Lektüre der Klassiker gelernt haben mögen, wir brauchen es jetzt, um die Arbeiten unserer Zeitgenossen zu beurteilen, denn wenn je Leben in ihnen ist, werden sie ihr Netz über irgendeinen unbekannten Abgrund auswerfen, um neue Formen einzufangen, und wir müssen dann unsere Phantasie auswerfen, wenn wir die seltsamen Geschenke, die sie uns bringen, annehmen und verstehen wollen.
Doch wenn wir all unsere Kenntnis der alten Schriftsteller brauchen, um nachvollziehen zu können, was die neuen Schriftsteller versuchen, gilt sicherlich auch, daß wir von unseren Streifzügen durch die neuen Bücher mit einem viel schärferen Blick für die alten zurückkommen. Es scheint, als müßten wir nun in der Lage sein, ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen; tief in ihre Werke hineinblicken zu können und zu sehen, wie die Teile sich zusammenfügen, weil wir die Entstehung neuer Bücher beobachtet haben und mit Augen, die frei von Vorurteilen sind, wahrhaftiger beurteilen können, was sie tun und was gut und was schlecht ist. Womöglich werden wir feststellen, daß einige der Großen weniger verehrungswürdig sind, als wir dachten. Tatsächlich sind sie nicht so vortrefflich oder so tiefgründig wie manche unserer eigenen Zeit. Doch wenn das in ein oder zwei Fällen zuzutreffen scheint, überkommt uns anderen gegenüber eine Art Demut, gemischt mit Freude. Nehmen wir Shakespeare, oder Milton, oder Sir Thomas Browne. Unser geringes Wissen darüber, wie Dinge gemacht werden, nützt uns hier nicht viel, verleiht unserem Entzücken aber eine zusätzliche Würze. Empfanden wir in unserer Jugend je ein derartiges Staunen über ihre Leistung wie das, das uns nun erfüllt, da wir auf der Suche nach neuen Formen für unsere neuen Empfindungen unzählige Wörter gesiebt und unerforschte Wege beschritten haben? Neue Bücher mögen in mancher Hinsicht stimulierender und in mancher anregender sein als die alten, aber sie geben uns nicht jene absolute Gewißheit des Vergnügens, das uns durchweht, wenn wir zu Comus zurückkehren, zu Lycidas,[16]Urn Burial oder Antony and Cleopatra. Es liegt uns fern, eine Theorie über das Wesen der Kunst zu wagen. Vielleicht werden wir nie mehr darüber wissen, als wir von Natur aus wissen, und unsere längere Erfahrung damit lehrt uns nur dies – daß unter all unseren Genüssen jene, die die großen Künstler uns bereiten, unbestreitbar zu den besten gehören; und mehr brauchen wir vielleicht nicht zu wissen. Aber, ohne eine Theorie vorbringen zu wollen, wir werden in Werken wie diesen ein oder zwei Besonderheiten finden, welche wir in Büchern, die während unserer eigenen Lebenszeit geschrieben wurden, kaum erwarten können. Vielleicht besitzt das Alter an sich eine eigene Alchimie. Aber es stimmt: man kann sie so oft lesen, wie man will, ohne feststellen zu müssen, daß sie an Kraft verloren und eine bedeutungslose Worthülse zurückgelassen haben; und sie besitzen eine absolute Endgültigkeit. Keine Wolke von Andeutungen schwebt über ihnen und neckt uns mit einer Vielzahl irrelevanter Gedanken. Vielmehr sind all unsere Fähigkeiten gefordert, wie in den großen Augenblicken unserer eigenen Erfahrung; und eine Weihe sinkt aus ihren Händen auf uns herab, welche wir ans Leben zurückgeben, das wir intensiver empfinden und tiefer verstehen als zuvor.
Deutsch von Brigitte Walitzek
Anmerkungen
Der Essay erschien am 30. November 1916 im Times Literary Supplement (TLS). Der Titel erinnert an Leslie Stephens vierbändige Sammlung seiner kritischen Essays, Hours in a Library, die 1874 und 1876 erschienen war.
Leidenschaftliche Prosa
Als De Quincey noch ein Junge war, löste sein eigener Scharfblick bei ihm Zweifel aus, ob »seine natürliche Berufung auf dem Gebiete der Poesie lag«.[17] Er schrieb eine Fülle sprachgewandter Gedichte, und sie wurden gelobt; trotzdem kam er zu dem Schluß, daß er kein Dichter sei, und die sechzehn Bände seiner gesammelten Werke sind ausschließlich Prosa. Im Stile seiner Zeit schrieb er über viele Themen – über Nationalökonomie, über Philosophie, über Geschichte; er schrieb Essays, Biographien, Bekenntnisse und Memoiren. Aber wenn wir jetzt vor der langen Reihe seiner Bücher stehen und, wie wir es nach all diesen Jahren tun müssen, unsere eigene Auswahl treffen, scheint die gesamte Masse und Breite dieser sechzehn Bände zu einer einzigen dunklen Fläche zusammenzuschrumpfen, in der einige wenige Sterne prangen. Er lebt in unserem Gedächtnis fort, weil er Formulierungen finden konnte wie »Bangnisse zahlloser Flüchtlinge«, weil er Szenen komponieren konnte wie die der lorbeergeschmückten Kutsche, die auf den mitternächtlichen Marktplatz fährt, weil er Geschichten erzählen konnte wie die vom Geist des Holzfällers, der von seinem Bruder auf der einsamen Insel gehört wird. Und wenn wir unsere Wahl prüfen und einen Grund dafür angeben wollen, müssen wir gestehen, auch wenn er ein Prosaschriftsteller ist, so lesen wir ihn wegen seiner Poesie und nicht wegen seiner Prosa.
Was könnte schädlicher sein, für ihn, den Schriftsteller, und für uns, die Leser, als dieses Geständnis? Denn wenn die Kritiker sich über eines einig sind, dann darüber, daß es nichts Verwerflicheres für einen Prosaschriftsteller gibt als zu schreiben wie ein Dichter. Poesie ist Poesie und Prosa ist Prosa – wie oft haben wir das nicht gehört! Poesie hat eine Aufgabe und Prosa eine andere. Prosa, so schrieb Mr Binyon kürzlich, »ist ein Medium, das sich vornehmlich an den Verstand richtet, Poesie dagegen an das Gefühl und die Phantasie«. Und weiter, »die poetische Prosa ist nur von Bankertschönheit und wirkt leicht zu herausgeputzt«.[18] Es ist unmöglich, die Wahrheit dieser Bemerkungen nicht wenigstens teilweise anzuerkennen. Das Gedächtnis liefert nur allzu viele Beispiele von Unbehagen, von Qual, wenn mitten in nüchterner Prosa plötzlich die Temperatur steigt, der Rhythmus sich ändert, wir mit einem Ruck hochschnellen, dann mit einem Rums zu Boden fallen und aufwachen, verstört und verärgert. Aber das Gedächtnis liefert auch eine Reihe von Passagen – bei Browne, bei Landor, bei Carlyle, bei Ruskin, bei Emily Brontë[19] –, wo es keinen solchen Stoß gibt, kein solches Gefühl (denn dies ist vielleicht die Quelle unseres Unbehagens) von etwas Unverschmolzenem, Unverbundenem, Unpassendem, das alles andere ins Lächerliche zieht. Der Prosaschriftsteller hat sich seine Armee von Fakten untertan gemacht; er hat sie alle denselben Gesetzen der Perspektive untergeordnet. Sie wirken auf unser Bewußtsein ein, wie es die Dichtung auf ihre Weise tut. Wir werden nicht aufgeweckt; wir erreichen den nächsten Gedanken – und es kann durchaus ein höchst banaler sein – ohne jegliches Gefühl von Mühe.
Aber, zum Leidwesen all jener, die es gerne sähen, wenn wesentlich mehr Dinge in Prosa ausgedrückt würden, als jetzt für geziemend gelten, wir leben unter der Herrschaft der Romanciers. Wenn wir von Prosa sprechen, meinen wir in Wahrheit erzählende Prosa. Und von allen Schriftstellern hält der Romancier die meisten Fakten in Händen. Smith steht auf, rasiert sich, nimmt sein Frühstück ein, schlägt sein Ei auf und liest die Times. Wie können wir den keuchenden, den schwitzenden, den emsigen Schreiber, der all das am Hals hat, bitten, elegant hinüberzuwechseln zu Rhapsodien über die Zeit und den Tod und das, was die Jäger auf den Antipoden treiben? Es würde das Gleichmaß seines Tages völlig durcheinanderbringen. Es würde zu schweren Zweifeln an seiner Wahrheitsliebe Anlaß geben. Zudem scheinen die Größten seiner Zunft ganz bewußt eine Methode zu bevorzugen, die das Gegenteil von poetischer Prosa ist. Ein Achselzucken, ein Wenden des Kopfes, einige wenige, im Augenblick der Krise hastig gesprochene Worte – das ist alles. Aber die Lunte ist so tief unter Seite um Seite und Kapitel um Kapitel ausgelegt worden, daß das eine Wort, wenn es ausgesprochen wird, genügt, um die Explosion herbeizuführen. Wir haben so intensiv mit diesen Männern und Frauen gelebt und gedacht, daß sie nur einen Finger zu heben brauchen, und er scheint bis in den Himmel zu reichen. Diese Geste auszuschmücken hieße, sie zu verderben. Die Romanliteratur strebt also insgesamt von der poetischen Prosa fort. Die geringeren Romanciers werden keine Risiken eingehen, die von den größeren bewußt gemieden werden. Sie verlassen sich darauf, wenn nur das Ei real ist und der Kessel kocht, dann werden die Sterne und die Nachtigallen irgendwie von der Phantasie des Lesers hinzugefügt werden. Und deshalb schenken sie der Seite des Geistes, die in der Einsamkeit zu Tage tritt, keinerlei Beachtung. Sie mißachten seine Gedanken, seine Rhapsodien, seine Träume, mit dem Ergebnis, daß die Menschen in Romanen, die auf der einen Seite vor Energie platzen, auf der anderen verkümmert sind; während die Prosa selbst, so lange im Dienste dieses Zuchtmeisters, die gleiche Deformation erlitten hat und nach weiteren hundert Jahren solcher Disziplin zu nichts weiter taugen wird als zum Schreiben der unsterblichen Werke von Bradshaw und Baedeker.[20]
Aber zum Glück gibt es in jeder Epoche Schriftsteller, die den Kritikern Rätsel aufgeben, die sich weigern, den Pferch der Herde zu teilen. Sie setzen den Fuß starrsinnig über die Grenzlinien und leisten durch Erweiterung und Befruchtung und Beeinflussung einen größeren Dienst als durch ihr eigentliches Werk, das in der Tat oft zu exzentrisch ist, um Gefallen zu finden. Browning leistete der Poesie einen Dienst dieser Art. Peacock und Samuel Butler[21] haben beide einen Einfluß auf Romanciers ausgeübt, der in keinem Verhältnis zu ihrer eigenen Bekanntheit steht. Und De Quincey hat unter anderem Anspruch auf unsere Dankbarkeit, fesselt vor allem unser Interesse, weil er eine Ausnahme war und ein Solitär. Er bildete eine Kategorie für sich. Er ermöglichte anderen ein breiteres Spektrum. Angesichts des üblichen Problems, was schreiben, denn schreiben mußte er, kam er zu dem Schluß, daß er bei all seiner poetischen Sensibilität kein Dichter war. Ihm fehlten das Feuer und die Konzentration. Ein Romancier war er andererseits auch nicht. Trotz der ungeheuren Sprachgewalt, die ihm zu Gebote stand, war er unfähig, ein anhaltendes und leidenschaftliches Interesse für die Angelegenheiten anderer Menschen aufzubringen. Es sei seine Krankheit, sagte er, »zu viel zu meditieren und zu wenig zu beobachten«. So folgte er einer armen Familie, die an einem Samstagabend zu Markte zog, mitfühlend, aber distanziert. Er stand niemandem nahe. Dann wiederum besaß er eine außerordentliche Begabung für die toten Sprachen und eine Leidenschaft für die Aneignung von Wissen aller Art. Aber es steckte eine Eigenart in ihm, die ihm verbot, sich allein mit seinen Büchern einzuschließen, worauf solche Begabungen hinzudeuten schienen. Die Wahrheit war, daß er träumte – er träumte ständig. Diese Fähigkeit war ihm zu eigen lange bevor er sich angewöhnte, Opium zu nehmen. Als er noch ein Kind war, stand er am Leichnam seiner Schwester, und plötzlich
schien sich im Zenit des weiten blauen Himmels ein Gewölbe aufzutun, ein Schacht, der ewig emporstrebte. Ich stieg im Geiste wie auf Wogen auf, die in dem Schacht gleichermaßen ewig emporstrebten; und die Wogen schienen den Thron Gottes zu verfolgen; aber auch der stieg vor uns auf und floh unaufhörlich.[22]
Die Visionen waren von ungeheurer Lebhaftigkeit; sie ließen das Leben ein wenig langweilig erscheinen; sie dehnten es aus, sie vervollständigten es. Aber in welcher Form sollte er das ausdrücken, was der realste Teil seiner eigenen Existenz war? Ihm stand keine vorgefertigte zur Verfügung. Er erfand, so behauptete er, »Tonarten leidenschaftlicher Prosa«. Mit großer Kunstfertigkeit formte er einen Stil, um diesen »visionären Szenen, gewonnen aus der Welt der Träume«, Ausdruck zu geben. Solche Prosa, glaubte er, war bislang ohne Beispiel; und er bat die Leser inständig, sich »die gefahrvolle Schwierigkeit« eines Versuchs zu vergegenwärtigen, bei dem »eine einzige falsche Note, ein einziges Wort in einer falschen Tonart die ganze Musik zugrunde richtet«.