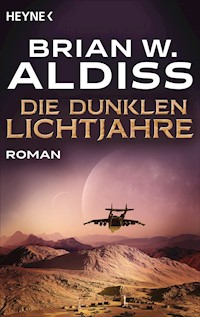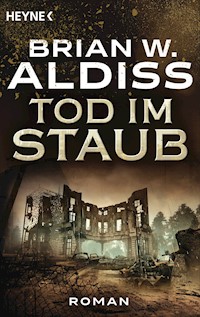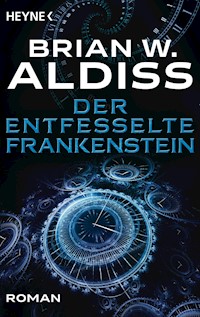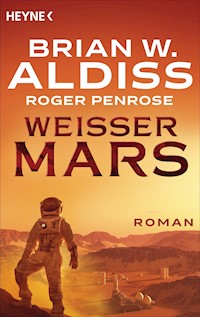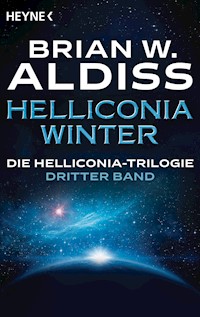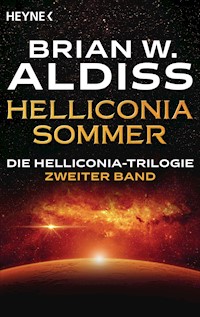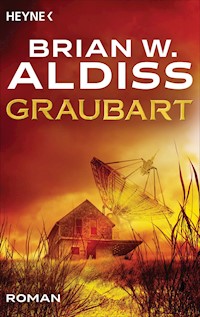
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Viele Wissenschaftler hatten eindringlich davor gewarnt, doch die Militärs glaubten, nicht auf sie verzichten zu können, also wurden Atombombentests im Orbit, außerhalb der Atmosphäre, durchgeführt. Zunächst schienen die Befürchtungen grundlos gewesen zu sein. Doch dann stellte sich heraus, dass keine Kinder mehr geboren wurden. Die Menschheit hatte es fertiggebracht, sich selbst zu sterilisieren. Die Menschen wurden immer älter, die sozialen Strukturen wandelten sich den Erfordernissen entsprechend, die Zivilisation begann zu erlöschen. Nur eines blieb: Das zählebige Gerücht, es würden dann und wann doch noch Kinder geboren. Nur blieben sie unsichtbar ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BRIAN W. ALDISS
GRAUBART
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Viele Wissenschaftler hatten eindringlich davor gewarnt, doch die Militärs glaubten, nicht auf sie verzichten zu können, also wurden Atombombentests im Orbit, außerhalb der Atmosphäre, durchgeführt. Zunächst schienen die Befürchtungen grundlos gewesen zu sein. Doch dann stellte sich heraus, dass keine Kinder mehr geboren wurden. Die Menschheit hatte es fertiggebracht, sich selbst zu sterilisieren. Die Menschen wurden immer älter, die sozialen Strukturen wandelten sich den Erfordernissen entsprechend, die Zivilisation begann zu erlöschen. Nur eines blieb: Das zählebige Gerücht, es würden dann und wann doch noch Kinder geboren. Nur blieben sie unsichtbar …
Der Autor
Brian Wilson Aldiss, OBE, wurde am 18. August 1925 in East Dereham, England, geboren. Nach seiner Ausbildung leistete er ab 1943 seinen Wehrdienst in Indien und Burma, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb er bis 1947 auf Sumatra, ehe er nach England zurückkehrte, wo er zunächst als Buchhändler arbeitete. Dort begann er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, anfangs noch unter Pseudonym. Seinen Durchbruch hatte er mit Fahrt ohne Ende, einem Roman über ein Generationenraumschiff. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der lange Nachmittag der Erde, für das er 1962 mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, und die Helliconia-Saga, mit der er den BSFA, den John W. Campbell Memorial Award und den Kurd Laßwitz Preis gewann. Brian Aldiss starb am 19. August 2017 im Alter von 92 Jahren in Oxford.
Erfahren Sie mehr über Brian W. Aldiss und seine Werke auf
www.diezukunft.de
www.diezukunft.de
Titel der Originalausgabe
GREYBEARD
Aus dem Englischen von Reinhard Heinz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1964 by Brian W. Aldiss
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Nele Schütz, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-25656-2V001
Inhalt
1. Der Fluss: Sparcot
2. Cowley
3. Der Fluss: Jahrmarkt von Swifford
4. Washington
5. Der Fluss: Oxford
6. London
7. Der Fluss: das Ende
In Liebe
für Clive und Wendy,
die hoffentlich eines Tages
die Geschichte hinter dieser Geschichte
verstehen werden.
1. Kapitel
Der Fluss: Sparcot
Ein Gewehr hing an einem Lederband über seine linke Schulter. Schweigend bewegte er sich zwischen Bergahornbäumen hindurch, die so groß waren wie er selbst. Auf dem Weg vor ihm sonnte sich eine Schlange. Der Tag war warm für diese Jahreszeit. Er sah an der Musterung, dass es sich um eine harmlose Grasschlange handelte. Sie verschwand bei seiner Annäherung im Gebüsch. Er hatte sie dort schon einmal gesehen.
Als er zum Fischteich kam, sprang eine Wasserratte mit leisem Platschen ins Wasser. Das geschah jedes Mal.
Graubart arbeitete sich zwischen den Ästen, die über dem Wasser hingen, um das Ufer des Teiches herum vor. Er zertrat Zweige und roch wieder den muffig-süßen Duft ihres Marks, einen Duft, den er seit seiner Kindheit kannte. Er sah in den Teich hinunter. Es gab so reichlich Fische wie immer.
Alles war wie zuvor. Die Jahre liefen durch ihre Zyklen, aber nichts änderte sich.Er konnte in die Untiefen sehen, wo ein Döbel unter dem Ufer zwischen Unkraut wartete. Oder er konnte die Wasseroberfläche beobachten. Es gab einen reflektierten blauen Himmel, der mit Wolken übersät war. Er stand eine Weile da, wo er war, bevor er sich erinnerte. Dann konnte er sich nicht erinnern, was seine Gedanken gewesen waren.
Nun, murmelte er halb laut, alles wäre unerträglich, wenn sie nicht wäre … Martha … und dieser Gedanke war nicht neu.
Er wandte sich ab, wo eine bröckelnde Mauer stand, überwuchert mit Farn. Einst hatte die Mauer die Grenze eines privaten Anwesens markiert. Jetzt gab es keine privaten Grundstücke mehr, die Mauer zeigte die Grenzen des Dorfes Sparcot und die Grenzen von Graubart Patrouille an.Er schob das Gewehr von seiner Schulter und sah über die Wand. Sein Gefühl der Gefahr wurde durch Wiederholung getrübt. Seit vielen Jahren zweimal in der Woche, bei Regen oder Sonnenschein, hatte er diese bescheidene Grenze patrouilliert, Schneeglöckchen unter dem Schutz der Mauer entdeckt, die Hecken voller glänzender Brombeeren gesehen, die ganze Szene hell und unfruchtbar unter Schnee gefunden … Irgendwo in der Richtung, in die er spähte, lag Grafton Lock, regiert von der wilden Gipsy Joan; aber ihr Stamm war wenig bedrohlich. Männer des Dorfes sagten von Joan, dass sie keine Unterwäsche trug. Er lächelte bei dem Gedanken vor sich hin. Auch für eine alternde Bevölkerung blieb Sex von beständigem Interesse.
Dann bestand die Möglichkeit einer weiteren Invasion von Wieseln, die das Flussufer heimsuchten, wie es in den letzten Jahren dreimal geschehen war. Aber an diesem friedlichen Tag bewegte sich nichts. Vom Tierleben sah er nur eine wilde Katze, regungslos auf einem toten Baumstumpf.
Er wartete darauf, dass die Katze herabsprang, aber sie bewegte sich nicht. Endlich drehte er sich um. Ein leichter Dunst lag über Sparcot und seinem Weideland. In seine Nasenlöcher stieg der stechende Steinzeitgeruch von Holzrauch. Alles war, wie es immer war. Und wie es immer sein würde.
Er wusste nicht, wie der Wochentag genannt wurde. Eines war jedoch sicher: In zwei Tagen würde er wieder auf Patrouille sein, dieselben Wege beschreiten und dieselben Ausblicke beobachten. Und warten.
Die Tage näherten sich der Zeit, welche die Leute immer noch Weihnachten nannten.
Vier kleine Wiesel schwammen durch den Bach. Sie kletterten aus dem kühlen Wasser und tapsten durch totes Schilf das Ufer hinauf. Ihre Körper waren tief am Boden, ihre Hälse ausgestreckt, die Jungen ahmten ihre Mutter nach. Sie hielten sich in Deckung und schauten hungrig auf Kaninchen, die nur wenige Meter vor ihrer Nase nach Nahrung suchten.
Wo die Kaninchen knabberten, war einst Weizenland gewesen. Die Jahre der Vernachlässigung nutzend, war Unkraut aufgekommen, hatte die Oberhand gewonnen und das Getreide erstickt. Später hatte sich ein Feuer übers Land gewälzt und die Disteln und riesigen Gräser niedergebrannt. Kaninchen, die niedrige Flora bevorzugen, hatten sich eingenistet und die frischen grünen Triebe, die durch die Asche sprossen, benagt. Die Triebe, die das Jäten überlebten, hatten reichlich Platz zum Wachsen vorgefunden und waren inzwischen zu stattlichen Schösslingen gediehen. Infolgedessen hatte sich die Zahl der Kaninchen verringert, da Kaninchen offenes Gelände mögen; folglich hatte das Gras wieder die Möglichkeit, sich auszubreiten. Nun wurde es seinerseits dünn gehalten unter den ständig schwellenden Birken. Die wenigen Kaninchen, die hier herumhoppelten, hatten schmächtige Flanken.
Und sie waren wachsam. Eins von ihnen sah die runden, glänzenden Augen, die aus den Binsen lugten. Es hüpfte in Deckung, und die anderen taten es ihm gleich. Sofort preschten die erwachsenen Wiesel los und huschten als braune Streifen über die offene Stelle. Die Kaninchen flitzten in ihre Baue. Ohne innezuhalten, folgten die Wiesel hinterher. Sie kamen überallhin. Die Welt – dieser winzige Flecken Erde – gehörte ihnen. In kürzester Zeit waren ihre Schnauzen blutig und sie schlemmten.
Nicht viele Meilen davon entfernt war unter demselben flockigen Winterhimmel und an den Ufern desselben Flusses die Wildnis eingedämmt. Im dichten Grün war nach wie vor ein Muster zu erkennen; es war ein überholtes Muster, sodass es Jahr für Jahr mehr verblasste. Große Bäume, an denen hie und da noch ein rot gefärbtes Blatt hing, markierten die Position alter Hecken. Sie umschlossen wuchernde Vegetation, die einstigen Äcker. Brombeeren sprossen, die sich wie rostiger Stacheldraht einen Weg zur Mitte der Felder bahnten, Holunder und dornige Heckenrosen sowie stämmige Baumschösslinge. Entlang des Rands der Lichtung dienten diese widerspenstigen Hecken als Bollwerk gegen weiteres Wachstum, das sich in einem weiten, krummen Bogen dahinzog und somit ein Gebiet von einigen Hundert Morgen abschirmte, dessen längere Seite sich an den Fluss lehnte.
Dieses plumpe Bollwerk wurde patrouilliert von einem alten Mann in einem derben Hemd mit orangefarbenen, grünen, roten und gelben Streifen. Das Hemd war so ziemlich der einzige bunte Tupfer in der völlig öden Landschaft; es war aus dem Segeltuch eines Liegestuhls gemacht.
In Abständen wurde der lebendige Zaun von Trampelpfaden ins Unterholz durchbrochen. Die Pfade waren kurz und endeten an primitiven Aborten, Löchern im Boden, die mit Planen oder Brettern abgedeckt waren. Das waren die Sanitäranlagen des Dorfes Sparcot.
Das eigentliche Dorf lag am Fluss in der Mitte der Lichtung. Es war in H-Form gebaut, beziehungsweise es hatte diese Form im Laufe der Jahrhunderte angenommen, wobei der Querbalken zu einer steinernen Brücke führte, die sich über den Fluss spannte. Die Brücke spannte sich nach wie vor über den Fluss, hin zu einer ruinösen Straße, die immer noch als Oxford Road oder Oxfroad bekannt ist, und zu einem Dickicht, in dem die Dorfbewohner Brennholz sammelten oder sich in der Gymnastik der antiken Leidenschaft versuchten.
Von den beiden längeren Straßen war die dem Fluss am nächsten gelegene nur für die Bedürfnisse innerorts bestimmt gewesen. Das war nach wie vor der Fall; ein Ende davon führte zu einer alten Wassermühle, wo Big Jim Mole, der Boss von Sparcot, lebte. Die andere Straße war früher eine Landstraße gewesen. Wo die Häuser endeten, führte sie schließlich beidseitig in die eingepfählte Pflanzenwildnis; dort wurde sie wie eine Schlange im Krokodilschlund niedergerungen und von der Last des Unterholzes verschlungen.
Alle Häuser von Sparcot zeigten Spuren des Verfalls. Manche waren zerstört, andere unbewohnte Ruinen. Hundertzwölf Seelen lebten hier. Davon war niemand in Sparcot geboren.
An einer Straßengabelung stand ein Steinhaus, das einst als Postamt gedient hatte. Die oberen Fenster gewährten sowohl Blick auf die Brücke in der einen als auch Blick auf den bestellten Boden, hinter dem sich die Wildnis anschloss, in der anderen Richtung. Jetzt diente es als Wachstube des Dorfes, und da Jim Mole auf ständiger Wache bestand, war es nun besetzt.
Drei Personen hielten sich in dem alten, kahlen Zimmer auf. Eine Greisin, weit über achtzig, saß an einem Holzherd und summte mit dem Kopf nickend vor sich hin. Die Hände hielt sie zum Herd, auf dem sie in einem Blechtiegel Eintopf aufwärmte. Wie die anderen war sie dick eingehüllt gegen die winterliche Kälte, gegen die der Ofen nicht viel auszurichten vermochte.
Von den beiden anwesenden Männern sah der eine steinalt aus, obwohl seine Augen strahlten. Er lag auf einer Strohmatratze am Boden, blickte rastlos um sich und starrte zur Decke, als wollte er die Risse dort enträtseln, oder stierte auf die Wände, als wollte er das Muster der Stockflecken dort deuten. Sein Gesicht, durch die Bartstoppeln spitz wie ein Wieselgesicht, wirkte gereizt, weil das Gesumme der alten Frau ihm auf die Nerven ging.
Nur der dritte Anwesende in der Wachstube war richtig aufmerksam. Er war ein stattlicher Mann, Mitte fünfzig und ohne Wanst, dennoch nicht so spindeldürr wie seine Gefährten. Er saß auf einem knarrenden Stuhl beim Fenster mit einem Gewehr neben sich. Obwohl er ein Buch las, sah er häufig auf und richtete den Blick zum Fenster. Dabei sah er den patrouillierenden Mann in dem bunten Hemd, der sich über die Wiesen näherte.
»Sam kommt«, sagte er.
Damit legte er das Buch weg. Sein Name war Algy Timberlane. Er hatte einen dichten Krausbart, der ihm bis zum Nabel reichte, wo er glatt abgeschnitten war. Wegen seines Bartes hieß er Graubart, obwohl er in einer Welt von Graubärten lebte. Aber sein hoher, fast kahler Schädel brachte den Bart zur Geltung, der allemal durch sein Streifenmuster schwarzer Zotten, die dicht am Kinn sprossen und sich weiter unten verloren, besonders auffiel in einer Welt, die sich keine anderen Formen persönlichen Schmucks mehr leisten konnte.
Als er sprach, hörte Betty zu summen auf, ohne anderweitig zu erkennen zu geben, dass sie ihn gehört hatte. Der Mann auf der Strohmatratze setzte sich auf und griff zum Knüppel, den er neben sich liegen hatte. Er verzog das Gesicht und spähte angestrengt zur Uhr, die laut auf einem Bord tickte; dann schielte er zu seiner Armbanduhr. Dieses alte, schäbige Souvenir aus einer anderen Welt war der bestgehütete Besitz von Towin Thomas, obwohl das Ding schon seit zehn Jahren nicht mehr ging. Eine aufziehbare Uhr auf einem Regal gab ihm verlässlichere Information.
»Sam kommt früh von seinem Rundgang, zwanzig Minuten zu früh«, sagte er. »Der alte Fuchs. Hat wohl Appetit aufs Mittagessen gekriegt vom Marschieren draußen. Kümmere dich mal um dein Süppchen, Betty! Ich will keinem zumuten, sich an dem Fraß den Magen zu verderben, Mädel.«
Betty schüttelte den Kopf. Es war sowohl ein nervöses Zucken als auch eine Ablehnung von allem, was der Mann mit dem Knüppel sagen mochte. Sie behielt die Hände am Herd und blickte sich nicht um.
Towin Thomas packte seinen Knüppel und stand steif auf, wobei er sich am Tisch abstützte. Er ging zu Graubart ans Fenster und spähte durch die dreckige Scheibe, die er mit dem Ärmel blank rieb.
»Klar ist das Sam Bulstow. Das Hemd ist nicht zu verwechseln.«
Sam Bulstow kam auf der schuttübersäten Straße näher. Abfall, Scherben von Dachziegeln und anderer Müll lagen auf dem Pflaster herum; winterstarrer Ampfer und Fenchel wuchs aus zerbrochenen Rosten. Sam Bulstow ging mitten auf der Straße. Seit mehreren Jahren herrschte hier nur noch Fußgängerverkehr. In Höhe des Postamts bog er ab, und bald hörten seine Beobachter seine Schritte auf den Dielen des Zimmers darunter.
Gelassen lauschten sie dem ganzen Spektakel der Treppenbesteigung: dem Ächzen der blanken Stufen, dem Quietschen der schwieligen Hand auf dem Geländer, an dem er sich hochzog, dem Keuchen der Lungen, die jeder Schritt forderte.
Schließlich erschien Sam in der Wachstube. Die bunten Streifen seines Hemds verliehen dem Gesicht mit den weißen Stoppeln etwas Farbe. An den Türstock gelehnt, blieb er eine Weile stehen, schaute sie an und schöpfte Atem.
»Bist früh dran, wenn du zum Essen kommst«, sagte Betty, die sich nicht einmal umblickte. Niemand achtete weiter auf sie, und so schüttelte sie unmutig ihre alten Zotteln.
Sam blieb einfach stehen, wo er war, und bleckte beim Schnaufen die gelbbraunen Zähne. »Die Schotten rücken an«, sagte er.
Betty drehte steif den Hals und schaute zu Graubart. Towin Thomas brachte sein listiges, altes Wolfsgesicht über dem Knüppelende zur Geltung und musterte Sam aus verkniffenen Augen.
»Vielleicht sind sie auf deinen Job aus, Sammy«, meinte er.
»Woher weißt du das, Sam?«, fragte Graubart.
Sam kam behäbig ins Zimmer, blickte verstohlen zur Uhr und goss sich aus einem verbeulten Kanister, der in einer Ecke stand, Wasser zum Trinken ein. Er kippte das Wasser hinunter, sank auf einen hölzernen Stuhl, streckte die sehnigen Hände zum Feuer und ließ sich ordentlich Zeit mit der Antwort.
»An der nördlichen Barrikade kam gerade ein Hausierer vorbei. Der sagte, er wolle nach Faringdon. Sagte, die Schotten hätten Banbury erreicht.«
»Wo ist dieser Hausierer?«, fragte Graubart, der kaum die Stimme hob und scheinbar aus dem Fenster schaute.
»Schon wieder weg, Graubart. Sagte, er wolle nach Faringdon.«
»Ist an Sparcot vorbeigezogen, ohne reinzukommen, um uns was zu verhökern? Sehr unwahrscheinlich.«
»Ich melde nur, was er gesagt hat. Ich bin nicht für ihn verantwortlich. Ich meine halt, dass unser alter Boss Mole erfahren sollte, dass die Schotten kommen, das ist alles.« Sams Stimme nahm den weinerlichen Ton an, den sie alle von Zeit zu Zeit anschlugen.
Betty kehrte sich wieder ihrem Herd zu. Sie sagte: »Jeder, der zu uns kommt, bringt Gerüchte mit. Wenn's nicht die Schotten sind, dann wilde Tierhorden. Gerüchte, Gerüchte … Ebenso schlimm wie im letzten Krieg, als sie uns weismachen wollten, es stehe die Invasion bevor. Ich war seinerzeit der Meinung, das taten sie nur, um uns Angst zu machen; hatte aber trotzdem Angst.«
Sam unterbrach ihr Jammern. »Ob Gerücht oder nicht, ich melde euch, was der Mann gesagt hat. Ich dachte, ich sollte hochkommen und euch Bescheid geben. War das nun richtig oder nicht?«
»Woher kam der Bursche?«, fragte Graubart.
»Von nirgendwo. Wollte nach Faringdon.« Er grinste verschlagen über seinen Scherz und entlockte Towin damit ein Lächeln.
»Hat er gesagt, wo er gewesen ist?«, fragte Graubart geduldig.
»Er sagte, er komme von flussaufwärts. Sagte, 'ne Menge Wiesel kämen aus der Richtung.«
»Aha, noch so ein Gerücht, das wir schon kennen«, sagte Betty und nickte.
»Du hältst die Klappe, alte Kuh!«, meinte Sam ohne jeden Groll.
Graubart packte seine Flinte am Lauf und trat in die Zimmermitte, wo er sich vor Sam aufpflanzte.
»Ist das alles, was du zu melden hast, Sam?«
»Schotten, Wiesel – was willst du mehr von einem einzelnen Patrouillengänger? Ich habe keine Elefanten gesehen, falls dich das interessiert?« Damit grinste er wieder und blickte zu Towin, wo er sich Beifall erhoffte.
»Beschränkt, wie du bist, würdest du einen Elefanten gar nicht erkennen, falls du einen sehen solltest, du Tölpel«, meinte Towin.
Ohne darauf einzugehen, sagte Graubart: »Also gut, Sam, geh wieder auf Patrouille! Du hast noch zwanzig Minuten, bevor du abgelöst wirst.«
»Was, ich soll noch mal raus für lausige zwanzig Minuten? Kommt nicht in die Tüte, Graubart! Mir reicht's für heute, und ich steh' nicht mehr auf von diesem Stuhl. Die zwanzig Minuten kommen wir auch ohne aus. Es wird uns schon keiner unser Dorf klauen, wie immer Jim Mole auch darüber denken mag.«
»Du weißt ebenso gut um die Gefahren wie ich.«
»Du weißt, mit mir ist nicht zu rechnen, nicht solange ich diese Kreuzschmerzen hab. Dieses verflixte Wacheschieben steht mir bis hier.«
Betty und Towin blieben still. Letzterer warf einen Blick auf seine kaputte Armbanduhr. Obgleich sowohl ihm als auch Betty wie allen anderen im Dorf die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit häufig genug eingebläut worden war, blickten sie nun vor sich auf den Boden und studierten die Fugen in den Dielen, wussten sie doch, wie mühsam es war, alte Knochen dazu zu bewegen, ein zusätzliches Mal Treppen zu steigen und eine Zusatzrunde um die Grenze zu drehen.
Sam hatte den Vorteil auf seiner Seite, wie er feststellte. Noch dreister wandte er sich an Graubart und sagte: »Warum übernimmst du nicht die zwanzig Minuten, wenn du so darauf erpicht bist, dieses verwahrloste Nest zu verteidigen? Du bist jung – ein bisschen Bewegung wird dir guttun.«
Graubart warf sich den Ledergurt der Flinte über die linke Schulter und wandte sich an Towin, der jetzt aufhörte, an seinem Knüppelende zu kauen, und aufsah.
»Schlag den Alarmgong, wenn ich schnell kommen soll, ansonsten aber nicht. Erklär der alten Betty noch mal, dass es kein Dinnergong ist.«
Die Frau kicherte, während er zur Tür ging und sich dabei die weite Jacke zuknöpfte.
»Dein Eintopf ist fast fertig, Algy. Bleib doch noch und iss!«, meinte sie.
Ohne zu antworten, schlug Graubart die Tür hinter sich zu. Die anderen lauschten seinen schweren Schritten auf der Treppe.
»Er wird doch nicht verärgert sein, was glaubt ihr? Er wird mich doch nicht dem alten Mole melden, was?«, fragte Sam nervös. Die anderen murmelten nichtssagendes Zeug und schlangen die Arme um die dünnen Rippen; sie wollten keinesfalls in unliebsame Dinge verwickelt werden.
Graubart schlenderte langsam mitten auf der Straße dahin und wich den Pfützen aus, die das Unwetter vor zwei Tagen hinterlassen hatte. Die Kanalisation von Sparcot war verstopft; aber das Wasser zog hauptsächlich deshalb so stockend ab, weil das umgebende Land sumpfig war. Irgendwo stromaufwärts blockierte Unrat den Fluss, der über die Ufer trat. Graubart nahm sich vor, mit Mole zu reden; sie müssten eine Mannschaft auf die Beine stellen, um dem Hindernis beizukommen. Aber Mole wurde zunehmend streitsüchtiger, und seine Politik der Isolation würde ein Verlassen des Dorfes nicht zulassen.
Graubart beschloss, entlang des Flusses zu gehen und anschließend die Runde um die Grenzpalisaden zu drehen. Er zwängte sich durch ein dreist wucherndes, kahles Holundergestrüpp. Melancholisch süß schlug ihm der Duft des Flusses und der modrigen Uferwelt entgegen.
Einige der Häuser, die sich ans Ufer schmiegten, waren ein Raub der Flammen geworden, bevor Graubart und die Seinen sich hier niederließen. In und um die Grundmauern wucherte robustes Grün. Auf einem Hoftor, das verbogen im langen Gras lag, verkündete eine abblätternde Schrift den Namen des nächsten Gemäuers: Themseblick.
Weiter oben waren die Häuser unbeschädigt und bewohnt. Graubarts eigenes Haus stand hier. Er blickte zu den Fenstern, aber von Martha, seiner Frau, war nichts zu sehen; sicher säße sie still am Feuer, eine Decke über den Schultern, und starrte in die Glut und sähe – was? Plötzlich überkam Graubart gewaltige Ungeduld. Diese Häuser waren schäbige Bruchbuden, die sich zusammenduckten wie ein Häuflein Raben mit gebrochenen Flügeln. Den meisten fehlten Schornstein und Dachrinnen; jedes Jahr wurden sie in dem Maße, wie das Dachgebälk nachgab, schmächtiger von Statur. Überhaupt passten die Leute hier in diese Verfallsstimmung. Er nicht; und auch seiner Martha wollte er das nicht zumuten.
Graubart mäßigte seine Gedanken. Zorn war sinnlos. Er machte eine Tugend daraus, nicht zornig zu sein. Aber er sehnte sich nach einer Freiheit jenseits der fliegenverseuchten Geborgenheit von Sparcot.
Nach den Häusern kam Tobys Handelsniederlassung – ein neueres Gebäude in besserem Zustand als die meisten übrigen – und die Scheunen, plumpe Gebilde, denen anzusehen war, wie stümperhaft sie aus dem Boden gestampft worden waren. Hinter den Scheunen lagen die Felder, deren gepflügte Schollen den Winterfrost einläuteten. Wasserpfützen glitzerten zwischen den Furchen. Hinter den Feldern stand das Dickicht, das die Ostgrenze von Sparcot bildete. Hinter Sparcot lag das gewaltige, unendlich geheimnisvolle Land des Themsetals.
Unmittelbar außerhalb des Dorfgebiets trotzte eine alte, gemauerte Ziegelbrücke mit einem eingestürzten Bogen dem Fluss, deren Reste an die Hörner eines Widders erinnerten, die im Alter zusammenwachsen. Graubart betrachtete nachdenklich die Brücke und das alte, kleine Wehr dahinter, denn jenseits davon lag heutzutage das, was er unter Freiheit verstand; schließlich wandte er sich ab, um den lebenden Zaun abzuschreiten.
Die Flinte bequem unter dem angewinkelten Arm tragend, machte er seinen Rundgang. Er konnte zur anderen Seite der Lichtung hinübersehen. Außer zwei Männern, die in der Ferne durch die Viehherde spazierten, und einer gebückten Gestalt im Kohlfeld war da niemand. Die Welt gehörte ihm fast allein: und mit jedem Jahr mehr.
Er schob diesem Gedanken den Riegel vor und konzentrierte sich auf das, was Sam Bulstow gemeldet hatte. Es war vermutlich erfunden, um die Patrouille zwanzig Minuten abzukürzen. Das Gerücht über die Schotten klang unwahrscheinlich – jedoch nicht weniger wahrscheinlich als die anderen Geschichten, die ihnen von Reisenden zugetragen wurden: dass eine chinesische Armee auf London marschierte oder Gnomen und Elfen und Menschen mit Bibergesicht beim Reigen im Wald gesehen worden seien. Der Spielraum für Irrtum und Dummheit schien sich Jahr für Jahr zu vergrößern. Es wäre nicht schlecht, in Erfahrung zu bringen, was wirklich vor sich ging …
Weniger unwahrscheinlich als das Schottenmärchen war Sams Geschichte von einem seltsamen Hausierer. Trotz des Dickichts gab es Wege, die ins Dorf führten, und Menschen, die diese Wege beschritten, obwohl das abgeschiedene Dorf Sparcot fast nur den Verkehr zu sehen bekam, der sich mühsam die Themse hinauf und hinab schleppte. Nun, sie mussten wachsam sein. Selbst in dieser eher friedlichen Zeit – »Apathie, die vollkomm'nen Frieden bringt«, dachte Graubart und überlegte, woher er das Zitat hatte – mussten unbewachte Dörfer damit rechnen, wegen ihrer Nahrungsvorräte oder aus purer Zerstörungswut geplündert und geschleift zu werden. Davon wurde ausgegangen.
Nun passierte Graubart angebundene Kühe, die jeweils den krummen Radius ihrer Halterungen abgrasten. Es war eine neue Rasse, kleine, robuste, plumpe, friedliche Tiere. Und jung! Zarte Geschöpfe, die Graubart aus feuchten Augen musterten, Geschöpfe, die dem Menschen gehörten, aber an seiner Hinfälligkeit keinen Anteil hatten, Geschöpfe, die das Gras bis zu den dornigen Brombeerranken niedrig hielten.
Graubart fiel auf, dass eines der Tiere bei den Brombeeren an seinem Strick zerrte. Es warf den Kopf hin und her, rollte mit den Augen und muhte. Graubart beschleunigte seine Schritte.
Offenbar störte sich die Kuh lediglich an einem toten Kaninchen, das bei den Brombeeren lag. Als Graubart herangekommen war, sah er es sich näher an. Es war noch nicht lange tot. Obwohl es mausetot war, bewegte es sich, wie Graubart zu sehen glaubte. Er beugte sich darüber und beobachtete es gespannt. Ein Schauder lief ihm über den Rücken.
Zweifellos war das Kaninchen tot, gestorben an einem glatten Nackenbiss. Nacken und Anus waren blutig, die purpurnen Augen glänzten.
Dennoch bewegte es sich. Die Brust wölbte sich auf.
Der Schreck – eine unwillkürliche, abergläubische Ahnung – schoss Graubart durch die Glieder. Er wich einen Schritt zurück und legte seine Flinte an. Im selben Augenblick blähte sich das Kaninchen wieder auf, und sein Mörder kam zum Vorschein.
Aus dem toten Kaninchen kam flugs ein Wiesel gekrochen, das geduckt das Weite suchte. Sein braunes Fell war mit Kaninchenblut besudelt, das wilde Schnäuzchen, das es Graubart entgegenstreckte, glänzte scharlachrot. Er schoss es tot, bevor es davonhuschen konnte.
Die Kühe hüpften und trampelten. Wie Aufziehpuppen richteten sich die Gestalten im und am Kohlfeld auf. Vögel flatterten von den Wipfeln auf. Der Gong von der Wachstube ertönte, wie Graubart angeordnet hatte. Ein Menschenknäuel bildete sich vor den Scheunen; die Menschen steckten die Köpfe zusammen, als wollten sie ihr trübes Augenlicht vereinen.
»Gaffer. Es ist weiter nichts passiert«, brummte Graubart. Aber er wusste, dass der unüberlegte Schuss ein Fehler gewesen war; er hätte das Wiesel mit dem Gewehrkolben totschlagen sollen. Ein Schuss löste immer Alarm aus.
Eine Gruppe aktiver Sechzigjähriger sammelte sich und marschierte knüppelschwingend zu ihm. Obwohl er sich ärgerte, musste er den prompten Einsatz anerkennen. Es war trotz allem ein funktionierender Haufen.
»Alles in Ordnung«, rief er und winkte mit den Armen über dem Kopf, während er ihnen entgegenging. »Alles in Ordnung! Ich wurde von einem einzelnen Wiesel angegriffen, das ist alles. Ihr könnt umkehren.«
Charley Samuels war dabei, ein kräftiger Mann mit blässlicher Haut; er führte Isaac, seinen zahmen Fuchs, an der Leine mit sich. Charley bewohnte das Nachbarhaus der Timberlanes und war zunehmend auf sie angewiesen seit dem Tod seiner Frau im vergangenen Frühjahr.
Er eilte den älteren Männern voraus und schloss sich Graubart an.
»Im Frühjahr machen wir eine Treibjagd und fangen mehr Jungfüchse zum Abrichten«, sagte er. »Mit ihnen lassen sich die Wiesel in Schach halten, die auf unser Land vordringen. Wir kriegen auch immer mehr Ratten, die sich in altem Gemäuer einnisten. Ich schätze, die Wiesel treiben sie dazu, in menschlichen Behausungen Unterschlupf zu suchen. Die Füchse werden sich auch um die Ratten kümmern, nicht wahr, Isaac, mein Junge?«
Nach wie vor mit sich grollend, machte Graubart sich wieder auf den Weg entlang der Grenze. Charley begleitete ihn und hielt verständnisvoll den Mund. Der niedliche Fuchs ging mit hängender Lunte zwischen ihnen.
Die übrigen Männer blieben unschlüssig mitten im Gelände stehen. Die einen beruhigten das Vieh oder betrachteten den zerfetzten Wieselkörper; andere kehrten zu den Häusern zurück, aus denen wieder andere strömten, um in das Gerede einzustimmen. Als dunkle Gestalten mit weißem Schopf hoben sie sich von den rissigen Ziegelmauern ab.
»Sie sind gewissermaßen enttäuscht, dass nichts Aufregendes passiert ist«, bemerkte Charley. Eine Strähne seines struppigen Haares hing ihm über die Stirn. Einst war es strohblond gewesen; nun war es schon seit so vielen Jahren weiß, dass der Besitzer Weiß als richtige und vorherbestimmte Farbe ansah, während der strohblonde Ton auf seine Haut übergegangen war.
Charleys Haare hingen nie in die Augen, obwohl man immer damit rechnete, wenn er energisch den Kopf schüttelte. Freilich war energisches Kopfschütteln nicht Charleys Art; sein Merkmal war eher Stein, nicht Feuer; und in seiner Haltung wurde offenbar, wie die Jahre seine Geduld auf die Probe gestellt hatten. Gerade dieser Eindruck, viel mitgemacht zu haben, verband diese beiden robusten Ältesten, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam hatten.
»Obwohl die Leute keinen Ärger mögen, lieben sie Abwechslung«, sagte Charley. »Komisch – von dem Schuss, den du abgefeuert hast, tut mir's Zahnfleisch weh.«
»Und ich bin halb taub davon«, räumte Graubart ein. »Ob er den Alten in der Mühle aufgerüttelt hat?«
Er bemerkte, dass Charley zur Mühle schaute, um zu sehen, ob Mole oder sein Häscher, »Major« Trouter, zum Nachsehen herauskämen.
Als Charley merkte, dass er von Graubart beobachtet wurde, lächelte er verlegen und sagte, um irgendetwas zu sagen: »Da kommt der alte Jeff Pitt, der wissen will, was die ganze Aufregung soll.«
Sie waren an einen Bach gelangt, der sich durchs gerodete Gelände schlängelte. Seine Ufer waren mit den Stümpfen von Birken bestanden, die die Dorfbewohner abgeholzt hatten. Von daher kam der zerlumpte, alte Pitt. Über der Schulter trug er einen Stock, an dem ein Tierkörper baumelte. Obwohl sich einige Dorfbewohner ein Stück hinauswagten, war Pitt der Einzige, der auf eigene Faust die Wildnis durchpirschte. Für ihn war Sparcot kein Gefängnis. Er war ein griesgrämiger Einzelgänger. Er hatte keine Freunde, und selbst unter den Verkalkten galt er als verrückt. Sicherlich wirkte sein Gesicht, narbig wie die Rinde einer Weide, diesem Ruf nicht gerade entgegen. Und seine kleinen Augen zuckten unruhig hin und her wie ein in seinem Schädel gefangenes Fischpaar.
»Ist denn jemand erschossen worden?«, fragte er. Als Graubart erzählte, was vorgefallen war, brummte Pitt, als wäre er überzeugt, es würde ihm die Wahrheit vorenthalten.
»Wenn du durch die Gegend ballerst, lockst du nur die Gnomen und Ungeheuer an«, meinte er.
»Mit denen werde ich schon fertig, wenn sie erscheinen.«
»Die Gnomen kommen, nicht wahr?«, murmelte Pitt. Graubarts Worte hatte er gar nicht registriert. Er wandte sich dem kalten kahlen Wald zu. »Sie werden bald hier sein, um die Stelle der Kinder einzunehmen, merkt euch das.«
»Es gibt keine Gnomen hier, Jeff, sonst hätten sie dich längst gekriegt«, sagte Charley. »Was hast du da an deinem Stock?«
Mit einem argwöhnischen Blick auf Charley, um seine Reaktion abzuschätzen, schwenkte Pitt den Stock von seiner Schulter und zeigte ein feines Ottermännchen vor, das zwei Fuß maß.
»Ist der nicht schön? Bekomm' sie neuerdings oft zu Gesicht. Sind im Winter besser zu sehen. Oder vielleicht vermehren sie sich in dieser Gegend einfach zahlreicher.«
»Eben wie alles, was sich noch vermehren kann«, bemerkte Graubart forsch.
»Ich bring dir den nächsten, den ich fange, Graubart. Ich habe nicht vergessen, was gewesen ist, bevor wir nach Sparcot gekommen sind. Du kannst den nächsten haben, den ich fange. Ich habe am Ufer Schlingen ausgelegt.«
»Du bist ein echter alter Wilderer, Jeff«, sagte Charley. »Im Gegensatz zu uns übrigen hast du nie den Beruf wechseln müssen.«
»Was meinst du damit? Ich hab den Beruf nicht wechseln müssen? Du bist bekloppt, Charley Samuels! Ich habe den Großteil meines Lebens in einer stinkenden Werkzeugmaschinenfabrik verbracht vor der Revolution und so. Nicht dass ich nicht schon immer ein Naturliebhaber gewesen wäre. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal auf so vertrautem Fuß mit ihr stehen würde, wie man so schön sagt.«
»Jedenfalls bist du jetzt auch ein echter alter Waldläufer.«
»Meinst du, ich merke nicht, dass du mich auslachst? Ich bin nicht blöd, Charley, was immer du dir auch denken magst. Es ist schon schlimm, meine ich, dass aus uns Städtern grüne Bauerntölpel geworden sind, nicht wahr? Was hat das Leben noch zu bieten? Wir laufen in Lumpen und Fetzen rum, total verwurmt. Und das Zahnweh! Wohin soll das alles führen, hm, möcht' ich mal wissen? Wohin soll das führen?« Er wandte sich ab und spähte in den Wald.
»Es geht uns einigermaßen gut«, sagte Graubart. Das war seine unveränderliche Antwort auf die unveränderliche Frage. Charley hatte gleichfalls eine unveränderliche Antwort parat.
»Es ist der Wille des Herrn, Jeff, und es hilft nichts, sich darüber zu grämen. Wir können nicht sagen, was er mit uns vorhat.«
»Nach allem, was der uns in den letzten fünfzig Jahren angetan hat«, meinte Jeff, »wundert es mich, dass du mit dem noch Umgang pflegst.«
»Es wird nach seinem Willen vorübergehn«, stellte Charley fest.
Pitt zog die furchige Stirn in tiefe Falten, spuckte auf den Boden und ging mit seinem toten Otter davon.
Wo soll das enden, fragte Graubart sich, wenn nicht in Demütigung und Not? Er sprach die Frage nicht aus. Obwohl er Charleys Optimismus schätzte, brachte er nicht mehr Geduld als der alte Pitt auf für die allzu einfachen Antworten des Glaubens, der diesen Optimismus nährte.
Sie gingen weiter. Charley brachte die Sprache auf die verschiedenen Berichte der Leute, die angeblich Gnomen und kleine Männchen im Wald oder auf Giebeln oder beim Lecken am Euter der Kühe gesehen hatten. Graubart gab stereotype Antworten; die vergebliche Frage des alten Pitt ging ihm nicht aus dem Kopf. Wohin soll das alles führen? Gleich einem Stück Knorpel im Mund blieb diese Frage hartnäckig haften; dennoch ertappte Graubart sich immer häufiger dabei, darauf herumzukauen.
Nachdem sie die Peripherie abgegangen waren, kamen sie an der Westgrenze wieder zur Themse, die hier in ihr Gebiet mündete. Sie hielten inne und blickten zum Wasser.
Reißend und strudelnd spülte es unzählige Trümmer mit sich – o ja, und schwemmte sie wie von jeher – zum Meer. Selbst die beruhigende Gewalt des Wassers vermochte Graubarts Gedanken nicht zu beschwichtigen.
»Wie alt bist du, Charley?«, fragte er.
»Hab aufgehört zu zählen. Mach nicht so ein finsteres Gesicht! Was bekümmert dich plötzlich? Du bist ein heiterer Mensch, Graubart; du sollst dich nicht über die Zukunft grämen. Sieh dir das Wasser an – es kommt, wohin es will, ohne sich zu sorgen.«
»Der Vergleich ist kein Trost für mich.«
»Wirklich nicht? Das sollte er aber sein.«
Graubart empfand den eintönigen Charley als lästig, aber dennoch gab er geduldig Antwort.
»Du bist ein vernünftiger Mann, Charley. Sicher müssen wir vorausdenken. Die Erde wird zum Gefängnis. Du siehst die Warnzeichen ebenso gut wie ich. Es gibt keine Jugend mehr. Diejenigen von uns, die in der Lage sind, selbst den gegenwärtig niedrigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, werden Jahr für Jahr weniger. Wir …«
»Wir können nichts daran ändern. Wenn du das einsiehst, wird die Lage erträglicher. Dass der Mensch sein Schicksal zum Guten wenden kann, das ist ein alter Gedanke. Was ich damit meine? Nun, eine vorsintflutliche Vorstellung, Überbleibsel aus einer anderen Zeit … Wir können nichts tun. Wir werden einfach dahingetragen wie das Wasser in diesem Fluss.«
»Du liest 'ne Menge in den Fluss hinein«, sagte Graubart halb lachend. Er trat mit dem Fuß einen Stein ins Wasser. Daraufhin raschelte und plumpste es, als irgendein Getier – vermutlich eine Bisamratte, die wieder auf dem Vormarsch waren – sich ins Wasser flüchtete.
Sie schwiegen, und Charley ließ die Schultern hängen. Als er wieder sprach, zitierte er aus einem Gedicht.
»Die Wälder modern, modern und fallen,
Der Brodem entlädt seine Tränen auf den Boden,
Der Mensch bestellt das Feld und legt sich darunter.«
Zwischen dem schweren, prosaischen Mann, der Tennyson zitierte, und den Wäldern, die sich über den Fluss beugten, klaffte eine Ungereimtheit. Schwerfällig sagte Graubart: »Für einen heiteren Menschen kennst du düstere Gedichte.«
»Damit hat mich mein Vater großgezogen. Ich hab dir von seinem muffigen, kleinen Laden erzählt …« Eines der Merkmale des Alters war es, dass alle Gespräche die Vergangenheit ansteuerten.
»Ich geh jetzt, damit du auf deinem Rundgang vorankommst«, sagte Charley, aber Graubart packte ihn am Arm. Stromaufwärts hatte er ein Geräusch vernommen, das sich deutlich vom Rauschen des Wassers unterschied.
Er stellte sich ans Wasser und hielt Ausschau. Es kam etwas den Fluss herunter, das nicht näher zu erkennen war, da überhängendes Astwerk den Blick verwehrte. Graubart fing zu laufen an und eilte zur steinernen Brücke. Charley, der ging, so schnell er konnte, kam hinterher.
Von der Brückenbrüstung konnte man ungehindert flussaufwärts sehen. Ein plumpes Schiff kam keine achtzig Yards entfernt zum Vorschein. Dem geschwungenen Bug nach zu urteilen, war es einst motorisiert gewesen. Jetzt wurde es von einigen Weißbärtigen mit Paddeln und Stangen manövriert, während am Mast ein schlaffes Segel baumelte. Graubart zog seine Ältestenpfeife aus der Brusttasche und stieß zwei lang gezogene Pfiffe aus. Charley zunickend, lief er zur Wassermühle, wo Big Jim Mole wohnte.
Mole öffnete schon die Tür, als Graubart ankam. Die Jahre hatten sein von Natur aus ungestümes Wesen noch nicht gebrochen. Er war ein untersetzter Mann mit einem verwegenen, aufgedunsenen Gesicht und grauen Haaren, die wirr vom Kopf abstanden und ebenso aus den Ohren sprossen. Anscheinend prüfte er Graubart nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Nüstern.
»Was ist das für ein Radau, Graubart?«, wollte er wissen.
Graubart erzählte. Mole trat schneidig heraus, wobei er seinen alten Armeemantel zuknöpfte. Hinter ihm erschien Major Trouter, ein kleiner Mann, der schwer hinkte und sich auf einen Stock stützte. Als er im düsteren Tageslicht stand, begann er, mit seiner kreischenden Stimme Befehle zu erteilen. Noch lungerten Leute nach dem falschen Alarm herum. Prompt, wenn auch unbeholfen, stellten sich sowohl die Frauen als auch die Männer in festgelegter Ordnung zur Verteidigung auf.
Das Volk von Sparcot war ein bunt gewandeter Haufen. Die einzelnen Leute hatten sich die verschiedensten Kleider und Lumpen, die als Kleidung dienten, zusammengeschneidert. Da waren Mäntel aus Teppichen und Gardinenstoff zu sehen. Manche Männer trugen Westen, die aus notdürftig gegerbten Fuchsfellen zusammengeflickt waren; einige Frauen trugen zerrissene Armeemäntel. Trotz der Vielfalt war der Gesamteindruck farblos, und niemand hob sich besonders von der neutralen Landschaft ab. Die insgesamt vorherrschenden eingefallenen Wangen und grauen Haare verstärkten das klägliche Bild nur.
So mancher Greis hustete in der Winterluft. So mancher Rücken war gebückt, so manches Bein steif. Sparcot war eine Hochburg für Krankheit und Gebrechen: Gicht, Hexenschuss, Rheuma, grauer Star, Lungenentzündung, Grippe, Ischias, Schwindel. Brust, Leber, Rücken, Kopf bereiteten viele Beschwerden, und abends kreiste das Gespräch meist ums Wetter und ums Zahnweh. Trotz alledem reagierten die Dorfbewohner hurtig auf das Pfeifsignal.
Graubart registrierte es mit Wohlwollen, obgleich er sich fragte, ob es notwendig war. Er hatte Trouter dabei geholfen, eine Verteidigung auf die Beine zu stellen, bevor eine zunehmende Entfremdung gegenüber Mole und Trouter ihm eine untergeordnete Rolle aufzwang.
Die zwei langen Pfiffe bedeuteten eine Bedrohung vom Wasser her. Obwohl die meisten Reisenden heutzutage friedlich waren (und beim Passieren der Brücke von Sparcot Zoll entrichteten), hatten wenige der Dorfbewohner den Tag vergessen, als sie vor fünf, sechs Jahren von einem einzelnen Flusspiraten mit einem Flammenwerfer angegriffen wurden. Flammenwerfer wurden offenbar immer rarer. Wie Benzin, Maschinengewehre und Munition waren sie das Produkt eines anderen Jahrhunderts, Relikte einer untergegangenen Welt. Aber alles, was sich auf dem Wasserweg näherte, löste allgemeine Alarmbereitschaft aus.
Demzufolge versammelte sich eine schwer bewaffnete Truppe von Dorfbewohnern – viele führten selbst gebastelten Pfeil und Bogen mit – am Flussufer, während das seltsame Gefährt auftauchte. Sie duckten sich hinter eine niedrige brüchige Mauer und bereiteten sich, ein bisschen aufgeregter als sonst, vor zum Angriff oder zur Verteidigung.
Das näher kommende Schiff fuhr quer zum Strom. Es war mit den unbeholfensten Landratten besetzt, die je Anker gelichtet hatten. Die Ruderer waren offenbar bemüht, das Schiff sowohl vor dem Kentern zu bewahren als auch von der Stelle zu bringen; wie es schien, hatten sie in keiner Hinsicht eine glückliche Hand.
Ihr Ungeschick rührte nicht nur daher, dass es kein leichtes Unterfangen war, eine fünfzig Jahre alte, dreißig Fuß lange Jacht mit morschem Rumpf per Paddel zu manövrieren, die zudem mit einem vollen Dutzend Menschen samt Hab und Gut beladen war. Im Cockpit der Jacht stand, von vier Mann festgehalten, ein widerspenstiges Packren.
Obwohl das Tier kastriert war – wie es der Brauch war, seit das Ren vor gut zwanzig Jahren von einer der letzten autoritären Regierungen im Land eingeführt wurde –, hatte es doch genügend Kraft, beträchtlichen Schaden anzurichten; und Rentiere waren wertvoller als Menschen. Sie dienten als Milch- und Fleischlieferanten, wenn Vieh knapp war, und stellten auch hervorragende Lasttiere dar, während der Mensch nur älter werden konnte.
Trotz der Ablenkung erspähte einer der Navigatoren, der als Ausguck fungierte und im Bug stand, die bewaffnete Truppe von Sparcot und stieß eine Warnung aus. Es handelte sich um eine große dunkle Frau, mager und drahtig. Das schwarze Haar war unter einem Tuch verknotet. Als sie den Ruderern zurief, ließen diese prompt die Paddel ruhen, was sie offensichtlich gern taten. Jemand, der hinter einem aufgeschichteten Bündel Kleidung an Deck kauerte, reichte der dunklen Frau eine weiße Flagge. Sie streckte sie hoch und rief den lauernden Dorfbewohnern übers Wasser zu.
»Was schreit die da?«, fragte John Mellor. Er war ein alter Soldat, der früher eine Art Offiziersbursche für Mole gespielt hatte, bis dieser ihn verärgert als unnütz hinauswarf. Fast neunzig, war Mellor dünn wie ein Stock und taub wie ein Stein, obwohl er mit dem einen Auge, das ihm verblieben war, noch gut sah.
Wieder ertönte die Stimme der Frau, die selbstsicher genug einen Gefallen erbat. »Lasst uns in Frieden passieren! Wir wollen euch nichts tun und möchten nicht anhalten. Lasst uns vorbei, Leute!«
Graubart schrie Mellor ihre Worte ins Ohr. Der Weißhaarige schüttelte den Kopf und lächelte zum Zeichen, dass er nicht verstanden hatte. »Tötet die Männer und schändet die Weiber! Ich nehm die Dunkelhaarige vorndran.«
Befehle erteilend, traten Mole und Trouter vor. Offenbar waren sie zu dem Schluss gekommen, dass das Schiff keine ernsthafte Bedrohung darstellte.
»Wir müssen sie aufhalten und durchsuchen«, sagte Mole. »Den Balken raus. He da, bewegt euch, Männer! Wir wollen mit ihnen reden. Wer sie sind und was sie wollen. Sie werden bestimmt etwas haben, das wir brauchen.«
Mittlerweile war Towin Thomas neben Graubart und Charley Samuels aufgetaucht. Um das Schiff besser zu sehen, verzog er angestrengt das Gesicht. Mit dem Ellbogen stieß er Graubart sachte in die Seite.
»He, Graubart, das Ren käme nicht ungelegen für schwere Arbeiten, was?«, meinte er, während er nachdenklich an seinem Knüppelende kaute. »Wir könnten es vor den Pflug spannen, nicht wahr?«
»Wir haben kein Recht, es ihnen wegzunehmen.«
»Du wirst doch wegen so 'nem Ren keine frommen Gedanken entwickeln, was? Lässt dich vom Gefasel des alten Charley unterkriegen.«
»Ich höre weder auf Charley noch auf dich«, erwiderte Graubart.
Ein langer Balken, der seinerzeit, als es noch Telefon gab, als Leitungsmast gedient hatte, wurde übers Wasser geschoben, bis die Spitze auf zwei Steinen am anderen Ufer zu liegen kam. Der Fluss verengte sich hier zur verfallenen Brücke weiter stromabwärts. Diese Stelle hatte den Dorfbewohnern seit Jahren nützliche Einnahmen verschafft; ihre Zölle auf die Schifffahrt ergänzten ihre weniger begeisterten Bemühungen im Ackerbau. Es war der einzig gescheite Einfall von Big Jim Mole während seiner ansonsten beschränkten und tyrannischen Regentschaft gewesen. Um dem drohenden Mast Nachdruck zu verleihen, zeigten sich nun die wehrhaften Leute von Sparcot entlang des Ufers. Mit gezücktem Schwert lief Mole nach vorne und forderte die Fremden zum Anlegen auf.
Die große dunkle Frau auf dem Schiff drohte mit den Fäusten.
»Achtet die weiße Friedensflagge, ihr räudigen Hunde!«, schrie sie. »Lasst uns unbeschadet passieren! Wir sind, schlimm genug, Heimatlose. Wir haben nichts zu entbehren für euresgleichen.«
Ihre Mannschaft zeigte weniger Mut. Die Männer und Frauen zogen ihre Paddel und Stangen ein und ließen das Schiff unter die steinerne Brücke treiben, bis der Mast die Fahrt stoppte. Froh über eine so leichte Beute, zogen die Dorfbewohner es mit Enterhaken ans Ufer. Das Ren hob seinen mächtigen Kopf und brüllte trotzig, die dunkle Frau kreischte empört.
»He da, du mit der Metzgervisage«, schrie sie, auf Mole deutend, »hör mir gut zu! Wir sind eure Nachbarn. Wir kommen nur aus Grafton Lock. Behandelt man so seine Nachbarn, du rückständiger alter Pirat?«
Ein Raunen ging durch die Menge am Ufer. Jeff Pitt erkannte die Frau als Erster. Sie hieß Gipsy Joan, und der Name war selbst bei den Dorfbewohnern, die sich nie in ihr Gebiet vorgewagt hatten, eine Legende.
Jim Mole und Trouter traten vor und hießen sie schweigen, aber wieder schrie sie sie nieder.
»Nehmt gefälligst eure Haken da weg! Wir haben Verwundete an Bord.«
»Halt den Mund, Frau, und komm an Land! Dann wird euch nichts geschehen«, sagte Mole, der sein Schwert jetzt wie ein Könner hielt. Er ging zum Schiff; der Major marschierte an seiner Seite.
Schon hatten einige Dorfbewohner unaufgefordert versucht, an Bord zu kommen. Bestärkt vom gänzlich fehlenden Widerstand und darauf erpicht, ihren Anteil an der Beute zu ergattern, stürmten sie, von zwei Frauen angeführt, vorwärts. Einer der Ruderer, ein altersgrauer Greis mit einem Südwester und gelblichem Bart, geriet in Panik und schlug sein Paddel dem vordersten Eindringling über den Kopf. Die Frau ging zu Boden. Ein Handgemenge brach aus, obwohl von beiden Seiten zum Aufhören aufgefordert wurde.
Das Schiff schaukelte bedrohlich. Die Männer, die das Ren hielten, wichen Schutz suchend zurück. Das Durcheinander nutzend, riss sich das Tier los. Es trampelte übers Kabinendach, hielt einen Moment lang inne und sprang dann über Bord in die Themse. Mit kräftigen Zügen schwamm es stromabwärts. Entsetztes Geheul wurde auf dem Schiff laut.
Zwei der Männer, die sich um das Tier gekümmert hatten, sprangen hinterher und feuerten es zum Umkehren an. Schließlich waren sie gezwungen, die eigene Haut zu retten; der eine kämpfte sich ans Ufer, wo er gepackt und herausgezogen wurde. Drunten bei den Hörnern der verfallenen Brücke kletterte das Ren an Land, dessen Fell vom Wasser geglättet an den Flanken klebte. Es stand prustend und kopfschüttelnd am anderen Ufer, als wollte es sich vom Wasser in den Ohren befreien. Dann wandte es sich um und verschwand im Weidengestrüpp.
Der zweite Mann, der ins Wasser gesprungen war, hatte weniger Glück. Er konnte keines der Ufer erreichen. Die Strömung riss ihn mit sich, spülte ihn durch die Brücke und übers Wehr. Ein schwacher Schrei wurde vernehmbar. Ein Arm tauchte in den Strudeln auf, dann war es still bis auf das Rauschen des grünlichen Wassers.
Der Zwischenfall dämpfte die erhitzten Gemüter an Bord, sodass Mole und Trouter in der Lage waren, die Besatzung zu befragen. Die beiden, die an der Reling der Jacht standen, konnten sich davon überzeugen, dass Gipsy Joan nicht geblufft hatte, als sie von Verwundeten an Bord sprach. Drunten im einstigen Salon lagen neun Männer und Frauen, wovon einige schon über neunzig waren, wie ihnen an ihrer Pergamenthaut und den eingesunkenen Augen anzusehen war. Ihre dürftige Kleidung war zerrissen, ihre Gesichter und Hände blutig. Eine Frau, der das halbe Gesicht fehlte, schien dem Tode nahe zu sein. Dabei waren sie alle mucksmäuschenstill, was schrecklicher als Wehgeschrei war.
»Was ist mit denen passiert?«, fragte Mole sichtlich betroffen.
»Wiesel«, erklärte Gipsy Joan. Sie und ihre Gefährten waren nur allzu bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Die Fakten waren simpel genug. Ihre Gruppe war zwar klein, aber konnte leidlich vom Fischvorkommen in einem überschwemmten Gebiet bei Grafton Lock leben. Sie hielten nie Wache und hatten so gut wie keine Verteidigung. Am Vortag nun waren sie bei Sonnenuntergang von einem Wieselrudel – oder mehreren Rudeln, wie einige meinten – angegriffen worden. In ihrer Furcht waren sie an Bord ihrer Schiffe gegangen und hatten schleunigst das Weite gesucht. Sie prophezeiten, die Wiesel würden, falls nicht zufällig abgelenkt, bald in Sparcot einfallen.
»Warum?«, fragte Trouter.
»Weil sie hungrig sind, Mann, warum sonst?«, antwortete Gipsy Joan. »Sie vermehren sich wie Kaninchen und durchstreifen auf der Suche nach Nahrung das Land. Fressen alles, die Biester, ob Fisch oder Fleisch oder Aas. Ich würde euch raten, das Feld zu räumen.«
Mole blickte betreten um sich und sagte: »Bring mir hier keine Schauergeschichten in Umlauf, Frau! Wir kommen allein zurecht. Wir sind kein wilder Haufen, sondern gut organisiert. Macht, dass ihr verschwindet! Wir lassen euch unbeschadet ziehen, da ihr arg in der Klemme steckt. Verlasst unser Gebiet, so schnell ihr könnt!«
Joan wollte sich den Hinauswurf nicht gefallen lassen, aber zwei ihrer Anführer zogen furchtsam an ihrem Arm und bestürmten sie, unverzüglich aufzubrechen.
»Es kommt ein zweites Schiff hinterher«, erklärte einer dieser Männer. »Darauf sind unsere älteren, unverletzten Leute. Wir wären dankbar, wenn ihr sie ungehindert passieren ließet.«
Mole und Trouter traten gestikulierend zurück. Das Wort »Wiesel« hatte sie beunruhigt.
»Macht, dass ihr wegkommt!«, riefen sie, mit den Armen fuchtelnd, und dann, an die eigenen Leute gewandt: »Zieht den Mast zurück und gebt ihnen den Weg frei!«
Der Mast wurde zurückgezogen. Joan und ihre Mannschaft stießen vom Ufer ab, wobei ihre alte Jacht bedrohlich schaukelte. Bei denjenigen am Ufer hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Das Wort »Wiesel« war in aller Munde, und die Leute liefen in ihre Häuser oder zum Bootshaus des Dorfes.
Im Gegensatz zu ihren Feinden, den Ratten, war der Wieselbestand nicht zurückgegangen. In den letzten zehn Jahren hatten sie nicht nur zahlenmäßig stark zugenommen, sondern waren auch immer dreister geworden. Heuer war schon der alte Reggy Foster auf der Weide von einem Wiesel angegriffen worden, das ihm die Kehle durchbiss. Die Wiesel setzten verstärkt auf ein altes, früher nur gelegentlich praktiziertes Verhalten und jagten jetzt oft in Rudeln, wie es in Grafton geschehen war. Dabei zeigten sie keinerlei Furcht vor Menschen.
Die Dorfbewohner, die darum wussten, rannten am Ufer hin und her, rempelten sich an und schrien wirr durcheinander.
Jim Mole zog einen Revolver und zielte auf den Rücken eines der Fliehenden.
»Das kannst du nicht tun!«, rief Graubart, der mit erhobener Hand vortrat.
Mole senkte die Waffe und richtete sie auf Graubart.
»Du kannst nicht die eigenen Leute erschießen«, sagte Graubart energisch.
»Wirklich nicht?«, fragte Mole. Seine Augen waren wie Pusteln auf der gealterten Haut. Trouter sagte etwas, woraufhin Mole den Revolver hochhielt und in die Luft schoss. Die Dorfbewohner sahen sich erschrocken um; dann fingen die meisten wieder zu laufen an. Mole lachte.
»Lassen wir sie«, sagte er. »Sie rennen nur in den eigenen Tod.«
»Bring sie zur Vernunft!«, sagte Graubart und trat näher. »Sie haben Angst. Auf sie schießen bringt nichts. Sprich zu ihnen!«
»Vernunft! Geh mir aus dem Weg, Graubart! Sie sind wahnsinnig. Sie werden umkommen. Wir werden alle umkommen.«
»Wirst du sie gehen lassen, Jim?«, wollte Trouter wissen.