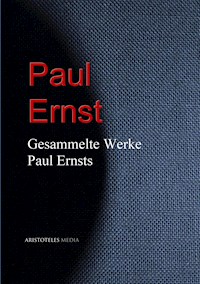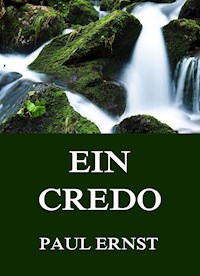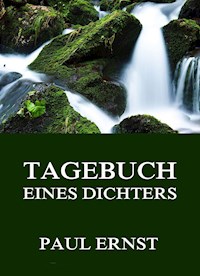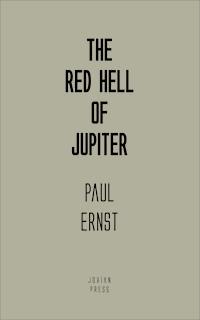Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein folkloristisch angehauchter Roman des 1933 in der Steiermark verstorbenen Schriftstellers. Paul Ernst verfasste sowohl Romane, Erzählungen und Novellen als auch Dramen, Essays und Epen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grün aus Trümmern
Paul Ernst
Inhalt:
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Grün aus Trümmern
Erstes Hauptstück
Zweites Hauptstück
Drittes Hauptstück
Viertes Hauptstück
Fünftes Hauptstück
Grün aus Trümmern, Paul Ernst
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster
Germany
ISBN: 9783849611859
www.jazzybee-verlag.de
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 7. März 1866 in Elbingerode (Harz), verstorben am 13. Mai 1933 in Sankt Georgen an der Stiefing in Österreich. Der Sohn des Grubenaufsehers Johann Christian Friedrich Wilhelm Ernst und dessen Frau Emma Auguste Henriette Dittmann studierte nach seinem Schulabschluss Theologie und Philosophie in Göttingen und Tübingen, später dann Literatur und Geschichte in Berlin. 1892 erfolgte die Promotion. Schon in jungen Jahren schloss er sich der Arbeiterbewegung an und war kurze Zeit Mitglied der SPD. Nach einem Aufenthalt in Weimar, wo viele seiner Werke entstanden, war er Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig.
Wichtige Werke:
·Ariadne auf Naxos
·Brunhild
·Canossa
·Childerich
·Chriemhild
·Der schmale Weg zum Glück
·Das Glück von Lautenthal
·Demetrios
·Der Schatz im Morgenbrotstal
·Der Tod des Cosimo
·Die Hochzeit
·Die selige Insel und andere Erzählungen aus dem Süden
·Komödianten- und Spitzbubengeschichten
·Preußengeist
·Saat auf Hoffnung
Grün aus Trümmern
Erstes Hauptstück
Der Schriftleiter des Volksblattes ging in seinem Arbeitszimmer wütend auf und ab, stöhnend und zuweilen mit dem Fuß auf den schmutzigen, feuchten Fußboden stampfend. Er hielt sich die Backe.
Das Zimmer war lang und schmal. Am Fenster stand der lange Schreibtisch, auf dem Zeitungen und sonstige Druckschriften aller Art staubig aufgehäuft lagen. Nur ein kleiner Raum auf ihm war frei zum Schreiben; da lag der angefangene Leitartikel, standen Tintenfaß und Kleistertopf. Ein Rohrstuhl aus gebogenem Holz, abgegriffen, durchgesessen, stand davor. Dann war da noch in einer Ecke ein emailliertes Waschbecken in eisernem Ständer, dahinter ein sehr schmutziges Handtuch an der Wand. An der Tür an Haken Hut, Rock und Manschetten. Die Nebentür öffnete sich. Ein Mann von etwa fünfzig Jahren, mit blondem, etwas angegrautem Vollbart sah durch die Spalte. Er fragte: »Was ist Ihnen denn, Herr Doktor?«
Dr. Lewandowsky, der Schriftleiter, ein verwachsener Mensch von etwa dreißig Jahren, mit unordentlichem Kopfhaar und Bart, übernächtig, verdrossen, erwiderte kurz: »Zahnschmerzen! Zahnschmerzen!« Er stampfte mit dem Fuß auf. »Verdammte Bude! Ihr Fenster schließt nicht. Beständig hat man Zug!«
Der Andere trat in das Zimmer und untersuchte das Fenster.
»Es schließt ganz fest. Ich kann nichts spüren.«
»Aber ich spüre es. Das genügt mir«, erwiderte Dr. Lewandowsky. »Weshalb lassen Sie nicht ein Doppelfenster anbringen? Für den Tintenkuli ist es wohl gut genug so, was?«
»Aber Herr Doktor!« entgegnete der Andere.
»Verdammte Zahnschmerzen! Habe früher nie Zahnschmerzen gehabt!« schrie der Schriftleiter.
»Gehen Sie gleich zum Zahnarzt, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit!« sagte der Andere. »Es ist genug Manuskript in der Druckerei.«
»Wissen Sie denn, ob ich die Zahnschmerzen los sein will?« fragte Dr. Lewandowsky ihn tückisch. »Der Mensch will sich fühlen. Fühlen will sich der Mensch. Aber das verstehen Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe!«
Es klopfte an der Tür. Der Schriftleiter rief »Herein!« Ein junger Mann trat ein, ein Arbeiter, in weiten Hosen von schwarzem Baumwollsamt, die unten merkwürdig ausgeschweift waren, und mit einem ungeheuer großen schwarzen Schlapphut.
»Lassen Sie sich sehen, lassen Sie sich bewundern«, rief Dr. Lewandowsky höhnisch. »Ein Beau – ein Gentleman. Alle Mädchen sehen hinter ihm her.«
Der junge Mann lachte verlegen: »Wenn man im Streikzug geht, da zieht man doch seinen besten Staat an!«
»Selbstverständlich, den besten Staat! Verdammter Zahn! Na, was sagt denn der Krauter?«
Der junge Mann schwieg, es zog eine Röte über sein Gesicht, und er drehte den Hut in der Hand.
Der Ältere, Dritte, der bis nun schweigend gestanden hatte, legte ihm die Hand auf die Schulter: »Nehmen Sie Verstand an, Genosse. Der Mann hat recht. Sehen Sie sich noch drei, vier Jahre in der Welt um, dann kommen Sie wieder. Dann haben Sie was gelernt, dann haben Sie die Welt gesehen, dann machen Sie sich selbständig. Ich war dreißig, als ich mich selbständig machte.«
Der junge Mann schüttelte verlegen unwillig die Hand ab. »Also punkt zehn geht der Zug vom Bahnhof ab; die Bahnhofstraße, die Kaiser-Wilhelmstraße zum Schloß. Dann Demonstration vor dem Schloß. Es werden gegen fünftausend Mann.«
»Muß noch in die Abendnummer«, sagte der Schriftleiter. »Haben Sie die Ansprachen?«
Der Arbeiter suchte in der Brusttasche und gab ihm zwei geheftete Papiere. Der Schriftleiter setzte sich an den Tisch, nahm die Feder zur Hand, überflog die Seiten, machte Striche, änderte einige Worte und klebte die Blätter dann zusammen. Die beiden Andern sprachen inzwischen leise miteinander. »Ich sehe es ja wohl ein, es ist ja wohl vernünftig«, sagte der Jüngere, »Und man will doch auch weiter kommen. Es steht nicht gut mit dem Alten. Ich sage mir: was habe ich von der Selbständigkeit?«
Der Schriftleiter stand auf und rief: »Ja, das ist nun der deutsche Revolutionär. Erst Verlobung mit Minchen. Es ist doch eine richtige Verlobung, was? Die Tanten waren doch dabei? Was? Und dann: Versprechen, ich bleibe dir treu, du bleibst mir auch treu. Ich spare, du sparst, er spart, wir sparen. Wenn wir fünfzig alt sind, dann heiraten wir. Verdammte Zahnschmerzen! Vertiko, Sofa mit Plüschbezug und Paneel.«
Das Telefon klingelte. Er stürzte eilig hin, hielt sich den Hörer an den Kopf und schrieb, indem er einige Worte fragend wiederholte. Er wendete den Kopf: »Neueste Nachricht. Der österreichische Thronfolger in Serajewo gemordet. Wieder einer hin. Na, Hampe, dauert nicht mehr lange. Sie erlebens noch. Sie werden noch Präsident der deutschen Republik!«
»Ich habe meine Druckerei, ich bin der Vorsitzende der Partei im Land, ich bin im Landtag, ich bin im Reichstag, weiter will ich nichts«, erwiderte Hampe. »Die Entwicklung geht langsam, aber sie geht sicher. Wir erlebens nicht mehr, unsere Kinder vielleicht. Wir sind hier nicht in Serajewo.«
»Nein, wir sind hier alle Untertanen seiner Königlichen Hoheit des Herrn Großherzogs«, rief Dr. Lewandowsky höhnisch aus. »Wir zahlen unsere Gelder an die Organisation und lesen das Parteiblatt, wir beteiligen uns an den Streiks und an den Demonstrationen, und dann gehen wir nach Hause und trinken unser Flaschenbier. Ausländer, Fremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion. Dergleichen Sünder, gottlob! sind selten Landeskinder.«
»Ja, dem deutschen Arbeiter fehlt es eben an Aufklärung«, sagte der junge Mann. »Ihnen, Genosse Hampe, kann man das nicht übelnehmen. Sie sind schließlich kein Proletarier.« »Kleinbürgerlich bis auf die Knochen, die ganze Partei in Deutschland«, sagte Lewandowsky. »Wer weiß. Einmal muß ja die Geschichte ins Rollen kommen. Der Zarismus kann keinen Stoß mehr aushalten. Dann gehe ich nach Rußland.«
»Genosse Müller«, sagte Hampe mit Nachdruck. »Ich habe die Druckerei. Aber mein Besitz ist das Eine, und meine Überzeugungen sind das Andere. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich habe noch das Sozialistengesetz mitgemacht. Damals war es nicht so leicht, wie heutzutage. Ich bin ja kein studierter Mann, aber das weiß ich, daß die Wissenschaft für den Sozialismus ist, das sehe ich, daß der Kleinbetrieb sich nicht halten kann heutzutage. Aber Fleiß und Ehrlichkeit ist auch etwas. Und wenn einer ein ordentlicher Kerl ist, so findet er schon ein Unterkommen.« »Na, wie ist es, Hampe, wenn ich zu Ihnen steige und sage: ›Geben Sie mir Ihre Tochter zur Frau‹, was sagen Sie da?« fragte ihn lachend Lewandowsky.
Hampe erwiderte: »Sie haben studiert und sind Doktor, und Sie sind mir sehr wert als Schriftleiter. Wenn Sie mir auch manchmal zu scharf sind, denn die Abonnenten vermehren sich, und das ist die Hauptsache. Aber meine Tochter gebe ich Ihnen nicht. Das wissen Sie ganz genau. Sie haben auch bloß einen Witz gemacht mit der Frage. Alles, wo es hingehört. Sie haben eine große Zukunft in der Partei vor sich. Sie haben große Gaben. Wer weiß, was einmal aus Ihnen werden kann. Ich habe mein Auskommen, und mein Schwiegersohn kann mir einmal im Geschäft helfen.«
»Verdammter Zahnschmerz«, schrie Dr. Lewandowsky. »Was wollen Sie denn eigentlich bei mir? Ich begleite den Zug, vielleicht kommt noch ein Zwischenfall, der in die Zeitung muß, aber wahrscheinlich ist das ja gerade nicht. So, nun, meine Herren, können Sie das Zimmer verlassen. Der Leitartikel schreibt sich nicht von selber. Zum Zahnarzt ist ja keine Zeit, da ist zum Schwatzen auch keine.« Der junge Arbeiter verabschiedete sich ungeschickt. »Hören Sie mal, Müller«, rief ihm der Schriftleiter nach, »Sie haben gehört, eben habe ich einen Korb gekriegt. Wie ist es denn, Minchen hat doch noch eine Schwester? Könnten wir Schwäger werden? Den Zimmerplatz beanspruche ich nicht, den können Sie erben, aber vielleicht hat der alte Krauter noch so etwas Pinke Pinke?«
Der junge Mann lachte verlegen und ging ohne Erwiderung aus dem Zimmer. Der Buchdruckereibesitzer trat in das Nebengelaß zurück, und so blieb Dr. Lewandowsky allein. Das Volksblatt war die sozialdemokratische Zeitung der Hauptstadt O. des gleichnamigen Großherzogtums. Aus dem Gespräch der drei Männer haben wir schon erfahren, daß ein größerer Streik begonnen hatte. Die sämtlichen Bauhandwerker hatten die Arbeit niedergelegt. Der junge Mann, dessen Namen Müller der Schriftleiter nannte, war Zimmermann und war Vertrauensmann seiner Gewerkschaft; er war ein tüchtiger und verständiger Mann, außerdem unverheiratet, und so machte es sich denn von selber, daß er der eigentliche Anführer in der Streikleitung war.
O. war eine Stadt von etwa siebzigtausend Einwohnern. Wer eine Vorstellung von ihr bekommen wollte, der mußte sich ihre Entstehung klarmachen. Noch bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte sie nicht mehr wie zwanzigtausend Einwohner gehabt. Da war das Schloß, das mit zwei Flügeln in einen eisengitterumzäunten Garten hineingebaut war, auf den die Hauptstraße führte, die Kaiser-Wilhelmstraße, mit Häusern meistens aus dem achtzehnten Jahrhundert. Heute waren im Erdgeschoß dieser früher vornehmen Häuser überall Läden mit großen Spiegelscheiben ausgebrochen. Hinter dieser Hauptstraße auf beiden Seiten befand sich ein Gewirr von Straßen, Gassen und Gäßchen, in denen Handwerker und kleine Geschäftsleute hausten. In den sechziger Jahren hatte man den Bahnhof etwas außerhalb der Stadt gebaut; schon längst aber war durch eine breite Straße die Verbindung mit der alten Stadt hergestellt; sie stieß in stumpfem Winkel auf die Kaiser-Wilhelmstraße, welche denn so als ihre Fortsetzung erschien; schon längst hatten sich Parallelstraßen zur Bahnhofstraße und verbindende Querstraßen entwickelt; alle mit dreistöckigen Häusern, wie sie in jenen Jahrzehnten gebaut wurden, alle sehr weit, ganz gerade und recht kahl. In der Bahnhofstraße standen große Geschäftshäuser, Banken, auch eine große Volksschule; in den Nebenstraßen wohnten in den hohen und großen Häusern Arbeiter, kleine Angestellte, in den Kellern waren Läden für Eßwaren und Ähnliches.
Auf der diesem Bahnhofsviertel gegenüberliegenden Seite der Altstadt befand sich das Villenviertel. Es war zunächst in einen alten städtischen Park hineingebaut, den man aufgeteilt hatte; und als die aufgeteilten Stücke nicht mehr ausreichten, hatte man weitere Villenstraßen in das umgebende Ackerland gezogen, Gärten eingerichtet mit jungen Bäumen und Ziersträuchern. Die Villen waren in der Geschmacksrichtung ihrer Entstehungszeit gebaut: zuerst kam deutsche Renaissance, meistens Ziegelbau mit Bruchsteinecken, Türmchen, auch wohl zwei Pyramiden auf dem Dach. Dann schlossen sich Häuser an, welche nicht mehr einen so einheitlichen Charakter trugen: da kam Jugendstil, Englischer Stil, auch Biedermeierbestrebungen machten sich geltend; aber in sehr vielen Straßen waren die Bäume doch schon so groß, daß man von der Architektur nicht allzusehr gestört wurde. Es hatte früher eine Landstraße quer durch den Park geführt. Zu deren Seiten waren die ersten Villen gebaut, und so hatte sie sich denn zur Hauptstraße des Viertels entwickelt; sie hieß jetzt noch »Landstraße«. Sie stieß wieder in einem stumpfen Winkel auf die Kaiser-Wilhelmstraße, so daß vom Bahnhof aus ein einheitlicher Straßenzug durch die ganze Stadt hindurchführte.
Der Großherzog war ein alter Herr, der nun mit Bewußtsein seit den vierziger Jahren die ganze große Entwicklung Deutschlands mitgemacht hatte: er hatte noch die letzten Nachklänge unserer geistigen Zeit gehört, dann war er in die liberale Zeit gekommen, die bestimmend und bildend auf ihn gewirkt hatte; bei der Gründung des Reichs durch den großen Kanzler hatte er in seinem kräftigsten Mannesalter gestanden und war opferwillig und begeistert einer der mächtigsten Helfer bei der großen Tat gewesen; dann hatte er den wirtschaftlichen Aufschwung gesehen: die Zunahme der Bevölkerung, die auch seine Hauptstadt so ganz verändert hatte, die Zunahme des Reichtums, die Entwicklung neuer Gesellschaftsklassen, die Rückbildung und das Untergehen alter. Er wurde von den Bürgern verehrt als das lebende Zeichen bedeutender geschichtlicher Vorgänge, als der ehrenhafte und tüchtige Mitarbeiter an ihnen. Aber von Jahr zu Jahr war die Sozialdemokratie mächtiger geworden, die sich nicht mehr durch geschichtliche Bande an ihn und sein Haus gefesselt fühlte und ihm fremd gegenüberstand; das ältere Geschlecht war ihm nicht feindselig, es war noch unter den Jugendeindrücken des allgemeinen Liberalismus aufgewachsen; aber die jüngeren Leute trugen schon eine heftige Gegnerschaft zur Schau und sprachen gern unter sich über eine republikanische Neuordnung der Verhältnisse, wo dem Tüchtigen freie Bahn gegeben werden sollte und veraltete Vorrechte fallen mußten.
Wir haben bereits die vornehmsten sozialdemokratischen Führer kennen gelernt. Es war das der Buchdruckereibesltzer Hampe, ein Mann in den Fünfzigern, der sich aus ganz kleinen Anfängen zu einem achtbaren Besitz emporgearbeitet hatte; er war der Drucker des Parteiblattes und gewissermaßen auch sein Besitzer, freilich sehr eingeschränkt in seinem Besitzrecht durch Einspruch und Besteuerung der Genossen. Er hatte eine ordentliche und fleißige Frau, die früher, solange es nötig war, im Geschäft mitgeholfen hatte, aber sich nun ganz ihrer Wirtschaft widmete, und ein einziges Kind, eine Tochter von nun fast sechzehn Jahren. Er war Abgeordneter der Partei im Reichstag und im Landtag, und seine tüchtige, verständige und bürgerlich ehrenwerte Art hatte viel dazu beigetragen, daß die Partei sich so schnell im Land verbreitet hatte. Der junge Zimmergeselle Müller war erst vor zwei Jahren zugezogen. Er war ein fleißiger und ordentlicher Arbeiter mit Streben nach Höherem: er hatte eine kleine Bibliothek naturwissenschaftlicher und politischer Werke, in der er eifrig las, und unermüdlich war er für Partei und Gewerkschaft tätig. Dr. Lewandowsky war gleichfalls nicht einheimisch. Er stammte aus Posen und war durch Beziehungen, die er als Schriftsteller in Parteikreisen hatte, nach O. als Schriftleiter gekommen, wo er nun schon seit drei Jahren lebte und wirkte. Da der Hof liberal war, so hatte die konservative Partei keine große Bedeutung. Die höheren Stände, die Unternehmer und Geschäftsleute rechneten sich fast ausschließlich zur liberalen Partei. Sie hatten die Vorstellung, daß 1871 eine große Tat geschehen sei, die sie nun zu schützen und zu ehren hatten; sie wünschten wohl, daß in Berlin ein freiheitlicherer Kurs eingeschlagen würde; aber sie waren doch dankbar dafür, daß sich Kunst und Wissenschaft, Handel und Industrie so entwickeln konnten, und nahmen an, daß vor der immer zunehmenden Bildung alle Gespenster rechts und links allmählich verschwinden mußten, und daß auch alle äußeren Verhältnisse und Beziehungen des Reichs sich immer günstiger gestalten würden durch Arbeit, Verstand, Bildung und Redlichkeit des deutschen Volks.
Der Liberalismus war hier ein enges Bündnis eingegangen mit den geistigen Mächten der Nation. Ein weltberühmter Unternehmer hatte in O. seinen Sitz, welcher sich zur Aufgabe gemacht hatte, Bildung und Wissen im weitesten Kreise des Volks zu verbreiten. Der Kommerzienrat Werner war der Besitzer und Leiter eines großen Verlagsunternehmens, das die Hauptwerke der Literatur in billigen und guten Ausgaben druckte; und sein Geschick und Fleiß hatte das Geschäft so gestellt, daß eine große Druckerei mit einem Personal von fast zweitausend Mann, mehrere große Papierfabriken im Lande und andere, kleinere Betriebe fast alles aus den Rohstoffen selber herstellten, was für das Verlagsgeschäft nötig war. Die Geschäftsgebäude des Kommerzienrats Werner lagen auf der Seite des Bahnhofs außerhalb der Stadt. Etwas später, als das erzählte Gespräch in der Druckerei des »Volksblatts« vor sich ging, saß Werner in seiner Schreibstube, öffnete die eingegangenen Briefe, versah sie mit kurzen Bemerkungen und legte sie dann neben sich zur Seite. In den Betrieben war es still. Die Arbeiter und ein Teil der Angestellten waren in einen Sympathiestreik für die Bauarbeiter eingetreten.
Es klopfte bescheiden an der Tür. Auf das Herein öffnete sie sich, und der Faktor der Druckerei trat ein.
»Setzen Sie sich, Reichardt«, sagte der Kommerzienrat und wies auf einen Stuhl neben seinem Schreibtisch.
»Ich habe es mir nun genau berechnet. Wenn Herr Kommerzienrat meinen, dann können wir den ganzen Homer mit den kleineren Gedichten gebunden für eine Mark fünfzig Ladenpreis abgeben.«
»Das ist mir lieb, das freut mich«, sagte Werner. »Ich habe hier noch ein paar Handschriften angeboten bekommen; das ist etwas, was die Leute kaufen für die Eisenbahn; bei dem können wir etwas verdienen, das rechnen wir dann dem Homer zugute. Das ist immer mein Wunsch gewesen, auch einen billigen Homer zu haben. Sie können doch die Leute beobachten. Meinen Sie, daß viele von den jüngeren Leuten sich den Homer kaufen werden?«
»Einige gewiß«, sagte Reichardt.
»Es geht langsam, es geht langsam. Aber es geht doch vorwärts, es muß doch vorwärts gehen!«
»Ja, natürlich, Herr Kommerzienrat«, sagte Reichardt, »und es ist doch auch wichtig, daß wir einmal der Welt zeigen, was die Firma leisten kann. Den Homer für eine Mark fünfzig, holzfreies Papier, klarer Druck, Ganzleinen mit Goldaufdruck, das macht uns so leicht keiner nach. Da kann die Konkurrenz sich anstrengen.«
»Wie steht es denn nun mit dem Streik?« fragte Werner.
»Unsere Leute treten morgen wieder an. Heute ist der große Demonstrationszug. Am Bahnhof sammeln sie sich. Die berittenen Schutzleute stehen schon überall den ganzen Weg entlang. Die Soldaten werden in der Kaserne gehalten. Ach, Herr Kommerzienrat, das ist kein Arbeiten mehr! Die jungen Leute wissen alles besser als unsereins, man darf schon kein Wort mehr sagen. Sehen Sie, ich habe das Gymnasium bis Tertia besucht. Mein Vater sagte: ‹Wenn du einmal Setzer werden willst, dann mußt du auch griechische und lateinische Worte setzen können, die kommen immer einmal vor.› Dann habe ich fünf Jahre gelernt, fünf Jahre. Und dann bin ich auf Wanderschaft gegangen. In England bin ich gewesen und in Frankreich. Aber heutzutage? Was ich bloß für Ärger habe, die Bengels immer pünktlich in die Fortbildungsschule zu bringen! ›Bildung macht frei‹, sage ich ihnen; aber Kino, Tanzboden, Mädchen, Kneipe, das ist es heute. Und dann drei Jahre Lehrzeit, und in denen nichts gelernt wird. Aber gleich hohen Lohn, das muß ja sein! Und dann losgeheiratet, so eine Schlunze vom Tanzboden weg, an der sich schon ein halbes Dutzend abgewirbelt hat. Es ist keine Ehre mehr in der Welt, Herr Kommerzienrat, und wenn keine Ehre mehr ist, dann ist alles zu Ende.«
Werner seufzte: »Ja, daran darf man nicht denken. Das müssen einmal die jungen Leute in Ordnung bringen. Wir können da nichts mehr tun.«
Ein Geräusch ließ sich von weitem vernehmen von taktmäßig gehenden Männern. »Das ist der Zug«, sagte der Faktor. Durch eine Lücke in den Häusern konnte man auf die Bahnhofstraße sehen; dort zog es schwarz von Menschen vorbei. »Bei Hahn und Sohn ist der Sympathiestreik auch angesagt. Das ist eine richtige Heerschau«, sagte der Faktor.
Wie ein Rauschen des Meeres klang das Marschieren des Zuges.
»Kommen Sie denn noch manchmal mit Hampe zusammen?« fragte Werner.
»Wenig. Die Ansichten sind zu verschieden«, erwiderte der Faktor. »Und dann: Er ist jetzt Prinzipal, er ist Landtagsabgeordneter, er ist Reichstagsabgeordneter, da will er eben einen anderen Umgang haben.«
»Er selber ist doch wohl ein ordentlicher Mann?«
»Da ist nichts zu sagen. Und er kommt auch vorwärts. Aber er paßt mir nicht mehr. Und sein Umgang paßt mir auch nicht. Ich bin ein Handwerker. Wenn bei uns zu Hause mehr Geld gewesen wäre, dann hätte ich ja wohl studieren können. Aber der Handwerkerstand muß auch sein. Und jeder muß wissen, was er ist. Und mit solchem Volk mag ich nichts zu tun haben, mit dem Hampe verkehrt, das lebt doch nur von den Arbeitergroschen, und wenn sie unter sich sind, dann lachen sie bloß über die Dummen.«
Der Zug ging und ging. Die beiden Männer sahen durch das Fenster, wie in den schmalen Ausschnitt der Lücke immer wieder neue Menschen taktmäßig vorkamen und verschwanden.
Der Zug ging durch die Bahnhofstraße, die Kaiser-Wilhelmstraße. Vor dem Schloß stellten sich die Massen auf. Es waren Ordner vorgesehen, welche die Reihen verteilten. Der große Platz vor dem eisernen Gitter war angefüllt von Männern, die Nebenstraßen auch; in der Wilhelmstraße wurde der Raum freigehalten für die Elektrische Bahn.
Drei Männer gingen zwischen den Wachen vor ihren Schilderhäuschen durch das eiserne Tor, überschritten den freien Platz zwischen den Flügeln und traten in das Schloß. Es waren Hampe, Müller und einer der Führer der Maurer. Sie wurden in einen großen und hohen Saal geführt. Die Wände waren weiß lackiert und vergoldet; es waren in festen Zwischenräumen Wandleuchter aus Bronze angebracht. Von der Decke hing ein großer Leuchter mit Kerzen herab; die Kerzen waren aus Porzellan nachgebildet und trugen an der Spitze ein Glühlämpchen. Der Saal war ganz leer, kein Stuhl und kein Tisch stand da. Der Boden war spiegelblank, zum Ausgleiten.
Die Männer standen da und waren verlegen; sie wußten nicht, wohin sie ihre Hände tun sollten. Hampe war in Frack und Zylinder, mit weißen Handschuhen; Müller in der beschriebenen Zimmermannstracht, der Maurer in dunklem Sonntagsanzug.
Die Tür wurde geöffnet und der Großherzog trat herein. Er war ein hoher und schlanker alter Herr, leicht gebückt, in einer prächtigen Uniform.
Die Drei verneigten sich tief, der Großherzog winkte leicht mit der Hand.
Hampe räusperte sich. »Königliche Hoheit,« begann er, »das arbeitende Volk Ihrer Residenzstadt ...« Er stockte. Er hatte sich eine kurze Rede zu Hause aufgeschrieben und wörtlich auswendig gelernt, aber nun versagte ihm plötzlich vor Verlegenheit das Gedächtnis, und es fiel ihm nichts ein, was er sonst sagen konnte; so fing er von neuem an: »Königliche Hoheit, das arbeitende Volk Ihrer Residenzstadt ...« Der Schweiß trat ihm auf die Stirn.
Der Großherzog sagte: »Sie wollen mir mitteilen, Herr Abgeordneter, daß die Bürger meiner Hauptstadt Beschwerden vorzubringen haben. Ich habe ein offenes Ohr für alle meine Untertanen. Als ich nach dem Hinscheiden meines hochseligen Herrn Vaters die Regierung meines Landes übernahm, da erklärte ich, daß meine Sorge der Wohlfahrt des Volkes geweiht sein solle. Ich habe mich bemüht, und wurde darin von meiner Regierung und meinem Landtag unterstützt, alle gebundenen Kräfte frei zu machen, jedem meiner Untertanen zu ermöglichen, nach seinen Anlagen und erworbenen Fähigkeiten zu arbeiten, um sein Los zu verbessern. Die alten Beschränkungen der Erwerbung des Bürgerrechts wurden aufgehoben. Die Gewerbefreiheit wurde eingeführt. Eine Bevorzugung des Adels findet in meinem Lande nicht statt, mein erster Minister ist bürgerlich; ich bin stolz darauf, daß er der Sohn eines rechtschaffenen Tischlermeisters dieser Stadt ist. Die neue Zeit brachte die neuen Aufgaben der sozialen Gesetzgebung. Sie wurden nach Kräften gelöst. Ich bin mir bewußt, daß große Veränderungen im gesellschaftlichen Leben der Menschheit vor unsern Augen vor sich gehen; es wird immer mein Streben sein, die Schwachen zu unterstützen in ihrem Kampf ums Leben; Sie wissen, daß von meinen Vorfahren eine Reihe von hochherzigen Stiftungen begründet sind, die zeitgemäß ausgebaut werden. Für jede Anregung bin ich dankbar.«
Er sah Hampe an, der weiter schwieg.
Nun schloß er: »Vielleicht haben Sie mir Vorschläge zu machen, ich bitte Sie, dieselben schriftlich aufzusetzen und mir einzureichen. Ich werde sie meinen Ministern zur Prüfung übergeben.« Ein Wink, die drei Männer verbeugten sich tief, und der Großherzog verließ den Raum. Auf der Treppe sagte der Maurer zu Müller: »Du, Albert, nun sind wir ebenso klug wie vorher.« Sie gingen über den freien Platz zwischen den Flügeln zurück, durch die eiserne Tür zu den harrenden Leuten. Hampe hatte ein leises Gespräch mit den Ordnern. Die zusammengehörenden Gruppen wurden in bestimmter Reihenfolge durch Querstraßen abgeführt, und bald waren Platz und Straße, wie sie vorher ausgesehen hatten. Es war die Zeit des Schulschlusses. Aus der Tür des Gymnasiums brachen die Kleinen, lachend, schreiend, sich knuffend, und sich schnell nach ihren Richtungen verteilend, dann kamen die größeren Schüler, plaudernd, streitend, mit ihren tiefern Stimmen, eifrig mit ihren kleinen Mappen.
Hans Werner, der einzige Sohn des Kommerzienrats Werner, ging mit zwei Freunden die Kaiser-Wilhelmstraße hinunter, dann in die Landstraße; erst trennte sich der eine Freund, dann der andere; er bog in eine Nebenstraße ein, die zu dem elterlichen Hause führte. An der Ecke einer Gasse blieb er stehen; hier lagen die Häuser in großen Gärten, der Weg führte an Zäunen, über welche Sträucher und Bäume überwuchsen. Hans trat einige Schritte zurück, so daß er auf der Straße nicht von weitem her gesehen werden konnte, und lauschte durch das Blattwerk.
Da bog Anna Hampe in die Straße ein, ihre Büchermappe übermütig an den Tragriemen schwenkend. Sie war ein frisches, rotbackiges Mädchen, mit braun strahlenden Augen, bräunlichem Gesichtston und dickem, dunkelbraunem Haar, das ihr in zwei sehr starken Zöpfen auf den Rücken siel. Plötzlich blieb sie stehen und sah sich um. Es war niemand auf der Straße. Da lag zwischen den Stäben eines eisernen Gitters, das einen Garten von der Straße abtrennte, ein kleiner Veilchenstrauß. Sie bückte sich rasch, ergriff ihn, und barg ihn in der hohlen Hand. Hans kam aus seinem Versteck hervor, mit gleichgültigem Ausdruck des Gesichts, als gehe er in gewöhnlicher Weise seinen Weg. Er ging an Anna vorüber und grüßte sie höflich. Sie dankte ihm mit einer hastigen Kopfbewegung, und in der Verlegenheit machte sie dazu einen Knicks, wie die kleinen Mädchen machen; das Blut war ihr ins Gesicht geschossen, tiefdunkel bis zu den Haarwurzeln. Sie hatte ihre Mappe fester gefaßt und ging mit festen Schritten.
Nun stand Hans vor der väterlichen Gartentür. Er öffnete sie und trat ein, dann ging er den Kiesweg zum Hause. Die Frau des Kommerzienrats Werner war schon vor längeren Jahren gestorben. Eine unverheiratete Schwester, Tante Minna, versorgte den Haushalt. Am Mittagstisch saßen der Kommerzienrat, Tante Minna und Hans. Der Vater erzählte von der Ermordung des Erzherzogs. »Hoffentlich zieht die Tat nicht weitere Folgen nach sich. Wahrscheinlich steht hinter ihr die russische Partei in Serbien und wird von den Kriegshetzern in Rußland geschoben. Wenn sich an dem Verbrechen ein Krieg entflammt, dann wird es der Weltkrieg«, sagte er.