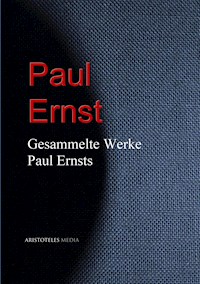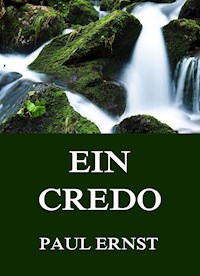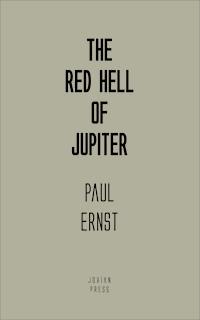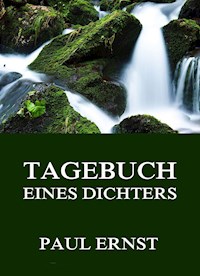
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Sprache: Deutsch
Paul Ernst, unter seinen Zeitgenossen einsam und im Wesentlichen kaum verstanden, pflegte sein Erleben und Erfahren überpersönlich zu betrachten, im Zusammenhang mit unserem gemeinsamen Schicksal und unseren Aufgaben zu sehen, und so entsprach es ihm, daß er gewissermaßen ein öffentliches Tagebuch führte, in dem er Gedanken und Erlebnisse seiner Tage in Zeitungsaufsätzen ganz allgemeinen Inhaltes festhielt. Zu diesen größtenteils im parteilosen roten "Tag" erschienenen Aufsätzen war die äußere Veranlassung meist geringfügig, oft nur eine Buchbesprechung oder eine Tagesbegebehnheit, aber durch die Art, wie der Dichter eine aufgenommene Frage mit siner Wirklichkeitsanschauung erfüllt und bis in ihre Tiefen treibt, gibt er ihrer Erörterung etwas über den Einzelanlaß und die eigene Zeit hinaus Bedeutsames. Die Auswahl und Anordnung der vorliegenden Aufsätze traf Paul Ernst erst auf seinem Gut Sonnenhofen in Oberbayern, wo er von 1918 bis 1925 lebte. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tagebuch eines Dichters
Paul Ernst
Inhalt:
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Tagebuch eines Dichters
Vorwort
Kunst und altes Spiegelbild
Die Kunst und der Bürger
Die literarische Kritik
Shakespeare und das deutsche Drama
Dostojewskis Weltanschauung
Zur Entwicklung des Romans
Das Theater
Möglichkeiten einer Kinokunst
Kunst und Persönlichkeit
Aussichten des Kunstgewerbes
Sprache und Dichtung
Das Geschichtslose
Idealismus und Realismus in der Kunst
Der Krieg und die Kunst
Zu Goethes Novellen und Märchen
Kunst, Wissenschaft, Adel und Bürgertum
Dichtung und Nation
Der Künstler
Unmittelbare und vermittelte Wirkung der Kunst
Die Entartung des Weibes und die Kunst
Bühne, Drama, Volk und Volkstheater
Die Kunst und das Volk
Kultur
Luxus und Luxus
Die Stellung der Bildung
Monarchie, Republik und Gottesträgertum
Der Atheismus und die Politik
So erben sich Gesetz und Recht
Veränderungen der Staatstätigkeit
Volk und Menschheit
Der Sinn der Revolution
Der Mietling
Der Staatsmann
Geheimer Ausspruch Bismarcks über Goethe
Organisation
Der Adel
Freie Bahn jedem Tüchtigen
Das Reich Gottes in uns
Die innere Freiheit
Der Stolz
Die Arbeit und der Krieg
Die Treue
Machiavellismus
Der geistliche Tod
Der Chef
Russische Möglichkeiten
Produktivkräfte und menschliche Kräfte
Der Beruf
Die Macht der Worte
Der Schriftsteller
Bedürfnis und Persönlichkeit
Bestreben und Forderung
Die Seligkeitslehre
Die Macht und die Freiheit
Der neue Gott
Revolution
Die Macht
Gottes Tempel
Das Böse
Die Gerechtigkeit
Die Religion des Philisters
Der Wert der Worte
Auri sacra fames
Vornehme Armut
Der Mut
Der sittliche Mut
Tagebuch eines Dichters, Paul Ernst
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster
Germany
ISBN: 9783849611903
www.jazzybee-verlag.de
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 7. März 1866 in Elbingerode (Harz), verstorben am 13. Mai 1933 in Sankt Georgen an der Stiefing in Österreich. Der Sohn des Grubenaufsehers Johann Christian Friedrich Wilhelm Ernst und dessen Frau Emma Auguste Henriette Dittmann studierte nach seinem Schulabschluss Theologie und Philosophie in Göttingen und Tübingen, später dann Literatur und Geschichte in Berlin. 1892 erfolgte die Promotion. Schon in jungen Jahren schloss er sich der Arbeiterbewegung an und war kurze Zeit Mitglied der SPD. Nach einem Aufenthalt in Weimar, wo viele seiner Werke entstanden, war er Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig.
Wichtige Werke:
·Ariadne auf Naxos
·Brunhild
·Canossa
·Childerich
·Chriemhild
·Der schmale Weg zum Glück
·Das Glück von Lautenthal
·Demetrios
·Der Schatz im Morgenbrotstal
·Der Tod des Cosimo
·Die Hochzeit
·Die selige Insel und andere Erzählungen aus dem Süden
·Komödianten- und Spitzbubengeschichten
·Preußengeist
·Saat auf Hoffnung
Tagebuch eines Dichters
Vorwort
(um 1923)
Ein Dichter ist, wie jeder Künstler, ein Mensch, welcher ein völliges Weltbild in sich trägt, das er durch seine Werke irgendwie darstellt. In vernünftigen und sittlichen Zeiten stimmt das Weltbild der großen Masse mit dem seinigen überein, in unvernünftigen und unsittlichen Zeiten lebt der Dichter mit seinem Weltbild ganz für sich.
Viele Dichter werden dadurch in ihrer Arbeit nicht geändert. Dieses Glück habe ich nicht gehabt. Die Art meiner Begabung brachte es mit sich, daß ich erst spät, mit fast 40 Jahren, das erste Werk fertigstellte, das mir selber bis zu einem gewissen Grad genügte; so konnte ich nicht mehr jenes naive Selbstgenügen erringen, das von der Torheit der Außenwelt gar nichts merkt; ich mußte immer erstaunt mich fragen, woher es denn komme, daß ich so in allem anders fühlte als die anderen Menschen, und lange habe ich in mir selber die Schuld gesucht, bis mir endlich die völlige Läppischkeit unserer Zeit klar wurde.
In die Dichtung darf solche Arbeit der Auseinandersetzung nicht eingehen. Was herauskommt, wenn das doch geschieht, das kann man an Kellers Salander sehen: Keller hat in diesem Roman sein Talent vernichtet. Ich hoffe, daß ich mich in meiner Dichtung freigehalten habe von dieser Zerstörung. Aber die Auseinandersetzung war doch nötig; ich nahm sie in kleinen Aufsätzen vor, die in Zeitungen erschienen.
Ich mußte in ihnen vorsichtig sein, damit die Herausgeber und Schriftleiter nicht merkten, was ich eigentlich sagte, sonst hätten sie die Aufsätze nicht gedruckt, und so steht denn das Wesentliche in diesen kleinen Arbeiten zwischen den Zeilen. Inzwischen ist nun die Revolution und der Beginn des allgemeinen Zusammenbruchs gekommen; ich sammle die Aufsätze in einen Band, und vielleicht ist nun heute ganz klar und unmißverständlich, was zwischen den Zeilen steht, die damals in den bürgerlichsten Blättern von der Welt abgedruckt wurden.
Sonnenhofen b. Königsdorf
Paul Ernst
Kunst und altes Spiegelbild
(1914)
Wenn man unsere Zeit zu betrachten vermöchte von einem Standpunkte, der außerhalb der Zeit läge, so würde man das wirre Bild sich ordnen können, indem man sich klarmachte, daß zwei große Mächte miteinander ringen, ohne selber von ihrem Kampf zu wissen: die Summe alles Absterbenden, Leeren und Nachklingenden und die Summe alles Jungen, Ungeformten und ziellos Wollenden. Alles hat in der Tiefe seinen Zusammenhang, deshalb würde man auf allen Gebieten eine solche Ordnung vornehmen dürfen. Wir leben in dieser Zeit, deshalb wird uns dieser gewaltige Kampf nicht klar, deshalb kommt es uns nicht zum Bewußtsein, daß wir in einer großen geschichtlichen Wende leben, in der sich alles ändert, in einer Wende, wie es die vom Altertum zum Mittelalter, vom Mittelalter zur Neuzeit war.
Gerade durch diesen allgemeinen Kampf sind die einzelnen Gebiete so voneinander geschieden, daß wenigstens ein teilweises Außerhalb-der-Zeit-Stehen möglich ist. Ich möchte es den Vielen raten, welche heute hilflos der Kunst gegenüber sind, indem sie nicht wissen, was gewollt wird und was die einzelnen Leistungen bedeuten. Auch in der Kunst ordnet sich alles, wenn man sich klarmacht, daß zwei Weltalter heute aufeinanderstoßen, die nichts miteinander zu tun haben, trotzdem das eine sich aus dem anderen entwickelt, die sich nicht verstehen können, trotzdem beide Weltalter unter Umständen in demselben Menschen sind. Die Fremdheit ist so groß, daß die einen notwendig die Leistung der anderen überhaupt nicht für Kunst zu halten vermögen. Der gewissenhafte Beobachter und Kritiker wird heute in vielen Fällen sagen müssen: »Wenn ich die Werke ansehe, so scheinen sie mir gänzlich unsinnig; wenn ich aber die Menschen betrachte, die sie geschaffen, so finde ich ernste, strenge Persönlichkeiten, die ihr ganzes Selbst für ihre Arbeit hingeben; das aber ist ein Zeichen dafür, daß diese Werke etwas künstlerisch Bedeutendes sein müssen; und ich muß zugeben, daß das Künstlergeschlecht, das man heute schätzt, zu seiner Zeit ebenso unsinnig erschien.« So entsteht eine allgemeine Unsicherheit in der Kunstbeurteilung; diese wird naturgemäß von den Betrügern und Narren ausgenutzt, und so wird der Wirrwarr noch größer.
Wenn man sich klargemacht hat, daß zwei Weltalter heute miteinander kämpfen, dann ordnet sich alles. Aber wie? Welches ist denn das neue, welches das vergehende Alter? Wohin rechne ich den Naturalismus, die neue Romantik, den Impressionismus in der Literatur, wohin den Impressionismus in der Malerei, den Kubismus oder Expressionismus? Ach, und die Namen sind so trügerisch; wie oft geben Männer ihrem Kunstwollen einen ganz falschen Namen, weil sie selber nicht wissen, wohin sie gehören: denn das neue Wollen hat ja naturgemäß noch kein Ziel, es ist nur Trieb, und das alte Wollen hat kein Ziel mehr, es ist Betrieb geworden; so können sich die neuen Richtungen als alte, die alten als neue Richtungen verkleiden.
Eine Führung in diesem Wirrwarr bekommt man durch die ältere Kunst. Alles, was die Menschen wollen können, haben sie schon einmal wollen müssen; der Ablauf des Damaligen liegt geschichtlich vor uns, und so können wir das Heutige einordnen. Es ist nicht so, als ob nun die Menschen in der Kunst immer wieder auf dasselbe kämen; die Kunst ist immer wieder neu; aber wir verstehen das Wollen einer heutigen Kunst, indem wir das Wollen einer alten Kunst zu verstehen suchen.
Diese Gedanken wurden veranlaßt durch das Lesen eines eben erschienenen Buches über die Plastik der Ägypter von Hedwig Fechheimer. Das Buch ist sehr gut in seiner Art; es ist selbständig, was mehr ist; und was noch mehr ist, es stellt einen Teil unseres heutigen Kunstwollens dar, des in die Zukunft weisenden Kunstwollens, indem es eine alte, abgeschlossene Kunst darstellt: es ist ein Buch für Künstler und nicht bloß für Museumsbeamte.
Es ist merkwürdig, wie bei den verschiedensten Veranlassungen von dem einen Punkt her alle Äußerungen immer wieder auf den einen Punkt kommen; mein eigenes Arbeiten in einer ganz anderen Kunst geht auf ähnliche Ziele, wie die ägyptische Kunst sich gestellt hatte; und bei dem verstandesmäßigen Erwägen, das ja bei jedem selbständig und nicht aus zweiter Hand schaffenden Künstler notwendig ist, bin ich als Dichter auf Gedanken gekommen, welche fast im wörtlichen Ausdruck mit Sätzen der Verfasserin dieses Buches über Plastik übereinstimmen; es heißt: »Der Entwicklungsgedanke wurde unter dem Druck der Naturwissenschaften in die ägyptische Kunstgeschichte eingeführt und damit diese Kunst zu einer archaischen Vorstufe der griechischen herabgewürdigt. Nichts ist willkürlicher und irreführender als die Methode, ein Kunstwerk zum Vorläufer eines anderen zu stempeln. Kunst stellt eine Summe von Vollendungen dar, die nicht vergleichsweise, sondern aus sich heraus zu begreifen sind. Die Meinung, als habe die bildende Kunst im großen sich in fünftausend Jahren weiterentwickelt, ist ganz und gar trügerisch. Es gibt nicht Entwicklungen oder Stufen des Künstlerischen – nur Formen. Form ist vielfältig. Sie ist notwendig die eine bei Jan van Eyck, und notwendig eine andere bei Michelangelo und Daumier. Form ist nicht willkürlich und wird nicht gelernt, sie ist die Spiegelung des Geistigen, sein endgültiger Ausdruck. Ein Genie ist gerade dadurch Künstler, daß es die Form besitzt. Nicht einmal die äußeren Mittel der Realisierung – das Handwerk – zeigen eine Entwicklung. Welcher spätere Steinmetz ist kunstfertiger als ein ägyptischer, der den Basalt gänzlich beherrschte und nach seiner Absicht modelte und polierte! Wie beklagen angesehene moderne Künstler den Verfall der Maltechnik. Ein Maler vom Range Renoirs beneidet die Giotto-Schüler um ein Handwerk, das damals Gemeingut der Ateliers war.«
Ach, wie beneidenswert sind doch die bildenden Künstler, wenn eine unbekannte Dame solche Worte sagen kann, die nicht einmal selber Künstlerin ist, sondern nur Kunstgelehrte! Ich, der ich als Dichter solche Ansichten verkündige, finde ein verwundertes Kopfschütteln und als einziges tatsächliches Ergebnis die Ansicht, daß ich ein Mann bin, der sich eine merkwürdige Lehre ausgedacht hat, nach welcher er nun in der achtungswertesten, aber auch langweiligsten Weise von der Welt unentwegt Dramen verfaßt.
Es gibt kaum eine Kunst, welche ein passenderes Beispiel gäbe als die ägyptische für diesen Satz, für die Kunstgesinnung, welche diesem Satz zugrunde liegt: deshalb, weil sie immer strenge Kunst gewesen ist. Das älteste Relief, das die Verfasserin abbildet, von 3200 v. Chr., die ältesten Rundplastiken von 2900 haben schon die höchste künstlerische Vollendung. Später werden die bildnerischen Vorwürfe bereichert, tauchen neue Vorwürfe auf, werden andere Aufgaben gestellt; aber diese ältesten Werke sind in ihrer Art vollkommen. Das Große an der ägyptischen Kunst ist nun, wie die Künstler ihre Persönlichkeit der Kunst unterordnen, wie deshalb bis etwa 600 v. Chr., wo der Einfluß der griechischen Kunst beginnt, immer eine gleich hohe Ebene der Kunst vorhanden ist. Man denkt an die Franzosen, die ja von den heutigen Völkern immer die künstlerisch ehrenhaftesten gewesen sind: nur daß ihnen stets die eigentliche Schöpferkraft mangelte; so bleibt bei den Franzosen die Ebene immer eine mittlere, und wenn man dann etwa an die in Kunstdingen fast immer gewissenlosen und dilettantisch gerichteten Deutschen denkt, bei denen aber geniale Personen auftauchten, so kommt man leicht zu der Ansicht, das sei eben nun so: in Deutschland gebe es einige Spitzen, die selber nicht ohne ein gewisses Aber sind, und eine Flut des Albernen und Unfähigen, bei den Franzosen aber eine ausgeglichene gute Ebene, ohne die Tiefen des Unsinns, aber auch ohne die Höhen der Schöpferkraft. Selten finden wir ein so glückliches Beispiel wie das ägyptische, das die Unrichtigkeit dieser Ansicht beweist: denn – vorausgesezt, daß man unseren gänzlich törichten Geniebegriff beibehält – bei den Ägyptern findet man die höchste denkbare Ebene von lauter Genies, und zwar lauter Genies ohne ein Aber.
Es gibt für diese Erscheinung eine Erklärung eben in dem Wollen dieser Kunst. Diese Kunst hatte immer einen außerkünstlerischen Zweck.
Die Kunst ist ein Weib: sie darf nie Selbstzweck sein, sonst entartet sie; sie muß sich immer als Mittel betrachten; sie darf nicht herrschen, sondern sie muß dienen. Die ägyptische Kunst fand in der Religion eine vorzügliche Herrin, welche sie Jahrtausende gehalten hat. Jede Kunst aber, welche das will, was die ägyptische Kunst will, ist religiöse Kunst. Wir haben noch nicht eine neue Religion – Religion ist ja wie Kunst ein Höhepunkt, auf dem es nur selten ein Beharren gibt, von dem meistens ein Verfall ausgeht – und wir haben noch nicht eine neue Kunst; aber überall, wo an neuer Kunst gearbeitet wird, da wird auch an neuer Religion gearbeitet.
Die Neuzeit war ungläubig, ja man kann sagen glaubensfeindlich. Seit Beginn der Renaissance bis heute wird das Christentum aufgelöst und nichts an die Stelle gesetzt; man werfe nicht ein, daß ja die christlichen Kirchen noch bestehen; eine Religion ist tot in dem Augenblick, wo nur noch die mittleren und unteren Schichten des Geistes ihr angehören, nicht mehr die obersten, denn die obersten Schichten sind ja die geschichtsbildenden. Das Ende dieses Vorganges war die vollständige Herrschaft der Naturwissenschaften und des Entwicklungsgedankens.
Eine solche ungläubige Zeit überschätzt die Bedeutung des Einzelnen und treibt so den Einzelnen zu seiner höchsten persönlichen Leistung, unterschätzt die Überlieferung, zwingt dadurch Jeden, von vorn anzufangen, und muß in der Kunst naturgemäß den Ausdruck der Persönlichkeit einerseits und die Darstellung der entgotteten, dadurch aber gerade empfindsam aufgefaßten sogenannten Wirklichkeit oder Natur verlangen. Die Ergebnisse in der Kunst sind das Ästhetentum, der Dilettantismus, die Verlogenheit, der Naturalismus, die Albernheit, die leere Kunstfertigkeit, die Stillosigkeit.
Schon bei den sogenannten Naturvölkern kann man die zwei Ansichten über den Ursprung der Menschheit finden: die einen Völker glauben, daß sie von den Göttern, und die anderen, daß sie von den Tieren abstammen. Mit den entsprechenden Veränderungen wechseln diese beiden Ansichten in der geistigen Geschichte der Menschheit ab: die unfrommen Zeiten glauben an eine Entwicklung aus dem Tier, die frommen glauben an die Gotteskindschaft. Derartige Ansichten sind Übertragungen des Wollens der Menschen in ihre Vorstellungen von ihrer Geschichte.
Heute ist die letzte Folge der ungläubigen Richtung gezogen, und was in den Künsten heute noch nach dieser Richtung geht, das ist leerer Nachklang. Es ist das heute in den Künsten äußerlich Herrschende und dadurch den Menschen allein Bekannte; kein Wunder, daß die Menschen heute von der Kunst nichts wissen wollen.
Das Neue, das sich entwickelt, ist naturgemäß schwerer zu bezeichnen als das Alte, das vergeht. Man kann sagen: es wird nach objektiver, reiner Kunst gesucht, nach der in sich vollendeten Form, nach dem Organischen als Gegensatz zum romantisch und naturalistisch Willkürlichen und Zufälligen, nach dem Festgefügten; die Persönlichkeit ordnet sich dem Werk, das Werk dem Zweck unter; es ist die Gefahr der Schematisierung vorhanden.
Aber: die schlimmste Gefahr ist, daß der Zweck noch gar nicht da ist. Wir könnten eine Freskomalerei bekommen, und wir haben keine Wände zu bemalen; ein Drama, und wir haben keine Bühne; eine Baukunst, und wir dürfen uns keine baukünstlerischen Aufgaben stellen. War das immer so in solchen Zeiten? Wir können es nicht wissen; denn wenn es so war, dann ist von dem, was keinen Boden finden und deshalb nicht Gestalt werden konnte, eben nur noch die Nachwirkung erhalten, die wir nicht mehr entziffern können. Aber wie das auch sei: ob dem, der heute arbeitet, Dauerndes gelingt oder ob er nur Lehrer oder gar nur Anreger ist: seine Arbeit ist gut und steht in einer bedeutenden Wirkungsreihe.
Die Kunst und der Bürger
(1912)
Von zwei Klassen von Menschen wird das Wort »Bourgeois« ingrimmig als Schimpfwort gebraucht, von den Arbeitern und von den Künstlern. Beide sehen im »Bourgeois« ihren Feind nicht nur, gegen den sie etwa zu kämpfen hätten, sondern ihren Gegner, dessen bloßes Dasein sie schon verneinen möchten.
Der Klassenkampf zwischen Arbeiter und Bürger ist eine geschichtliche Erscheinung, die, wie alle geschichtlichen Erscheinungen, bestimmt ist, sich in einer höheren Erscheinung aufzulösen; und ich glaube, daß die Zeit nicht fern ist, wo aus den Gegensätzen sich eine neue Einheit entwickelt: könnte nicht auch die Feindschaft zwischen Künstler und Bürger (sie ist gegenseitig, man lasse sich nicht durch die Bildungsredensarten und die Kunstspielerei der bürgerlichen Gesellschaft täuschen) auch nur eine Zeiterscheinung sein? Wenn man sie verstehen könnte, so würde man vieles Merkwürdige im heutigen Kunstleben verstehen.
Die bürgerliche Gesellschaft ist am tiefsten begründet in den germanischen Ländern; schon in Frankreich ist sie mehr Oberflächenerscheinung, Italien ist noch von mittelalterlicher Gesinnung, und Spanien ist kaum ein neuzeitliches Land zu nennen. Hand in Hand mit der bürgerlichen Gesellschaft geht das Übergewicht der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Denkens und die Auffassung, daß die Kunst einen mehr oder weniger überflüssigen Zierat und Luxus des Lebens liefere; so daß folgerichtige Denker sogar zu der Ansicht kommen können, daß eine Zeit bevorstehe, wo die Kunst überhaupt verschwinde, wie, nach ihrer Ansicht, die Religion bereits verschwunden sei. Dort, wo die Gesinnungen der Menschen mittelalterlicher sind, schätzt man die Religion am höchsten ein, gibt etwa die zweite Stelle der Kunst und den metaphysischen Bemühungen, und erst an die dritte Stelle setzt man die Wissenschaft. Wir sind ja geneigt zu dem Glauben, daß unsere heutigen Ansichten richtiger sind als die Ansichten der früheren Menschen, und daß Entwicklung für uns wenigstens auch immer Fortschritt zu Höherem ist: könnte man nicht die verschiedene Schätzung aus den verschiedenen Lebensbedürfnissen erklären und dann vielleicht die Hoffnung schöpfen, daß auch für die Kunst wieder einmal bessere Tage kommen können?
Wir haben bekanntlich nur unsere Empfindungen, aus diesen bilden wir unsere Vorstellungen, deren Gesamtheit wir die Welt nennen; wir sind gezwungen, uns diese als in sich folgerichtig zusammenhängend vorzustellen.
In unseren nördlichen Ländern nun, wo die Natur karg ist, werden die Menschen veranlaßt, sich besonders mit diesem Zusammenhang begrifflich zu beschäftigen; denn wenn sie begrifflich klar die Ursachen erkennen, so können sie vielleicht durch eine Einwirkung auf diese Ursachen Folgen erzeugen, welche ihnen den Kampf um ihr Dasein erleichtern. In einem Topf mit kochendem Wasser entwickelt sich Dampf; dieser hebt von Zeit zu Zeit den Deckel; ein Mensch beobachtet das, macht sich klar, daß das Wasser in Dampfform einen größeren Raum einnimmt, und baut daraufhin die Dampfmaschine. Unendlich lange Zeiten hindurch haben die Menschen nur empfunden, daß in dem Topf ein Treiben und Heben war; sie haben wohl gewußt, daß das irgendwelche Ursachen haben muß; aber sie haben sich mit ihrer Empfindung und mit ihrer Vorstellung des kochenden Topfes genügen lassen. Einmal auf den Weg geraten, ging die nördliche Menschheit immer weiter, Entdeckungen reihten sich an Entdeckungen, die Natur wurde durch sie ihnen immer ergiebiger, die Bevölkerung wuchs, Wunsch nach Gewinn und Furcht vor Not drängten nach. Durch die ungeheure Wichtigkeit, welche auf diese Weise das begriffliche Denken für die Menschen gewann, erschien es als die einzig wichtige geistige Betätigung; es griff sofort über den Nutzen hinaus, verband sich mit älteren geistigen Bestrebungen und erzeugte so die heutige Wissenschaft. Nun haben die Menschen heute ganz kindlich den Glauben, das auf diese Weise begrifflich geschaffene Weltbild sei das wirklich richtige, ein auf andere Weise geschaffenes Weltbild könne nur eine belanglose Spielerei der Phantasie bedeuten oder sei das Ergebnis von längst überwundenen Arten des Denkens.
Nun ist aber der erörternde Verstand nicht die einzige Kraft, die Begriffe nicht der einzige Stoff, durch welche wir die Welt schaffen, und das wissenschaftliche Weltbild ist nicht »richtiger« als das künstlerische. Der Künstler – hier kann man alle Künste zusammennehmen, denn in diesem sind sie alle gleich – hat denselben Stoff wie der Wissenschaftler, seine Empfindungen; wie der Wissenschaftler bildet er aus den Empfindungen Vorstellungen; dann aber schlägt er einen anderen Weg ein: er nimmt diese Vorstellungen zu anderen Vorstellungen in sein Inneres, läßt sie hier zu einem großen organischen, das heißt lebendig zusammenhängenden Gebilde zusammenwachsen, nach einer Richtung, oder sagen wir zu einem Zweck, den sein aus irgendeinem Unbekannten und Unerkennbaren aufsteigender Wille verlangt, und stellt nun dieses Gebilde mit seinen Kunstmitteln dar.
Man glaube nicht, daß der Wissenschaftler sein Bild ohne Willen schafft: nur er meint immer, und sei es in der höchsten Vergeistigung, einen nützlichen Zweck; der Künstler hat keinen nützlichen Zweck, deshalb nennt man sein Werk zwecklos oder schiebt ihm einen sittlichen Zweck, einen Zweck der Ergötzung und dergleichen unter. Beides ist falsch: er hat einen Zweck, aber der ist nicht durch den Verstand zu erkennen und ist nicht »nützlich«.
Man hat gefunden, daß Maler die Verhältnisse ihres eigenen Körpers in ihren gemalten Figuren haben; daß ein Bildnis stets Ähnlichkeiten mit dem Bildnismaler hat; man sieht, daß ein Dichter immer nur sein eigenes Ich formt, sein eigenes Schicksal darstellt, mag er auch einen Jago und eine Desdemona schaffen, die Fabel des Sturms oder die Fabel von Romeo und Julia erzählen: nach dieser Richtung geht, was ich den Willen des Künstlers nenne.
Das Kunstwerk muß wirklich gelungen sein, das heißt, es muß organisch sein, dann gibt es ein Weltbild, welches gerade so »richtig« ist wie ein wissenschaftliches Weltbild. Die Gestalten Shakespeares oder Homers haben nie gelebt, und nur die Kunstfertigkeit der Dichter bewirkt, daß man sich denken konnte, solche Menschen vermöchten auf dieser Erde zu wandeln; aber die von diesen Dichtern geschaffenen Bilder sind so in sich einheitlich, daß das Ganze in sich lebt. Daher sind »Verlogenheit« und »Disharmonie« die schwersten Vorwürfe, welche man gegen ein Kunstwerk richten kann, außer ihnen gibt es aber auch keine.
Das wissenschaftliche Weltbild hat die praktischen Interessen für sich – welche Interessen hat für sich das künstlerische Weltbild? Stellen wir uns vor, die menschliche Gesellschaft käme bis zur höchsten Spitze der sogenannten Beherrschung der Natur. Man brauchte nur auf einen Knopf zu drücken, und alles, was man braucht oder sinnlos wünscht, stellt sich ohne weiteres dar zur gefälligen Verwendung. Offenbar würden die Manschen in diesem Schlaraffendasein das Leben bald als eine unerträgliche Last empfinden, und es würde sich bald herausstellen, nachdem nun der Wahn verschwunden wäre, der die Mittel so lange als Zweck setzte (das ist vor allem die Arbeit), daß irgend etwas da sein muß, weshalb oder wozu die Menschen leben, oder wodurch man über das Unerträgliche des Lebens hinwegkommen kann.
Die höchsten Menschen würden die Lösung in der Religion finden, sie würden die Notwendigkeit ihres zufälligen Daseins als in einem höheren Weltzusammenhang begründet fromm fühlen und durch diese Empfindung über die Leiden des Unbefriedigtseins hinweggesetzt werden. Aber nur wenig Menschen sind ausgewählt, dieser Lösung teilhaftig zu werden. Für die anderen würde es die Kunst und die Metaphysik geben: sie würden sich mit ihrem ganzen inneren Menschen in ein anderes Weltbild retten und sich dadurch befreien können. Befreiung: das ist es, was die Kunst den Menschen geben kann.
Der Bürger hat nun offenbar keine Befreiung vom Leben nötig, er hat noch weniger eine Lösung der Frage nötig, wozu und weshalb er lebt. Er erscheint sich als zufriedener Selbstzweck, und die Wissenschaft gilt ihm als die höchste Betätigung der Menschen. So kann er die Kunst immer nur als ein Vergnügen betrachten, und er wird es nie verstehen, wie Menschen die ungeheuerste Anstrengung auf diese Dinge wenden mögen. Aber es gab Zeiten vor der bürgerlichen Gesellschaft, es wird auch Zeiten nach ihr geben; und schon scheinen ja Bedürfnisse nach Religion, Kunst und Metaphysik dunkel und unverstanden sich neu in der Menschheit zu regen.
Die literarische Kritik
(1913)
Die Kritik ist entstanden, damit sich die Menschen in der Fülle der Kunsterscheinungen irgendwie zurechtfinden können, wird also desto wichtiger, je größer diese Fülle ist. Aber je wichtiger sie wird, desto offener erscheint auch ihr äußerst fragwürdiger Charakter, und es scheint gar nicht ausgeschlossen, daß sie von einem gewissen Punkt an nicht nur nicht klärend wirkt, sondern noch mehr verwirrt. Die Kämpfe, welche in diesen Verwirrungen entstehen, werden gewöhnlich mit großer persönlicher Erbitterung geführt, und es scheint doch das Gewöhnliche zu sein, daß Verschiedendenkende sich gegenseitig entweder für Schurken oder für Dummköpfe halten; vielleicht wäre der Versuch nicht ohne Dank, einmal den Gründen der Verwirrung nachzugehen. Ein Geschichtsforscher, der viel Zeit aufwenden könnte, wäre gewiß imstande, Gesetze in diesen Kämpfen zu erkennen, wenn er die kritischen Einwände, welche in einem größeren Zeitenverlauf jedesmal gegen neue Werke gemacht worden sind, sammelte und etwa feststellte: gegen wen und von wem geht der Vorwurf der Willkür, der Kälte, des Schwulstes, der Leere usf. aus. Von der Kunst selber verstehen ja natürlich immer die Künstler am meisten, die darf man aber hier nicht fragen, denn jeder Künstler wird alle Kritiker, welche gegen ihn gestimmt sind, für mindestens überflüssig, und die, welche ihn schätzen, nur deshalb für notwendig halten, weil sie ihm nützen: von seinem Standpunkt aus mit Recht, denn er will ja doch immer unmittelbar auf das Gefühl wirken, weiß, daß selbst behutsames Dazwischenkommen des Verstandes schadet, und kann nicht ahnen, daß in verwickelten Zeiten das Gefühl derer, auf die er wirken will, seine Sprache vielleicht überhaupt noch gar nicht versteht, daß die Menschen, wie der Ausdruck lautet, »zu ihm erzogen werden müssen«.
Zunächst überrascht die Erscheinung, daß in der Musik und Malerei das kritische Verständnis nicht so häufig zu versagen pflegt wie in der Dichtung.
Könnte man ein Gesetzbuch für die Kritiker aufstellen, so würde das zwei Gebote enthalten: erstens, du sollst die Beschaffenheit erkennen, das heißt, du sollst wissen, ob ein Kunstwerk in seiner Art gut oder schlecht gemacht ist; zweitens, du sollst die Ebene unterscheiden, das heißt, du sollst die Werke von bedeutendem Gehalt von denen sondern, die nur einen geringen Gehalt haben. Im ersten Fall hat der Kritiker das – im weitesten Sinn – Handwerkliche des Werkes zu untersuchen, muß also überhaupt vom Handwerklichen etwas verstehen; im zweiten Fall hat der Kritiker ein Werturteil abzugeben, muß also ein seelisch bedeutender Mensch sein, der die verschiedenen Gehalte abschätzen kann.
Kritiker, welche über Musik und Malerei schreiben, verstehen nun fast immer etwas vom Handwerklichen, können also kaum in die ganz groben Irrtümer verfallen, welche kommen, wenn der Kritiker überhaupt nicht weiß, was der Künstler gewollt hat, und welche Mittel er für seine Zwecke verwenden mußte. Außerdem ist in der Musik der Gehalt nackt, ohne das Gewand eines Inhalts, und in der Malerei ist wenigstens gegenwärtig auch bei den geringeren kritischen Geistern bekannt, daß es nicht auf den Inhalt ankommt, sondern auf den Gehalt, der in ihm ausgedrückt ist, und daß in einem Zerrbild Daumiers eine ebenso heldische Seele zu uns sprechen kann wie in einer Bildhauerarbeit Michelangelos.
Aber erinnern wir uns an große kritische Kämpfe in der Musik und Malerei, etwa an die Kämpfe Glucks und die der Impressionisten. Heute empfinden wir Gluck als Klassiker, sehen Manets Olympia ruhig neben den alten Meistern, damals wurden von den gegnerischen Kritikern, und natürlich waren alle Kritiker gegnerisch, gegen die Beschaffenheit der Werke Einwände erhoben, man bezeichnete sie als schlecht gemacht, ihre Urheber als unfähige Menschen.
Will man nicht annehmen, daß die gegnerischen Kritiker damals alle gänzlich unwissend und dumm waren, daß sie an sich vom Handwerklichen nichts verstanden und an sich Beschaffenheit nicht erkennen konnten, so bleibt nur eine einzige Erklärung: der neue Gehalt wirkte so aufreizend auf sie, daß die Erbitterung ihre Sinne ganz geblendet hat, daß sie nicht mehr richtig sahen und hörten.
Das klingt unwahrscheinlich, ist aber doch zu erklären.
Jedes Werturteil, welches wir abgeben, ist zunächst ein Werturteil über uns selbst. Indem wir Dinge verehren, lieben, schätzen, laufenlassen, belächeln, bekämpfen, verachten, sitzen wir über uns selber zu Gericht. Eine hohe Seele verehrt das Hohe, eine gemeine haßt es. Wenn eine Zeit gemein ist, so bringt sie die Wortführer hervor, welche die Gemeinheit ihr für das allgemein Menschliche erklären; wenn sie bedeutend ist, so bringt sie die Männer in die Höhe, welche sie lehren, nach dem Großen und Edlen zu streben. Kommt in die erste Zeit ein Künstler mit bedeutendem Gehalt, in die zweite einer mit gemeinem, so verneint er ja die betreffende Zeit und ihre Wortführer in ihrem sittlichen Dasein, er muß als Todfeind von ihnen gehaßt werden, und ein solcher Todhaß macht blind.
Um den Gedanken klarzumachen, sind so schroffe und auch wenigsagende Gegensätze gewählt wie »bedeutend« und »gemein«; der Gehalt der Kunstwerke ist ja mit Worten so sehr schwer zu sagen: eben weil es sich um Gefühle handelt.
Wenden wir uns mit diesen Erklärungen nun zu der literarischen Kritik, so werden wir uns nicht langer wundern, daß sie ganz besonders fragwürdig ist, denn in der Dichtung ist Handwerk, Inhalt und Gehalt ganz besonders eng miteinander verknüpft. Dadurch ist zunächst die Untersuchung des Handwerks viel schwieriger als in den anderen Künsten; im höchsten Sinn gibt es in der Dichtung überhaupt kein reines Handwerk, ist das Handwerkliche immer inhaltlich bestimmt; bei der eigenen Arbeit – bei der allein man ja diese Dinge erfährt – wurde mir klar, daß selbst etwas scheinbar ganz Inhaltliches, wie der Deus ex machina, doch gleichzeitig eine Formforderung ist. Daraus ergibt sich zunächst, daß die Kritiker der Dichtung gewöhnlich schon die Beschaffenheit nicht erkennen können. Und das ist nicht etwa von kleinen Schriftstellern gesagt, bei den bedeutenden Menschen ist es sogar noch auffälliger. Wenn ein Mann wie Lessing imstande war, zu sagen, er könne jedes beliebige Stück von Corneille bessermachen als Corneille, wenn Schiller über Alfieri urteilte, er sei überhaupt kein Dichter, wenn Goethe über Kleist den Kopf schüttelte, so konnten sie alle drei die Beschaffenheit nicht abschätzen. Ein Dürer aber konnte die Beschaffenheit eines Bellini und Raffael, ein Richard Wagner die Beschaffenheit eines Bach abschätzen, und diese Männer waren gewiß ebensoweit von den Beurteilten entfernt wie jene. Dostojewski hat einmal von Tolstois Schriften gesagt, das sei Gutsbesitzerliteratur, Tolstoi von Dostojewski, ein so unklarer Mensch dürfe doch nicht andere Leute auch noch unklar machen wollen. Auch diese Männer konnten gegenseitig ihre Beschaffenheiten nicht abschätzen. Es ist ja auch längst bekannt, daß Musiker und Maler sich gegenseitig meistens am richtigsten beurteilen, sie vertragen sich ja auch menschlich untereinander; Dichter aber beurteilen sich gegenseitig fast immer falsch, und es kommt sehr selten vor, daß sie freundschaftlich verkehren können.
Denn, und nun kommt unser Endergebnis, der Gehalt hat in der Dichtung eine ganz andere Bedeutung als in den anderen Künsten; er hat eine so große Bedeutung, daß sogar der Inhalt ganz anders von ihm mitgerissen wird als in den übrigen Künsten.
Damit hängt zusammen, daß der Gehalt inhaltlich viel mannigfaltiger ist in der Dichtung als in der Malerei oder gar der Musik.
Wenn also schon die Leidenschaften für und gegen bei der Dichtung stärker erweckt werden als in den übrigen Künsten, so kommt noch dazu, daß bei der Dichtung sich viel mehr Gruppen unter den Aufnehmenden bilden.
Nehmen wir an, ein Musiker schreibe eine Symphonie, bei welcher er an das wirklich oder ihm so scheinende heldische Leben Napoleons gedacht hat. Wenn er es nicht sagt, so merkt niemand etwas davon; man spürt nur den Schwung einer großen Seele und mag sich Religiöses oder Tragisches oder Patriotisches oder Königstreues oder Revolutionäres oder sonst etwas denken, was Einem naheliegt, wenn man das Bedürfnis nach einer gedanklichen Bestimmung des Schwunges fühlt. Ein Dichter könnte die gewaltigste Tragödie der Welt dichten, welche Napoleon als Helden hätte, er würde in Deutschland sofort die lebhafteste Feindschaft aller vaterländisch gesinnten Leute erwecken, und es würde ihm gar nichts nützen, wenn er sagte: »Meine gedichtete Gestalt hat mit dem wirklichen Napoleon nichts gemein, ich bin doch ein Deutscher, habe, ohne es besonders hervorheben zu müssen, deutsche Empfindungen, die kein Fremder haben kann, mein Werk ist rein deutsch, selbst wenn ich es anders gewollt hätte.« Hier tritt also sofort das kindlichst Inhaltliche in den Vordergrund. Aber gesetzt, der Dichter vermeidet diesen Anstoß, nennt seinen Helden Friedrich und läßt das Ganze in der deutschen Geschichte spielen; dann hat er sofort andere Leute als Gegner, welche wieder das Inhaltliche in seinem Gehalt finden und sagen: »Staatliche Kämpfe interessieren uns nicht, wir wollen Weltanschauungskämpfe, unser Held wäre Giordano Bruno.« Es nutzt dem Dichter nichts, wenn er sagt: »Mit Giordano Bruno kann ich dramatisch nichts anfangen, ich muß einen handelnden Mann haben, mit dem Denker geht es nicht; aber es kommt doch auch darauf nicht an, es kommt doch auf den Kampf an und den Empfindungsgehalt.« So kann er sich wenden wie er will, überall stößt er auf Widerspruch. Nun ist noch dazu die Vorstellung natürlich inhaltlich bestimmt, wenn jemand das Bild Napoleons vor seinem geistigen Auge hat, so kann er nicht so einfach einen Friedrich daraus machen: er kann also durch etwas, das im Grunde ganz gleichgültig ist und das er doch nicht ändern kann, die Gegnerschaft erzeugen.
Gegen den Musiker kämpft nur der Mann, der überhaupt ein Gegner der heldischen Empfindung ist, gegen den Dichter eine Menge Leute, welche seine Empfindung teilen und sie nur anders gedanklich bestimmen. Und man sage nicht, daß die Beispiele von Napoleon, Friedrich und Giordano Bruno übertrieben seien. Selbst Männer wie Klopstock und Herder sind doch in solche Torheiten verfallen, als sie sich einbildeten, es sei nötig, statt der alten Mythologie in unsere Dichtung das schnurrige Phantasieerzeugnis einzuführen, welches sie für die germanische Mythologie hielten.
Mit anderen Worten: ein Dichter, der Neues bringt, verletzt dadurch, daß der Gehalt in der Dichtung eine viel größere Rolle spielt und dabei inhaltlich viel mannigfacher ist als in den anderen Künsten, alle die Menschen in ihrem innersten Lebensnerv, welche seelisch anders gerichtet sind, und macht sie dadurch unempfindlich gegen seine Beschaffenheit; es kommt dazu, daß die Beschaffenheit in der Dichtung überhaupt viel schwerer zu erkennen ist als in den anderen Künsten, weil das Handwerkliche nie rein förmlich ist.
Als ein Schulbeispiel, von einem großen Geiste, möge folgende Äußerung von Goethe über Kleist dienen: »Auch in seinem ›Kohlhaas‹, artig erzählt und geistreich zusammengestellt wie er sei, komme doch alles gar zu ungefüg. Es gehöre ein großer Geist des Widerspruches dazu, um einen so einzelnen Fall mit so durchgeführter, gründlicher Hypochondrie geltend zu machen. Es gebe ein Unschönes in der Natur, ein Beängstigendes, mit dem sich die Dichtkunst bei noch so geistreicher Behandlung weder befassen noch aussöhnen könne. Und wieder kam er auf die Heiterkeit, auf die Anmut, auf die fröhlich bedeutsame Lebensbetrachtung italienischer Novellen.« Hier haben wir den reinsten Ausdruck für den merkwürdigen Zustand: Goethe lehnt Kleist ab, weil Kleists Dichtung gegen sein untragisches Lebensgefühl geht. Und denselben Grund hat der letzte dumme Teufel, der Rezensionen schreibt, weil er nichts Ordentliches gelernt hat, um auf ehrliche Weise sein Brot zu verdienen, wenn er von »unnational«, oder »kalt«, oder »gedanklich«, oder »frivol« oder Ähnlichem spricht: er verteidigt sein Lebensgefühl. Und dieser Rezensent hat ebenso recht wie Goethe gegen Kleist, er verteidigt sich selber.
Aber wenn wir die Betrachtung nun umkehren, so haben wir als Ergebnis der Überwindung der gegnerischen Kritik für den Dichter auch etwas sehr viel Wichtigeres als für Maler und Musiker. Heute wird wohl niemand mehr wie noch in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts etwa Goethe als unnational, kalt, frivol oder gedanklich bezeichnen, denn Goethe hat seinen Gehalt der Nation aufgezwungen.
Dumpf kommt den Menschen ja zum Bewußtsein, daß die Gegnerschaft gegen einen Dichter ein Ausdruck für seine Bedeutung ist; leider hat diese Erkenntnis aber die üble Folge, daß man nun heute schließt, ein Dichter, den etwa jeder für dumm hält, müsse nun notwendig bedeutend sein, und dieser Fehlschluß hat bereits verheerende Wirkungen erzeugt. Jedes Instinkturteil, so dumm auch der Mensch sei, von dem es ausgeht, hat schließlich irgendwie eine Berechtigung; die heutige Instinktlosigkeit aber, die man oft gerade bei ganz gescheiten Literaten antrifft, ist immer schädlich und schafft die größte Verwirrung.
Shakespeare und das deutsche Drama
(1912)
Von Friedrich Gundolf ist ein Buch erschienen: »Shakespeare und der deutsche Geist«, das man auf das freudigste begrüßen muß als den Versuch einer wirklichen Literaturgeschichtsschreibung, von einem Manne, welcher weiß, was Dichtung ist. Gundolf stammt aus dem Kreise Stefan Georges und hat von daher seine Einsichten; denn nur aus der Literatur und von den Dichtern kann ja der Literaturhistoriker lernen. Voraussichtlich wird das vortreffliche Buch bald den großen Erfolg haben, welchen man ihm wünschen muß: und da ist es vielleicht schon jetzt angebracht, auf eine gefährliche Wirkung der Arbeit hinzuweisen.
Stefan George als Lyriker bewertet natürlich das Schrifttum nach den lyrischen Beschaffenheiten. Man schüttelt vielleicht den Kopf darüber, wie derselbe Mann gleichzeitig Dante und Jean Paul hochschätzen mag; aus Georges Lyrik versteht man, wie das möglich ist. Man sollte auch nichts dagegen sagen, wenn ein Jünger diese Wertungen herübernimmt: wenn so erfreuliche Werke entstehen wie Gundolfs Buch, so ist das doch etwas Schönes; aber man darf immer nicht vergessen, daß man da nun nichts weniger als ewige Wahrheiten vor sich hat. Kunsturteil ist sittliches Urteil; und so verschieden die sittlichen Richtungen der Menschen sind, so verschieden werden auch immer ihre Kunsturteile sein. Wahrscheinlich wird jeder Lyriker – wenigstens jeder subjektive Lyriker, den wir heute ja allein haben – immer Relativist sein, alles Metaphysische ablehnen und als Absicht seiner Kunst die Darstellung der inneren Bewegung des Dichters empfinden.
Er wird also vor allen Dingen dem epischen Epos, also etwa Homer, und dem dramatischen Drama, also etwa dem alten Dramatiker ohne starke Anteilnahme gegenüberstehen; denn das Epos will ein freundliches Weltbild ohne starke innere Bewegung des Dichters geben, das Drama will eine metaphysische Erschütterung im Zuschauer hervorrufen. Er wird Epos und Drama um so mehr schätzen, je lyrischer es ist, je mehr es seiner eigenen Dichtungsart entspricht. Ich selber, der ich auf dem Gegenpol von Stefan George stehe, empfinde naturgemäß die entsprechenden umgekehrten Wertungen; man müßte sich nicht scheuen, seine Empfindung zu sagen, denn im großen Leben der Nation verbessern sich ja die Einseitigkeiten der Einzelnen. Jemand, der eine bestimmte Art von Kunst wirklich empfindet, muß unbedingt die entgegengesetzte für unberechtigt halten und kann sie im besten Fall nur verstandesgemäß auffassen; verständlicherweise wird er sich ja denn wohl immer sagen, daß der Grund in seiner persönlichen Beschränkung liegt, denn schließlich kann man doch nicht alle entgegengesetzt empfindenden Menschen für ganz töricht halten.
Die Elisabethanischen Dramatiker hatten eine ganz andere Bühne als wir und wollten eine ganz andere Wirkung erzielen. Sie wollten irgendeinen Vorgang möglichst in seiner menschlichen Fülle und möglichst zur Kunst erhoben ihren Zuschauern vorführen. Aus solchen Absichten ist Shakespeare zu verstehen: als lyrisch-epischer Dichter, welcher für die Darstellung durch Schauspieler schreibt. Mag es sich da um Zeittriebe handeln, um gesellschaftliche Ursachen, oder um einen völkischen Trieb: das ist etwas ganz Anderes, als was die Deutschen wollten, in demselben Augenblick, als sie ihre Literatur machten, mit Lessing. Es ist bezeichnend, wie die Gesinnung den Geschichtschreiber sofort die Dinge falsch deuten lehrt. Von Anfang an ist unser dramatischer Vers anders gewesen als Shakespeares Vers, weil wir eben etwas Anderes wollten. Gundolf hält das für einen geschichtlichen Zufall: »Doch gerade deshalb, weil dieser (Lessings) Blankvers aus einem anti-shakespearischen Prinzip heraus gebaut ist und sich für die deutschen Nachfolger vor Shakespeares Original schob, hat er nicht nur eine heilsame, sondern auch eine verwirrende Wirkung ausgeübt. Wenn man bis auf den heutigen Tag den Theatervers nicht als ein dichterisches, sondern als ein rhetorisches, bühnenmäßiges Mittel ansieht, so hat Lessings großes Vorbild mit daran schuld. Wir werden bei Schiller seiner Nachwirkung noch begegnen. Überhaupt, vergessen wir nie, daß die Begründung des sogenannten nationalen Dramas der Deutschen durch Lessing (Goethe und Schiller sind, bei größerem Talent, darin nur seine Erben) nicht auf einen großen Dramatiker, sondern auf einen großen Literaten zurückgeht, und zwar auf einen, dem die Bühne moralische Anstalt war, also in einem außerhalb ihres eigenen Wesens liegenden Zweck beruhte. Dies ist ein πρώτον ψενδος unseres gesamten Theaterwesens, das auch unsere höchsten Dramen als solche zu ihrem Nachteil nicht nur von den Shakespearischen, sondern selbst von den französischen unterscheidet, von Corneille und Racine, die als Genies nicht an Goethe heranreichen. Die Vereinigung von Theater und Dichtung ist bei uns immer künstlich und gewaltsam gewesen, und unsere höchsten Dramen taugen etwas, nicht weil, sondern trotzdem sie für das Theater sind. Keines unserer größten Dichterwerke paßt in den Rahmen der Bühne, entweder sie überschreiten ihn, oder sie füllen ihn nicht. Unser Drama ist nicht der Schöpfer seines Theaters, unsere Bühne nicht Schöpferin unsers Dramas, sondern beide sind unter allerlei Vorwänden außerdramatischer und anßerdichterischer Natur einen Kompromiß eingegangen. Dieser Kompromiß geht letzten Endes auf Gottsched zurück, der Bühne und Literatur aus rationeller Herrschsucht wieder zusammengezwungen. Diesen Zustand hatte denn Lessing übernommen für den neuen Gehalt, und indem er für seine Bühne mit dem moralischen Endzweck den Shakespeare als obersten Typus gewann, hat er Shakespeare in einen falschen Zusammenhang gebracht, der bis auf unsere Tage die deutsche Dramatik verhängnisvoll beeinflußt.«
Sollte der Wirrwarr, der ja unzweifelhaft ist, nicht ganz anders erklärt werden können? Ist zu denken, daß unser dramatischer Vers sich nach dem zufälligen Vorbild Lessings entwickelt hat? Ist nicht die einfachere Erklärung, daß die Deutschen als Drama etwas Anderes wollen als Shakespeare? Man beobachte nur die Wirkung Shakespeares auf unsere Literatur: sie ist so lange gut und wird als gut empfunden, wie man Shakespeare als Wirklichkeitsdarsteller auffaßt, der zur Natur zurückführe; als man durch ihn die französische Konvention los war, stellten sich bald Bedenken ein: Goethe versuchte wieder Voltaire einzubürgern und schrieb »Shakespeare und kein Ende«; Schiller schrieb die »Braut von Messina«; Grillparzer prophezeite, die deutsche Literatur werde an Shakespeare zugrunde gehen, wie sie durch ihn groß geworden sei; Kleist wollte Shakespeare mit Sophokles vereinigen; selbst der schlichte Shakespearenachahmer Grabbe schrieb über Shakespearomanie; Hebbel macht den Eindruck hier wie in anderen Dingen, daß er sich nicht bis zum Äußersten vorgewagt hat. Das sind alles unklare Strebungen, denn sie gehen durchaus zusammen mit fortdauernder Wirkung Shakespeares auf unsere Dramatiker; aber sie zeigen doch, daß in der deutschen Dichtung das Streben ist, von Shakespeare loszukommen.
Es liegen ja da geheimnisvolle Dinge zugrunde, die wir um so weniger fassen können, als unser neueres Schrifttum doch noch nicht abgeschlossen vor uns liegt: wir leben noch immer in der Zeit, welche Lessing begonnen hat. Wenigstens auf Eines möge hingewiesen werden: Shakespeare, wie die großen Spanier, wie die Franzosen sind aristokratische Dichter, sie schließen die feudale Zeit ab; unsere Klassiker sind bürgerliche Dichter, sie beginnen die bürgerliche Zeit, und sie beginnen sie, noch ehe sie in der Wirklichkeit eingerichtet war. Deshalb haben sie auch keinen Ort gefunden, von dem sie sprechen konnten, deshalb haben sie das elende Zwitterding benutzen müssen, welches man heute Theater nennt. Und ist es nicht merkwürdig: auch die andern Kulturvölker haben doch dieses heutige Theater, aber bei ihnen denkt man nicht daran, die Bühne für die Dichtung in Anspruch zu nehmen; nur die Deutschen haben die Vorstellung, daß die Bühne für die Dichtung da sei; und diese Vorstellung, die doch jeder Wirklichkeit so ins Gesicht schlagt, kann doch nicht einfach, weil das nun einmal aktenmäßig so nachgewiesen ist, durch Gottsched erklärt werden: hier muß etwas in der Nation sein, das zum Ausdruck ringt. Viel einfacher als die aktenbelegte Ansicht Gundolfs scheint mir die zu sein: Im deutschen Volke, das offenkundig metaphysisch und religiös begabt ist, muß man einen Drang zu einer Art von Drama annehmen, das es bis jetzt noch nicht gab, das vielleicht eine Ähnlichkeit mit dem Drama des Äschylus und Sophokles hat. Aber in der Kunst sucht man immer an Überlieferung anzuknüpfen. Shakespeare war eine Weile, solange er als Befreier wirkte, eine angemessene Überlieferung; dann aber kam man nicht mehr richtig los von ihm, weil die hervorragenden Dichter zu jung starben, weil die zweite Sohnschaft fehlte, weil die Entwicklung aus verschiedenen Gründen auf lange Zeit unterbrochen wurde. Denn bei uns hat die Dichtung immer nur auf einigen großen Dichtern gestanden, sie hatte nie, wie bei anderen Völkern, eine Grundlage von vielen mittleren Begabungen, welche das Geschaffene erhielten. So ist fast alles, was wir bis jetzt im Drama besitzen, fragwürdig: aber deutlich geht es nach einer anderen Richtung wie Shakespeare. Man mag über die Formulierung »Bühne als moralische Anstalt« denken, wie man will; was damit gemeint ist, das meint jedenfalls unsere Nation, und das ist ganz das Gegenteil von dem, was Shakespeare will.
Und hier liegt die zweite Gefahr des Gundolfschen Buches. Nie wird ein Geschichtschreiber das Leben erfassen können: wer das kann, der kann nicht Geschichtschreiber sein. Dem Geschichtschreiber liegen die Dinge fertig vor Augen, er kann nicht unterscheiden, was abgeschlossen ist und was noch wird. Shakespeare ist ein Ende, das deutsche Drama von Lessing bis Hebbel ist ein Anfang. Shakespeare kann man nur nachahmen, und abgesehen von der Torheit jeder Nachahmung: er hat in einer Zeit und für Verhältnisse gedichtet, die auf ewig verschwunden sind; wenn man ihn als einen noch wirkenden Dichter empfindet, so kommt man in totes Ästhetentum, wie wenn man Dante als noch wirkenden Dichter empfände. Auf unseren Dramatikern aber kann man weiter bauen: es ist ganz klar, wo ihre Schwächen liegen, es ist aber auch ganz klar, was sie an Kunstmitteln, die wir heute gebrauchen können, schon geformt haben.
Dostojewskis Weltanschauung
(1913)
In der großen Ausgabe von Dostojewskis Werken ist als zwölfter Band eine Anzahl von Aufsätzen erschienen, die früher in Deutschland noch nicht bekannt waren. Für den Kenner von Dostojewskis Dichtung enthalten diese Aufsätze wohl nichts Neues; wie jeder große Dichter, so war auch Dostojewski in allen seinen Werken und immer derselbe, und was er in diesem Bande sagt, das hat er oft genug als Dichter gestaltet. Dennoch ist das Buch äußerst wertvoll, denn für die meisten Menschen wirkt ja das Grundgefühl eines bedeutenden Gebens ganz anders, wenn es gedanklich, als wenn es künstlerisch ausgedrückt wird: es macht sicher nicht den tiefen Eindruck, aber es geht deutlicher ins Bewußtsein über und wird, da ja meistens das verstandesmäßig Dargestellte überschätzt wird, ernsthafter genommen. So wird, aus Gründen der Zweckmäßigkeit, wenigstens heute wohl jeder Dichter, der mehr ist als ein bloßer Ästhet, das Bedürfnis haben, sich auch begrifflich zu äußern.
Der Ausdruck »Weltanschauung« ist recht irreführend bei einem Dichter, man sollte lieber den Ausdruck »Lebensgefühl« nehmen; immerhin gibt er eine volkstümliche Vorstellung von der Aufgabe, um welche es sich handelt.
Wenn man sich im heutigen Schrifttum umsehen will, so wird man am besten tun, auf die klassische deutsche Dichtung zurückzugehen, das letzte große Schrifttum Europas; von ihr aus kann man die Romantik, den Naturalismus und die hervorragenden völkischen Literaturen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstehen, die norwegische und russische, die sich nicht so leicht wollen in das Gesamtbild der allgemeinen Entwicklung einfügen lassen.
Ibsen und Björnson haben als Voraussetzung Sören Kierkegaard; Kierkegaard aber ist eine Persönlichkeit von der Art, wie wir sie im Deutschland der vorklassischen Zeit hatten, die wir allgemein als Pietisten auffassen mögen. Der deutsche Pietismus entstand im Gegensatz gegen die Orthodoxie, er wollte das orthodoxe feste Verhältnis von Gott und Mensch in ein bewegliches Verhältnis verwandeln, ähnlich wie es die alte Mystik getan; aber er drang nicht wie die alte Mystik bis zur Metaphysik der Religion durch und belud sich zuviel mit der Sittlichkeit, es fehlte ihm der letzte religiöse Schwung. So ist der deutsche Pietismus, wie es denn wohl auch den Verhältnissen entsprach, kleinbürgerlicher Art.
Man wußte in unserer klassischen Zeit nichts von der alten Mystik; unsere großen Geister suchten über die Enge des Pietismus hinauszukommen mit Hilfe von Spinoza. Das waren keine gedanklichen Vorgänge, das waren Gefühlsvorgange; wenn man Goethes Iphigenie liest und an die Bekenntnisse einer schönen Seele denkt, so mag man sich ungefähr klarmachen, wie alles Edle und Freie, das im Pietismus war, von dem Engen und Kleinbürgerlichen befreit wird und sich nun klar und schön gestaltet in dem, was man Humanität nannte, fast ohne sichtbaren Zusammenhang mit der recht ärmlichen damaligen Welt. Wenn wir heute an die damalige Zeit denken, dann denken wir eben nur an Goethe und Schiller, Kant und Lessing und einige andere Männer und vergessen, daß außer ihnen an geistigen Leuten nur die damaligen Frommen im Lande waren.
Gewiß hat Kierkegaard einen mystischen Kern in seiner Seele, Ibsen aber und Björnson haben ihn nicht, für sie hat sich Gott ganz in Sittlichkeit aufgelöst und noch dazu nicht selten in eine beschränkte bürgerliche Sittlichkeit; sie stehen in ihrem Empfinden noch hinter einem Mann wie etwa Jung-Stilling, so kindlich der auch war. Goethe hatte sich zuletzt zu dem Gefühl der ungeheuren Weltharmonie durchgerungen; ein Jung-Stilling konnte nie anders, wie sich selber als Hauptperson in der Welt zu denken, aber er wußte doch, daß es einen Gott gab, durch dessen unermüdliches Eingreifen die Angelegenheiten dieser Hauptperson immer zu einem glücklichen Ende geführt wurden; ein Ibsen aber dichtete Brand, der sich auch als Hauptperson fühlt, und seine Ansicht als die allein richtige, aber nicht einmal diesen kindlichen Glauben hat, sondern notwendig scheitert, weil er mit dem Kopf durch die Wand will. Unsere Klassiker hätten sicher die norwegischen Dramatiker lächelnd abgelehnt und sie geistig etwa auf eine Höhe mit Iffland gestellt.
Mitten in die Arbeit unserer Klassiker kam die Französische Revolution, dann, durch die Napoleonischen Kriege, das Entstehen des Nationalitätsbewußtseins bei den europäischen Menschen.
Es ist schon oft auf die Verwandtschaft der reindemokratischen Lehren mit den Lehren des Christentums hingewiesen; aber auch das neue Nationalgefühl hatte seine tiefsten Wurzeln im Christentum, in dem Bewußtsein, daß im letzten Grunde die Unterschiede des Standes, des Vermögens, der Bildung nichts bedeuten und alle Menschen gleich und Brüder sind. Diese Zusammenhänge waren damals den Menschen zum großen Teil noch unklar; unser klassisches Schrifttum hat nichts mit ihnen anfangen können, aber in der Romantik, der französischen wie der deutschen, beginnen sie sich bemerkbar zu machen – immer noch nicht deutlich genug durch die innige Verbindung, die die Umsturzgedanken auf dem gottlosen Boden Frankreichs mit der Ungläubigkeit geschlossen hatten. In unserem politischen Leben leiden wir ja noch heute an dieser Unklarheit.
Hier hat nun auf russischem Boden die Weiterentwicklung angesetzt, und der Mann, der sie als Persönlichkeit wie als Träger der völkischen Triebe geleitet hat, ist Dostojewski.
Dostojewski ist durch diese Leistung immer noch der jüngste Geist des heutigen Europas. Aber wir können sagen: auch er ist nicht tatsächlich über das Humanitätsideal unserer Klassiker hinausgekommen; er hat es nur in dem wirklichen Leben verankert und ihm dadurch einerseits viel von seiner vernünftigen Klarheit genommen, andererseits ihm mit dem Unverstand auch eine neue mystische Tiefe gegeben, wodurch es unmittelbarer wirken kann.
Es handelt sich hier immer nur um das allgemeine Gefühl, das der dichterischen Gestaltung zugrunde liegt, nicht um die dichterische Gestaltung selber, um die Ebene und nicht um die Beschaffenheit. Dostojewski hat das Hauptgewicht auf das Inhaltliche gelegt; er war zu sehr grübelnder Sucher und begeisterter Seher, um in genügendem Maße ein heiterer Gestalter zu sein, er war das gerade Gegenteil des Ästheten. Welche Bedeutung sein Lebenswerk endgültig haben wird, wenn einstmals auch diese Kämpfe ausgekämpft sein werden, und nur noch das reine Kunst gewordene Werk eine Wirkung ausübt, ist eine ganz andere Frage, die ja aufzuwerfen gar nicht nötig sein wird; deshalb wäre es auch töricht, sich zu fragen, ob er denn als Dichter neben Goethe zu nennen ist oder nicht; hier handelt es sich um ganz andere Dinge.
Dostojewski lehrt, daß das russische Volk »Christus und die Lehre Christi in sich aufgenommen« habe; er bekennt: »ich kenne unser Volk, ich habe jahrelang mit ihm zusammengelebt, habe mit ihm gegessen und geschlafen und ward selbst ›zu den Verbrechern‹ gezählt; ich habe gemeinsam mit ihm im Schweiße des Angesichts die Arbeit schwieliger Hände verrichtet, während die anderen, die ihre Hände in ›Blut getaucht‹, die ›Liberalen‹ spielten und über das Volk spöttelten und in Vorträgen und Aufsätzen zu dem Ergebnis kamen, daß unser Volk ›von Tiergestalt und auch geistig von Tierart‹ sei. Also sagen Sie mir nicht, daß ich das Volk nicht kenne! Ich kenne es, von ihm aus habe ich Christus wieder in meine Seele aufgenommen, den ich als Kind im Elternhause kennengelernt, dann aber verloren hatte, als auch ich mich in einen ›europäischen Liberalen‹ verwandelte.« Solche Lehren werden ja nicht Jeden überzeugen; man kann mit Recht sagen, daß der persönliche Eindruck, den ein bedeutender Mensch vom Volke hat, nicht maßgebend ist, weil er eben im Volk findet, was er ihm gegeben hat. Aber nicht darauf kommt es an, ob Dostojewski eine richtige Tatsache erzählt: er stellt eine richtige Forderung; mag das Volk Christus in sich aufgenommen haben oder nicht – es soll ihn aufnehmen, und es wird ihn aufnehmen, das ist der Sinn dieser Lehre. Und wie die Völker verschieden sind nach ihren Anlagen und Gesinnungen, so werden sie diese Lehren auch verschieden erfüllen, das Volk, in welchem der Schuhmacher Jakob Böhme lebte, wird einen anderen Christus in sich aufnehmen als das russische Volk.
Schwerlich wird heute ein Mensch zur Religion kommen durch die Lehren, die er von Kindheit an hört; diese Lehren führen doch offenbar die gebildeten Menschen zur Gleichgültigkeit oder zur Gottlosigkeit; aber vielleicht war es in früheren Zeiten nicht anders, denn die bedeutenden Männer haben immer gesagt, daß Religion ein Vorgang ist, der im Verlauf des Lebens vor sich geht. Natürlich ist ein Mann wie Dostojewski tiefer in die Abgründe des Unglaubens getaucht als ein anderer: ein bedeutender Mann weiß schon, weshalb er gläubig wird.
Und hier liegt der Punkt, wo Dostojewski sein Ideal stärker verankert hat als unsere Klassiker das ihre, das tatsächlich dasselbe war: er hat sich aus sinnloser Verzweiflung und blinder Leidenschaft, aus dem ursprünglichen Bösen der menschlichen Natur gerettet; das klassische Humanitätsideal aber weiß nichts von den seelischen Abgründen; es nimmt den Menschen als ursprünglich gut an. Vergleichen wir die Idealfigur Goethes, die Iphigenie, mit Dostojewskis Idealfigur, dem Idioten. Der Idiot versteht alles Fürchterliche, Entsetzliche und Gemeine, das in einer Menschenbrust herrschen kann, Iphigenie würde erstaunt sein, wenn sie davon erführe. Es ist nicht Zufall, daß die höchste sittliche Reinheit hier in einem Weibe, dort in einem Manne verkörpert ist. Dostojewski würde den Punkt verstanden haben, um den sich das Denken Luthers drehte, die Rechtfertigung durch den Glauben; Goethe hat nicht gewußt, was damit gemeint war.
Einmal faßt Dostojewski seine Anschauung in einem Gedanken: »Sittlich ist nur das, was mit unserem Schönheitsgefühl übereinstimmt, und mit dem Ideal, in welchem es sich verkörpert.«
Zur Entwicklung des Romans
(1913)
Unser Roman hat sich bekanntlich gebildet aus den Prosaauflösungen alter Ritterepen, die man zutreffend als Versromane bezeichnet hat. Diese alten Versromane waren bereits Gebilde zweiter Hand; sie waren entstanden durch mehr oder weniger äußerliche Zusammenstellung von einzelnen Erzählungen, die entweder schon vorher als Balladen ein selbständiges künstlerisches Leben geführt oder als Märchen und Sagen von Mund zu Mund gegangen waren, oder in Nachbildung solcher vorhandenen Geschichten gemacht wurden. Als Beispiel mag man den besonders gut gebauten Roman von Tristan und Isolde annehmen. Man unterscheidet noch genau die einzelnen unzusammenhängenden, einander zuweilen widersprechenden Balladen über die Liebesabenteuer, in denen Tristan, Isolde und Marke ihre Rollen spielen; man sieht, wie manches nicht ganz organisch verbunden ist, das vielleicht ursprünglich einen anderen Helden betraf, vielleicht einen anderen Helden mit zufällig demselben Namen: die Geschichte, wie Tristan zu Marke kommt, die Geschichte mit Morholt von Island u. a. Der erste Erzähler Beroul schmiedet aus den einzelnen Teilen als Dichter sein Werk, spätere Dichter überarbeiten es, endlich kommt die Prosafassung. Es handelt sich im Grunde um eine Aufeinanderfolge von dichterisch merkwürdigen Erzählungen, in denen von der verschollenen alten Form der Ballade noch so viel dramatisches Leben ist, daß neben der lyrischen Anteilnahme am Einzelvorgang noch eine Gesamtspannung stärkerer oder geringerer Art übrigbleibt.
Dieses dichterische Gebilde zweiter Hand sucht sich nun zu einer dichterischen
Form zu entwickeln. Das kann es aber nur, wenn eine Zeit kommt, die dafür günstige Bedingungen in der allgemeinen Betrachtung der Welt schafft.
Wie der Prosaroman mit dem Bürgertum ursprünglich entstanden ist, mit dem Leser auf seiner stillen Stube und der Buchdruckerkunst, so findet er auch für seine Weiterbildung zur Kunstform die geistigen Voraussetzungen in der Weltauffassung des entwickelten Bürgertums.
Die ritterliche Gesellschaft war eine nach ihrer Natur unorganische Gesellschaft; sie umfaßte nur die zwei höheren Stände und beachtete nicht die anderen, die für das Dasein der höheren Stände ja doch nötig waren; sie wußte nicht, daß ein Volk eine Einheit bildet, in welcher der Bettler mit dem König durch die engsten Bande verknüpft ist. Die bürgerliche Gesellschaft hatte von Natur die Neigung, das gesamte Volk zu umfassen; denn alle Bestrebungen nach Ausschließlichkeit einer herrschenden Schicht mußten daran scheitern, daß das Bürgertum sich nicht als Kaste abgrenzen kann. Es entwickelt sich eine neue Wissenschaft, die Soziologie, zunächst noch formlos und ohne Zucht, und ebenso zunächst noch formlos und ohne Zucht kündet sich der neue Roman an, in dem man nicht eine Form sucht, sondern etwas Inhaltliches.
Balzac ist der erste bewußte Vertreter des neuen Romans, der erste auch, der die enge Verbindung des Romans mit der Soziologie sucht und sein Dichten als eine Art Wissenschaftsbetrieb auffaßt. Man muß ja wohl, wenn man die Dinge klarmachen will, den volkstümlichen Gegensatz von Form und Inhalt beibehalten. Die Geschichte des neuen Romans wäre dann also aufzufassen als das Suchen der neuen Inhalte nach der ihnen angemessenen Form. Die neuen Inhalte aber, das sind nicht etwa nur neue Tatsachen: es ist eine neue Empfindung, ein neues Weltgefühl; die Menschen fühlen ihre Abhängigkeit voneinander, von den Verhältnissen, von der Vergangenheit, von der Natur; die Dichter sehen nicht mehr einzelne selbständige Herrennaturen, die rein aus sich heraus wirken, sondern sie sehen ein ungeheures Netz, in dem alles verknotet ist; Menschen und Dinge; sie sehen nicht mehr logische Ursächlichkeit, sondern psychologische, zuletzt physiologische.
Es kommt hier nicht darauf an, ob diese Weltauffassung richtig ist oder nicht; sie ist vorhanden und für den größten Teil der heutigen Menschheit herrschend geworden. Es scheint, daß eine neue Betrachtung der Dinge sich anbahnt, die einem neuen Drang der Menschheit entspricht, die auch die bürgerliche Gesellschaft verneint und in ihrer beginnenden Auflösung die Grundlagen einer neuen Bildung ahnt. Der Mensch will wieder frei werden, und Dichter wie Tolstoi, Dostojewski, Ibsen suchen hier jeder in seiner Art, sich selbst unklar und oft über ihre notwendige Unklarheit, ihren selbstverständlichen Gegensatz zu der herrschenden bürgerlichen Gesellschaft verzweifelt. Mir scheint, daß das, was hier erstrebt wurde, sich einmal in einem neuen Drama ausdrücken wird. Aber von diesem, dem Neuen, wollen wir nicht sprechen: wir wollen der Entwicklung des Andern folgen.
Man weiß, wie Zola bewußter noch als Balzac und deshalb dichterisch unzulänglicher das Ziel des »wissenschaftlichen Romans« verfolgt hat. Man weiß auch, woran er scheiterte. Er wollte die gesamte Gesellschaft in einer Reihe von Romanen darstellen, indem er ein großes Epos schuf, dessen einzelne Episoden die verschiedenen Romanbände waren. Aber der Stoff ist zu umfangreich, als daß ihn ein Dichter dichterisch beherrschen könnte, nämlich alles in sich selber lebendig haben und aus seinem eigenen Innern herausstellen. Er kann nur äußerlich beobachten und Dinge erzählen, die er mit den Augen gesehen hat; aus dem Dichter ist ein Berichterstatter geworden. So hat Zola die Idee des bürgerlichen Romans zu ihrer eigenen Verneinung geführt, soweit es eine nicht künstlerische, sondern inhaltliche Idee war.
Aber wie nun, wenn es der Dichtung gelänge, aus dem Inhalt eine Form zu entwickeln?
Es ist soeben in deutscher Übersetzung der Roman eines bei uns bis jetzt noch unbekannten polnischen Dichters erschienen: »Die polnischen Bauern« von W. S. Reymont. Mich wird gewiß niemand im Verdacht haben, daß ich eine Vorliebe für die Art Reymonts habe; denn ich gehe in meinen eigenen Arbeiten von ganz anderen Vorbedingungen zu ganz anderen Zielen. Desto gewichtiger muß es sein, wenn ich erzählen kann, daß ich von diesem neuen Dichter den allerstärksten Eindruck gehabt habe, daß ich oft beim Lesen zu mir selber sagen mußte wie glücklich wäre ich, wenn ich in meiner Art so Schönes und Vollkommenes schaffen könnte wie dieser Mann in seiner! Das Einordnen der Künstler ist ja eine große Torheit; man muß es tun, um der Allgemeinheit irgendeine Vorstellung von dem Wert eines Mannes zu geben. Nun, dieser Reymont hat die Beschaffenheit der bedeutenden Dichter des vorigen Geschlechts, neben die wir Heutigen, wenn wir etwa Pontoppidan ausnehmen, ja niemand zu setzen haben.