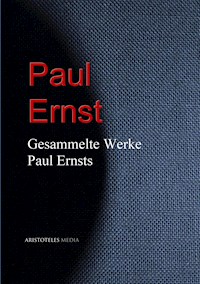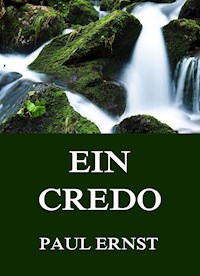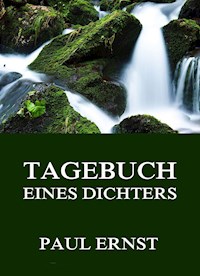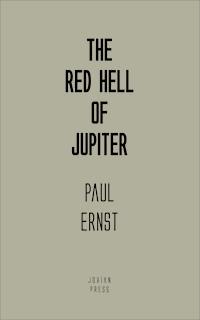Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Stile von Paul Heyse hatte auch Paul Ernst ein Faible für kurze, humoristische Erzählungen. Die meisten davon, mit italienischem Hintergrund, sammelte er in diesem Band.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Komödianten- und Spitzbubengeschichten
Paul Ernst
Inhalt:
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Komödianten- und Spitzbubengeschichten
An A. und M.L. Holz
Cassander
Der Kapitän Spavento
Pantalon
Silvie
Die Achatkette
Das grüne Ungeheuer
Die verfallene Kirche
Neue Liebe
Der Geigenbogen
Der Dichter
Pierrot und Colombine
Die arme Seele
Die Liebesbriefe
Die ungewollte Freiwerbung
Der Mäzen
Das Wunder
Der Bi-Ba-Bo
Der Traum
Die zehn chinesischen Hofkleider
Der Vorhang
Die Liebesprobe
Das Priesterseminar
Cinthios Heirat
Die Gans
Der Anzug des Dichters
Die Tote
Der kleine Schuh
Der Balkon
Die Straußenfeder
Der weinende Schornsteinfeger
Die Verschreibung
Der edelmütige Arlechin
Die fünfzig Dukaten
Das letzte Lied
Die Briefe des Seligen
Die gesparten Schlachtschüsseln
Hauptmann Tromba
Die Ostermesse
Der Umzug
Die Brüder
Die Uhr
Coralinens Erbschaft
Der Strick über der Rolle
Das spitzenbesetzte Wäschestück
Der Smaragd
Die Schnupftabaksdose
Der Strumpf
Der Fund
Der neue Anzug
Die Repetieruhr
Die verdoppelten Skudi
Das Stelldichein
Das Festmahl
Der Seelenfrieden
Das Bett
Der Tod der Waschfrau
Der moralische Eindruck
Der Silberschatz
Das versiegelte Kästchen
Der Hecht
Das Ende
Komödianten- und Spitzbubengeschichten, Paul Ernst
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster
Germany
ISBN: 9783849611866
www.jazzybee-verlag.de
Paul Ernst – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 7. März 1866 in Elbingerode (Harz), verstorben am 13. Mai 1933 in Sankt Georgen an der Stiefing in Österreich. Der Sohn des Grubenaufsehers Johann Christian Friedrich Wilhelm Ernst und dessen Frau Emma Auguste Henriette Dittmann studierte nach seinem Schulabschluss Theologie und Philosophie in Göttingen und Tübingen, später dann Literatur und Geschichte in Berlin. 1892 erfolgte die Promotion. Schon in jungen Jahren schloss er sich der Arbeiterbewegung an und war kurze Zeit Mitglied der SPD. Nach einem Aufenthalt in Weimar, wo viele seiner Werke entstanden, war er Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig.
Wichtige Werke:
Ariadne auf NaxosBrunhildCanossaChilderichChriemhildDer schmale Weg zum GlückDas Glück von LautenthalDemetriosDer Schatz im MorgenbrotstalDer Tod des CosimoDie HochzeitDie selige Insel und andere Erzählungen aus dem SüdenKomödianten- und SpitzbubengeschichtenPreußengeistSaat auf HoffnungKomödianten- und Spitzbubengeschichten
An A. und M.L. Holz
Als ich Ihnen die folgenden Geschichten in der Handschrift gab, sagten Sie mir: »Diese Sammlung ist wie ein Strauß blühender Rosen, die Sie gepflückt, und nun den Komödianten überreichen. Da wir ja Gott sei Dank auch zu den Komödianten gehören, so sagen wir Ihnen herzlichen Dank.«
Es hat wohl kaum jemals eine Verfassung der menschlichen Gesellschaft gegeben, welche den Künstlern so feindselig gestimmt war, wie es die heutige bürgerliche Verfassung ist. Das Bürgertum hat uns viel Leid zugefügt; das schlimmste, das es uns angetan hat, war aber, daß es die Mauern niedergerissen hat, die uns von ihm trennten.
Nach der Legende war Homer ein Bettler, ja, er war ein blinder Bettler; denn ein Mann, welcher die ganze Welt im Bild in seinem Innern trug, durfte wohl seine Augen geschlossen halten für die gleichgültige und törichte äußere Welt, die ihn ja nur gestört hätte. Ein Dichter muß ja arm sein, wenn er nicht durch Zufall in Reichtum geboren ist: denn wer immer nur daran denkt, den Menschen zu schenken, der kann freilich nicht bürgerlich für sich selber sorgen, für sein Durchkommen und seine Zukunft. Frühere Zeiten haben diesen Zustand geehrt, indem sie jede Art von Künstlern so leben ließen, wie sie ihrer Natur nach leben müssen: diejenigen, bei denen das Handwerkliche bedeutend ist, wie Maler und Bildhauer, als Handwerker, und diejenigen, bei denen das Handwerkliche weiter zurücktritt, wie die Dichter, Musiker und Schauspieler, als Zigeuner. Jede Künstlerschaft ist mit Leid erkauft, denn das Höchste ist ja wohl nicht umsonst zu haben. Auch das Zigeunerleben ist wahrhaftig nicht leicht; nur starke und heitere Gemüter können es ertragen, nur Menschen, welchen die unbürgerliche Gabe verliehen ist, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Aber das Zigeunerleben ist das einzig mögliche gesellschaftliche Leben für den Künstler: wird es ihm unmöglich gemacht, dann ist er dazu verdammt, Einsiedler zu sein.
Die bürgerliche Gesellschaft, im Bewußtsein ihrer Vortrefflichkeit, hat uns alle in ihren Schoß aufgenommen; nur bei einem Stand unter uns ist ihr das noch nicht ganz geglückt: bei den Schauspielern. Zwar löst sie auch ihn heute zusehends auf, und wenn die Bemühungen auf die soziale Hebung des Standes weiter so fortgehen, wie sie angefangen, dann wird es auch bei ihm bald so sein, daß eine junge Dame aus guter Familie nicht deklassiert ist, wenn sie Schauspielerin wird. Aber noch ist unter den Schauspielern die alte Ordnung nicht ganz gestört, noch bilden sie eine geschlossene Gesellschaft, welche den Bürger durch Höflichkeit und Liebenswürdigkeit draußen zu halten versteht.
Als ich zum ersten Male unter Schauspieler kam, und aus der Vereinsamung des Dichters in der bürgerlichen Gesellschaft in die Wärme, welche nur durch die Gesellschaft Gleichgestimmter möglich ist; die Heiterkeit, die Härte gegen uns selber, die Leichtigkeit im Nehmen des Äußerlichen, die Lügenlosigkeit, die Ironie, die Nüchternheit – Hölderlin nennt sie heilig – das Spiel, und die ganze Geistesverfassung, welche ich bis dahin nur am einzelnen Künstler kannte, nun als gesellschaftlichen Geist vorfand; da war mir, wie einem Kind, das immer in der Fremde gelebt hat, das sah, wie andere Kinder Eltern, Verwandte, Freunde, Volksgenossen hatten, und das für sich immer allein war, von allen nur verwundert, oft bedauernd, oft freundlich, aber doch immer fremd angesehen wurde; und das nun plötzlich sich in seinem Heimatslande sieht.
Ihnen, liebe Freunde, danke ich viel von diesem Heimatsgefühl: deshalb möchte ich diesen Strauß, den ich in Dankbarkeit meinen theatralischen Freunden gepflückt habe, Ihnen widmen.
Ich habe die Novellen in einer Zeit spielen lassen, wo der Schauspieler noch ganz Schauspieler war, wo er also noch nicht den Unterschied zwischen Bühne und Leben zu machen brauchte. Die Figuren waren typisch und kamen in jedem Drama wieder vor; der Schauspieler spielte also sein ganzes Leben lang nur eine Rolle, und so konnte es dahinkommen, daß er bald sich selber spielte und seine Rolle lebte. Man kann sich vorstellen, daß es damals noch keinen »denkenden Schauspieler« gab.
Es herrschte damals noch Stilgefühl, das heißt, man wußte, daß Kunst nichts mit den Bewertungen der Wirklichkeit zu tun hat. Zwei Möglichkeiten gibt es für das Drama. Die eine ist die Idealität des Seelendramas, bei welchem die Wirklichkeit nur die Symbole für die Bewegungen der Seele hergibt; die antike Tragödie mit ihrem komischen Gegenstück, der aristophanischen Komödie ist die Form dieses Seelendramas; es lebt nur immer sehr kurze Zeit, wenn in den Seelen der Menschen große religiöse Bewegungen geschehen. Die andere dieser Möglichkeiten ist das, was die mittlere und neuere Komödie und der Mimus wollten: die Wirklichkeit unter die Herrschaft des Geistes bringen, indem man die Leidenschaften komisch nimmt, denn die Leidenschaften sind ja die heftigsten Bejaherinnen der Wirklichkeit.
Schon im griechischen Lustspiel wurden die großen Charaktertypen geschaffen, welche bis zum Ende des eigentlichen Theaters lebendig gewesen sind.
Lelio ist der Liebhaber; er heißt auch Flavio oder Oratio, Cinthio, Ottavio oder Leander. Isabelle ist die Liebhaberin; sie kann auch Fiorinette, Aurelie, Flammte, Silvie oder Camille heißen. Die beiden lieben sich heiß; aber nie gibt es zwischen ihnen die Tragödie von Romeo und Julia. Das ist unmöglich, denn nicht nur ihr eigener Charakter schließt das aus, auch die Väter und Oheime, die Pantalons, Dottores, Cassander, Tartaglia, Notare, Apotheker haben nicht die Gemütsart der Montechi und Capuletti, und die Helden sind der Kapitän Spavento oder Spezzafer, welche desgleichen das Blutvergießen nicht lieben. Aber treue Diener und Dienerinnen stehen den Herrschaften zur Seite und übertreffen sie an Geist: Arlechino, Pulcinella, Mezzetin, Colombine, Betta, Coraline und Violette. Dieses Personal gibt die Helden zu den nachfolgenden Novellen; es kommen nur noch der Direktor hinzu und der Dichter, und außerhalb des Theaters der Mäzen Samuel und die mehr oder weniger platonischen Liebhaber, wie der Schornsteinfeger.
– Diese Einleitung wurde vor dem Krieg geschrieben. Manche Leute glauben, daß seitdem eine Revolution gekommen ist. Aber ich glaube das nicht, Sie, meine Freunde, wohl auch nicht. Bloß die Zahl der Beamten hat sich vermehrt, sie stieg von sieben vom Hundert der Bevölkerung auf fünfzehn und wird auf zwanzig steigen, wenn erst die neuen Steuern in Kraft sind. Nein, die bürgerliche Gesellschaft ist lebendiger als je, sie findet in der deutschen Republik ihren schönsten Ausdruck.
Paul Ernst
Cassander
Cassander ist natürlich ein alter Schauspieler. Er ist so alt, daß sein Charakter sich bereits verändert. In früheren Jahren hatte er einen offenen Verstand, eine leichterregte Phantasie. Man kennt doch die Geschichte vom Karpfen: sein Freund, der Fürst Tartaglia, hatte einen Karpfen gezähmt. Karpfen sind bekanntlich sehr dumme Tiere und deshalb schwer zu zähmen; der Principe Tartaglia aber besaß jene Gabe, mit den Tieren umzugehen: er war energisch, liebenswürdig und vor allen Dingen konsequent. Er war von eiserner Konsequenz; und die Konsequenz ist es hauptsächlich, die auf das Tier wirkt. Der Karpfen folgte dem Principe wie ein Hündchen auf die Straße, in Gesellschaften, in den Ballsaal, zum Spieltisch; ein Hündchen hätte man natürlich nicht derart überallhin mitnehmen können, denn auch der klügste Hund hebt plötzlich in einem unpassenden Moment an einem Stuhl oder Tisch das Bein hoch. Diesen Karpfen also besaß der Principe Tartaglia, als er noch in Neapel lebte; nach Rom brachte er ihn nicht mit, denn das Tier war damals schon verunglückt; er hatte ihn einmal zur Probe mitgenommen, ein Wolkenbruch geht über Neapel los, der Principe eilt nach Hause, damit die Prinzessinnen die gewaschenen Unterhosen hineinnehmen, die vor den Fenstern zum Trocknen hängen; der Karpfen folgt ihm, gerät in eine tiefe Gosse und ertrinkt. Niemand in Rom glaubte diese Geschichte, aber Cassander glaubte sie. Das war vor vierzig Jahren. Wenn heute ihm jemand sagt: »Der Direktor hat alle Gagen ausbezahlt«, so antwortet er: »Du lügst«; so phantasielos ist er in seinem Alter geworden, so skeptisch, so schwerbeweglichen Geistes, so – wissenschaftlich mit einem Worte.
Merkwürdig ist dabei, daß er sich nunmehr auf die Dichtung geworfen hat. In den neueren Stücken fallen ihm immer nur kleine Rollen zu; zwar, er sagt mit Recht von sich: »Wenn ich auf der Bühne bin und nichts sage, dann steht immer ein Schauspieler da«; aber seine Kraft wird doch nicht ausgenutzt, sie liegt brach, sie schreit nach Betätigung. So hat er ein großes Epos begonnen: Die Schöpfung; sieben Bände wird das Epos haben, jeder Band vierundzwanzig Gesänge. Er stellt sich neben Homer, Dante und Lorenconi mit diesem Werk.
Aber was geht uns hier Cassanders Epos an!
Cassander hat eine einzige Tochter namens Colombine. Natürlich verlangt er, daß sie den reichen, vornehmen Duca heiraten soll, den Duca, der einen Wagen hat und einen Silberdiener, den Duca, in den Isabella, Aurelie, Coraline verliebt sind; aber der Duca liebt nur Colombinen. Colombine indessen findet, daß der Duca zu alt ist für sie, und hat eine Liebschaft mit dem Kapitän, eine Liebschaft, ja eine für bürgerliche Begriffe recht weitgehende Liebschaft. Cassander weint, er ermahnt sie, er erzählt aus seinem Leben, vom Fürsten Tartaglia, der auch eine Liebschaft hatte, ehe er den Karpfen zähmte, und natürlich das Mädchen nicht heiratete, wie er den Karpfen hatte; nun ist sie alt geworden, die anderen Liebhaber haben sie auch nicht geheiratet, sie hat jetzt eine Garküche; für einen Soldo darf man dreimal in den Ölkessel stechen, und was dann an der Gabel bleibt, das hat man. »Das ist ja meine Mutter«, ruft Colombine lachend, »das verwechselst du ja!« Cassander wird böse und verstummt; der Kapitän kommt und sagt, daß Cassander gleich zur Probe muß; er wird inzwischen Colombinen Gesellschaft leisten. »Ach, was habe ich denn für eine Rolle!« klagt Cassander. »Nichts habe ich zu sagen, als: ›Meine Herrschaften, gehen wir zu Tisch‹. Braucht man für eine solche Rolle einen Cassander? Gewüstet wird mit dem Talent! Es ist himmelschreiend! So behandelt man Künstler!« »Aber Papachen,« antwortet ihm Colombine und reicht ihm Hut und Stock, »wer soll denn sonst die Rolle spielen! Auf diesem Satz steht ja das ganze Stück! Wenn der Satz nicht herauskommt, dann ist das Stück gefallen!« »Du hast recht, mein Kind«, antwortet besänftigt Cassander; »gerade diese Rollen sind die schwierigsten, sie erfordern die reife Meisterschaft, das ganze Können. Davon versteht natürlich das Publikum nichts. Aber dem wahren Künstler genügt der Beifall des Kenners.« Mit diesen Worten setzt Cassander seinen Hut auf, nimmt seinen Stock und geht zur Probe, zur Generalprobe. Der Kapitän bleibt inzwischen bei Colombinen.
Die Generalprobe nimmt den erwünschten Verlauf. Lelio beginnt einen Streit mit dem Souffleur und nennt ihn einen Idioten, denn irgendein Ärger muß vorfallen. Cassander spricht seine Worte, und wie er diese Worte spricht, da steht er allein auf der Bühne, alle anderen Schauspieler sind verschwunden, wenigstens man merkt sie nicht. Das ist die Macht des Talents. Aber im Abgehen stolpert er über einen rostigen Nagel, der da vorsteht, man weiß nicht weshalb; er fällt, reißt sich eine große Schramme ins Bein mit dem Nagel; Mezzetin hilft ihm auf, Coraline zieht ihm den Strumpf aus, Isabelle verbindet ihn mit ihrem Taschentuche; es war rein, die Taschentücher der männlichen Kollegen sind voller Schnupftabak; der Principe Tartaglia weint, Cassander aber lacht und erklärt, daß die Verletzung ganz harmlos sei. »In deinen Jahren!« antwortet ihm der Principe besorgt. »Wessen Jahre?« fragt Cassander scharf, und alles verstummt.
Aber die Verletzung ist nicht harmlos. Das Bein schwillt an, der Doktor kommt, der richtige Doktor, nicht der Schauspieler, schüttelt den Kopf, spricht von Schneiden, verordnet vorläufig Umschläge und Bettruhe; dann geht er, indem er eine Prise nimmt.
»Bettruhe?« ruft Cassander, als der Doktor das Haus verlassen hat und außer Hörweite ist. »Bettruhe? Was denkt dieser Scharlatan von einem Künstler?« »Aber Papachen, er hat gesagt, es ist gefährlich«, ruft Colombine. »Gefährlich? Und wer spielt meine Rolle heute abend?« entgegnet Cassander. »Du wirst doch nicht ins Theater gehen wollen!« ruft entsetzt Colombine. »Wer spielt meine Rolle?« fragt Cassander. »Aber Papachen, da kann doch ein anderer einspringen!« sagt Colombine. »Einspringen? In eine solche Rolle? Ist das künstlerische Gewissenhaftigkeit? Und wenn schon Einspringen möglich wäre, wer sollte es? Auf meinem Satz steht das ganze Stück. Wenn der Satz nicht herauskommt, so ist das Stück gefallen!«
Cassander steigt aus dem Bett, zieht die amarantfarbene Hose an, die hellblauen Strümpfe. »Das geschwollene Bein!« jammert Colombine. »Die Schuhe her!« kommandiert er; weinend bringt ihm Colombine die Schuhe, hilft ihm in den pfirsichfarbenen Rock. Dann geht er, auf Colombinens Arm gestützt, humpelnd zum Theater. Unterwegs begegnen ihnen die Theaterbesucher; stumm zeigt er auf die Leute, endlich sagt er: »Es wird ein volles Haus, es ist aber auch eine Glanzrolle für mich.«
Der Vorhang geht hoch, das Haus ist besetzt bis auf den letzten Platz. Das Schauspiel beginnt, die Verwicklungen folgen, es naht der Höhepunkt, Cassander erhebt sich, auf seinen Stock gestützt, und sagt: »Meine Herrschaften, gehen wir zu Tische.« Tosender Beifall, die Galerie rast. Majestätisch sieht sich Cassander im Theater um, geht dann langsam humpelnd durch die Kulisse ab.
Ächzend faßt er den Arm des Inspizienten; der Inspizient sieht ihm ins Gesicht, erschrickt; da fühlt er auch schon die Last des schwerer werdenden Körpers. Vorsichtig legt er den Ohnmächtigen auf den Boden, winkt einen unbeschäftigten Schauspieler herbei; es wird ein Wagen geholt, Cassander hineingelegt und in die Klinik gefahren. Eben ist das Theater aus, als der Wagen abrollt, die Leute strömen aus dem Tor. »Nein, dieser Cassander, wie er heute wieder die paar Worte sagte!« ruft Einer aus; dem ohnmächtigen Cassander fliegt ein glückliches Lächeln über das Gesicht.
Der Arzt in der Klinik macht eine sehr ernste Miene, als er das dunkel gefärbte, geschwollene Bein sieht. Schnell wird Cassander entkleidet, auf dem Operationstisch festgeschnallt ...
Nach einigen Stunden darf Colombine ihren Vater besuchen. Er liegt in einem freundlichen Stübchen, in einem weißen, sauberen Bett. Wie sie eingetreten ist und die Tür hinter sich zugezogen hat, sieht er sie lange an, dann schlägt er die Bettdecke zurück, das Bein ist abgeschnitten. Laut jammernd sinkt Colombine neben dem Bett in die Kniee. »Auf dem Felde der Ehre«, sagt mit dumpfer Stimme Cassander.
Eine lange Weile schluchzt Colombine. Endlich hört sie ihren Vater wieder sprechen: »Der Schauspieler Cassander ist gestorben, von heute an lebt nur noch der Dichter Cassander.«
Der Kapitän Spavento
Es ist Nacht. Die Vorstellung ist längst zu Ende, die Zuschauer sind nach Hause gegangen, auch die Komödianten. Vor dem niedergelassenen Vorhang brennt trübselig noch eine einzige Öllampe. Ein Schauspieler und eine Schauspielerin sind allein in dem leeren Zuschauerraum, im kleinen Umkreis des Lichtes. Der Kapitän Spavento hockt, die Beine auf dem Sitz, auf der Rücklehne des Sessels, der für den Herrn Duca aufgestellt war. Er ist ein schlanker, junger Mann, in furchterregender Weise braun geschminkt, in prächtigem, gelb und rot gestreiftem seidenem Anzug, ungeheurer Halskrause, fabelhaftem Schlapphut mit einem herrlichen Fasanenschwanz und mit einem märchenhaft langen Degen. Colombine steht vor ihm mit rotgeweinten Augen; die Tränen haben Straßen durch die dicke Schminke gezogen; sie trägt zierliche rote Schühchen, ein Kleid aus grünem Tarlatan und ein rotes Mieder dazu.
Der Kapitän rollt furchtbar die Augen, streicht den langen Schnurrbart, versetzt seinem Hut einen Schlag mit der Faust, springt vom Sessel mit beiden Füßen auf die Erde, stößt die linke Hand in den Korb seines Degens und ruft aus: »Zoll für Zoll sollte er dieses Eisen fressen, hätte ich ihn hier, dieses Eisen, das gegen die Mauren gefochten hat, gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier, die Türken, die Griechen, die Deutschen und gegen das für unüberwindlich gehaltene Heer des großen Moguls!«
»Das ist es ja eben«, versetzt Colombine schluchzend. »Ich mag ja den Pierrot gar nicht« – sie hängt sich an den Hals des Kapitäns – »er ist weiß vom Kopf bis zum Fuß, sein Gesicht ist weiß gepudert; wie kann man denn einen Pierrot lieben, wenn man einen Kapitän geliebt hat!« »Hat?« schreit der Kapitän mit furchtbarer Stimme. »Nein, liebt«, antwortet ängstlich das Mädchen, indem sie an ihrem Kleidchen zupft und die Augen niederschlägt. Lange sieht der Kapitän sie an, dann schüttelt er schweigend langsam den Kopf. Colombine tritt zurück, richtet sich majestätisch auf und sagt: »Der Künstler gehört nicht sich selber, er gehört dem Publikum«, dann fährt sie in anderem Tone fort: »Nicht wahr, wenn ich will, dann kann ich auch die Isabelle spielen?« »Alles, mein Kind, auch die Fiorinette und Silvie, wenn du willst«, erwidert in tiefem Ton der Kapitän. »Nur erst fort von dieser Schmiere.« »Ach nein«, bittet Colombine. »Ha, ich verstehe, du denkst an Pierrot!« schreit der Kapitän. »Wir sind so gut aufeinander eingespielt«, lispelt sie. Der Kapitän läßt den Kopf hängen und spricht mit dumpfer Stimme: »Eingespielt! Eingespielt! Mit dem Kapitän ist nie ein Weib eingespielt – nur gestern, da erzählte doch unser verdammter Stückeschreiber, er wolle ein Stück schreiben mit einer verliebten Alten, die ich heiraten soll, und die verliebte Alte gibt es noch nicht in der italienischen Komödie, sagte er. Aber ich« – hier richtet er sich auf und streicht mit furchtbarer Gebärde seinen Schnurrbart – »ich habe ihm geantwortet! Mit einem alten Weib spiele ich nicht. Gibt es für den Kapitän keine Colombine, Coraline, Arlequine, Bette, Francesquine, Diamantine, Marinette, Violette, gibt es keine Isabelle, Fiorinette, Aurelie, Silvie, Flaminie oder Camille – gut, der Kapitän Spavento weiß sich zu bescheiden, er ist Soldat. Seine Geliebte ist der Degen. Und Zoll für Zoll soll der verdammte Stückeschreiber dieses Eisen fressen, wenn ich seine Alte lieben soll; er mag sie dem Dottore geben oder dem Apotheker, dem Tartaglia oder Pantalon, oder zum Teufel auch dem Pierrot.«
Wieder schmiegt sich Colombine an ihn; er wird schwach und setzt sich schwer in den großen Lehnstuhl; sie hüpft auf seine Kniee und schlingt die Hände um seinen Hals; dann flüstert sie ihm ins Ohr: »Nein, ich bin keine Isabelle, Fiorinette oder Silvie, ich bin eine Colombine. Ich weiß es ja. Und das ist es eben: wenn ich dich liebe, dann verliere ich das Talent. Wenn du die Augen rollst, die edlen Worte sprichst, wenn die Bretter zittern unter deinen Füßen – sieh, ich komme schon wieder in den falschen Ton, in das Theater, das ich so hasse –,« hier beginnt sie zu weinen, »wenn ich bei dir bin, dann bin ich nicht mehr Colombine, dann bin ich Isabelle; aber ich bin eine schlechte Isabelle, ich weiß es. Zu dir gehört nicht Colombine, zu dir gehört Isabelle.« »Isabelle hat ja Flavio«, erwidert dumpf der Kapitän. »Nimm sie ihm ab«, rät Colombine. Der Kapitän sieht sie an und sagt ängstlich: »Dann verprügelt er mich ja.«
»Armer Kapitän«, spricht Colombine und trocknet sich heimlich eine Träne. »Dein Schicksal ist furchtbar ... Nein,« ruft sie laut aus, springt von seinem Schöße zur Erde, stellt sich vor ihn, stampft mit dem zierlichen, rotbeschuhten Füßchen auf! und ballt die reizenden Händchen zu Fäusten: »Colombine gehört zu Pierrot. Wo mein Talent ist, da ist auch mein Herz.« Sie pustet das einzige Licht aus und eilt aus der Tür; sie hatte sich vorher die Entfernung der Tür von den Stuhlreihen gemerkt. Stolpernd und überall anstoßend folgt ihr langsam der Kapitän ins Freie; sie ist schon lange verschwunden ...
Der Kapitän wurde still und stiller, seine Stimme klang hohl; »ein melancholischer Kapitän«, hieß es im Publikum; der Direktor kündigte ihm, und er bekam kein neues Engagement. Er lobte niemanden mehr ins Gesicht wegen seines Talentes und verhöhnte niemanden mehr hinter seinem Rücken wegen seiner Talentlosigkeit. Er sagte nicht mehr: »Rom ist die Hauptstadt der Welt und ich bin der erste Schauspieler von Rom!« Er blieb vom Theater fort, kein Mensch sah ihn mehr, weder auf dem Korso, noch beim Marforio, noch in der Konditorei, um Kritiken zu lesen und über die Kritiker zu schimpfen.
An einem Abend brachte Pierrot Colombinen nach Hause, das heißt die beiden gingen zusammen nach Colombinens Stube. Plötzlich faßte Colombine auf ihr Herz und schrie leise auf; da war eine dunkle, schmale Nebengasse; sie riß sich von Pierrot los, lief in die Gasse. Pierrot lief hinter ihr her, sie war wie vom Boden verschluckt. Pierrot sagte ärgerlich vor sich hin: »Wenn der junge Conte wenigstens noch Geld hätte, aber der Alte hält die Quattrini fest«; dann ging er nach Hause.
Aber Colombine war nicht zu dem jungen Conte gegangen, der sie vielleicht erwartete. Sie wußte ja nicht, daß der Kapitän hier wohnte, in dieser elenden Gasse; sie lief in ein baufälliges Haus, das durch Balken gestützt wurde, die selber schon vermodert waren, eilte eine Steintreppe hinauf; sie kannte das Haus nicht; eine Tür stieß sie auf, da lag auf einem elenden Bett der kranke Kapitän. »Kommst du endlich?« fragte er, »ich habe mich so gesehnt, daß du kommst; nun sterbe ich bald.« »Nein,« rief sie, »du sollst nicht sterben«, und sie warf ihr Umschlagetuch ab und stand da in ihren roten Schuhen, dem grünen Tarlatanröckchen und roten Mieder. Dann kniete sie vor seinem Bett nieder und legte ihr Händchen auf sein Herz; das Herz pochte müde. »So wird es besser«, sagte sie, und er nickte ihr traurig zu. Dann war es lange still in dem armseligen Gemach, dann schlummerte der Kranke ein. Stundenlang kauerte sie vor ihm und hielt die Hand auf seinem Herzen; endlich fröstelte sie, sie stieg auf den Tisch, wo eine Brotkruste und ein halber Ziegenkäse lag neben einem Fiasko mit Wein; sie wickelte sich in ihr Tuch, rollte sich zusammen wie ein Kätzchen und schlief ein.
Am anderen Morgen fiel schräg ins Zimmer ein Sonnenstrahl. Der Kapitän war erwacht; lange lag er still und sah auf die Schlafende; endlich dehnte die sich, öffnete blinzelnd die Augen. »Ich sterbe noch nicht, ich werde wieder gesund«, rief der Kapitän.
Pantalon
Pantalon ist Familienvater, auf der Bühne wie im Leben. Er hat zwei Töchter, auf der Bühne wie im Leben; sie heißen Isabelle und Aurelie, auf der Bühne wie im Leben.
Der Vorhang ist noch nicht hochgegangen, aber das Publikum sitzt schon erwartungsvoll; von der Galerie werfen die Jungen zum Zeitvertreib den seinen Herren im Parkett Orangenschalen auf den Kopf, und feine Damen in den Logen schleudern Blicke durch ihre schwarzen Schleier, Blicke, welche eigentlich die Schleier müßten in Flammen aufgehen lassen.
Pantalon hat in der ersten Szene nichts zu tun, aber er steht noch vor seinen Töchtern: Isabelle näht und Aurelie spielt auf der Laute, oder vielmehr sie wird spielen, wenn der Vorhang hochgeht.
»Das wahre Glück ist nur in der Familie zu finden,« sagt er zu seinen Töchtern, »aber es will durch die Tugend verdient werden.« »Ach, Papa, es ist so furchtbar schwer, tugendhaft zu sein, wenn man beim Theater ist«, seufzt Isabelle und läßt ihr Nähzeug sinken. »Ich könnte mich ja wieder verheiraten, wenn ich wollte; Colombine liebt mich«, fährt würdevoll Pantalon fort; Aurelie lächelt, sieht schräg zu ihm hin und sagt: »Du mußt die Hustenkaramellen nehmen, die alle alten Männer gebrauchen; es ist schrecklich, jeden Morgen hustest du zwei Stunden lang.« »Das ist ein Gesundheitshusten«, erwidert Pantalon; »junge Leute, deren Gesundheit noch schwankend ist, haben ihn nicht, man bekommt ihn erst, wenn man sich den Siebzigern nähert und der Körper sich gesetzt hat.«
Das Publikum wird ungeduldig und trampelt. Isabelle fädelt eine Nadel ein und sagt: »Sie sind schon unruhig, aber der Inspizient zieht den Vorhang nicht eher hoch, bis er vom Direktor seine Gage hat.« »Er hat recht, der junge Mann, er ist kein Künstler, er ist nur ein Söldner«, antwortet ernsthaft Pantalon. »Aber was ich bei dieser Gelegenheit sagen wollte: ich habe zwei Partien für euch. Meine Kinder, ich kann ruhig sterben, ich hinterlasse euch versorgt in dieser harten Welt«; er zieht sein buntes Taschentuch, schneuzt sich, besieht nachdenklich das Geschneuzte und steckt das Taschentuch wieder ein.
Die beiden Mädchen lachen aus vollem Halse: »Der Doktor und der Notar!« »Sie sind meine Freunde«, erwidert Pantalon. »Jugendfreunde«, werfen die beiden ein. »Ja, Jugendfreunde«, sagt der Vater. »Sie sind Männer, Männer in ihren besten Jahren. Meint ihr, wenn – wenn – ich alter Karrengaul, ich werde in den Sielen sterben; mein Vater ist in den Kulissen gestorben und mein Großvater; sie waren beide die ersten Pantalons ihrer Zeit, und damals war noch eine andere Zeit, da gab es noch ein Theater, da konnten die Schauspieler noch sprechen!« Er wird gerührt, trocknet sich die Tränen. »Aber Papachen, wer denkt denn wohl ans Sterben!« rufen die Töchter und springen auf, umarmen ihn, halten ihre blühenden, weiß und rot geschminkten Wangen ganz nahe an seine graugeschminkten Runzeln. »Noch gestern hat Colombine geseufzt, wie du vorbeigingst, du hast es nur nicht gemerkt.« »Hat sie das?« fragt Pantalon lebhaft; dann tätschelt er ihre Hände und sagt: »Ihr seid gute Kinder; ihr habt euer Papachen lieb. Aber denkt an mich. Leander und Lelio sind junge Männer. Auf junge Männer ist kein Verlaß.« Die beiden kichern und rufen aus: »Aber Papachen, wer hat denn noch vorige Woche an Coraline einen Rosenstrauß geschickt mit einem Gedicht!« »Die Rosen haben nichts gekostet«, erwidert er eifrig; »der Conte hatte sie gesendet, sie sollten eigentlich für euch sein. Wo werde ich denn Geld für Rosen ausgeben! Der Conte hat auch nichts dafür bezahlt ...« »Der Conte?« antworten ihm die Schönen, »und du hast uns nichts gesagt davon!« »Wo werde ich euch etwas davon sagen!« erwidert er eifrig. »Ich bin Vater! Meine Töchter sind mein Höchstes! Was ist für mich der Conte! Luft ist er für mich!« »Aber er erbt doch einmal!« wirst nachdenklich Aurelie ein. »Wann?« fragt kaltblütig Pantalon.
Aber nun kommt eilig und schwitzend der Inspizient, fragt fluchend, was Pantalon auf der Bühne zu suchen hat, Pantalon verschwindet in den Kulissen, seinen Töchtern noch ein zärtliches Kußhändchen zuwerfend; die Klingel ertönt, der Vorhang geht hoch, Aurelie spielt und singt zur Laute, Isabelle läßt ihre Arbeit in den Schoß sinken und sieht ihr mit gerührtem Gesichtsausdruck zu. Das Publikum ist fasziniert.
Leander und Lelio erscheinen, die Mädchen erzählen, daß Pantalon sie an den Doktor und an den Notar verheiraten will; alle vier lachen; wie die Mädchen lachen können! Aurelie hat ein wundervolles silbernes Lachen, sie hat es von ihrem Vater geerbt; ihre Mutter hatte doch damals die Liebschaft mit dem jungen Duca! Pantalon trocknet sich, vorsichtig, damit er die Schminke nicht beschädigt, im linken Auge eine Träne der Rührung. Lelio gibt eine Beschreibung von Pantalon: so geizig soll er sein, daß er seine Nägelabschnitzel aufhebt und an die Bauern als Dünger verkaufen will, daß er die Hausglocke umwickelt, damit die Luft im Haus nicht durch das Schellen abgenutzt wird; Pantalon lächelt geschmeichelt: durch seine Sparsamkeit hat er doch ein hübsches Vermögen zusammengebracht; nun sollen seine Töchter nur den Doktor und den Notar heiraten, die haben auch gespart; da kann er unbesorgt sterben. Isabelle singt; sie hat eine herrliche Altstimme, es wäre besser gewesen, wenn sie Sängerin geworden wäre, sie bekäme eine ganz andere Gage. Die Stimme hat sie von ihrem Vater, ihre Mutter hatte doch damals die Liebschaft mit dem schönen Franziskaner! Das Publikum klatscht Beifall, ruft da capo; jawohl, da capo! Ach, wie lange ist das alles her, als Aurelie geboren wurde und Isabelle!
Jetzt kommt Pantalons Stichwort; er tritt auf, donnert gegen die beiden Mädchen, die Liebhaber sind in dem großen Schrank versteckt; Pantalon will den Schrank öffnen; der Schlüssel ist nicht da; das Publikum windet sich vor Lachen; ja, wenn einer von den alten Schauspielern auftritt, aus der großen Zeit der Schauspielkunst, das ist doch eine andere Sache! Pantalon kündigt den Töchtern an, daß der Doktor und der Notar gleich kommen müssen, der Notar bringt Pulcinella mit, der Schreiber bei ihm ist, die Heiratsverträge sollen sofort aufgesetzt werden. Und nun kommen wirklich die drei; der Doktor, der Notar und Pantalon spielen zusammen, drei von der alten Garde; schon vor vierzig Jahren haben sie zusammen gespielt. Das Publikum trampelt vor Vergnügen, hält sich den Bauch, die Jungens auf der Galerie werfen Apfelsinen auf die Bühne vor Bewunderung. Nun erzählen die drei, wie es alles war vor vierzig Jahren, und was sie für Schwerenöter gewesen sind, als sie noch jung waren, und die Tränen der Rührung über die glückliche, die selige, die unwiederbringliche Jugend kollern Pantalon über die Backen.
Pulcinella hat sein Buch aufgeschlagen, sein Tintenfaß aufgestellt, die Heiratsverträge sollen unterschrieben werden. Aber wo sind die Mädchen? Nährend die Alten erzählen, und Pulcinella sein Buch zurecht macht, haben sie leise hinter ihnen den Schrank aufgeschlossen und sind mit den Liebhabern entflohen. Nun stehen die drei Alten allein und klagen, Pulcinella weint über die entgangenen Sporteln, der Vorhang fällt, der Beifall tost, die Jungens auf der Galerie rasen vor Vergnügen.
Wo sind Isabelle und Aurelie, Leander und Lelio! In den Kulissen sind sie nicht. Der Notar und der Doktor suchen überall; Pantalon hat sich selig lächelnd nach hinten geschlichen, wo vom gestrigen Abend noch allerhand Dekorationen stehen. Er setzt sich in einen rosenbekränzten Wagen, der von zwei Tauben an rosa Bändern durch die Lüfte gezogen wird; lächelnd neigt er das Haupt und entschlummert. Auf der Bühne spielen die anderen Komödianten, das Publikum klatscht und trampelt, dann sinkt der Vorhang zum letzten Mal, das Publikum geht nach Hause, die Lichter erlöschen, die Schauspieler schlüpfen eilig durch ihre kleine Hintertür auf die Straße; Pantalon aber sitzt in seinem rosenbekränzten Wagen und schläft lächelnd; und wie am anderen Morgen die Frauen kommen zum Fegen und Wischen, finden sie den alten Mann steif und kalt; er ist gestorben in seinem rosenbekränzten Wagen, der von zwei weißen Tauben an rosa Bändern durch die Luft gezogen wird; und um die spitz gewordene Nase schwebt ein überirdisches Lächeln.
Silvie
Es ist kein Wunder, daß Coraline und Flavio sich lieben; sie sind die beiden ausgezeichnetsten Mitglieder der Truppe, und Coraline hat immer das Prinzip, den Mann zu lieben, hinter dem die Frauen am meisten her sind. Das ist das Prinzip eines mutigen Mädchens; aber sie hat es noch immer durchgesetzt, daß sie dann diesen Vielumworbenen bekam.
Sie hat also auch Flavio bekommen. Aber es ging ihr mit ihm, wie es uns so oft geht, wie es auch ihr schon so oft gegangen war: was man hat, das schätzt man nicht mehr. Schließlich ist Flavio im Grunde auch langweilig. Flavio ist immer langweilig. Die jungen Mädchen schwärmen für ihn; sie kritzeln seinen Namen auf ihre Butterbrote und essen sie dann; Coraline ist aber nicht mehr sechzehn Jahre alt, sie ist bereits fünfundzwanzig. Wenn man fünfundzwanzig alt ist, dann wird einem der Liebhaber komisch, man beginnt dann den Charakterspieler zu verstehen.
Indessen handelt es sich hier nicht um einen Charakterspieler, sondern um einen Aristokraten. Der Aristokrat betreibt eine große Seifenfabrik, und Mezzetin nennt ihn geradezu einen Seifensieder. Nun, Marchese oder Seifensieder, das ist schließlich ziemlich gleichgültig; sie sind beide bürgerlich und haben Geld; und natürlich ist es sehr angenehm, wenn ein Liebhaber Geld hat. Was bekommt Coraline für Roben, Kostüme, Toiletten, Kleider, Kleidchen, Röcke, Jupons, Blusen, Taillen, Kittel, Mieder, Jäckchen; was für Strümpfchen, Schühchen, Handschuhe, Bänder – ja, denkt euch, sie bekommt sogar eine Badewanne. Die ganze Truppe besucht sie, um die Badewanne zu besehen; sie ist aus Blech, rot angestrichen, mit einem Badeofen, mit einer Brause; jeder von der Gesellschaft verspricht Coralinen, wenn er einmal baden wolle, dann werde er zu ihr kommen. Eine Badewanne! Wie kann ein Mädchen einem Mann widerstehen, der Badewannen schenkt, Badewannen mit Badeöfen dazu!
Man kann sich denken, daß Flavio traurig wird. Er macht ihr eine Szene, sie antwortet ihm kaltblütig: »Ich bin noch nicht so alt, daß ich treu bleiben müßte; bei dir ist die Sache ja anders.« Flavio braust auf, ruft mit großer Gebärde: »Das wird die Welt sehen«, und geht fort.
Silvie ist ein reizendes Mädchen, sie ist noch ganz jung, so jung, daß man überhaupt nicht weiß: hat sie eigentlich Talent, oder ist sie nur jung? Sie hat also viel Gefühl; wir wollen es nur verraten, auch sie hat Flavios Namen mit dem Fingernagel auf ein Butterbrot gekritzelt. Nun liebt Flavio also Silvien, und Silvie ist glücklich; mit verklärten Augen sieht sie durch die Kulissen seinem Spiel zu; wie ein kleines Beutelchen, in dem Federbälle sind, hängt sie an seinem Arm, wenn er sie nach Hause begleitet, in ihr zierliches Dachstübchen, wo im Fenster ein Resedabusch steht, eingepflanzt in einen alten braunen Topf ohne Henkel, auf dem Tisch liegt ein großes Brot neben einem Haufen Apfel – sie hat so wenig Gage, die Kleine, und hat solchen Appetit. Einmal, wie er sie in ihr Stübchen gebracht hat und sich verdrießlich umschaut, weil gar nichts zu Essen da ist, beißt sie sich heimlich in den kleinen Finger, sie kann ja gar nicht glauben, daß es ein solches Glück gibt, sie denkt immer, daß sie nur träumt. Dann aber, wie der Finger recht weh tut und sie doch nicht aufwacht, springt sie mit beiden Beinen in die Höhe, hängt sich an seinen Hals und sagt: »Bring' mir nur immer dein gebrauchtes Hemd, ich wasche es dir mit; das macht mir keine Mühe, das heiße Wasser habe ich ja doch.«
Es gibt Leute, welche behaupten, daß Schauspielerinnen keine Kinder bekommen. Silvie ist nach kurzer Zeit ein Beweis dafür, daß diese Behauptung falsch ist. Der Zustand hat seine Unbequemlichkeiten, aber Silvie ist trotzdem selig. Wie wunderbar, wenn sie nun ein Kind haben wird, das ganz allein ihr gehört, das sie anziehen, ausziehen, waschen, baden, nähren, zu Bett bringen, aus dem Bett nehmen kann; das sie anlacht, mit seinen kleinen Händchen machen kann »backe, backe Kuchen«, und das so süß ist, so süß wie ein Engel! Auch Flavio ist ganz glücklich; Flavio ist ja überhaupt meistens der Ansicht, welche die Anderen haben.
Silvie ist nun sehr fleißig. Zwei Hemden hat sie nur; wenn sie das eine in ihrer Waschschüssel wäscht, zieht sie das andere an; aber das Kind muß Windeln haben, und im Sommer kann man auch mit einem Hemd auskommen; es trocknet ja schnell vor ihrem Fenster; so zerschneidet sie also das überflüssige zweite Hemd und näht Windeln. Die Anderen bewundern sie und bringen ihr Hemden, Tischtücher, Bettlaken; selbst Mezzetin schleppt einen großen Packen alte Leinwand an; er war früher in Verona engagiert, wo das Publikum die Gewohnheit hat, beliebten Schauspielern zu ihrem Benefiz Wäsche zu schenken; und Mezzetin war natürlich ein sehr beliebter Schauspieler.
Doch wer kennt das weibliche Geschlecht! Coraline sieht die Liebe Silviens und beschließt, Flavio wieder zu erobern. Der Aristokrat ist ihr gleichgültig.
Die Eroberung Flavios ist nicht schwierig; er ist es so gewohnt, erobert zu werden. Das verdrießt Coralinen schon; noch mehr aber verdrießt es sie, daß Silvie gar nichts von Flavios Untreue merkt. Vergeblich schreibt sie ihr anonyme Briefe; Silvie zeigt ihm die Briefe lachend, sieht seine Verlegenheit nicht und sagt stolz zu ihm: »So werde ich um deine Liebe beneidet, daß man mir sogar Briefe schickt, um uns auseinanderzubringen.« Vergeblich stichelt sie, wenn sie Silvien hinter den Kulissen begegnet; Silvie denkt nur, sie ist traurig, daß Flavio sie nicht mehr liebt, denn ein Mädchen muß doch traurig sein, wenn sie einen Flavio verloren hat! Coraline würde ihr ja durch einen Kollegen alles sagen lassen, aber niemand will ihr helfen, sie ist zu unbeliebt bei allen. Silvie merkt nichts, gar nichts; sie denkt, daß sie nun bald nicht mehr auftreten kann, daß dann Flavio während der Vorstellungen ohne sie ist und sich langweilen wird; sie will aber so lange ins Theater kommen, wie es geht, und hinter den Kulissen stehen, damit Flavio mit ihr plaudern kann, wenn er nicht auf der Bühne zu tun hat.
Heute spielt sie das letztemal mit; das Publikum findet, daß es eigentlich nicht mehr so recht geht, aber es ist gerührt und klatscht, wie es noch nie geklatscht hat. Silvie strahlt vor Vergnügen und Stolz. Sie hat eine junge Frau zu spielen, die ihren Mann bei einer Untreue belauscht; sie ist allein auf der Bühne und muß durch ein Schlüsselloch in ein Nebenzimmer sehen, laut berichten, was sie sieht, und zuletzt in Ohnmacht fallen. Sie beugt sich vor das Schlüsselloch – wie komisch! Da ist wirklich ein kleines rundes Loch, durch das sie auf die Hinterbühne sehen kann; da steht Flavio; sie nickt ihm zu, denn sie vergißt im Augenblick, daß er sie ja gar nicht sieht; sie ruft: »Flavio!« besinnt sich aber schnell, kommt wieder in ihre Rolle und fährt fort: »Ungetreuer, Meineidiger! Was sehe ich!« Ach, was sieht sie! Coraline steht neben ihm, legt die Hand um seinen Nacken. Silvien schwimmen die Augen in Tränen. Sie muß in ihrer Rolle fortfahren: »Sie legt den Arm um seinen Nacken«; ihre Stimme will ersticken, sie sieht, wie er sie umfaßt und küßt, und sie muß sagen: »Du küßt sie, sie kannst du küssen und mir hast du Treue geschworen!« Lautlose Stille ist im Publikum, noch nie wurden diese Worte mit solcher Naturwahrheit gesprochen. Die beiden halten sich fest umschlungen, Coraline lacht. Silvie muß sagen: »Ach, wie kannst du das nur tun, ich habe dich doch so lieb«; dann sinkt sie um und wird ohnmächtig, und der Vorhang geht nieder.
Sie wird wirklich ohnmächtig, sie hört nicht den donnernden Beifall, sie sieht nicht, wie der Vorhang wieder hochgeht, wie Blumensträuße auf die Bühne geworfen werden, wie das Publikum im Parterre aufsteht, um noch lauter zu klatschen; sie liegt noch ohnmächtig; der Vorhang sinkt nieder und geht wieder hoch; da hörte sie das Klatschen wie einen Gewitterregen auf ein Dach, sie besinnt sich, es wird ihr alles klar, sie erhebt sich, mit einem freundlichen, dankbaren Lächeln verneigt sie sich vor dem Publikum.
Die Kollegen sind empört über Coralinen. Mezzetin erklärt: »Die Badewanne riecht nach Seife.« Der Witz kommt uns vielleicht nicht gut vor, aber er wirkt wie ein Dolchstoß; Coraline wird blaß und reißt sich schluchzend aus Flavios Armen. Mezzetin und der Kapitän begleiten die leise weinende Silvie nach Hause, der Kapitän schwört, daß er Flabio fordern wird, denn wer eine Dame beleidigt, der hat es mit dem Kapitän zu tun, der Kapitän ist der Verteidiger jeder Unschuld.
Die armen Schauspieler haben ja alle kein Geld, um Blumen zu kaufen. Aber man kann Blumen stehlen, man bekommt auch vom Publikum Blumen geschenkt, schließlich kann man auch borgen: jedenfalls, als am anderen Tage Silvie erwachend das Köpfchen von ihrem naßgeweinten Kopfkissen hebt, da klopft es, und der Zettelträger bringt Rosen vom Kapitän, Nelken von Mezzetin, Veilchen von Isabellen, Anemonen vom Doktor, Aurikeln von Pantalon, von jedem Mitglied bringt er einen großen Blumenstrauß. Und wie das kleine Zimmer schon ganz voll ist von den Blumen der Kollegen, da kommt ein feiner Diener und bringt ein kostbares Bukett von einem Conte, und ein anderer einen Lorbeerkranz von einer Marchesa, und ein Kaufmannslehrling bringt eine Kiste Apfelsinen von seinem Herrn, und immer mehr Blumen und Geschenke kommen. Das Publikum schickt, weil Silvie so schön gespielt hat, die Kollegen aber, weil sie finden, daß Coraline gemein gegen sie gehandelt hat; denn das ist ja menschlich, daß die Liebe wechselt, aber es muß alles anständig vor sich gehen.
Die Achatkette
Lelio liebt Isabellen und Isabelle liebt Lelio; das ist so in der Ordnung, und alle übrigen Schauspieler glauben, daß die beiden sich nur deshalb lieben, weil es so in der Ordnung ist. Es ist peinlich für Lelio, daß sie das glauben, denn Isabellen würde gewiß jeder lieben, den Lelio aber – wir wollen nichts über Lelio sagen, er ist eine sehr gute Bühnenerscheinung, aber alle Schauspieler glauben eben, daß ihn Isabelle nur deshalb liebt, weil das so in der Ordnung ist.
Der Ritter de Marinis lebt auf dem Turm seiner Väter; er ist ein sehr junger und wunderhübscher Mensch mit langen schwarzen Locken und feurigen und zugleich sanften schwarzen Augen. Der Turm war früher eigentlich eine Windmühle; vor langen Zeiten hat der letzte Müller in ihr Bankerott gemacht, weil die Leute ihm kein Korn mehr zum Mahlen brachten; die Flügel faulten im Laufe der Jahre und fielen ab; und dann zog des Ritters Vater ein und erklärte, die Mühle sei ein Turm. Die Italiener sind liebenswürdige Leute; sie dachten: weshalb soll eine Mühle nicht ein Turm sein; sie glaubten auch von dem Vater des Ritters, daß er ein Ritter sei, denn eigentlich war er ein Jude, der in Tunis Handel getrieben. Es war nicht Hochmut von ihm, daß er diesen Glauben nicht störte, aber er war verarmt, weil er sein ganzes Vermögen einer trunksüchtigen Gräfin geliehen, die unter Kuratel gestellt wurde, als sie ihm sein Kapital mit schweren Zinsen zurückzahlen wollte; und ein armer Jude ist doch nicht möglich, nicht denkbar; es ging nicht anders, er mußte ein armer Ritter sein. Von diesem Vater also hatte der Kavalier de Marinis seinen Turm geerbt, diesen Turm, der einsam aufragte in der schweigenden großen Campagna.
Einsam lebte auch der Kavalier. Wie oft schaute er aus seinem hohen Fenster den leuchtenden Sonnenuntergang und dachte an – nun, in der letzten Zeit dachte er an Isabellen. Wenn er auf Jagd ging, und er ging täglich auf Jagd und schoß Sperlinge, zuweilen auch Kaninchen, welche er selber zurechtmachte und briet, dann dachte er in der letzten Zeit immer an Isabellen. Die Kolleginnen lachten; wenn er den Eintritt bezahlen konnte – die Hirten in der Campagna hielten ihn für einen Zauberer und ließen sich von ihm das Ungeziefer besprechen, dadurch verdiente er gelegentlich einige Bajocchi – wenn er den Eintritt bezahlen konnte, so saß er in der vordersten Reihe, mit den schönen, sanften, feurigen, dunklen Augen Isabellen ansehend, wie ein Junge ein Butterbrot ansieht, das die Mutter ihm eben schmiert.
Isabelle wurde ungeduldig über den schweigsamen Liebhaber und die Scherze der Kolleginnen; wenn sie ihn mit seinen hungrigen Blicken vor sich sitzen sah, so verzog sie geringschätzig ihr reizendes Mündchen und rümpfte das Näschen. Lelio war überzeugt, daß der Kavalier auch keinen Mut hatte; er schlug an sein Schwert und erklärte: »Einer von uns muß sterben. Das nächste Mal frage ich ihn, stelle ich ihn zur Rede.« Der erschreckte Direktor begütigte ihn und erklärte, die Kunst sei für alle. »Die Kunst ist für alle, das ist seine Rettung«, erwiderte Lelio düster grollend.
Der Kavalier kauft sich Fleckwasser, klopft, bürstet und reinigt seinen blauseidenen Anzug, den sein Vater einmal von einem nahe befreundeten Duca mit in Zahlung bekommen; dann nimmt er ein Wollbäuschchen, benetzt es mit Öl und putzt die Klinge seines kostbaren Degens, den sein Vorfahr einst auf dem Schlachtfelde – die Tränen stürzen ihm aus den Augen; er ist ja erst achtzehn Jahre alt und liebt Isabellen. So zieht er den kostbaren Anzug an, die weißseidenen Strümpfe, die feinen weißen Schuhe, schnallt den Degen um – keine Wolke steht am Himmel, die Landstraße ist nicht staubig; so kann er es versuchen, in die Stadt zu gehen. Wie er durchs Tor gegangen ist, nimmt er sich einen Wagen, denn innerhalb der Mauern kostet die Fahrt immer nur drei Bajocchi, und einen Bajocco gibt man Trinkgeld. Vor Isabellens Haus hält der Wagen mit elegantem Ruck; aus allen Fenstern fahren Köpfe und bewundern das Gespann; stolz läßt der Kutscher die Pferde tänzeln, ruft dröhnend sein »danke, Eccellenza«, als er die vier Bajocchi erhält, wendet dann energisch und stiebt von dannen. Er hätte es für unwürdig gehalten, noch ein zweites Trinkgeld zu verlangen, so fein sah der Kavalier aus.
Nun steht der Kavalier vor der errötenden Isabelle, welche sich bemüht, ihre zerrissenen Morgenschuhe den Blicken des Liebhabers zu verbergen; ach, der Liebhaber sieht nur ihre Augen! Er greift in die Brusttasche, holt ein altes, schönes Lederkästchen mit geschmackvoller Goldverzierung vor, öffnet es, nimmt eine Kette aus Achatperlen in die Hand und erzählt die Geschichte dieser Kette.
Auf seinen großen Reisen, zu denen ihn Forschungstrieb und die Lust zu industriellen Unternehmungen veranlaßt hatten, war der Vater des Kavaliers auch in die Länder gekommen, welche im Herzen Afrikas liegen. Auf den uralten Handelsstraßen, wo seit Jahrtausenden bereits die materiellen und geistigen Güter der Menschheit von den Kaufleuten geschäftig von Land zu Land, von Volk zu Volk, von Rasse zu Rasse gebracht werden, hatte er die große Wüste Sahara durchkreuzt, auf feurigem Renner neben einer Karawane herreitend, mit diesem Degen bewaffnet, der noch heute an der Linken des Kavaliers blitzt oder vielmehr hängt. Unwillkürlich erschrickt Isabelle, als der Kavalier an diesen Degen schlägt. Da wurde ihm von einem uralten jüdischen Händler über die kostbaren Achatperlen erzählt, welche inmitten der Wüste gefunden werden. Vor undenklichen Zeiten, vor vielen, vielen tausend Jahren, muß die Wüste ein bewässertes und fruchtbares Land gewesen sein, von einem Volk bewohnt, das den Boden bebaute und eine große Stadt errichtete auf einem Hügel. Keine Kunde meldet, wann zuerst der Wind den Wüstensand mit sich brachte; in langen, langen Zeiten hat der Sand den fruchtbaren Boden überzogen, die Bäume zum Verwelken, die Flüsse und Ströme zum Austrocknen gebracht; die Menschen starben, die Hütten des Landvolkes fielen zusammen, die Städte verwandelten sich in Mauertrümmer. Aber der Sand, welchen der Wind in der Sahara vor sich treibt, ist so scharf, daß er allmählich, allmählich in den Jahrtausenden die Mauern abschliff, daß auch sie sich in Sand auflösten, und daß er dann den Hügel abschliff, weil der Wind ja alle Höhen gleichmachen will. In dem Hügel aber lagen in steinernen Gräbern die toten Könige jenes Volkes, das damals hier gelebt hatte, und jedem König hatte man eine Kette aus Achatperlen mitgegeben. Nun schliff in Jahrtausenden der Sand, vom Winde getrieben, den Hügel ab und kam auf die schweren steinernen Platten, welche die Gräber bedeckten, schliff in Jahrtausenden die Platten ab, bis sie ganz dünn wurden und endlich völlig verschwanden; da waren die Knochen der Toten schon längst vermodert, die Kleider, die Stiefel; alles Metall war verzehrt, das man ihnen mitgegeben; das Band war verschwunden, das die Achatperlen zusammengehalten hatte; nun lagen von allem nur noch die einzelnen Perlen da. Der Achat ist ein sehr harter Stein, er ist härter als die Mauern der Stadt und der Häuser, wie der Felsen des Hügels war und die steinerne Platte, welche die Gräber deckte; aber wie sie nun unzählige Jahre so offen dalagen und der Wind immer neuen Sand gegen sie antrieb, da wurden auch sie vom Sand angegriffen; die rotgeflammten Stellen sind eine Kleinigkeit weicher als die durchsichtigen und weißen, und so erscheinen diese nun in den alten Perlen vertieft.
Diese uralten Perlen werden von den Wüstenvölkern an jener Stelle, wo einst die Stadt sich erhob, eifrig gesucht, und eine einzelne schon hat bei ihnen einen ungeheuren Wert, daß man sich tausend Sklaven für sie kaufen kann. Welchen Wert aber werden diese Völker einer ganzen Kette solcher Perlen zuerkennen!
Eine solche Kette nun hatte des Kavaliers Vater dort erworben, in die Heimat mitgebracht, bei allen Schlägen des Schicksals sorgfältig aufbewahrt: jetzt überreicht sie der Kavalier mit einer vornehmen Verbeugung Isabellen, welche sich das klopfende Herz hält, damit es ihr nicht fortspringt in die Hände des Kavaliers.
Man wird nicht erstaunt sein, daß Isabelle einen jungen Mann von achtzehn Jahren – sie selber ist erst sechzehn – lieben muß, der ihr so wunderbare Perlen schenkt.
Lelio wütet, rast, schäumt. Und nachdem er tagelang im Theater erklärt hat, daß er von dem Kavalier Aufklärungen verlangen werde, bleibt ihm nichts weiter übrig, als zu dem Turm zu gehen, dieser halbverfallenen Stätte mittelalterlicher Barbarei, und nun wirklich Aufklärungen zu fordern. Er erzählt später selber den Vorgang. »Innerlich kochte ich, äußerlich war ich von der gewinnendsten Höflichkeit. Der Kavalier wurde blaß, als er mich erblickte. Ha! dachte ich, da habe ich meinen Triumph, und wurde noch höflicher. Er hatte ein Kaninchenpfeffer auf dem Herd; vor Angst, vor Angst! ladet er mich ein, es mit ihm zu teilen; ironisch lächelnd, aber dabei skrupulös die Form wahrend, entgegne ich, daß er mir eine große Ehre erweise; wir setzen uns und essen; er gießt ein, zitternd, ich sage: zitternd! wir trinken, ich hebe mein Glas auf sein Wohl; ich sehe, wie er immer unruhiger wird; armer Teufel! denke ich, ich habe meinen Triumph gehabt, ich verzeihe dir! Darauf biete ich ihm Brüderschaft an, und auf diese Weise gelingt es mir denn, ihn so zu beruhigen, daß er mich am Ende noch um einen Paolo angepumpt hat, weil er Isabellen Blumen schenken wollte.«
Das grüne Ungeheuer
Ein grünes Ungeheuer ist in das Land eingefallen und haust in einer Höhle. Der König muß ihm täglich zehn Jungfrauen schicken, die es verspeist, ungerupft und ungebraten. Wenn der König das nicht tut, dann verheert das Ungeheuer das ganze Land. Nun ist die Reihe auch an die Königstochter gekommen; sie soll mit ihren neun Kammerjungfern dem Ungeheuer gleichfalls zum Opfer gebracht werden. Aber in die jüngste Kammerjungfer ist Arlechin verliebt. Wenn ein mutiger Ritter das Ungeheuer zum Lachen bringt, dann ist es besiegt, wird in einen Käfig gesperrt und für Geld gezeigt. Viele tapfere Ritter haben schon versucht, das Ungeheuer zum Lachen zu bringen. Sie haben es an der Kehle gekitzelt, hinter den Ohren, unter den Achseln; sie haben ihm Gesichter geschnitten, Geschichten erzählt und sich auf den Kopf gestellt; sie haben sich verkleidet, haben ihm Juckpulver gestreut und haben Lieder dazu gesungen. Das Ungeheuer hat keine Miene bewegt, es hat nur, wenn sie mit ihrer Weisheit zu Ende waren, den Rachen aufgesperrt und sie hinuntergeschluckt, indem es dabei mit den Augen blinzelte. Arlechin gelingt es, das grüne Ungeheuer zum Lachen zu bringen; es lacht, daß ihm die dicken Tränen über die Backen kullern; dann geht es gutwillig in den Käfig, den schon der erste Ritter mitgebracht hatte, gähnt behaglich und wird an den Hof geführt, wo es dann den durchreisenden Fremden der besseren Stände für fünf Silbergroschen gezeigt wird.
Arlechins Frau hat kein Talent; sie muß denn solche Rollen spielen wie das grüne Ungeheuer; aber die spielt sie auch vorzüglich. Und Arlechin selber ist in dem Stück überhaupt einfach unübertrefflich. Die Vorstellung ist also gelungen, die ganze Stadt spricht von Arlechin und dem grünen Ungeheuer; zuerst spricht die erste Gesellschaft, dann die zweite Gesellschaft, dann die dritte Gesellschaft; endlich werden auch die Kinder neugierig, schicken eine Abordnung an den Bürgermeister und ersuchen, daß sie sich das Stück ansehen dürfen. Der Bürgermeister gewährt ihnen die Bitte, die Kinder sehen sich die Vorstellung an und sind begeisterter als alle drei Gesellschaften zusammen waren.
Aber nun kommt eine schwere Krankheit über die Kinder. Sie klagen über Halsschmerzen, legen sich ins Bett, haben Fieber; der Hals ist ihnen plötzlich wie zugeschnürt, sie können weder schlucken noch sprechen, kaum noch atmen; und die Ärzte sagen, daß manche Kinder sterben werden, welche die Krankheit befallen hat. Die armen Eltern weinen, geloben Wallfahrten und Kerzen, verändern ihren Lebenswandel; die Wut der Krankheit wird nicht gemildert.
Der kleine Sohn des Bürgermeisters winkt seinen Vater aus Bett. Dann nimmt er sein Schreibtäfelchen, denn er gehört zu den Schwerkranken, und schreibt darauf: Er weiß wohl, daß er schwer krank ist, wenn die Erwachsenen auch immer lächeln und ihm sagen, daß er morgen wieder werde mit seinem weißen Schaf spielen können. Aber wenn er denn nun sterben muß, so bittet er seine Eltern, daß sie ihm vorher noch einmal eine große Freude machen, nämlich er bittet, daß Arlechin und das grüne Ungeheuer zu ihm kommen, und daß Arlechin das grüne Ungeheuer zum Lachen bringt.
Der Bürgermeister bezwingt sich, daß ihm nicht die Tränen kommen; er lächelt und sagt, er wolle Arlechin bitten; dann geht er und kommt zu Arlechin.
Arlechin und seine Frau sitzen am Kleiderschrank und weinen. Der Kleiderschrank hat vor langen Seiten seine Türen verloren und dient nun als Lager für ihr krankes Kind; als Vorhang aber haben sie das Fell des grünen Ungeheuers aufgehängt, damit das Kind dunkel liegen kann, wenn es schlafen will. Der Bürgermeister weint mit ihnen, als er das kranke Kind sieht, dann bringt er seine Bitte vor. Die Mutter läuft schnell in die Nachbarschaft und ersucht Colombinen, solange bei dem Kind zu bleiben; dann holen sie den Arlechinanzug aus dem Brotkasten, hängen das Fell des grünen Ungeheuers ab und folgen dem Bürgermeister.
Arlechin hat seinen Sieg über das Ungeheuer durch seine Menschenkenntnis davongetragen. Wenn man einen Anderen zum Lachen bringen will, so muß man selbst ernsthaft bleiben. Er bleibt also ernsthaft und preist dem Ungeheuer einfach die Vorzüge der Tugend vor dem Laster. Das Ungeheuer wackelt mit dem Kopf, es bezwingt sich, es will nicht lachen; aber als endlich Arlechin in Tränen ausbricht und von der Seligkeit spricht, welche der arme, aber tugendhafte Schauspieler auf seiner Bühne genießt, indessen der lasterhafte Reiche sich auf seinem roten Plüschsessel langweilt, da öffnet das Ungeheuer seinen Rachen, hält sich den Bauch und lacht, bis ihm zuletzt die Tränen kommen.
Der Schn des Bürgermeisters lacht auch, er lacht immer angestrengter, sein Gesicht wird dunkelrot, Vater und Mutter stürzen hinzu, um ihn aufrechtzuerhalten; plötzlich macht er innerlich eine große Anstrengung, das Geschwür platzt, welches ihm in der Kehle saß, er schreit laut: »Das Ungeheuer weint ja«; dann sinkt er kraftlos zurück.
Der Arzt verordnet ihm noch ein leicht schweißtreibendes Mittel und verlangt vierzehn Tage lang strenge Bettruhe, dann steht er dafür, daß das Kind gerettet ist.
Der Bürgermeister drückte den beiden Komödianten selig die Hand und schüttelte sie kräftig, die Frau Bürgermeister sagte, sie müßten in das Eßzimmer gehen, und befahl, ihnen zu decken; aber in der allgemeinen Aufregung achteten die Dienstboten nicht auf sie. So gingen sie in die Stube, in welcher sie sich angekleidet hatten, zogen sich wieder um und packten Arlechintracht und Ungeheuerfell zusammen, dann liefen sie schnell nach Hause zu ihrem kranken Kind.
Colombine kam ihnen auf der Treppe entgegen. »Erschreckt nicht, es ist etwas eingeschlafen.« »Es ist tot!« schrie die Mutter und lief in die Stube; da lag der Kleine lang ausgestreckt, mit wächsernem Gesicht; Colombine hatte ihm die Augen zugedrückt.
Die verfallene Kirche
Es geschieht ja sehr selten, daß die Komödianten an die Zukunft oder an die Vergangenheit denken, denn wer die Begabung zu solchen Gedanken besitzt, der wird wahrscheinlich nicht Komödiant. Aber zuweilen geschieht es doch, daß einen Komödianten ein philosophischer Gedanke überkommt.
So ereignet es sich, daß eine Gesellschaft Komödianten auf dem Kapitol steht, auf der Treppe der Kirche St. Maria in Araceli und niederblickt auf das Forum, wo gerade Markttag ist und die Leute eifrig miteinander handeln, indem jeder es für richtig hält, daß er selber billig einkauft und teuer verkauft, und es nur nicht liebt, wenn die anderen ebenso denken.
Lelio macht eine Bemerkung über den Glanz des römischen Reiches, der nun verblichen ist, und schließt an diese Bemerkung die Überlegung, daß auch der Ruhm der Schauspieler nicht ewig währt, sondern wenn man stirbt, ja, schon wenn man nicht mehr auftritt, dann ist der Name von der undankbaren Welt vergessen. Auch ihm wird es so gehen.
Aber von dieser Überlegung, welche die Zukunft betrifft, wendet er sich schnell der Vergangenheit zu. Man kennt die alten Kaiser noch mit Namen, welche gegenüber auf dem Palatin gewohnt haben, man weiß noch von den Philosophen und Dichtern jener Zeiten. Und sollte es damals nicht auch Schauspieler gegeben haben? Von ihnen weiß niemand. Die Namen aller anderen Männer hat die Geschichte mit ehernem Griffel auf ihre Tafeln geschrieben; die Namen der Mimen schreibt ein Kind in fließendes Wasser.
Die übrigen Schauspieler erstaunen über diese Rede Lelios.
Der Doktor und der Apotheker weinen.
Der Doktor und der Apotheker sind zwei uralte Schauspieler, von denen es heißt, daß sie vor langen Jahren sehr beliebt gewesen sind, die aber keiner von den heutigen Komödianten auf der Bühne gesehen hat. Es wird erzählt, daß das Publikum sie zuletzt nicht mehr hat haben wollen. So leben sie denn nun bei der Truppe, indem sie sich sonst nützlich machen; sie klopfen den Fundus aus, damit nicht die Motten hineinkommen, sie kleben die Zettel an die Straßenecken, und sie repräsentieren die Truppe nach außen, denn der Direktor hat zu wenig Zeit, um den Repräsentationsverpflichtungen nachzukommen.
Alles schweigt also, denn niemand weiß auf die Worte Lelios etwas zu erwidern, und der Doktor und der Apotheker weinen. Sie weinen zuerst jeder allein, dann umarmen sie sich und weinen zusammen.
Nun beginnt aber der Dichter. Er sagt, daß die Nachwelt freilich dem Dichter holder gesinnt sei als dem Komödianten, vorausgesetzt in der heutigen Zeit, daß seine Werke gedruckt würden, was ja nicht jedem Dichter geschehe. Und freilich habe es auch zur Zeit, da die alten Kaiser noch herrschten, schon Komödianten gegeben, und von einem werde erzählt bei dem Philosophen Seneca, daß er so alt gewesen sei, daß ihn die Leute nicht mehr auf der Bühne haben sehen mögen; da sei er jeden Tag auf den Kapitolinischen Berg gestiegen, dorthin, wo sie jetzt stünden, und sei in den Tempel des Jupiter gegangen, der für die Heiden das gewesen sei, was Sankt Peter heute für uns Christen sei, und habe dem Jupiter vorgespielt.
Die Komödianten finden es sehr anständig von den alten Priestern, daß sie das erlaubt haben. Sie finden, daß unsere Religion ja die wahre ist, aber daß ein Komödiant doch auch seinen Glauben hat, und daß die Priester selber gern in die Komödie gehen, daß ein Kapuziner Sprachunterricht beim Kapitän genommen hat und später ein berühmter Prediger geworden ist, weil er beim Kapitän so viel gelernt hat, und daß es nicht nötig wäre, daß die Komödianten mit dem Bann belegt sind, denn schließlich will doch jeder leben. Der Doktor und der Apotheker horchen gespannt auf.
Der Apotheker beginnt zu erzählen. Jeder kennt ja seine Erzählung, denn er hat sie schon oft vorgebracht; aber man hört doch so zu, als sei sie neu, denn weshalb soll man nicht zuhören? Ihm macht es Freude, und er hört ja auch zu, wenn man ihm etwas erzählt. Er erzählt also, wie Lelio in Isabellen verliebt ist, welche die Tochter des Doktors ist, und in Silvien, welche seine Tochter ist, und wie Lelio zum Doktor geht, damit ihm der ein Rezept schreibe, weil er doch nur eine lieben kann, und wie er dann in die Apotheke kommt, um das Rezept machen zu lassen, und wie er, der Apotheker, sich vergißt, und ihm ein Abführmittel gibt, und wie das Publikum gelacht hat, als er Lelio das Mittel gibt. Es hat auch gelacht, wie der Doktor das Rezept schreibt, aber so wie bei ihm, dem Apotheker, hat es doch nicht gelacht.