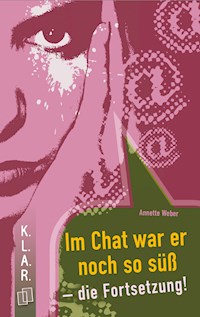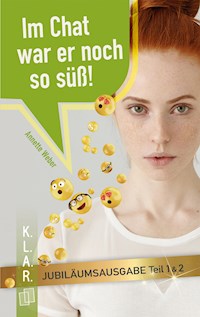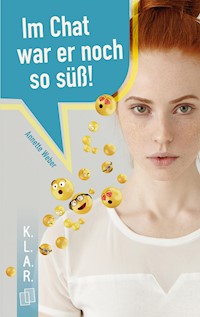Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Tradition und Neubeginn – das Erbe einer westfälischen Gutshof-Familie STÜRME EINER NEUEN ZEIT: 1922 im Mindener Land. Das Gestüt der Werdenbergs scheint dem Untergang geweiht: Einst weithin für seine prachtvollen Kaltblutpferde bekannt, droht nun der Verfall. Die einzige Hoffnung ruht auf Thekla, die als älteste Tochter den reichen Freiherren von Ellerbruch heiraten soll. Doch dafür müsste Thekla ihren Traum von einer Revolution der Pferdezucht aufgeben – und ihre Gefühle für einen anderen Mann … HOFFNUNG EINES NEUEN LEBENS: Auch Theklas beste Freundin Bettina, die Tochter des Stallmeisters, eckt mit ihren Talenten überall an: Eine respektable junge Frau kann unmöglich am Turniersport teilnehmen, entrüsten sich die Männer! Aber dann kommt Bettina eine gewagte Idee … Mutig muss auch Theklas jüngere Schwester Franzi sein, als sie in Hannover am Mädchenpensionat St. Ursula einen Neuanfang sucht – doch die Vergangenheit holt sie bald wieder ein … Die ersten zwei Romane der großen deutschen Familiensaga exklusiv in einem Band – für alle Fans von Maria Nikolai und Ulrike Renk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
STÜRME EINER NEUEN ZEIT: 1922 im Mindener Land. Das Gestüt der Werdenbergs scheint dem Untergang geweiht: Einst weithin für seine prachtvollen Kaltblutpferde bekannt, droht nun der Verfall. Die einzige Hoffnung ruht auf Thekla, die als älteste Tochter den reichen Freiherren von Ellerbruch heiraten soll. Doch dafür müsste Thekla ihren Traum von einer Revolution der Pferdezucht aufgeben – und ihre Gefühle für einen anderen Mann …
HOFFNUNG EINES NEUEN LEBENS: Auch Theklas beste Freundin Bettina, die Tochter des Stallmeisters, eckt mit ihren Talenten überall an: Eine respektable junge Frau kann unmöglich am Turniersport teilnehmen, entrüsten sich die Männer! Aber dann kommt Bettina eine gewagte Idee … Mutig muss auch Theklas jüngere Schwester Franzi sein, als sie in Hannover am Mädchenpensionat St. Ursula einen Neuanfang sucht – doch die Vergangenheit holt sie bald wieder ein …
Über die Autorin:
Annette Weber, 1956 in Lemgo geboren, schreibt seit über 20 Jahren Romane, in die sie stets ihre Begeisterung für Pferde einfließen lässt. Annette Weber ist verheiratet, hat drei Söhne, fünf Enkelkinder und lebt in der Nähe von Paderborn. Die Autorin im Internet: www.annette-weber.com/ und www.sina-trelde.de In ihrer Familiensaga um »Gut Werdenberg« veröffentlichte Annette Weber bei dotbooks auch den Roman »Der Glanz eines neuen Morgens«.
Auch bei dotbooks erscheint ihre »Verliebt auf der Isle of Wight«-Reihe mit den Romanen »Das Cottage in Seagrove Bay«, »Die Teestube in Freshwater Bay«, »Der Inselhof in Woodside Bay« und »Der Schmuckladen in Whitecliff Bay«; die ersten beiden Bände sind auch als Hörbücher bei Saga Egmont erhältlich.
***
Sammelband-Originalausgabe Dezember 2024
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgaben der Einzelbände 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98952-726-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annette Weber
Gut WerdenbergStürme einer neuen Zeit & Hoffnung eines neuen Lebens
Zwei Romane in einem Band
dotbooks.
Gut Werdenberg – Stürme einer neuen Zeit
Das Mindener Land, 1922. Die schweren Kriegsjahre sind vorüber, Hoffnung liegt in der Luft – dennoch scheint das Gestüt der Werdenbergs dem Untergang geweiht: Einst glanzvoll und weithin für seine Kaltblutpferde bekannt, droht nun der Verfall. Die einzige Hoffnung ruht auf Thekla, die als älteste Tochter den Freiherren Hagen von Ellerbruch heiraten soll. Doch dafür müsste Thekla alles aufgeben, was sie liebt: die langen Ausritte voller Freiheit, ihren Traum von einer eigenen Pferdezucht und einem selbstbestimmten Leben. Ihr Vater und Hagen scheinen in der Starre alter Konventionen gefangen, für sie ist unvorstellbar, dass Thekla den Pferdesport für immer revolutionieren könnte. Einzig in dem jungen Hofschmied Robert findet Thekla Unterstützung – aber die Geheimnisse und Intrigen ihrer Familie treiben sie schon bald auseinander …
Für Susannedie Familiensagas genauso liebtwie das Mindener Land
Mindener Tageblatt, 1922
Welch hartes Schicksal ereilt unsere Kavalleriepferde doch in der heutigen Zeit. Es ist noch nicht lange her, da trugen sie unsere Soldaten auf ihrem Rücken in den Krieg, sie zogen die Kanonen und das Rüstzeug, und sie kämpften Seite an Seite mit den Männern für unser Vaterland. Viele starben wie sie den Heldentod. Doch im Gegensatz zu den mutigen Soldaten setzte man ihnen kein ehrenvolles Denkmal. Im Gegenteil. Kaum war der Krieg zu Ende, rangierte man sie einfach aus. Unsere geliebten Pferde, die Freunde des Menschen, wurden durch Maschinen ersetzt. Viele starben auf dem Schlachthof und wurden zu Nahrungsmitteln verarbeitet.
Haben die großen Riesen das verdient? Ist es nicht Aufgabe von uns Menschen, uns auch um die Tiere zu kümmern, die uns in Notzeiten beiseitestanden?
Rudolf Brunner. Journalist
Kapitel 1
Widerstrebend musste Thekla sich eingestehen, dass sie und ihre Freundin Bettina den Weg für ihren Ausritt diesmal zu weit gewählt hatten. Nebel breitete sich über den Wiesen aus, und schon bald würde das Tageslicht der herannahenden Dämmerung weichen. Sie mussten umkehren, bevor es schwierig wurde, den richtigen Weg zu finden.
Es war Theklas Schuld, dass sie so lange unterwegs gewesen waren. Sie hatte so viel auf dem Herzen gehabt, dass die Zeit für den üblichen Ausritt bis zur Weser und am Fluss entlang bis zur großen Weserschleife nicht ausgereicht hatte, sich alles von der Seele zu reden. So waren sie über die hölzerne Brücke bis zu den kleinen Dörfern geritten, die sich am Fuße von Burg Stolzenau erstreckten und schon zur benachbarten Provinz gehörten.
»Lass uns umkehren«, sagte Bettina endlich, wohl wissend, dass sie Thekla damit zwang, sich dem Schicksal zu stellen, das sie zu Hause erwartete.
Thekla seufzte ergeben, und sie wendeten ihre Pferde Athena und Fallada, die erleichtert über die Einsicht ihrer Reiterinnen wirkten. Sie hatten am Tag zuvor schon ein längeres Springtraining absolviert und waren immer noch erschöpft davon. Statt eines längeren Ausrittes hätten sie heute wahrscheinlich gerne einen ruhigen Tag auf der Weide genossen. Nun, war Thekla sicher, hofften sie auf einen großen Berg duftenden Heus und einen warmen Schlafplatz im Stall.
Vom Kirchturm her schlug eine Uhr siebenmal. Thekla schaute sich zu ihrer Freundin um, die sie nachdenklich betrachtete.
»Jetzt müsste er angekommen sein, oder?«
Bettina zuckte die Schultern. »Wenn der Zug pünktlich ist«, antwortete sie.
Thekla wusste nur zu gut, dass der Zug nur selten Verspätung hatte. Vor allem aber würde es sich der Vater nicht nehmen lassen, den Gast ganz persönlich mit der Kutsche abzuholen. Schon seit einigen Tagen redeten ihre Eltern über nichts anderes als über diesen ach so wichtigen Gast. Er hieß Hagen von Ellerbruch. Freiherr Hagen von Ellerbruch, um genau zu sein! Er war der Sohn eines Freundes des Vaters und kam aus Hannover. Für mehrere Wochen würde er auf ihrem Gut zu Besuch sein, angeblich um sich in die Kunst der Pferdezucht einzuarbeiten. Bei der Aufregung, die ihre Eltern versprühten, ahnte Thekla, dass dieser Mann mehr war als nur ein gern gesehener Gast. Es stand nicht gut um das Gestüt der Werdenbergs, und Thekla vermutete, dass der Vater sich Rat und Hilfe, vielleicht sogar eine wirtschaftliche Unterstützung von dem Sohn des Freundes erhoffte.
Freiherr! Thekla hatte sich aufgeregt, als ihr Vater diesen Titel nur erwähnte. Der Adel war abgeschafft, ob es dem Vater nun passte oder nicht. All die Fürsten und Grafen, die Königinnen und Freifrauen gehörten nun zu den gewöhnlichen Menschen, auf die sie stets hinuntergeschaut hatten. Junkerland in Bauernhand, hieß es jetzt. Doch wenn Thekla ihren Vater daran erinnerte, wies er sie zurecht, sie solle keine kommunistischen Parolen schwingen.
Der Vater hatte in Sachen Politik immer einen Spagat gemacht. Einerseits hatte er oft genug verlauten lassen, dass er den Kaiser für einen Lumpen hielt, der für den Krieg verantwortlich war, andererseits aber gehörte gerade der Vater zu den Menschen, die mit dem Krieg gutes Geld verdient hatten. Er hatte Pferde für die Kavallerie geliefert und damit auch noch erreicht, dass er zu Hause unersetzbar wurde und nicht eingezogen wurde. Doch wenn es hart auf hart kam, schwärmte er von den alten Zeiten und ließ sich zu gerne Graf von Werdenberg nennen, ob der Titel nun abgeschafft war oder nicht. Hagen von Ellerbruch blieb für ihn ebenfalls ein Freiherr, das ließ er sich nicht nehmen.
Nach den Worten des Vaters war Hagen ein gutaussehender junger Mann, sehr gebildet, höflich, mit guten Manieren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Hannover, um eines Tages das Gut seiner Eltern unter modernen wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten zu können. Thekla konnte sich nur dunkel an ihn erinnern. Er war einige Male mit seinen Eltern und seinen Geschwistern am Hof zu Gast gewesen, als sie noch ein Kind war. Sie hatte damals mit seiner Schwester gespielt und sich auch um seinen kleinen Bruder gekümmert. Hagen hatte auf sie einen hochnäsigen Eindruck gemacht. Er hatte es abgelehnt, mit ihnen durch das Dorf zu ziehen, stattdessen hatte er zwischen den Erwachsenen gesessen und sich hin und wieder an ihren Gesprächen beteiligt wie ein junger Gutsherr. Thekla hatte ihn damals schon eingebildet und herablassend gefunden.
Dass die Eltern nun so aus dem Häuschen waren, weil er für einige Wochen zu Besuch kam, ärgerte sie. Sie taten so, als wenn der Kaiser persönlich sie beehrte. Dabei waren die Ellerbruchs genau wie sie Gutsherren, nur dass sie sich auf das Züchten von Rindern und Milchkühen und nicht auf Pferde verstanden. Damit stand das Gut der Ellerbruchs allerdings nach dem Krieg wirtschaftlich besser da als Theklas Familie, denn bei der einsetzenden Hungersnot war Fleisch immer ein gutes Kapital, während die schweren Kaltblutpferde der Werdenbergs derzeit nicht besonders gefragt waren. In den Sportpferden dagegen, die sie im Moment nur zu privaten Zwecken züchteten, lag die Zukunft, da waren sich Bettina und Thekla einig.
Sie seufzte leise.
»Mich ärgert es, dass sie so einen Wirbel um Hagen machen«, platzte sie heraus. »Mutter hat sogar das große Gästezimmer für ihn einrichten lassen, damit es der feine Herr so heimelig wie möglich hat.« Sie verdrehte die Augen. »Das Zimmer mit Balkon und großen Fenstern nach Osten und Westen. So wacht er schon morgens mit der Sonne im Gesicht auf, und abends kann er den Sonnenuntergang sehen.«
Thekla machte wilde Handbewegungen nach links und rechts, sodass Athena einen Moment irritiert stehen blieb, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. Schnell nahm Thekla die Zügel wieder auf und trieb ihr Pferd erneut an.
»Ach Thekla, sei doch nicht so ängstlich«, lachte die Freundin. »Vielleicht ist er doch ganz nett, dieser Hagen. Und vielleicht kommt er doch wirklich nur, um sich eure schönen Pferde anzuschauen und eines für sich auszuwählen.«
Thekla runzelte die Stirn. Sie wünschte sich, ihre Freundin hätte recht und Hagen beabsichtigte tatsächlich, sich ein schönes Pferd zu kaufen. Dann aber fragte sie sich, warum ihr Vater ihm so viel Interesse entgegenbrachte. Und warum sie und ihre Schwester an diesem Abend schön gekleidet zum Abendessen erscheinen mussten und nach dem Abendessen ein Menuett am Klavier vortragen sollten. Das alles roch viel zu sehr nach ersten Verbindungen, die über das normale freundschaftliche Kennenlernen hinausgingen.
Sie ahnte bereits voller Unmut, was der Vater plante. Schon so oft hatte er betont, wie gut es sei, wenn sich landwirtschaftliche Anwesen zu einer großen Landwirtschaft zusammenschlossen. So war das Gut finanziell abgesichert und hatte gleichzeitig neue Möglichkeiten, dringende Modernisierungen durchzuführen. Insofern würde eine Heirat mit Hagen sicherlich dem Gestüt der Werdenbergs helfen, aus den roten Zahlen zu kommen. Schließlich schreckte ja auch Thekla der Gedanke ab, von einem fremden Verwalter abhängig zu sein.
Aber da war noch ein ganz anderer Gedanke – einer, der nach Freiheit und Unabhängigkeit verlangte. Ihr ganz persönlicher Traum war es, das Gut eines Tages allein zu übernehmen. Sie kannte sich so gut mit Pferden aus, war mittlerweile sogar ihrem Vater in der Pferdeerziehung überlegen. In diesem Jahr wollte sie ihn daher endlich überreden, sie auch in die Gestütsverwaltung einzuführen. Dann könnte sie das Gut in die Richtung entwickeln, die sie für zukunftsweisend hielt.
Lange hatte sie ihren Vater bedrängt, bis er sich bereit erklärt hatte, ihr das Gut zu überschreiben, da es keinen männlichen Nachfolger gab. Er hatte sich allerdings eine Hintertür offengehalten. Sein sehnlichster Wunsch nämlich war, dass Thekla einen Ehepartner finden würde, der die Leitung des Gestüts mit ihr gemeinsam übernahm. Und nun hatte er Hagen ins Spiel gebracht. Vielleicht wäre der Freiherr von Ellerbruch tatsächlich ein liebenswerter Ehe- und Geschäftspartner – vielleicht würde er das Gestüt in der Weise führen, wie es auch in Theklas Sinne wäre. Vielleicht, vielleicht. Aber wenn Thekla ehrlich war, wollte sie unabhängig sein. Sie brauchte für die Arbeit auf dem Gestüt keinen Ehemann. Sie hatte ausreichend großartige Hilfe in Bettina und ihrem Vater Lorenz von Wallmeyer, dem Stallmeister.
»Freu dich erst mal auf den Abend«, versuchte Bettina, ihre Freundin zu trösten. »Es gibt ein gutes Essen, ihr plaudert nett …«
Nun wurde Theklas Seufzen noch tiefer. »Du hast es viel besser als ich«, sagte sie. »Du kannst den ganzen Abend in Reitsachen herumlaufen, den Stallburschen beim Füttern helfen, Fallada und Athena Gute Nacht sagen …«
»Und du lernst vielleicht einen interessanten Mann kennen, der sich in dich verliebt, und eh du dich’s versiehst, bist du Freifrau Thekla von Ellerbruch, und ich muss einen Knicks machen, wenn ich mit dir rede!«, wandte Bettina ein.
»Oh, bitte hör auf damit!«, rief Thekla heftig. »Ich will keinen Ehemann, der mir Vorschriften macht. Es lohnt sich sowieso nicht mehr, einen Freiherrn zu heiraten. Einen Knicks macht bei mir niemand mehr.«
Sie lachte, brach aber ab, als sie die traurigen Blicke der Freundin auf sich ruhen sah. Sie wusste genau, dass Bettina sie darum beneidete, den Sohn des Gutsbesitzers kennenlernen zu dürfen, der als charmant und gutaussehend beschrieben wurde. Ihre Freundin machte sich keine Hoffnungen, dass sich so ein Mann für sie interessierte. Sie war seit ihrem vierten Lebensjahr an Polio erkrankt, was eine Gehbehinderung zur Folge hatte. Obwohl es ihrem Vater durch eine gezielte Gymnastik gelungen war, eine schlimmere Lähmung zu verhindern, hatte sich die Muskulatur des linken Beines nicht entwickelt, sodass sie ihr Bein nachzog und nicht sehr lange ohne Gehhilfe laufen konnte. Bettina redete nicht viel darüber, aber Thekla wusste genau, wie traurig ihre Freundin über diese Behinderung war und wie wenig Chancen sie sich auf einen Ehemann und eine Familie ausrechnete. Dabei waren in Theklas Augen die Zeiten längst vorbei, in denen die Frauen einen Ehemann brauchten. In den Städten lebten sie bereits den Traum vom selbstbestimmten Leben, in dem die Frau unverheiratet und frei war, sogar arbeitete. Es würde eine Weile dauern, bis dieses Weltbild sich in einem Dorf wie Ilvese durchsetzte, aber die Grundsteine waren gelegt, davon war Thekla fest überzeugt.
Bettina konnte so großartig mit Pferden umgehen – da machte sie allen Männern etwas vor. Das Reiten hatte ihr geholfen, einen schlimmeren Verlauf der Krankheit zu verhindern, und hatte ihr gleichzeitig auch eine große Freiheit ermöglicht. Um diese Unabhängigkeit beneidete Thekla ihre Freundin. Sie wurde nicht bedrängt, irgendeinen ehemaligen Adeligen heiraten zu müssen, damit der Vater sein Gut erweitern und seine wirtschaftlichen Belange verbessern konnte. Außerdem wurde sie nicht auf das Gut eines anderen geschickt, musste sich nicht von den Pferden trennen, konnte einfach immer da bleiben, wo sie am liebsten war, auf dem Gestüt der Werdenbergs zwischen Stall, Reitplatz und Pferden.
Schweigend ritt Thekla weiter. Auch Bettina an ihrer Seite war still geworden. Sie wirkte müde und ein bisschen traurig.
Als ein kleiner Dorfweiher in Sicht kam, parierte Thekla ihr Pferd durch. »Wo sind wir?«, fragte sie verwundert.
Die kleinen Lehmhäuser rund um den See waren ihr nicht vertraut. Es gab nur eine Erklärung dafür: Sie mussten in dem Wäldchen hinter ihnen an einer Kreuzung in die falsche Richtung abgebogen sein.
Sorgenvoll betrachtete Thekla die kleine Straße, die zum Dorf hinunterführte. »Es könnte das kleine Angerdorf sein, aus dem Margot stammt«, überlegte sie.
Die Köchin Margot hatte Thekla früher öfter mal mitgenommen, wenn sie an ihren freien Tagen ihre Eltern besucht hatte, aber das lag lange zurück.
»Wenn wir erst hier sind, haben wir noch einen anstrengenden und langen Rückweg vor uns«, bemerkte Bettina.
Bekümmert strich Thekla ihrer Stute über den Hals. Das Pferd wirkte schon jetzt müde und verschwitzt.
Sie ritten durch die Dorfstraße, und einige Kinder liefen mit ihnen mit. Frauen auf Pferden in Männerhosen und Herrensätteln schienen sie hier noch nicht gesehen zu haben. Es gab aber auch Dorfbewohner, die Thekla als Tochter des gnädigen Herrn erkannten und sich höflich verbeugten. »Komtess«, sagten einige sogar, oder auch »Prinzessin«.
Thekla grüßte freundlich zurück und ließ sich nicht anmerken, mit wie viel Sorge sie an den Rückweg dachte.
Als sie über den steinigen Kirchplatz ritten, bemerkte Thekla das seltsame Geräusch, das von Falladas Hufen ausging. Ein Scheppern, ein leises Klackern – auch das noch! Ein Hufeisen schien sich gelöst zu haben.
»Halt an!«, rief Thekla.
Bettina schien den schleppenden Gang ihres Pferdes ebenfalls bemerkt zu haben, sie parierte Fallada durch. Thekla stieg aus dem Sattel, reichte ihrer Freundin Athenas Zügel, damit das Pferd nicht weglaufen konnte, und ging um Fallada herum, um sich die Hufe genauer anzuschauen. Da Bettina Schwierigkeiten hatte, aus dem Sattel zu steigen, verlagerte sie ihr Gewicht so, dass Thekla Falladas Bein anfassen und den Huf heben konnte. Mit kritischen Blicken betrachtete sie ihn. Es war genau das geschehen, was sie befürchtet hatte, das Hufeisen des rechten Hufes hatte sich gelockert. Ein Nagel fehlte, ein weiterer schaute zur Hälfte aus dem Eisen heraus und hatte bereits den Rand des Hufes beschädigt.
Ein älterer Mann, der mit einem Handwagen unterwegs war und nun auf gleicher Höhe mit ihnen, hielt an und betrachtete den Huf ebenfalls kritisch.
»Damit sollten Sie besser nicht weiterreiten, gnädiges Fräulein«, riet er. »Oder haben Sie es nicht mehr weit?«
»Doch, leider müssen wir noch eine längere Strecke reiten«, erwiderte Thekla unglücklich und setzte Falladas Huf behutsam wieder auf dem Pflaster ab.
»Dann empfehle ich Ihnen, unseren Hufschmied aufzusuchen«, rief der Mann. »Er ist ein guter Hufschmied. Seine Schmiede ist gleich unten am Dorfteich.«
Bettina und Thekla tauschten einen kummervollen Blick. Die Schmiede am Dorfteich hatten sie bereits hinter sich gelassen. Jetzt hieß es, noch mal ein kleines Stück zurückzureiten und den Hufschmied zu bitten, das Pferd neu zu beschlagen. Auch das würde Zeit kosten. Dazu der lange Rückweg. Bis sie wieder am Gut ankamen, würde noch eine ganze Weile verstreichen.
Thekla straffte sich. Letztendlich konnte ihr das nur recht sein. Nun hatte sie wenigstens eine gute Ausrede dafür, ihren Gast nicht unterhalten zu müssen.
***
»Vater? Ist dir kalt?«
Ratlos betrachtete Robert seinen alten Vater, der unter einem Berg an Decken auf dem schmalen Bett im Wohnzimmer der Schmiede lag. Es war nicht zu übersehen, dass es dem Vater an diesem Tag schlechter ging als am Tag zuvor, dass es sowieso von Tag zu Tag mit seinem Gesundheitszustand bergab ging. Der Vater antwortete nicht, kroch nur tiefer unter die Decke und schlug klappernd die Zähne aufeinander.
Robert seufzte leise. Es war ein milder Sommerabend, die Luft hatte sich endlich ein wenig abgekühlt, und der Wind wehte eine sanfte Brise über das flache Land. Im Zimmer der Schmiede hatte Robert die frische Luft ausgesperrt, um die Wärme des Tages für seinen Vater zu speichern. Doch das schien nicht mehr auszureichen.
Langsam ging Robert zum Kamin, legte Brennholz und Sägespäne hinein und entfachte das Feuer. Nun wurde die Luft so warm, dass Robert der Schweiß auf die Stirn trat. Doch dem Vater schien die Hitze gutzutun. Seufzend streckte er sich unter der Decke aus, und kurze Zeit später verrieten leise Atemzüge, dass er eingeschlafen war.
Gerade als Robert beschloss, frisches Wasser aus dem Brunnen zu pumpen und für den Vater bereitzustellen, klopfte es an der Tür, zaghaft zunächst, dann etwas lauter.
Mit schnellen Schritten durchquerte Robert das Zimmer und öffnete die Tür. Eine junge Frau stand vor ihm. Sie hatte blondes lockiges Haar, das ihr in einem Kurzhaarschnitt bis zum Kinn ging. Außerdem war sie mit einer Bluse, einer Reithose und Stiefeln bekleidet. Fremd und ungewöhnlich sah sie aus. In der Kleidung ähnelte sie einem Mann, ihr Gesicht allerdings trug weiche feine Züge.
»Guten Abend«, sagte sie mit fester Stimme und machte eine kleine Verbeugung in seine Richtung. Robert erwiderte sie mit kurzem Kopfnicken.
»Wir brauchen einen Hufschmied«, erklärte die junge Frau nun.
Wieder nickte er. »Der bin ich.« Und nun lächelte er und verbeugte sich leicht. »Robert Steinfels.«
Sie stellte sich nicht vor, machte dagegen eine Armbewegung hinter sich. Robert öffnete nun die Tür weiter und erkannte eine andere Frau, die auf einem Pferd saß und ein zweites Pferd an den Zügeln festhielt. Er betrachtete die beiden Frauen respektvoll. Sie sahen so gegensätzlich aus wie Schneeweißchen und Rosenrot, die eine mit blonden Locken bis zum Kinn, die andere mit einem schwarzen Bubikopf. Genauso unterschiedlich wie die beiden waren auch ihre Pferde. Die Blonde hatte eine weiße Stute, die andere einen schwarzen Wallach. Schöne Pferde waren es, das sah Robert sofort. Und auch, dass die Frauen wohlhabend waren. Ihre Kleidung war aus teurem Tuch genäht, die Lederstiefel gut verarbeitet, sie hatten sicherlich ein kleines Vermögen gekostet.
Robert hatte bis jetzt nur Frauen mit Hosenröcken gesehen, mit denen sie im Damensattel manchmal bei einer Jagd mitritten oder einen Spazierritt unternahmen. Diese beiden aber trugen Breeches, Kniebundhosen, die am Oberschenkel weit gearbeitet waren und am Knie eng geschnürt wurden.
»Eins unserer Pferde hat sich ein Hufeisen abgetreten«, erklärte nun die junge Frau. »Zwei Nägel sind noch drin, einer fehlt, und der vierte hängt ein Stück heraus. Der Nagel hat bereits den Huf an den Seiten verletzt.«
»Ich komme«, sagte Robert.
Er drehte sich noch einmal kurz zu seinem Vater um, dessen spitze Nase weiß unter dem Deckenberg herausragte. Er schien immer noch zu schlafen. Dann griff Robert nach der braunen schweren Lederschürze, in der sich sein Arbeitswerkzeug und die Nägel befanden, und stülpte sie sich über den Kopf. Anschließend trat er ins Freie und schloss die Haustür sorgsam. Die blonde Frau ging nun zu der anderen, nahm ihr das Pferd ab und reichte Robert die Zügel.
»Können Sie das bitte halten?«, sagte sie. »Ich muss meiner Freundin aus dem Sattel helfen.«
Robert war einen Moment zu überrascht, um seine Hilfe anzubieten. Dann aber sah er, dass sie gut ohne ihn zurechtkamen. Sie schienen ein eingespieltes Gespann zu sein. Die Frau, die mit ihm gesprochen hatte, ging um das Pferd der anderen herum, zog ihren Fuß aus dem Steigbügel und hob ihn an. Die dunkelhaarige Frau schaffte es, das Bein auf die andere Seite zu ziehen. Sie kam mit dem rechten Bein im Steigbügel zum Stehen, setzte sich seitlich auf den Sattel, zog auch den anderen Fuß aus dem Steigbügel und ließ sich vorsichtig an der Seite des Pferdes hinuntergleiten. Ihre Freundin war nun wieder bei ihr und achtete darauf, dass sie heil und vorsichtig landete.
»Verraten Sie mir Ihre Namen?«, fragte Robert höflich lächelnd.
Die Frauen erwiderten es, und während die Schwarzhaarige langsam zur Wand der Schmiede hinüberging, um sich dort an einem Pfeiler abzustützen, stellte die andere Frau sie vor.
»Das ist Bettina von Wallmeyer, und mein Name ist Thekla von Werdenberg.«
Robert hatte es fast geahnt. Der Graf von Werdenberg war im Angerdorf ein Begriff. Er leitete das große Gestüt jenseits der Weser, was erklärte, warum die jungen Frauen derartig edle und schöne Pferde hatten. Auch der Vater des anderen Fräuleins, Stallmeister Lorenz von Wallmeyer, war Robert bekannt. Er hatte seine Pferde schon einige Male von Robert beschlagen lassen.
»Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen«, erwiderte Robert nun, und jetzt verbeugte er sich ein bisschen tiefer. »Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Ein Wasser oder …«
Er schwieg, denn mehr als ein Wasser fiel ihm nicht ein.
Bettina von Wallmeyer nickte ihm zu. »Das wäre zu nett«, sagte sie.
Robert zeigte nun auf die Bank, die sich an der Hauswand befand. »Möchten Sie hier so lange Platz nehmen?«, schlug er ihnen vor. »Ich könnte Sie auch hereinbitten, aber mein Vater ist sehr krank, und im Moment …«
»Wir setzen uns gerne auf die Bank, wenn Sie gestatten, Ihnen bei der Arbeit zuzuschauen«, erwiderte Thekla, und dann reichte sie der anderen die Hand, um sie zu der Bank zu begleiten. Robert bemerkte, dass Bettina das Bein nachzog und einen langsamen und schleppenden Gang hatte. Als ihm aber auffiel, dass es ihr unangenehm war, so von ihm angestarrt zu werden, wandte er sich verlegen ab, um das Feuer der Schmiede mit dem Blasebalg neu zu entfachen.
»Selbstverständlich können Sie mir gerne zuschauen«, sagte er und fuhr sich durch die kurzen Haare. »Das wird mich dazu anhalten, mich besonders anzustrengen.«
Er lächelte, und die jungen Frauen erwiderten sein Lachen.
Robert legte nun einen Metallhaken in die Glut und ließ ihn heiß werden. Nachdem er die Vorkehrungen getroffen hatte, ging er zum Haus hinüber, füllte den Krug mit frischem Wasser und holte zwei Gläser aus der Küche. Ein kurzer Blick auf seinen Vater zeigte ihm, dass der immer noch in tiefem Schlaf lag.
Er reichte den beiden Frauen das Wasser, führte danach die beiden Pferde zur Anbindestange der Schmiede hinüber. Sofort fiel ihm das klackernde Geräusch des Hufeisens auf, das sich gelöst hatte. Ruhig stellte er sich mit dem Rücken zum Hinterteil des schwarzen Wallachs, bückte sich und hob den Huf des Pferdes, um ihn zwischen seine Beine zu klemmen. Das Hufeisen hing inzwischen nur noch an einem Nagel, ein herausgebrochener Nagel hatte den Rand des Hufes leicht beschädigt. Routiniert griff Robert zur Zange, löste die Nägel und das Hufeisen. Dann klemmte er das Hufeisen ein, um es kritisch zu betrachten.
»Das kann ich noch einmal verwenden«, rief er den beiden Frauen zu, die ihn aufmerksam beobachteten. Er sah ihnen an, dass sie sich freuten, denn sie wussten sicherlich, dass die Arbeit schneller gehen würde, wenn er nicht erst ein neues schmieden musste. Er setzte den Huf des Pferdes ab, legte dann das Eisen in die Glut und ließ es heiß werden. In der Zwischenzeit kehrte er zu den Pferden zurück und strich ihnen liebevoll über den Hals.
»Hannoveraner, nicht wahr?«
Thekla nickte. »Wir züchten sie«, sagte sie, und in ihrer Stimme klang Stolz mit. »Allerdings erst in erster Generation und bis jetzt nur für den Hausgebrauch. Eigentlich waren schwere Pferde für die Kavallerie unser Kapital.«
»Wenn Sie mir eine Meinung gestatten, aber Sie sollten mit der Züchtung dieser schönen Pferde fortfahren«, wagte Robert sich vor.
»Das sehe ich genauso«, rief Thekla erfreut.
»Die Zeit der Kriegspferde ist ja Gott sei Dank vorbei«, fuhr er fort. »Wenn man bedenkt, wie viele Pferde im Krieg gestorben sind. Über sie redet niemand. Sie waren nur Material.« Seine Züge wurden weicher, und er betrachtete die Pferde aufmerksam. »Die beiden Hannoveraner sehen anmutig und edel aus.«
»Und sie sind dazu noch klug und lernwillig«, ergänzte Bettina.
Robert nickte respektvoll, schaute dann zu den beiden Frauen. Ihre Kenntnisse über die Pferde und das Reiten beeindruckten ihn.
Ganz zufällig glitt sein Blick zum Fenster des Wohnhauses hinüber. Dabei erschrak er fast zu Tode. Hinter der Fensterscheibe war ein Gesicht aufgetaucht – bleich und mit weit aufgerissenen Augen. Der Vater! Wie ein Geist sah er aus. Aber wie war das möglich? Er hatte die ganze Zeit über heiß und fieberkrank im Bett gelegen.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick!«, rief Robert den Frauen zu. Dann lief er zum Wohnhaus hinüber und riss die Haustür auf. Immer noch stand der Vater wie versteinert am Fenster und starrte zur Schmiede.
»Vater? Was machst du denn da?«, rief Robert besorgt. Mit einem Satz war er bei seinem Vater und berührte seinen Arm. Der Vater drehte sich nur langsam zu ihm um.
»Wer sind diese Frauen?«, fragte er mit schleppender Stimme.
»Zwei Reiterinnen. Eines ihrer Pferde hat ein Hufeisen verloren«, erklärte Robert.
»Hufeisen verloren«, murmelte der Vater wie in Trance.
Robert war dieses Verhalten mehr als unheimlich. Vorsichtig legte er seinen Arm um die schmalen Schultern des Vaters.
»Komm, leg dich wieder hin!«, sagte er. »Du musst dich ausruhen.«
Der Vater protestierte nicht. Sanft führte Robert ihn zu seinem Bett zurück und deckte ihn wieder zu. Der Vater murmelte vor sich hin, dann schloss er die Augen erneut und atmete leise.
Auf Zehenspitzen verließ Robert den Raum wieder.
Das Eisen war in der Zwischenzeit heiß geworden. Mit geübten Hammerschlägen brachte Robert es in Form. Dann nahm er es mit der Zange auf, ging damit zu dem schwarzen Wallach und klemmte sich den Huf des Pferdes zwischen die Beine. Ruhig, aber zügig brannte er es in das Horn des Pferdes. Schwarzer, unangenehm riechender Dampf stieg auf und hüllte den Hufschmied für kurze Zeit ein. Der wartete kurz, schlug dann vier neue Nägel in das Hufeisen, drei geübte Hammerschläge pro Nagel. Anschließend kniff er die Nägel an der Stelle ab, an der sie aus der Hufwand heraustraten. Vorsichtig setzte er das Bein des Pferdes ab. Die Arbeit war geschafft. Das Pferd hatte dabei nicht mit der Wimper gezuckt. Es war gut erzogen.
Nun löste Robert es von der Anbindestange und ließ es neben sich hergehen, zunächst im Schritt, dann im Trab. Es trat gleichmäßig auf, ein Zeichen dafür, dass er seine Arbeit gut gemacht hatte. Zuletzt feilte er den beschädigten Huf an der Seite noch behutsam aus, dann war die Arbeit getan. Die beiden Frauen waren überglücklich.
»Wir haben noch nicht einmal Geld bei uns«, bekannte Thekla nun und sah ein wenig verlegen aus. »Aber wir werden morgen unseren Stallburschen zu Ihnen schicken und Sie ausreichend belohnen.«
Robert verbeugte sich noch einmal.
»Es war mir eine Ehre, Ihnen helfen zu können«, sagte er.
***
Mit lautem Pfeifen fuhr der Zug in den Bahnhof Gernheim ein. Hagen von Ellerbruch stand auf, verabschiedete sich von der reizenden älteren Dame und ihrer schönen Tochter, die mit ihm in einem Abteil gesessen hatten, öffnete das Fenster und ordnete einen Kofferträger an. Schon beim Blick auf den Bahnsteig konnte er erkennen, dass Werdenberg dort stand und auf ihn wartete. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, ihn persönlich abzuholen. Für Hagen war das ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm sein Besuch war. Kurz strich er sich noch einmal durch das Haar und rückte die Krawatte zurecht. Dann nahm er seinen Hut, grüßte noch einmal in die Runde und verließ das Abteil.
Die Kutsche der Werdenbergs wartete am Bahnhof. Es war eine stilvolle schwarze Kutsche mit dem goldenen Wappen der Werdenbergs, in dem zwei Pferdeköpfe davon zeugten, dass das Gestüt glanzvolle Zeiten gesehen hatte. Dahin, so ordnete Hagen an, hatte der Kofferträger das Gepäck zu bringen. Er selbst schritt auf Werdenberg zu und reichte ihm die Hand.
»Herr Graf«, sagte er höflich. Er wusste, dass Werdenberg es liebte, so angeredet zu werden. »Mein Vater lässt Sie herzlich grüßen. Wir sind alle erfreut, dass Sie mir die Gelegenheit bieten …«
»Papperlapapp!«, rief Werdenberg vergnügt. »Gute Freunde sollten Du zueinander sagen.« Er umarmte Hagen herzlich. »Willkommen in der Provinz. Wir freuen uns, dich bei uns zu haben.«
Er führte Hagen zu der Kutsche und wies den Kutscher an loszutraben. Hagen lehnte sich gegen das samtrote Polster und schaute aus dem Fenster.
Auch das Gut der Ellerbruchs lag abseits der Stadt in einem kleinen Dorf, und doch erschien es Hagen hier im Mindener Land deutlich rückständiger zu sein. Die Elektrizität hatte es bis hierhin noch nicht geschafft, und an den Brunnen im Dorf war Hochbetrieb, ein Zeichen dafür, dass nur wenige Häuser fließend Wasser besaßen. Hagen unterdrückte ein Seufzen. Er sehnte sich schon jetzt nach der Zivilisation zurück.
Das schöne große Gästezimmer und die freundliche Aufnahme durch Friedrichs Frau Sybille sowie das höfliche Benehmen der Hausmädchen stimmten Hagen dann aber doch zufrieden. Sehr angetan war er auch von der jüngsten Tochter des Hauses. Franziska war ein anmutiges Mädchen von angenehmem Wesen. Leider ließ die ältere Tochter noch auf sich warten, aber Hagen war sich sicher, dass sie ihrer Schwester in nichts an Schönheit nachstehen würde.
Nachdem er sich frisch gemacht hatte – das Wasser in der Waschschüssel war wohltemperiert –, vertraute er sich Friedrichs Führung an und begutachtete das Gestüt. Auf den ersten Blick war zu erkennen, dass es in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte. Das Dach der Scheune war an einer Stelle heruntergekommen. Auch die Ställe bedurften einer Renovierung. Im Gegensatz zu den Gestüten, die Hagen aus seiner Heimat kannte, gab es neben zahlreichen Boxen, in denen große imposante Kaltblüter untergebracht waren, noch die Ständerhaltung. Ausgerechnet die edlen Warmblutpferde waren hier durch Trennwände voneinander getrennt und an einer Stange unterhalb eines Fensters angebunden. Nicht alle Fensterscheiben waren heile, und so standen einige dieser Pferde mitten im Durchzug.
Auf dem Gut der Ellerbruchs hatte man eine derartige Tierhaltung schon lange nicht mehr. Die Rinder standen in Herden zusammen, konnten sich gegenseitig anschauen und sich beknabbern. Auch war es ihnen möglich, sich frei zu bewegen.
»Ständerhaltung? Gibt es das noch?«, tat er überrascht und strich über die moderigen Trennwände, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatten.
Friedrich fühlte sich sofort genötigt, sich zu verteidigen.
»Wir renovieren die Ställe nach und nach«, erklärte er. »Aber das geht nicht von heute auf morgen. Im Moment haben wir Probleme damit, unsere Pferde zu verkaufen. Wie du sicherlich weißt, steckt der Pferdehandel nach dem Krieg in einer wirtschaftlichen Krise.«
Hagen nickte. Natürlich wusste er das. Ihm war überhaupt recht gut bewusst, wie es um das finanzielle Wohl des Gestüts stand. In einigen deutschen Höfen wurden die Kaltblüter sogar bereits geschlachtet, um das Überleben zu sichern.
»Du müsstest dich auf andere Pferde umstellen«, riet er ihm. »Kutschpferde braucht man nur zu dem einen Zweck, und auch das nicht mehr lange. Was die Menschen brauchen, sind Rennpferde. Die Pferdewetten sind groß in Mode.«
Verärgert winkte Werdenberg ab. »Das ist nichts für mich!«, rief er. »Diese Pferde sind viel zu nervös. Schon bei dem kleinsten Geräusch gehen sie durch. Was soll man mit denen?«
Hagen trat nun näher an die Tiere heran, die zwischen den Trennwänden standen. Hier gab es eine schöne Fuchsstute, einige braune Pferde, sogar ein Fohlen. Leider war sogar das kleine Ding angebunden.
»Was sind das für Pferde?«, wollte er wissen.
»Hannoveraner«, erklärte Werdenberg mit leuchtenden Augen, während er auf das Brandzeichen zeigte, das sich auf dem Schenkel des einen Pferdes befand. Zwei Pferdeköpfe, der eine nach links, der andere nach rechts zeigend, waren zu einem H verbunden.
»Das sollen richtig gute Sportpferde sein«, bemerkte Hagen. Er kannte sich im Reitsport nicht gut aus, aber das immerhin hatte er schon oft gehört.
Friedrich nickte. »Sehr gute sogar. Sie werden von unserer Familie geritten. Leider bringen sie nichts ein. Sie sind zu zart für die Kutsche und zu edel für den Krieg.«
»Turniere werden bald wieder groß im Kommen sein«, bemerkte Hagen. »Die Menschen sehnen sich danach, sich im Vergnügen zu messen. Bei uns gründen sich immer mehr Reitvereine, und viele veranstalten Spring- oder Dressurturniere.«
Friedrich hörte interessiert zu.
»Damit liegt mir meine Tochter auch immer in den Ohren«, seufzte er. »Die Hannoveraner sind sehr wendige Tiere. Sie haben auch eine großartige Springveranlagung. Meine älteste Tochter – du wirst sie noch kennenlernen – überspringt mit ihnen fast zwei Meter hohe Hürden.«
Jetzt war Hagen tatsächlich beeindruckt.
»Wie elegant sie aussehen«, staunte er. »Wenn ich du wäre, würde ich sie in die Boxen bringen und die anderen in die Ständer stellen. Und dann würde ich die Zucht umstellen auf diese hier.«
Friedrich wiegte bedenklich den Kopf. »Ich kann mich noch nicht dazu durchringen«, sagte er. »Diese Riesen waren mein ganzer Stolz. Mein Lebensinhalt.« Er sah plötzlich ein wenig verloren aus. »Aber wenn du meine Tochter reden hören würdest, die ist auch der Ansicht.« Jetzt hellte sich sein Gesicht wieder auf. Der Gedanke an Thekla schien ihn zu beleben. »Komm mal mit. Ich muss dir unbedingt den jungen Hengst zeigen, den ich auf einer Auktion erworben habe, meine Tochter hat mich dazu gedrängt. Der hat mich fast ein Vermögen gekostet.«
Hagen konnte Friedrich das schlechte Gewissen ansehen.
»Jaja, die Frauen nötigen uns zu so einigen leichtfertigen Dingen«, lachte er.
»Und die jungen Töchter erst recht«, stimmte Friedrich ihm zu. »Gott sei Dank interessiert sich Sybille überhaupt nicht für Pferde. Wenn sie den Preis erfahren hätte, wäre meiner Frau sicherlich die Teetasse aus der Hand gefallen.«
Hagen nickte zustimmend. Er wusste genau, diese Gutsfrauen lebten noch immer in ihrer eigenen kleinen Welt mit ihren Teegesellschaften und ihren Wohltätigkeitsveranstaltungen im Kreise der adeligen Freundinnen. Da war Sybille sicherlich nicht anders als Hagens Mutter. Wahrscheinlich hatte sie nicht einmal bemerkt, wie wirtschaftlich schlecht es um das Gut der Werdenbergs stand. Ihr würde die Lage wahrscheinlich erst bewusst werden, wenn die Kammermädchen nicht mehr da waren.
Wachsam folgte Hagen seinem Gastgeber.
Aus dem Gestüt könnte man etwas machen, dachte er. Man musste es nur geschickt anstellen. Laut sagte er: »Wir sollten uns gemeinsam Gedanken machen, wie man dieses schöne Gestüt wieder zum Laufen bringt. Ich will dir gerne dabei behilflich sein. Wir am Gut Ellerbruch haben es auch geschafft, in diesen schwierigen Zeiten wirtschaftlich zu bleiben.«
Er spürte, dass er seine Worte gut gewählt hatte, Friedrichs Gesicht entspannte sich. Hagen konnte ihm ansehen, dass er froh war, ihn bei sich zu haben. Und ganz sicher erhoffte er sich auch, ihn als Schwiegersohn zu gewinnen. Sicherlich hatte er sich immer einen Sohn gewünscht, Hagen könnte ihm ein guter Ersatz sein.
Und tatsächlich.
»Ich bin so froh, dass du gekommen bist«, sagte Friedrich voller Hoffnung.
Kapitel 2
Mittlerweile war es Abend geworden. Sorgenvoll blickten die beiden jungen Frauen zum Himmel. Robert betrachtete sie mitleidig. Wahrscheinlich hatten sie nicht die Erlaubnis, so lange fortzubleiben.
»Können Sie uns wohl erklären, wie wir nach Hause zurückkommen?«, fragte Bettina.
Nun zögerte Robert keine Minute. Er hatte sich schon die ganze Zeit über ein wenig Sorgen um ihren Rückweg gemacht. Es dämmerte bereits, und sie hatten noch eine längere Wegstrecke vor sich.
»Wenn es Ihnen recht ist, begleite ich Sie«, schlug er vor, und als ihn die Frauen überrascht anschauten, fügte er stolz hinzu: »Ich besitze auch ein schönes Pferd.«
»Das wäre zu gütig von Ihnen«, erwiderte Thekla.
Roberts Pferd löste Entzückungsschreie bei den Frauen aus, was den Hufschmied verlegen und stolz zugleich machte. Denn tatsächlich war auch sein Pferd Titus ein ansehnlicher Hengst, dunkelbraun, fast schwarz, mit drei weißen und einem schwarzen Huf. Mit diesem Pferd konnte er mit den Pferden der Werdenbergs mithalten.
»Was für ein wunderschöner Hengst«, rief Thekla begeistert und streichelte die weiße Blesse. Auch ihre Stute betrachtete den Hengst mehr als interessiert. Der aber tat, als sei ihm die Stute gleichgültig. Allerdings konnte Robert erkennen, dass er das eine Ohr in Athenas Richtung gestellt hatte, während er versuchte, so unbeteiligt wie möglich auszusehen.
»Typisch Hengst«, lachte Thekla, die es auch bemerkt zu haben schien. »Die lassen sich ja gerne bitten!«
»Er sieht aus wie ein Pferd der Werdenbergs«, bemerkte Bettina überrascht. »Hat er ein Brandzeichen?«
Robert schüttelte den Kopf. »Wir haben ihn als Fohlen geschenkt bekommen. Er hatte das erste Lebensjahr noch nicht überschritten, als seine Mutterstute starb. Man hatte ihm wenig Chancen ausgerechnet, aber ich habe es geschafft und ihn mit der Flasche großgezogen.«
»Oh, wirklich?«, rief Thekla nun respektvoll und streichelte das Pferd erneut. »Das habe ich auch schon mal gemacht. Es ist eine anstrengende Arbeit.«
»Aber sie ist auch wundervoll«, erwiderte Robert nun. »Dieses Pferd ist auf die Weise mein größter Freund geworden.«
Robert brach erschrocken ab. So viel Persönliches wollte er gar nicht erzählen. Aber die Frauen brachten ihn dazu, mehr zu sagen, als er sonst redete.
Thekla blickte Robert an, und er erschrak erneut bei dem tiefen Blick, mit dem sie ihn anschaute. Ihre Augen hatten eine so ungewöhnliche Farbe – grau, fast silbrig, die im Schein des Schmiedefeuers fast zu leuchten schienen. Ihr Blick war so intensiv, dass sich Robert zwingen musste wegzuschauen.
»Ich sattele Titus schnell«, sagte er. »Dann können wir losreiten.«
Während er in aller Eile den Hengst für einen Ritt fertig machte, half Thekla ihrer Freundin erneut in den Sattel, um dann selbst aufzusteigen. Gemeinsam ritten sie los.
Er kannte eine Abkürzung durch die Weserwiesen bis hin zu einem kleinen Fährhaus. Von hier aus ließen sie sich mit der Fähre über die Weser setzen, führten dann ihren Weg fort, bis sie das kleine Dorf Ilvese erreichten.
Die Frauen bedankten sich noch einmal herzlich und versicherten ihm, einen Tag später jemanden vorbeizuschicken, der die Rechnung beglich.
Als Robert wieder an der Schmiede ankam, war es bereits später Abend. Robert versorgte Titus und brachte den Hengst in den großen selbst gebauten Stall, der sich direkt neben der Schmiede befand und den sich Titus mit zwei Ziegen teilen musste. Pferde waren Herdentiere und lebten nicht gern allein, aber Robert hatte keine weiteren Beistelltiere gefunden. Die drei waren allerdings trotz ihrer Unterschiedlichkeit gute Freunde.
Nachdem Robert sein Pferd und die anderen Tiere versorgt hatte, ging er zu seinem Vater in das Lehmhaus hinüber. In den Fensterscheiben spiegelte sich das Flackern des Kaminfeuers, ein Zeichen dafür, dass es immer noch warm in der guten Stube war. Robert betrat das Haus, hängte seine Jacke an den Haken hinter der Tür und schaute sich zu seinem Vater um. Dann aber durchzuckte ihn ein eisiger Schrecken. Der Vater hatte sich bis auf das Hemd ausgezogen. Die schmalen Beine und die großen Füße ragten unter der Bettdecke hervor. Jetzt strampelte der Vater sich los.
»Heiß ist es. Viel zu heiß«, murmelte er. Es war fast ein Flüstern.
»Vater!« Mit einem Satz war Robert bei ihm. »Natürlich ist es viel zu heiß. Du wolltest es so, weil du so gefroren hast. Aber wenn dir jetzt warm ist, mache ich das Feuer wieder aus.«
Der Vater lachte leise. Es klang wie ein merkwürdiges Kichern – ein albernes Glucksen wie von einem Wesen, das sich in einer anderen Welt befand.
»Es ist nicht das Kaminfeuer, das zu heiß ist«, krächzte der Vater. Er legte seine dürren Arme um die Schultern seines Sohnes, zog ihn tief zu sich und flüsterte ihm ins Ohr: »Es ist … das Fegefeuer.«
Robert versuchte, sich aus der festen Umarmung seines Vaters zu lösen. Und obwohl er nun versuchte zu lachen, war ihm dieser Satz doch sehr unheimlich.
»Vater«, versuchte er, gelöst zu klingen. »Du glaubst doch selbst nicht, dass du im Fegefeuer landest. Du hast in diesem Leben nur Gutes getan.«
Die Umarmung des Vaters wurde fester, veränderte sich zu einer Umklammerung.
»Es ist nicht schlimm, im Fegefeuer zu sein«, flüsterte er. »Ich bin doch bei ihr.«
Robert konnte nicht verhindern, dass ihm eine Gänsehaut über den Rücken kroch. »Bei wem?«, wollte er wissen.
Der Vater löste sich nun von ihm und sank zurück auf das Bett. Seine mageren nackten Beine krochen wieder unter die Bettdecke. »Bei deiner Mutter«, sagte er leise.
Gerade wollte Robert erwidern, dass sich auch seine Mutter nicht im Fegefeuer befand, da redete der Vater schon weiter.
»Doch, sie ist da!«, sagte er nun mit ruhiger Stimme. Sein Blick irrte nicht mehr umher, vielmehr fixierte er Robert. »Sie ist schon so lange da, und nun werde ich bei ihr sein. Ja, nun ist es so weit.«
»Vater! Hör auf mit diesem Unsinn!«, rief Robert entsetzt. Er hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten wie ein kleines Kind, aber der Vater hinderte ihn daran.
»Du weißt es nicht, weil ich dir immer etwas vorgelogen habe«, erklärte der Vater nun. »Du hättest die Wahrheit über sie nicht ertragen.« Er schluckte. »Ich habe sie ja selbst kaum ertragen.«
Robert hatte Mühe, seine Gedanken zu ordnen. Er spürte aber, dass der Vater etwas auf dem Herzen hatte, was er unbedingt loswerden wollte. Also setzte er sich zu ihm und nahm seine Hand. Dabei lief ihm der Schweiß von der Hitze, die im Raum hing, den Rücken hinunter.
»Was ist mit Mutter?«, fragte er nun.
Der Vater rang nach Luft.
»Sie ist nicht ertrunken«, murmelte er. »Sie hat den Freitod gewählt.«
Es traf Robert wie ein Schlag, doch er zuckte nur innerlich zusammen. Er zwang sich, seinen Vater ruhig anzuschauen. »Wie kommst du darauf?«, wollte er wissen.
»Ich weiß es, weil ich sie verstoßen habe«, flüsterte der Vater nun. Dann drehte er sich zur Seite, schaute gegen die Wand und vermied es auf die Weise, Roberts Blick standhalten zu müssen. »Sie trug ein Kind in sich«, sagte er leise. »Von einem anderen.«
Robert schnappte nach Luft, aber der Vater redete sofort weiter. »Sie hat es mir nicht erzählen wollen, aber ich habe sie gedrängt, die Wahrheit zu sagen«, erklärte er. »Ich wusste, dass das Kind nicht von mir war. Ich war ja immer unterwegs.«
Robert nickte. Sein Vater war in den Jahren vor dem Krieg als Wanderschmied unterwegs gewesen, war mit einem Wagen und einem Pferd von Ort zu Ort gezogen und hatte Pferde beschlagen und Schmiedearbeiten erledigt.
Als die Mutter gestorben und auf dem kleinen Friedhof an der Kirche begraben war, hatte er sich zu Hause eine Schmiede eingerichtet, um für seinen Sohn da zu sein. Oft hatte Robert ihm bei der Arbeit zugeschaut, später seinem Vater als Gehilfe zur Seite gestanden. Dann kam der Krieg. Zunächst dachten sie noch, sie würden ihn unbeschadet in dem kleinen Angerdorf überleben, schließlich war viel zu tun, um die Kavalleriepferde zu beschlagen, doch der Krieg machte auch vor ihnen nicht halt. Der Hufschmiedemeister Hans-Georg Steinfels wurde an der Front gebraucht, zunächst als Schmied, dann als Soldat.
In der Zwischenzeit führte Robert allein die Schmiede. Das war die Zeit, in der er erwachsen wurde. Als das Ende des Krieges abzusehen war, wurde Roberts Vater durch einen Granatsplitter im rechten Oberarm schwer verletzt, hatte einige Zeit im Kriegslazarett gelegen und war mit schlecht verheilter Wunde nach Hause geschickt worden. Anschließend war es ihm nur mit Roberts Hilfe möglich gewesen, den schweren Beruf weiter auszuüben. Der Splitter hatte einen Teil seiner Muskeln zerstört. Er übertrug seinem Sohn die häusliche Schmiede und übernahm die Versorgung des Haushaltes. In den schweren Zeiten nach dem Krieg, in denen die Lebensmittel knapp wurden, hatte er sich auf das Einkochen und Haltbarmachen der Nahrungsmittel verstanden, um Robert und sich ein einigermaßen erträgliches Leben zu ermöglichen. Sie konnten froh sein, dass sie auf dem Land lebten, wo das Beschlagen der Pferde und das Schmieden von Haushaltsgegenständen oft mit einem Huhn, Kartoffeln oder Gemüse bezahlt wurden. So lebten sie gar nicht schlecht. Im Vergleich zu den mageren Städtern, die aufs Land fuhren, um sich einige Nahrungsmittel zu erbetteln, war ihr Leben fast wie ein kleines Paradies.
Dass seine Mutter schwanger gewesen war, schien Robert eine ungeheuerliche Behauptung zu sein. Er war unsicher, ob es sich bei den Bildern um Fieberphantasien des Vaters handelte oder ob es die Wahrheit war, die er seinem Sohn kurz vor dem Tod offenbaren wollte.
Robert konnte sich nicht erinnern, seine Mutter mit einem Babybauch gesehen zu haben. Andererseits war er klein gewesen, gerade mal sieben. Plötzlich fiel ihm wieder ein, dass seine Mutter vor ihrem Tod einige Monate lang fort gewesen war. Er erinnerte sich dunkel, dass sie damals zu ihrer Schwester gegangen war, um ihr in einer schwierigen Zeit im Haushalt zur Hand zu gehen.
Und dann war sie ertrunken, beim Schwimmen in der Weser. Das hatten sie ihm damals erzählt.
»Wie hat sie den Freitod begangen?«, fragte Robert tonlos.
Er war immer noch verwirrt, und doch machte sich nun in seinem Hinterkopf eine Erinnerung breit, die er immer versucht hatte beiseitezuschieben. Es hatte Gerede gegeben im Dorf.
Und noch etwas gab es, an das sich Robert nur noch dunkel erinnerte. Einen Mann. Ein- oder zweimal war er zu Besuch gewesen. Ob der Vater damals zu Hause gewesen war, wusste er nicht mehr. Dieser Mann hatte ihm damals auch das Fohlen geschenkt. An diesen Tag konnte er sich noch genau erinnern. Aber nur an das Fohlen, die Freude darüber hatte alles andere verdrängt.
Sein Vater atmete schwer. Robert spürte, dass es mit ihm zu Ende ging. Er nahm seine Hand, diese alte faltige, schwielige Hand, die so viele schwere Arbeiten hatte tun müssen und mit so vielen Brandblasen gezeichnet war, die zuletzt so mager und schwach gewesen war, dass er sie kaum noch heben konnte.
»Sie ging in die Weser«, murmelte der Vater. »An einer Stelle, an der die Strömung ganz besonders stark ist. Dabei konnte sie doch gar nicht schwimmen. Es hat wie ein Unfall ausgesehen. Wir durften sie darum auf dem Friedhof an der Kirche beerdigen.«
In Roberts Ohren rauschte das Blut. »Und das Kind?«, wollte er wissen. »Hat sie es mit in den Tod genommen?«
Nun drehte sich der Vater auf den Rücken und schaute seinen Sohn lange an. Dann schloss er die Augen.
»Vater!«, drängte Robert und nahm erneut seine Hand. »Das Kind? Wo ist es?«
Der Vater ließ die Augen geschlossen. »Das Kind wurde geboren«, flüsterte er. »Sie …« Er war kaum noch zu verstehen. »… hat … es weggegeben.«
Robert war sich nicht sicher, ob er diese Worte richtig verstanden hatte.
»Weggegeben? Wohin?«
Aber der Vater antwortete nicht. Nur einmal sagte er noch einen Satz wie »Meine Schuld« oder auch »Herr, erbarme dich«.
Aber da war sich Robert nicht mehr sicher, ob er das richtig verstanden hatte.
***
Das Hausmädchen Gerlinde fing Thekla bereits im Flur ab. Sie war zu spät, viel zu spät.
»Der gnädige Herr ist untröstlich«, sagte Gerlinde.
Thekla musste sie nur kurz anschauen, um zu wissen, dass das eine behutsame Formulierung war. Ihr Vater war sicherlich außer sich vor Empörung.
»Tut mir leid, Gerlinde!«, rief sie. »Wir haben uns verirrt. Und dann hat Fallada auch noch ein Hufeisen verloren.«
Das Hausmädchen deutete ihr an, leiser zu sprechen.
»Kommen Sie schnell nach oben, gnädiges Fräulein«, flüsterte sie ihr zu. »Sie müssen sich noch umziehen. Ihre Schwester und der feine Herr von Ellerbruch haben sich bereits im Esszimmer eingefunden.«
Thekla seufzte. »Hoffentlich ist mir wenigstens das vierhändige Klavierspiel erspart geblieben«, rief sie.
Gerlinde sah richtig entsetzt aus. Sicherlich konnte sie nicht verstehen, wie man so wenig Wert darauf legen konnte, eine gute Partie zu machen.
Thekla huschte die Treppe hinauf, und Gerlinde folgte ihr hastig, um ihr beim Ankleiden behilflich zu sein. Als sie ihr Zimmer betrat, sah Thekla, dass das hellblaue Baumwollkleid mit den hübschen Glasperlen am Ausschnitt und in der Taille schon bereitlag. Darüber die Korsage mit den Strümpfen. Thekla verzog das Gesicht. Das Hausmädchen würde wohl nie akzeptieren, dass sie sich nicht mehr schnüren wollte.
»Nein, nein, Gerlinde, dieses Schraubgestell trage ich nicht«, winkte sie ab. »Es quetscht mir alle Bewegungen ab.«
»Aber diesmal …«, begann Gerlinde ein wenig hilflos. »Heute Abend. Es ist doch schön, sich von seiner fraulichen Seite zu zeigen.«
Thekla sah sie aufmerksam an. Bestimmt war den Dienstboten schon zu Ohren gekommen, dass Freiherr von Ellerbruch nicht nur gekommen war, um ein Pferd zu kaufen.
»Ich brauche das nicht«, gab sich Thekla selbstbewusst. »Ich bin dünn genug.«
Gerlinde machte eine hilflose Geste mit den Armen, ließ sie dann aber wieder sinken. Sie wusste, dass sich Thekla allein ankleidete, nur beim Schließen des Büstenhalters ließ sie sich helfen. Dann schlüpfte sie in Unterwäsche, Unterrock und Strümpfe und ließ das helle Baumwollkleid über ihren Körper fallen. Gerlinde beobachtete sie nachdenklich. Thekla grinste.
»Ich weiß, was du denkst, Gerlinde«, meinte sie. »Franzi hat bestimmt den halben Nachmittag damit zugebracht, sich für das Abendessen fertig zu machen.«
»Nun ja«, erwiderte Gerlinde und senkte den Kopf. Sicher wollte sie nichts Nachteiliges über Theklas jüngere Schwester sagen. »Das gnädige Fräulein Thekla sieht jedenfalls genauso schön aus«, murmelte sie. »Und braucht dafür nur zehn Minuten.«
Thekla lachte, bürstete sich schnell ihre kurzen Haare, puderte die Nase, trug Lippenstift auf und stand schon wieder an der Tür.
»Wollen das gnädige Fräulein …«, begann Gerlinde verunsichert.
Thekla winkte ab. »Das reicht«, behauptete sie. »Drück mir die Daumen, dass der Abend nicht so langweilig wird.« Dann stürmte sie die Treppe hinunter.
Vor der Tür zum Esszimmer hielt Thekla kurz inne und lauschte. Sie hörte, wie ihr Vater einen kurzen Trinkspruch aussprach. Man hatte sich offenbar bereits zu Tisch begeben. Thekla wartete den Moment ab, in dem die Gläser klirrten, dann betrat sie das Zimmer.
An diesem Abend hatte man noch mehr Gäste eingeladen, wie Thekla jetzt feststellte. Die Gutsleute Heinrichhof aus Schlüsselburg waren gekommen, außerdem Paul Picht, ebenfalls ein angesehener Gutsherr vom Hof Petershagen. Sie hatten gerade ihr Glas erhoben und gemeinsam angestoßen. Nun richteten sich alle Blicke auf sie.
»Entschuldigen Sie!«, rief Thekla in die Runde und verbeugte sich kurz.
Die anwesenden Männer erhoben sich. Thekla entging nicht, dass ihr Vater die Nase rümpfte. Auch die Mutter sah verärgert aus. Ihre kritischen Blicke streiften Theklas Körper. Natürlich sah sie sofort, dass sie auf das Schnürkorsett verzichtet hatte. Aber Thekla beschloss, sich diesen verärgerten Blick nicht zu Herzen zu nehmen. Im Gegenteil musste sich die Mutter endlich damit auseinandersetzen, was es für die Frauen an Qualen bedeutete, mit so einem Mörderteil gestraft und in ihren Bewegungen eingeschränkt zu werden. Die Mutter war oft noch nicht einmal in der Lage, etwas vom Boden aufzuheben, das ihr aus der Hand gefallen war.
Thekla lief einmal um den Tisch herum und begrüßte die Anwesenden, ließ sich von Paul Picht die Hand küssen, achtete darauf, dass sie nur die Fingerspitzen der gnädigen Frau von Heinrichhof berührte, und ließ sich zuletzt den Stuhl von Hagen von Ellerbruch zurechtrücken. Ärgerlicherweise hatte man ihren Platz neben dem seinen gewählt, während ihre Schwester für den alten Paul Picht als Tischdame vorgesehen war. So konnte sie sich ihm nicht entziehen.
Thekla war überrascht, dass er tatsächlich recht gut aussah. Sein welliges dunkelblondes Haar hatte er nach hinten gekämmt und es mit Pomade in Form gebracht. Seine Augen waren von einer undefinierbaren blau-grau-grünen Farbe, die vollen Lippen hatten einen spöttischen Zug. Aufmerksam musterte er sie.
»Meine Verspätung ist unverzeihlich«, rief Thekla nun in die Runde und hoffte, man würde ihr nicht ansehen, dass das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Und dann erzählte sie von dem Ausritt, auf dem sie sich verirrt und zuletzt auch noch ein Hufeisen verloren hatten. Zu ihrer Freude hatte sie mit ihrer Geschichte genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Das Gespräch drehte sich von nun an nur noch um Pferde. Bei der Vorsuppe redete man über die großartigen Fohlen, die in diesem Jahr zur Welt gekommen waren, beim Hauptgang – es gab Wildbret, vom Vater eigenhändig erlegt, dazu Eingemachtes aus dem Vorratskeller der Köchin Margot – war man bereits bei den Stuten, und als die Herren schließlich nach dem Fruchtcocktail beim Absinth und die Damen beim Kaffee saßen, schwärmte man von den Hengsten. Die Rheinisch-Deutschen Kaltblutpferde waren nach Ansicht des Vaters die kräftigsten und eindrucksvollsten Pferde Deutschlands.
»Da fällt mir ein, Sybille«, wandte sich Friedrich nun an seine Frau. »Sollten wir nicht zu Ehren unseres Gastes wieder ein schönes Gutsfest geben?«
Alle Blicke richteten sich nun auf Sybille. Thekla sah, wie die Augen ihrer Mutter strahlten, Gutsfeste hatte sie immer geliebt. Im Krieg war so vieles auf der Strecke geblieben. Auch Thekla war sich sicher, dass es allen guttun und für viel Zerstreuung sorgen würde.
»Was für ein schöner Gedanke«, rief ihre Mutter.
»Vor dem Krieg haben wir regelmäßig große Gartenfeste veranstaltet und dabei unsere Pferde in einer einmaligen Parade vorgestellt«, wandte sich Friedrich nun an Hagen. »Wenn wir das wieder aufleben lassen, könnte man das Interesse der Bauern wieder auf unsere kraftvollen Riesen lenken. Vielleicht würden sie sich ganz neu für sie erwärmen?«
Thekla unterdrückte ein Seufzen. Hatte sie nicht oft genug mit ihrem Vater darüber geredet, dass die Zeit der Sportpferde gekommen war? Wenn sie zusammen darüber sprachen, zeigte er sich einsichtig, doch dann wieder konnte er in seiner Meinung umfallen wie ein dreijähriges Kind. Wobei ihm Thekla auch zugestehen musste, dass diese Riesen sein Lebenswerk waren. Das konnte er einfach nicht vergessen.
An einem Gutsfest zeigten sich auch die anderen Gäste interessiert. Es war in ihrem Dorf immer eine willkommene Abwechslung.
»Eine gute Idee«, stimmte Hagen zu. »Hengstparaden sind ja immer sehr imposant.« Und er lächelte in dieser leicht überheblichen Weise.
Thekla wurde nun aufmerksamer, misstrauischer sogar. Was dachte er wirklich? Machte er sich insgeheim über den Vater lustig?
»Vater, du solltest nicht vergessen, unsere schönen Hannoveraner vorzuführen«, rief sie. Und nun blickte sie direkt zu ihrem Nachbarn. »Hat mein Vater sie Ihnen gezeigt? Sie sind so elegant und so lernbereit.«
Ihr fiel auf, dass Hagen sie sehr genau anschaute. Der spöttische Zug um seinen Mund hatte sich verstärkt.
»Jaja, die habe ich gesehen«, sagte er vorsichtig. »Sie haben mich auch beeindruckt.«
»Ich habe Vater schon oft gesagt, dass er mit diesen Pferden züchten muss«, begeisterte sich Thekla. »Die Zukunft liegt im Sport.«
Jetzt trat so etwas wie Achtung in Hagens Blick.
»Das habe ich Ihrem Vater auch gerade erzählt«, sagte er. Seine Stimme klang abwartend. Thekla war jetzt nicht mehr zu bremsen. Vielleicht gelang es ihr ja mit Hagens Hilfe, den Vater vollends zu überzeugen.
»Ich konnte Vater sogar überreden, einen schönen Hengst zu kaufen, um die Züchtung zu veredeln«, fuhr sie fort. Sie drehte sich zu ihrem Vater um. »Siehst du, Vater, Hagen ist wohl auch der Meinung, oder?«
Sie wandte sich ihrem Sitznachbarn zu. Der kam gar nicht dazu zu antworten.
»Ihr habt ein neues Pferd gekauft?«, ließ sich Sybille nun vernehmen. »Das habt ihr gar nicht erzählt.«
Thekla fing den warnenden Blick ihres Vaters auf und sprach schnell weiter. Dabei redete sie sich warm. Erst als ihr auffiel, wie irritiert sie der Freiherr von Ellerbruch von Zeit zu Zeit anschaute, brach sie ab.
Er räusperte sich. »Sie scheinen sich ja gut mit Pferden auszukennen«, stellte er anerkennend fest.
»Nicht nur mit Pferden«, versuchte Sybille nun, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.
Thekla wusste, dass es ihrer Mutter nicht gefiel, wenn sie zu viel über Pferde redete. Sie fürchtete dann immer, Thekla würde nicht weiblich genug erscheinen.
Sofort nutzte ihre Mutter die entstandene Gesprächspause.
»Thekla hat auch viele andere Qualitäten«, sagte sie schnell und warf ihrem Mann einen tadelnden Blick zu. Thekla ahnte, was jetzt kam.
»Sie musiziert sehr schön«, begann ihre Mutter. »Das Stück, das Franziska Ihnen vorhin vorgespielt hat, ist ursprünglich für vier Hände geschrieben. Die beiden haben es gemeinsam einstudiert.« Jetzt wandte sie sich Thekla zu. »Vielleicht wollt ihr es noch einmal vorspielen?«
Thekla hatte es erwartet und ärgerte sich dennoch. Warum redete die Mutter so? Es hörte sich fast an, als wollte sie Thekla dem Freiherrn anbiedern.
»Oh, Mutter, nein, bitte erspar uns das!«, rief sie. Dann wandte sie sich ihrem Tischnachbarn zu. »Meine musikalische Qualität erinnert an eine Grille in der Sommernacht. Schnarrend und eintönig«, bemerkte sie.
Hagen von Ellerbruch lachte. »Das würde ich zu gerne einmal hören, gnädiges Fräulein«, sagte er.
In diesem Moment wünschte sich Thekla, ihre Blicke wären in der Lage, ihn zu töten. Es war klar, was er wollte. Er wollte sich über sie lustig machen. Gerade überlegte sie, etwas zu entgegnen, da erhob sich Franziska bereits. Offenbar war sie froh, ihrem Tischnachbarn entkommen zu können.
»Es ist uns eine Ehre, Ihnen etwas vorzuspielen«, erwiderte sie.
Thekla blieb keine Wahl, als den Platz neben ihr am Klavier einzunehmen.
***
Der Vater hatte nicht nach dem Pfarrer verlangt. Sein letzter Wunsch war es gewesen, dass sein Sohn an seinem Bett saß und ihm aus der Bibel vorlas. Robert suchte lange nach einer geeigneten Stelle, las schließlich den Psalm »Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal …«. Aber er war sich nicht sicher, ob der Vater das noch hören konnte. Seine Atemzüge wurden leiser, die Pausen länger. Dann atmete er nicht mehr.
Robert streichelte das hagere Gesicht seines Vaters und schloss ihm seine eingefallenen müden Augen. Eine Weile saß er reglos an seinem Bett und starrte vor sich hin. Er musste den Pfarrer rufen, damit er die Glocke läutete, die den Dorfbewohnern anzeigte, dass jemand gestorben war. Auch musste er den Nachbarn Bescheid sagen, damit sie den Toten waschen und ihm sein Sterbehemd anziehen konnten. Doch er war nicht in der Lage, irgendwas zu tun.