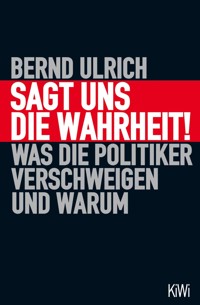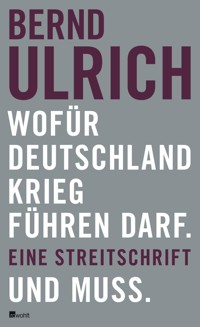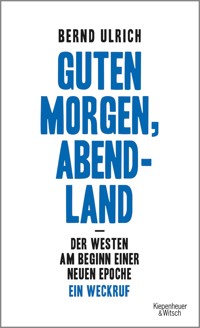
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Wüten der Welt. Die politischen Selbstverständlichkeiten sind gehörig ins Wanken geraten. Die Welt, wie wir sie kannten, ist »aus den Fugen«. Doch mittlerweile zeigen sich die Konturen einer neuen Welt immer klarer. Man muss sie nur sehen wollen.Die Erschütterungen dieser Jahre sind hilfreich und notwendig, um den aufgeklärten, aber auch privilegierten Kreisen dieses Landes die Augen zu öffnen für die Ursachen, die viel zu lange verdrängt worden sind: die Wucht, mit der die weltweiten Krisenherde an unser Leben unmittelbar heranrücken, und die grotesken und obszönen Ungerechtigkeiten, die so sichtbar werden und die sich die Opfer nicht mehr bieten lassen, bei uns und weltweit ...In Zeiten von Brexit, Trump-Amerika, IS-Terror, weltweiter Flüchtlingsströme und neuem Nationalismus wächst das Bedürfnis und die Notwendigkeit politischer Bestandsaufnahmen und Analysen, die über den Tag hinaus reichen. Dieser Arbeit hat sich Bernd Ulrich, Leiter der Politik-Redaktion der Zeit, in den letzten Jahren mit Bravour gewidmet und bei den zahllosen nationalen und internationalen Krisen immer wieder mit kühlem Verstand nach Ursachen und Zusammenhängen gefragt. Darauf basierend entwirft Bernd Ulrich ein präzises Epochenbild, das für die politische Kultur dieses Landes und für ein höchst notwendiges demokratisches Engagement unverzichtbar ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernd Ulrich
Guten Morgen, Abendland
Der Westen am Beginn einer neuen Epoche
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bernd Ulrich
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bernd Ulrich
Bernd Ulrich, geboren 1960 in Essen, ist seit vierzehn Jahren stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Politikressorts der Zeit. Für seine journalistischen Arbeiten erhielt er 2013 den Henri-Nannen-Preis und 2015 den Theodor- Wolff-Preis. Buchveröffentlichungen u.a.: »Deutsch, aber glücklich.«, 1997, »Wofür Deutschland Krieg führen darf. Und muss.«, 2011, »Sagt uns die Wahrheit!«, 2015.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Erschütterungen dieser Jahre sind hilfreich und notwendig, um den aufgeklärten, aber auch privilegierten Kreisen dieses Landes die Augen zu öffnen für die Ursachen, die viel zu lange verdrängt worden sind: die Wucht, mit der die weltweiten Krisenherde an unser Leben unmittelbar heranrücken, und die grotesken und obszönen Ungerechtigkeiten, die so sichtbar werden und die sich die Opfer nicht mehr bieten lassen, bei uns und weltweit …
In Zeiten von Brexit, Trump-Amerika, IS-Terror, weltweiter Flüchtlingsströme und neuem Nationalismus wächst das Bedürfnis und die Notwendigkeit politischer Bestandsaufnahmen und Analysen, die über den Tag hinaus reichen. Dieser Arbeit hat sich Bernd Ulrich, Leiter der Politik-Redaktion der Zeit, in den letzten Jahren mit Bravour gewidmet und bei den zahllosen nationalen und internationalen Krisen immer wieder mit kühlem Verstand nach Ursachen und Zusammenhängen gefragt. Darauf basierend entwirft Bernd Ulrich ein präzises Epochenbild, das für die politische Kultur dieses Landes und für ein höchst notwendiges demokratisches Engagement unverzichtbar ist.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Im Zentrum des Bebens – warum gut ist, was geschieht
Noch ein Mauerfall – was uns die Flüchtlinge bringen
Abschied von Amerika – Befreiung vom Atlantizismus
Deutschland – ein Land wie keines, so schön, so seltsam
Das Beste kommt noch, das Schlimmste auch – Angela Merkel
Russische Verführung, deutscher Komplex
Europa – die Weltmacht, die sich selbst nicht kennt
Wir und Die – warum eine Politik ohne Moral keinen Erfolg hat
Die neue Plutokratie – verraten die Reichen die Demokratie?
Die Mehrheit wieder zur Mehrheit machen – wie die Autoritären zu schlagen sind
Literatur zum Thema
Meinen Kindern Franziska, Fritz und Luise
Vorwort
Woran merkt man, dass die Welt sich wirklich ändert? Das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Bei mir begann es damit, dass ich anfing, meinen Kindern andere Geschichten zu erzählen. Bis vor wenigen Jahren ging die Story vom Großen und Ganzen so: Deutschland ist nach einer schwierigen Geschichte mittlerweile ein ziemlich liberales, offenes, freundliches, recht friedliches Land geworden, das auf die Umwelt achtgibt, Minderheiten anständig behandelt und all das. Die Generation Eurer Eltern hat dazu beigetragen, dass es so geworden ist, darauf ist sie stolz, auch wenn man »stolz« nicht sagt. Außerdem ist dieses Land sehr reich, es verfügt über eine stabile Demokratie und liegt inmitten eines friedlichen Kontinents, es ist fest eingebunden in die EU und in den Westen. Gewiss, vieles gibt es noch zu verbessern, aber wirklich sorgen müsst ihr Euch nur um die Details, das Fundament steht.
Diese Geschichte hatte einen ungewollten Subtext, der lautete: Euer Vater war zeit seines Lebens ein ziemlich politischer Mensch, wäre also schön, wenn Ihr zumindest auch wählen geht und ein Freiwilliges Soziales Jahr macht. Aber zwingend nötig ist das nicht.
Diese Erzählung ist mittlerweile ins Stocken geraten, wenn nicht ganz verstummt.
Und eine neue gibt es noch nicht. Behelfsweise müsste man den Kindern sagen: Dies ist ein gutes Land, aber ob es das bleibt, können wir nicht sagen. Innerhalb von wenigen Jahren sind sehr viele Gewissheiten zerstoben, nichts ist stabil, was nicht ständig stabil gehalten wird. Institutionen – im Grunde war das immer klar – basieren auf Vereinbarungen und Gewohnheiten, die jeden Tag neu getroffen und unterzeichnet werden müssen, nichts funktioniert, was nicht von Menschen gemacht und bejaht wird. Wir vererben Euch vielleicht keine für immer stabile Demokratie und EU, wir übergeben Euch allerdings die Chance, beides zu erhalten. Wir haben Euch geliebt und gelehrt, wir haben Euch stärker werden lassen, als es für ein Leben in einem sorgenarmen Deutschland nötig gewesen wäre, nun werdet ihr diese Stärke brauchen, mehr als wir es für möglich gehalten hätten. Haben wir Fehler gemacht, dass nun alles so fragil geworden ist? Vielleicht ja, sogar sicher. Aber wir entschuldigen uns nicht, wir kämpfen um dieses Land, aber nicht an Eurer Stelle, höchstens mit Euch.
So etwa müsste die Geschichte gehen. Ist es eine traurige? Oder war die vorherige nicht viel trauriger? Tatsächlich waren wir doch an einem toten Punkt angekommen. Die alte Idee, dass es den Kindern einmal besser gehen soll als einem selbst, war doch eh schon etwas mürbe. Heimlich dachten viele, jedenfalls in der gebildeten Mittelschicht, bereits: noch besser als uns? Das kann doch nur in Verwöhntheit enden! Das Ende der Geschichte, hier mal ganz persönlich.
Vielen erscheint die Entwicklung der letzten Jahre als eine Verdunkelung der Welt. Und ja, man kann Terroranschlägen oder dem Krieg in Syrien nichts abgewinnen außer Wut und Traurigkeit. Manchmal ist für mich Verstehen der einzige Trost, zuweilen ist es auch in diesem Buch so. Ich bestehe auf der Verstehbarkeit der Welt. Verstehen ist schließlich auch eine Zumutung, denn es wäre verführerisch zu sagen »Ich versteh’ die Welt nicht mehr« und deswegen die Flucht in die Resignation anzutreten oder in die Nostalgie. Stattdessen will ich hier zu zeigen versuchen, dass im Kern des Weltbebens, das wir zurzeit erleben, etwas bewegend Neues und sogar viel Gutes steckt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die westlichen Demokratien, die vielen hier eine angenehme und schöne Heimat waren und sind, vom Rest der Welt in ihrer internationalen Rolle durchaus als autokratisch empfunden wurden. Dort erscheinen wir als die Herrschenden, denen die Kontrolle entgleitet.
Doch die Kritik oder sogar die Schadenfreude der anderen mindert ja nicht den eigenen Schaden. Die Frage ist also, was es mit uns macht, wenn die liberale Demokratie von innen und von außen unter Druck kommt.
Und noch etwas ändert sich beim Blick auf die Welt. Kritische, aufgeklärte Geister sehen ihre Aufgabe darin, der Selbstgefälligkeit der herrschenden Verhältnisse etwas entgegenzusetzten, mit scharfer Skepsis zu entlarven und zu geißeln. Falsch wird das auch heute nicht, aber unzulänglich. Denn es genügt nicht mehr, das Schlechte anzuprangern, man muss auch dem Guten ans Licht helfen. Was, wenn die Wirklichkeit selbst eine apokalyptische Gestalt annimmt, wenn das Gute sich noch mehr verbirgt als das Böse? Wo das Negative hegemonial wird, da ist die Zuversicht plötzlich subversiv. In diesem Sinne ist dies ein positives, ermutigendes Buch, das auf die Chancenseite der Wirklichkeit schaut.
Mehr noch hat sich geändert durch den Umsturz unserer Welt: Das Leben ist intensiver geworden. Man hätte sich sicher nicht gewünscht, dass etwa Donald Trump Präsident wird oder dass Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kommen – aber da es nun mal geschehen ist, muss man sagen: So viel Leben war selten.
Auch das wird man diesem Buch anmerken. Ich habe in den vergangen beiden Jahren so viele Gespräche geführt wie noch nie zuvor und – fast keines war langweilig. Mein Beruf als politischer Redakteur einer bekannten Zeitung gibt mir das Privileg, fast jeden Menschen treffen zu können, der mich interessiert. Das habe ich nach Kräften genutzt. Und ich gab dem Zufall, der beiläufigen Begegnung, jede Chance. Darüber hinaus gibt es in meinem privaten Leben Menschen aus allen sozialen Schichten und mit biografischen Wurzeln in allen möglichen Ländern. Sie alle, die Freunde und Bekannten, habe ich ausgefragt und mit meinen Gedanken konfrontiert, manchmal sicher zu sehr, aber sie haben mitgemacht und – mal gewollt, mal ungewollt – auch zu diesem Buch beigetragen. Dafür möchte ich mich hier bedanken:
Die Redaktion der ZEIT, vor allem das politische Ressort, war eine unerschöpflich Quelle von Erkenntnis, Solidarität, Emotion und Streit. Sodann meine Freundin Luisa Seeling, mein mich unermüdlich unterstützender Widerpart. Dann meine Kinder, die mich zwangen, die Welt neu zu erzählen und mir ihre Sicht auf diese Welt anzuhören. Darüber hinaus in willkürlicher Reihenfolge: Maybrit Illner, Walid Kamarieh, Adam Tooze, Joschka Fischer, Shimon Stein, Ercan Aslan, Udo Hock, Harald Schäfer, Zeljko Ristic, Tine Stein, Bernd Rheinberg, Helge Malchow, Samira El Ouassil, Rainer Forst, Anton Troianowski, René Obermann, Jonathan Brackett, Katja Kraus, Thea Dorn, Michael Wollny, Peter Frey, Kübra Gümüsay, Rainer Baake, Wolfgang Blau, Teresa Bücker, Tamar Tsvaigrach, Kathy Meßmer, Beklan Coscun, Felix Ensslin, Meron Tadesse, Klaus Mertes, Philipp Johner, Thelse Godewert, Dirk Kurbjuweit, Walid Nakshbandi, Philipp Ruch.
Diese Gespräche sind hoffentlich nicht abgeschlossen, sie haben nur jetzt zwischendurch die Form eines Buches angenommen.
Bernd Ulrich, im Mai 2017
Im Zentrum des Bebens – warum gut ist, was geschieht
Irgendwann im Laufe des Jahres 2015 wurde hierzulande die Formulierung populär, die politische Welt sei »aus den Fugen«. Das hatte zu tun mit der russischen Annexion der Krim, mit der andauernden, ungeklärten Eurokrise, mit dem schrecklichen Krieg in Syrien, mit zahlreichen grausamen Terroranschlägen, die in Europa und im Nahen Osten vom IS verübt oder reklamiert wurden.
Und dann kamen noch die Flüchtlinge in großer Zahl.
Lange spielten sich die tiefen Konflikte, die Kriege und die Krisen nur außerhalb von Deutschland ab, doch das Jahr 2015 brachte eine Wende, der Aggregatzustand des Landes änderte sich, fortan bekam das Lebensgefühl etwas Banges, auch etwas Aufgekratztes.
Ich selbst spürte den Unterschied besonders deutlich bei einem Besuch in Tel Aviv. Israelische Freunde hatten zum Abendessen eingeladen, alles war laut und fröhlich, bis dann die Sprache unweigerlich auf die Lage in Israel kam. Es hatte Anschläge gegeben und Messerattacken, eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern rückte in immer weitere Ferne. Hinzu kam – für meine säkularen Freunde ein besonderes Ärgernis – die weitere Radikalisierung der ultraorthodoxen Juden und damit der innenpolitische Fundamentalismus. Irgendwann stellte ich die Frage, die ich schon oft gestellt hatte in diesem Land:
»Wie haltet ihr das bloß aus?«
Die Antwort kam prompt und mit einem spöttischen Lächeln: »Und ihr so?«
Ja, und wir so?
Damals, Mitte 2015, hatte diese Replik noch eine ironische Note, schließlich ließ es sich in Deutschland nach wie vor sehr gut leben, man war, jedenfalls im Vergleich zu Israel und Palästina, ziemlich sicher.
Aus heutiger Sicht bleibt einem die Ironie dann eher im Halse stecken. Denn das Jahr 2016 hatte noch einmal einen Schub an Verunsicherung gebracht, wie ihn wohl niemand für möglich gehalten hätte. Der Brexit, Donald Trumps Wahlsieg und sein erratisch-autoritäres Regieren, überhaupt der internationale Aufmarsch der Autoritären, das geht schon an die politisch-seelische Substanz der Menschen im Westen – jenem Westen, den es überdies in ein, zwei Jahren womöglich gar nicht mehr gibt, man weiß es nicht genau. Und was ist, nebenbei gefragt, mit der nuklearen Sicherheitsgarantie der NATO? Wird Europa von einem Trump-Amerika noch geschützt?
Das sind mittlerweile die Fragen, unerhörte, verstörende Fragen.
Ein weiteres Mal noch musste ich mich danach bei meiner Irritation irritieren lassen. Ein aus dem Libanon stammender Freund zuckte nur mit den Schultern, als ich ihm etwas atemlos beschrieb, wie sehr unsere Welt neuerdings aus den Fugen sei. »Unsere Welt war schon immer aus den Fugen«, gab er zurück.
Ja, so kann man es sehen. Der Gedanke lässt sich – zumindest aus der Sicht eines Arabers – sogar noch böser fassen: Das Chaos, das vom Westen überall auf der Welt geschaffen wurde, kehrt nun zu euch heim.
Gegen diese Sichtweise lässt sich manches einwenden, etwa dass vieles vom Chaos im Mittleren Osten auch hausgemacht ist, ja dass die Ausrede, der Westen sei schuld, zu den wichtigsten Ursachen arabischer oder islamischer Fehlentwicklung gehört.
Eigentlich jedoch verfehlt der libanesische Freund aus einem anderen Grunde den springenden Punkt. Nicht nur der Westen und der Mittlere Osten sind aus den Fugen, vielerorts auf der Welt scheinen, wie auf Kommando, gleichzeitig die Ordnungen zu wanken. Auch die westöstliche Türkei beispielsweise hat sich destabilisiert. Und im Afrika der Subsahara mag es widersprüchliche Tendenzen geben, unterm Strich wächst jedoch auch dort die Unsicherheit, nicht zuletzt deswegen erlebt die Welt jetzt die größten Fluchtbewegungen ihrer Geschichte.
In Ostasien hat derweil ein Kampf der Nationalismen begonnen, von dem man nicht weiß, wo er endet. Die Philippiner haben einen Mann zum Präsidenten gemacht, der mit dem Wort »durchgeknallt« noch freundlich umschrieben ist. Und natürlich dreht in einem solchen Umfeld auch der junge nordkoreanische Diktator Kim Yong Un, dessen ganzes politisches Kapital sich in der eigenen nuklear bewaffneten Unberechenbarkeit erschöpft, kräftig mit an der Irrsinnsschraube. Man will schließlich weiterhin auffallen als kleiner Teilstaat in einer großen, rasenden Welt.
Und Lateinamerika? Brasilien, Mexiko, Venezuela? Eben.
Nein, es handelt sich durchaus um ein globales Phänomen, nennen wir es vorerst: das Wüten der Welt.
Aber warum bloß? Natürlich sind sogleich Dutzende von Erklärungen zur Hand. Die Globalisierung, der Kampf der Kulturen, die wachsende Ungleichheit, der Hunger, die Arbeitslosigkeit. Manche lehnen sich in erkennbarer Abwehr der eigenen Verunsicherung tief zurück im Ledersessel der Geschichte, es habe doch seit alters her immer wieder Phasen von Stabilität und Instabilität gegeben, verkünden sie Pfeife paffend. Ja, das kann schon sein. Die letzte »Phase der Instabilität« indes ergab zwei Weltkriege, sie brachte Verwüstung, unendliches Leid, zig Millionen Tote und den Holocaust mit sich. Wenn es sich also tatsächlich um die »normalen« Rhythmen der Geschichte handeln sollte, dann wäre jetzt allerdings der Moment für den Aufstand gegen diese Rhythmen gekommen.
Doch ganz abgesehen davon, dass aus dem Ledersessel der Geschichte schnell ein Schleudersitz werden kann – solcherlei geschichtsphilosophische Betrachtungen erklären in Wahrheit nichts, sie kleben nur einen Namen auf die Ereignisse. Was allerdings auch für die anderen genannten Ursachen gilt. Vor allem für jene, die einen materiellen Niedergang für die subjektive Wut verantwortlich machen. Denn den Afrikanern beispielsweise geht es neuerdings besser, sie hungern seltener, sie sind besser ausgebildet und weniger krank als vor Jahren. Noch spektakulärer sind die Fortschritte in Asien, wo gleichwohl der Nationalismus immer aggressiver wird, wo die religiöse Intoleranz – siehe Indien – genauso schnell zunimmt wie das Bruttoinlandsprodukt. In den USA hat eine relative Mehrheit zu einem Zeitpunkt die Wut ins Weiße Haus gewählt, als die Arbeitslosigkeit sank und die Löhne endlich wieder anzogen. Und beim Brexit haben viele durchaus mit vollem Bewusstsein gegen ihre mutmaßlichen ökonomischen Interessen abgestimmt.
Nein, die ökonomischen Entwicklungen sind in den verschiedenen Ländern einerseits zu unterschiedlich und andererseits unterm Strich zu positiv, um das weltweite Phänomen der Wut damit erklären zu können. Selbst die umfassende Verunsicherung durch die Globalisierung vermag nicht plausibel zu machen, warum nun allenthalben Menschen – Männer – an die Macht kommen, die mit ihrer wilden Politik nur noch mehr Verunsicherung schaffen.
Die Antwort auf die Frage nach dem Warum sprang mich im Sommer 2016 an. Um Urlaub zu machen und aus Neugier auf den amerikanischen Wandel reiste ich mit meiner Freundin für fünf Wochen durch die USA. Florida, Washington, New York, Massachusetts, New Hampshire, Maine. Ich habe dabei viel gelernt über Trump- und Sanders-Wähler, über die amerikanische Zerknirschung, über ultra-aggressives Autodesign und über die zunehmend verzweifelte Selbstheroisierung der Amerikaner.
Die Wut der Welt begegnete mir an einem Sommerabend in Manhattan, Upper Eastside. In einer Stadt, in der man alles machen kann, ist das, was man dann macht, zuweilen etwas willkürlich. An diesem Abend war es nach einiger Sucherei im Netz schließlich Slam-Poetry. Trotz Reservierung mussten wir lange in der Schlange stehen; Zeit, das Publikum zu beobachten. Vor uns ein offenbar chinesischstämmiger Junge, den ich in Zeiten, da mit Adjektiven noch etwas laxer umgegangen wurde, als »dick« bezeichnet hätte. Hinter uns ein dünner junger Mann, ebenfalls asiatisch aussehend. An der immer länger werdenden Schlange lief derweil unentwegt mit großen Schritten ein Latino entlang, der, so flüsterte mir mein Vorurteils-Ich ein, in schwierigen sozialen Verhältnissen zu leben schien, auch er allenfalls Mitte zwanzig. Ebenso die Frau, die später die Tickets überprüfte.
Nach dem Einlass in den hohen ziegelroten Saal dann die erste Blamage – für mich. Alle, über die ich innerlich ein bisschen gelästert hatte, waren: Poeten. Und was für welche!
Zuerst trat der beleibte Chinese auf und slamte sich die Seele aus dem Leib. Er erzählte dabei so intensiv von seiner Rolle als Migrantenkind, von seinen Drogenproblemen und dem überforderten Elternhaus, dass es mich rührte. Und verstörte.
Dann der lange dünne Chinese. Er sprach schnell, der erste Satz, der bei mir hängen blieb, hieß: »Michelle Obama is not my mother.« »Ich wache nicht jeden Morgen in einem Haus auf, das von Sklaven gebaut wurde.« Damit griff er eine Formulierung der damaligen First Lady auf – und an –, die diese zu der Zeit häufig verwendete, um die Seltsamkeit ihres Daseins im Weißen Haus zu beschreiben, aber auch den Triumph, den das für eine Afroamerikanerin wie sie bedeutet. Genau in diese Opfer- und Erfolgsgeschichte wollte und konnte der junge Mann hier nicht einsteigen. Er sei Chinese, man erwarte von ihm, dass er gefälligst fleißig sei. Und gut in Mathe. »But I am not good at math«, schrie er mehr, als er es sagte.
Das alles trug er mit einer ungeheuren Kraft vor und mit einer poetischen Versiertheit, bei der man sich fragen konnte, wo er das mit seinen vielleicht 17 Jahren herhatte. Der Saal tobte, als er völlig verausgabt zum Ende kam.
Es folgte der Latino mit den großen Schritten, dessen Vortrag mehr gerappt als geslamt war. Tatsächlich lebte er in einem »Project«, also einer sozial brenzligen Siedlung mit besonderer staatlicher Betreuung. Und er arbeitete bei McDonald’s, nicht als Ferienjob, sondern zum Leben. »Aber ich will das nicht, das ist nicht mein Leben.« Äußerste soziale Ungeduld sprach aus ihm.
Schließlich die Ticket-Frau. Da war ich schon fast nicht mehr aufnahmefähig für all diese Intensität, diese Schicksale, diese, ja: Klasse.
Ihr Gedicht hieß: »I’m your modern house nigger«. Es handelte von ihrem dunkelhäutigen Vater aus der Dominikanischen Republik, der zum Zwecke eines »rassischen Upgrades der Familie« eine weiße Frau geheiratet hat. »Das Ergebnis bin ich. Nicht schwarz genug für die Schwarzen, nicht weiß genug für die Weißen, aber gut genug für die Hausarbeit.« Und wieder der Refrain: »I’m your modern house nigger.«
So ging das noch eine Weile, den Wettbewerb gewonnen hat schließlich eine junge Afroamerikanerin, die mit bezwingender Leichtigkeit und Eleganz ihre Diskriminierungserfahrungen erzählte und geschliffen dagegen andichtete.
Dieser Abend hatte mich überwältigt, aber was sollte ich damit anfangen, was blieb als Erkenntnis? Eine Menge. Zunächst mal: Diese Menschen waren nicht mehr bereit, irgendeine Art von Diskriminierung zu dulden, sei sie rassisch motiviert, sexuell oder sozial. Null, zero, keine verdammte Sekunde lang. Sie wehrten sich und sie waren gut darin, wortgewaltig und gefühlsmächtig.
Nebenbei fiel noch eine für mich recht unbequeme Erkenntnis ab: Für einen privilegierten weißen heterosexuellen älteren Mann gab es hier kaum einen moralischen Bewegungsraum. Ein einziger Slammer von meiner Sorte war aufgetreten, auch er brillant, doch flüchtete sich dieser Mann in reine Poesie, kein politisches Anliegen, kein identitärer Anspruch. Heimlich fragte ich mich, wie ein minder eloquenter und weniger privilegierter weißer Trucker wohl mit diesem Sturm der Begabten umgehen würde. Die Antwort erhielt ich dann einige Monate später, am 8. November, sie hieß: Trump.
Denn, das sollte ich auf meiner Reise noch erfahren, auch außerhalb von New York und auch bei weißen, älteren, nicht sehr gebildeten Männern wuchs die Ungeduld gewaltig, wenn auch in entgegengesetzte politische Richtung. Aber auch sie haben eine Form erschaffen, sich auszudrücken, ungereimt, vielleicht auch ungeschlacht, aber was soll’s: In Donald Trump haben sie einen Mann gefunden, der ihnen wieder Gehör verschafft. Jahrzehntelang waren sie von den Demokraten, im Grunde also: von ihrer Partei, mehr und mehr ignoriert worden. Die Republikaner wiederum hatten dieses Milieu mit dem amerikanischen Traum getränkt und mit religiösen Argumenten dazu gebracht, wieder und wieder gegen die eigenen ökonomischen Interessen zu wählen. Nun hatten diese so oft betrogenen Weißen, jedenfalls sehr viele von ihnen, genug. Bernie Sanders, den Sozialisten, boten ihnen die Demokraten nicht zur Wahl an, und bei den Republikanern stand plötzlich ein Etablierter gegen das Establishment, einer, der erkennbar nicht christlich lebte oder auch nicht leben wollte. Egal, Hauptsache, Revolte.
In den Hügeln der Appalachen und in einem alternativen Klub der Upper East Side also dieselbe Botschaft: Es reicht.
Hier lag es, das Epizentrum des Weltbebens. Menschen, die nicht mehr bereit waren zu dulden, sich zu gedulden. Und die ohne Weiteres in der Lage waren, ihren im Kern ohnehin kaum bezweifelbaren Ansprüchen Gehör zu verschaffen. So wie der Afrikaner, der ohne jede Perspektive in Liberia lebt oder in Nigeria. Oder im Tschad. Er kann jetzt vergleichen, weil er ein Handy hat. Und er kann weg, weil er ein bisschen Geld und ein bisschen Bildung und – wiederum – ein Handy hat.
Diese New Yorker Abendgedanken brachten mich zurück zum Gespräch mit einem außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Der hatte mir wenige Wochen zuvor eine kleine Anekdote erzählt. Beim Besuch des Präsidenten des Tschad, Idriss Déby, habe der seit Jahrzehnten regierende Diktator des Landes zu Angela Merkel gesagt, er überlege neuerdings wegen dieser sozialen Medien, Sie wissen schon!, ob er sein Volk künftig nicht doch ein wenig am politischen Prozess beteiligen müsse. Die Kanzlerin soll aufmunternd genickt haben.
Als ich mich an jenem Abend in Manhattan aus der Überwältigung gelöst und das Erlebte sortiert hatte, fiel mir ein, wo ich etwas Ähnliches schon einmal erlebt hatte, wenn auch nicht ganz so intensiv. Das war im deutschen Wahljahr 2013. Da hatten einige junge Feministinnen den damaligen Spitzenkandidaten der FDP, Rainer Brüderle, politisch gewissermaßen schachmatt gesetzt. Unter dem Hashtag »#Aufschrei« hatten sie eine Twitter-Kampagne gegen eine sexistische Bemerkung von Brüderle gestartet, die alsbald über diesen Einzelfall weit hinausging – eben weil sexuelle Belästigung auch im fortschrittlichen Deutschland noch immer kein Einzelfall ist.
Mich überraschte damals nicht die Stoßrichtung der Kampagne, wohl aber die Wut, die darin spürbar wurde. Also traf ich mich mit einigen der »Aufschrei«-Frauen. Ich wollte wissen, woher die Vehemenz kam. Schließlich, so mein Gedanke, hatte es in den letzten Jahrzehnten doch immense Fortschritte gegeben auf dem Felde der Emanzipation. In meiner Jugend im Ruhrgebiet wurden Frauen noch routinemäßig geschlagen, Abtreibung stand unter Strafe, Vergewaltigung in der Ehe hingegen nicht. Warum also jetzt so viel Theater um so wenig Diskriminierung? Die Aufschrei-Frauen wunderten sich nur über meine Verwunderung. Denn sie verglichen das, was sie erlebten, nicht mit den 60er-Jahren, sondern mit dem Idealzustand, für sie der umgehend herbeizuführende Normalzustand. Und natürlich: Warum sollten junge Frauen unter dreißig bereit sein, überhaupt irgendeine Art von Herabsetzung oder Benachteiligung zu akzeptieren, einen Euro Gehalt zu wenig, eine sexistische Bemerkung zu viel? Und Geduld? Warum denn Geduld? Und zu wessen Nutzen?
Selbstverständlich: Die Lebenslagen eines Schwarzen im Tschad, einer Latina in Manhattan und einer Mittelschichtsfrau aus Berlin könnten ungleicher kaum sein, doch das Prinzip ist ähnlich. Sie vergleichen nicht mehr mit der Vergangenheit, sondern mit dem, was ihnen als Optimum vor Augen steht; sie sehen nicht ein, warum sie warten sollten und worauf; sie sind in der Lage, sich zu artikulieren, sich zu bewegen, zu agieren; und sie lassen sich von all den Ideologien nicht länger beeindrucken, die ihnen einreden, dass es eben ihre Bestimmung oder ihre Natur oder der Wille eines Gottes sei, da zu bleiben, wo sie sind, dass Ertragen edel sei oder fromm oder unausweichlich. So erklärt sich auch der Widerspruch, dass in den USA Menschen, die sich als streng gläubig definieren, millionenfach einen Mann gewählt haben, der ostentativ lügt und dessen Reden und Denken von Sex erfüllt zu sein scheint. Den Glauben, das kann man ihnen abnehmen, haben diese Amerikaner nach wie vor, aber selbst sie lassen sich davon nicht mehr in die Demut drängen.
Diese, wie soll man sagen, revolutionäre Ungeduld hat noch längst nicht alle Menschen erfasst – aber schon zu viele, als dass es in absehbarer Zeit wieder so stabil werden könnte, wie es einmal war. Und es gibt so viele Ungeduldige, dass diejenigen, die fürchten, dabei etwas zu verlieren, zum Gegenaufstand blasen. Was in gewisser Weise auch zu verstehen ist. Denn die Rebellion gegen jedwede Diskriminierung lässt sich nicht so leicht als ein Angebot zu einem neuen Wir interpretieren. Und die Aufmerksamkeit, um die alle nun miteinander ringen, ist keine unendliche Ressource, die Beachtung des einen erscheint leicht als Missachtung des anderen.
Die Stabilität von Staaten und Religionen beruht, das zeigt sich jetzt in aller Einfachheit und Klarheit, nicht in erster Linie auf Institutionen, nicht mal auf Macht und Gewalt, sondern auf etwas ganz anderem: auf der Demut der Gedemütigten. Und damit geht es nun zu Ende, diese Ressource ist fast völlig aufgebraucht.
Darum bebt die Erde.
Man kann es auch schlichter ausdrücken: Die Ansprüche der Menschen steigen schneller als alles, was die Politik ihnen bieten kann. Barack Obama, nebenberuflich einer der klügsten Zeitdiagnostiker Amerikas, hat es am 8. Oktober 2016 im Economist so auf den Punkt gebracht: »Die Erwartungen steigen schneller, als die Regierungen liefern können, ein tief greifendes Gefühl von Ungerechtigkeit unterminiert den Glauben der Menschen an das System.«[1]
Ist das nicht alles furchtbar und heillos und erschreckend? Nein, nicht nur, es ist auch wunderbar.
Angesichts der neuen Unsicherheiten fällt es wohl jedem schwer, das so zu empfinden, aber dennoch: An der Basis dieses Bebens explodieren legitime Ansprüche. Die politische Urgewalt, die da losbricht, ist etwas Gutes, eine Befreiung. Wenngleich sie sich, vorerst, als eine Überforderung aller durch alle darstellt.
Die ganze Welt, zumindest der Teil, der durch das Internet verknüpft ist, wird gerade mit hohem Tempo zu einer Eins-zu-eins-Gesellschaft. Jeder muss darauf gefasst sein, dass derjenige, über den man redet, jederzeit auch mitreden oder gar vor der Tür stehen kann. Daraus ergibt sich eine Diskursregel, die bescheiden daherkommt, aber Systeme zum Einsturz bringen und Menschen in Panik versetzen kann: Nur was ich jemandem direkt ins Gesicht sagen kann, vermag auch Anspruch auf Geltung zu erheben.
Es ist leicht, bei einem wirtschaftlichen Symposium vom Trickle-down-Effekt zu schwärmen, also von der Idee, dass man den Reichen nur genug geben müsse, dann würde für die Armen auch irgendwann was abfallen – oder zu begründen, warum Manager 500 mal mehr verdienen müssen als ein gewöhnlicher Angestellter. Sogar von Professoren geäußerte Gegenpositionen tun da dem Ganzen keinen Abbruch, im Gegenteil, sie runden den Diskurs noch ab. Aber wie will man das einem einfachen Arbeiter erklären? Da stocken dann die Argumente, und der Schweiß tritt auf die Stirn.
Gewiss lässt sich die stimulierende Wirkung einer niedrigen Erbschaftssteuer wissenschaftlich herleiten. Aber wenn ein 15-jähriger einem anderen 15-jährigen erklären soll, warum der in seinem ganzen Leben nicht einmal einen Bruchteil dessen wird verdienen können, was der andere bereits hat, ohne je einen Finger dafür gerührt zu haben, dann wird es haarig.
Ohne Zweifel ist es menschlich und legitim, wenn deutsche Eltern klagen, dass ihre Kinder schon seit Wochen keinen Sportunterricht haben, weil die Turnhalle von Flüchtlingen belegt ist – bis ein Flüchtling aufsteht und sagt, dass seine Kinder im Mittelmeer ertrunken sind. Doch auch wenn die Klage der Privilegierten zwischendurch verstummt, wenn ihr Leiden relativiert ist, so sind ihre Probleme dadurch noch nicht verschwunden.
Es hat ja keinen Zweck mehr, drumherum zu reden: Tatsächlich beruhte die Wirkung vieler Argumente, die soziale, geschlechtliche oder rassische Diskriminierung erklären oder sogar legitimieren sollten, weniger auf innerer Logik als auf äußerem Abstand, darauf also, dass die je Benachteiligten nicht im (öffentlichen) Raum präsent waren. Oder dass sie schüchtern waren. Oder dass ihnen die Worte fehlten. Oder dass ihnen das Hirn verklebt war von Unterwerfungsideologien.
Das ist es vielleicht, was an diesem Umbruch unserer Welt am meisten beunruhigt, aber auch bewegt: Die Wirkung vieler Argumente beruhte weniger auf Plausibilität als vielmehr auf Macht. Das gilt, wie noch zu zeigen sein wird, auch für die westliche Außenpolitik, für ihren scheinbaren Realismus. Es gilt in gewissem Maße allerdings auch für die liberalen Eliten, die im Westen, gerade in Deutschland, für lange Zeit unangefochten hegemonial waren. In dieser Hegemoniephase gewöhnten sie sich etwas zu sehr an die Wirkung der eigenen Argumente, verstanden nicht, dass sie durch Macht verstärkt waren oder durch die Angst vieler Menschen, bloßgestellt zu werden von den Wortmächtigen. Sie glaubten auch etwas zu häufig, ihre Wahrheiten seien so selbstverständlich, dass jene, die sie nicht verstehen, dumm oder böse sein müssten. Die Tabuzone wurde ausgedehnt, anstatt das Argument zu schärfen.
Das bedeutet nun natürlich nicht, dass alles Hierarchische sogleich verdampft, dass jedes Tabu falsch ist, dass jeder Unterschied zu Unrecht wird. Aber es bedeutet, dass alles unter einen nie da gewesenen Legitimationsdruck kommt. Vieles wird darunter zerbröseln, gewiss der Trickle-down-Effekt.
Alle spüren heute die immense Kraft der Veränderung, die in dieser globalen Eins-zu-eins-Gesellschaft steckt – entsprechend stark sind die Gegenkräfte. Denn so kann man es selbstverständlich auch drehen: Wenn Privilegien weniger auf Plausibilität beruhen denn auf dem Abstand zu den Unterprivilegierten, dann muss eben der Abstand wiederhergestellt werden, notfalls mit Gewalt. Gegen die neue Nähe durch das Internet, den globalen Handel, die räumliche Mobilität werden dann Mauern gebaut. Aus Beton gegen die Migration; aus Geld gegen die ohne Geld; aus Bildungsdünkel gegen die ohne Abitur; aus religiösem Fundamentalismus gegen die Zweifel, die aus dem Vergleichen erwachsen.
Die Revolution der Nähe und die Konterrevolution des Abstands schicken ihre Schockwellen über den Globus – und gegeneinander. Und wir können sagen, wir sind dabei gewesen.
Noch ein Mauerfall – was uns die Flüchtlinge bringen
Was sich vollzieht, ist so etwas wie eine Revolution. Sie wird (hoffentlich) anders ablaufen als jene historischen Revolutionen, die einem sofort einfallen, wenn man das Wort hört – also ohne Sturm auf die Bastille, ohne Jakobiner an der Macht und ohne Guillotine; ohne Sturm auf das Winterpalais mit anschließender Diktatur der Arbeiterführer; ohne parallel mitlaufende Sklaverei und blutige Eroberung eines Kontinents.
Eine Revolution ist es gleichwohl, weil sich zu viel auf einmal wandelt, mehr, als von den bestehenden Systemen so schnell absorbiert werden kann. Von der Explosion der Ansprüche war schon die Rede, auch von der zur Neige gehenden Stabilitätsreserve »Demut der Gedemütigten«. Eine dritte große Bewegung auf diesem Feld stellt der neueste, vielleicht der letzte große Mauerfall dar, der zwischen der vormals Ersten und der vermeintlich Dritten Welt. Er ist vielleicht noch bedeutender, noch fundamentaler als der Mauerfall zwischen Erster und Zweiter Welt, zwischen westlichem Kapitalismus und östlichem Kommunismus in den Jahren 1988 bis 1990. Fundamentaler unter anderem deswegen, weil diesmal nicht nur die eine Seite ins Wanken gerät, sondern beide Seiten, also auch jene Nationen und Mächte, die seit 500 Jahren den Globus beherrschen.
Der Westen, keine Frage, wankt.
Formal ging der Kolonialismus schon in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu Ende, wenngleich das die meisten Kolonisierten bestreiten oder als heuchlerisch bezeichnen würden. Denn auch nachdem die nicht-westlichen Länder ihre staatliche Souveränität erlangt hatten, blieb das ökonomische, militärische und politische Machtgefälle so ungeheuer groß, dass von echter, sachhaltiger Souveränität keine Rede sein konnte. Bis vor Kurzem konnte der Westen sich aus dem Süden noch einseitig holen, was er brauchte, seien es Drogen, Arbeiter oder Prostituierte. Er konnte dort arbeiten lassen, zu Bedingungen, die daheim niemand akzeptieren würde. Er konnte dorthin exportieren, was ihm beliebte, von Waren über Waffen bis zum Tourismus und dem Müll. All dies, ohne dass die massiven Auswirkungen dort zu vergleichbar massiven Rückwirkungen hier geführt hätten. Globalisierung war eine Einbahnstraße.
Das ändert sich seit einer Weile rapide. Zum einen wachsen die vormals verlängerten Werkbänke der westlichen Industriegesellschaften besonders in Asien zu echten Konkurrenten auf. Zum anderen führte das vom Westen mit verursachte Chaos im Mittleren Osten dazu, dass islamistischer Terrorismus immer öfter auch nach Europa und in die USA getragen wird. Die dritte Rückwirkung auf den Westen ist die wichtigste, die aufregendste, die revolutionärste: Flucht und Migration.
Es kommen Menschen in großer Zahl, die man nicht bloß als ökonomische Konkurrenz abtun kann und die sich nicht wie Terroristen moralisch und militärisch abwehren lassen. Diese Flüchtlinge sind Menschen mit allem Drum und Dran. Sie stellen sicher auch eine wirtschaftliche Herausforderung dar, vor allem aber eine kulturelle und moralische.
Kontrollieren lässt sich diese Bewegung offenkundig nur sehr schwer, denn sonst würden nicht in den USA, ein Land, das im Westen und Osten von zwei Ozeanen sowie im Norden von 35 Millionen wenig auswanderungswilligen Kanadiern umgeben ist, elf Millionen illegale Einwanderer leben. Sonst würde Europa sich nicht mit Millionen Flüchtlingen und Einwanderern aus Afrika und dem Mittleren Osten so unendlich schwertun.
Mit all diesen Menschen wird die globale Eins-zu-eins-Gesellschaft für jeden greifbar. Sie sind die Verkörperung eines Gezeitenwechsels, der sich zwischen Erster und vormals Dritter Welt vollzieht. Politisch lässt sich der Kern dieser Revolution leicht benennen. Es geht um das Ende der rücksichtslosen Ausbeutung, aber auch des bloß karitativen Helfens. Denn auch das gehörte ja komplementär zusammen, die gnadenlose Ausbeutung und das gnadenvolle Geben.
Die kopernikanische Wende im Verhältnis der beiden Welten lässt sich so auf eine Formel bringen: Heute hat der Westen erstmals in der Geschichte ein massives, dringendes und materielles Interesse daran, dass es den Menschen »da unten« mindestens so gut geht, dass sie nicht in zu großer Zahl kommen.
Die Flüchtlinge von Lampedusa oder von den griechischen Inseln, die Hispanics, die den Rio Grande überqueren oder über das Karibische Meer kommen, sie erzwingen eine völlig neue Nachbarschaftlichkeit – oder aber einen neuen Grad von Abschottung mit bisher nicht gekannter Brutalität und Rigorosität.
Die obszöne Ungleichheit zwischen Erster und Dritter Welt lässt sich nicht länger verdrängen oder vernebeln. Entweder sie wird nun rasch verringert oder aber der gewalttätige Kern dieser Ungleichheit tritt offen zutage. Keine angenehmen Alternativen sind das, aber vielleicht steckt in alldem eine Chance auf Befreiung auch für den Westen.
Das Potenzial, das darin steckt, überhaupt zu erkennen oder gar zu erleben, scheint zurzeit fast unmöglich. Das wiederum liegt zuallererst an den Umständen, unter denen sich diese Bewegung vollzieht. Denn ausgerechnet in der Phase, in der nun die Menschen außerhalb des Westens auf die eine oder andere Weise ihre Ansprüche geltend machen, ausgerechnet jetzt haben auch viele Menschen im Westen von erfahrener und gefühlter Ungleichheit innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften genug. Zweierlei Ungerechtigkeiten prallen aufeinander, die nur schwer miteinander zu vermitteln sind. Denn diejenigen in den USA oder in Europa, die sich als Verlierer der Globalisierung fühlen, sehen die Migranten zunächst mal als Menschen mit konkurrierenden Gerechtigkeitsansprüchen. Wer andersherum aus einem korrupten und verarmten Kaff in Mexiko in die USA kommt oder aus dem von Kriegen verheerten Irak nach Deutschland, der wird die Armen des Westens selbstverständlich als relativ Reiche empfinden.
Revolutionäre Zeiten mögen sich ihre eigenen Mythen schaffen, aber sie enthüllen auch immer Wahrheiten über die Welt, die sie gerade umstürzen. »Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug erst bei einbrechender Dämmerung«, hat der Philosoph Hegel gesagt. Sie ist schon losgeflogen. Zu den neuerdings freigelegten Wahrheiten gehört eine bittere Erkenntnis über den Westen, vor allem über die USA. In den vergangenen beiden Jahrzehnten, als die Globalisierung bereits auf Hochtouren lief, wurden die daraus entspringenden gigantischen Surplusgewinne für den Westen nicht etwa dazu genutzt, den Armen zu helfen oder die Mittelschichten zu stabilisieren, sondern in erster Linie dazu, die Reichen noch viel reicher zu machen, so reich, dass sie nun ihrerseits – jedenfalls in den USA – genug Macht haben, um die Demokratie zu obstruieren, zu delegitimieren und de facto zu unterwandern.