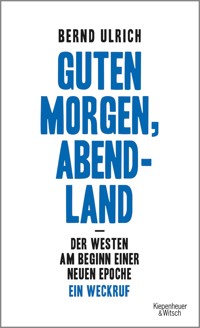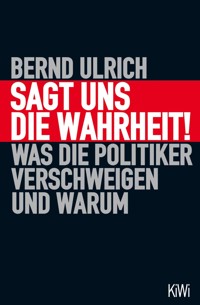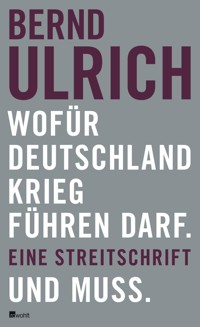
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Krieg hat keine Macht mehr über uns, Gott sei Dank. Doch er scheidet noch immer die Geister: Er ist der moralische Ernstfall für Staaten, auch für demokratische. Selbst wer sich sonst für Politik kaum interessiert, hier fühlt er sich aufgerufen, Partei zu ergreifen. Aber wie und nach welchen Kriterien? Darüber ist viel Verwirrung entstanden, zuletzt beim Libyen-Krieg, an dem Deutschland nicht teilgenommen hat. Und wir merken: Auch Kriege, die man nicht führt, können einen verändern. Dieses Buch zieht eine Bilanz nach zwei Kriegen im Irak, zweien auf dem Balkan, einem in Afghanistan und einem in Nordafrika. Es unterscheidet zwischen richtigen und falschen Kriegen und liefert Kriterien dafür, wie Deutschland sich künftig verhalten soll. Es ist darin anders als andere Bücher über dieses Thema. Denn weil Krieg immer eine Einladung zum Machismo ist, geben sich Bücher über ihn oft allwissend, zweifelsfrei, unerschütterlich: Gedankengänge als Waffengänge. Dabei hängt die Einstellung zum Krieg nicht zuerst von Theorien ab, sondern von Biographien und Begegnungen. Darum lebt dieses Buch, außer von den Erfahrungen des Autors, namentlich von der lebendigen und alltäglichen Auseinandersetzung mit einem Mann, der mehr vom Krieg und von der Geschichte weiß als die meisten anderen – mit Helmut Schmidt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Bernd Ulrich
Wofür Deutschland Krieg führen darf. Und muss.
Eine Streitschrift
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Schmidt
«Kriegsbücher langweilen mich zu Tode. Ich verachte den maskulinen Blick. Mich langweilen ihr Heroismus, ihre Tugend und Ehre. Ich denke, das Beste, was diese Männer tun können, ist, nicht mehr von sich selbst zu reden.»
VIRGINIA WOOLF
1.Die Freitagskonferenz oder: Der Offizier und der Ungediente
Der Krieg ist nicht mehr entscheidend für unser Leben. Er hat keine Macht über uns, Gott sei Dank. Doch er scheidet immer noch die Geister, er ist der moralische Ernstfall für Staaten, auch für demokratische. Selbst wer sich sonst für Politik nicht sonderlich interessiert, fühlt sich hier aufgerufen, hinzusehen und sich zu positionieren, irgendwie. Und der Krieg hört nicht auf. Seit dem Ende des Kalten Krieges standen die Deutschen ein halbes Dutzend Mal vor der Frage, ob sie sich an einer größeren Militärintervention beteiligen wollen oder nicht. Und so vorsichtig man heute mit Prognosen sein sollte, so sicher lässt sich doch sagen: So wird es vorerst bleiben. Deutschland wird gefragt sein.
Welche Antworten geben wir? Darüber ist viel Streit entstanden und einige Verwirrung, zuletzt beim Libyen-Krieg, an dem dieses Land nicht teilgenommen hat. Deutschland hatte sich im UN-Sicherheitsrat enthalten, und wir merken: Auch Kriege, die man nicht führt, können einen verändern.
Dieses Buch ist der Versuch, ein wenig Ordnung zu schaffen, eine Bilanz zu ziehen nach zwei Kriegen im Irak, zweien auf dem Balkan, einem in Afghanistan und einem in Nordafrika. Es versucht, zwischen richtigen und falschen Kriegen zu unterscheiden, es möchte Kriterien dafür liefern, wie Deutschland sich in künftigen Entscheidungssituationen verhalten soll. Es ist für all jene geschrieben, die sich den Kopf zerbrechen über die Kriege, die geführt, und über die, die nicht geführt werden. Es richtet sich an diejenigen, die überlegen, wie sie entscheiden würden, wenn sie an der Macht wären, und die unter Umständen ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen, wie sich eine Partei in Fragen von Krieg und Frieden verhält.
Krieg ist immer eine Einladung zum Machismo, das gilt schon für die Diskussionen darüber, und es gilt auch für Bücher über den Krieg. Sie geben sich oft allwissend, zweifelsfrei, wie vom Berge geholt: Gedankengänge als Waffengänge. Dabei hängt die Einstellung zum Krieg nicht zuerst von abstrakten Erwägungen ab, sondern von der eigenen Biographie. Darum soll in diesem Buch Erlebtes, Erfahrenes und Erdachtes zusammengebracht und offengelegt werden, wie die eigenen Thesen entstanden sind. Es dokumentiert den Streit nicht nur zwischen politischen Auffassungen, sondern auch zwischen Generationen. Es kommt über die Irrtümer, auch über meine eigenen, nicht über die Gewissheiten, und hier und da wird es unweigerlich persönlich.
Nachrüstung und Nasenbluten
Meine erste Begegnung mit Helmut Schmidt fand im Frühjahr 2003 statt. Sie war ein Desaster – nicht für ihn natürlich, aber für mich. Als künftiger Berliner Büroleiter der ZEIT saß ich in Anzug und Krawatte vor seinem Schreibtisch, um uns die nikotingelben, mit Sachbüchern überfüllten Billy-Regale, zwischen uns ein altmodischer Aschenbecher, in dem von Zeit zu Zeit kreiselnd die Kippen verschwanden. Ein Antrittsbesuch. Schmidt, der seine Gäste meist neugierig ausfragt, konnte mit mir offenbar wenig anfangen. Er wusste wohl, dass ich vor Jahren für die Grünen im Bundestag gearbeitet hatte und dass ich den amtierenden Außenminister seitdem ganz gut kannte, aber nach einem Joschka Fischer pflegte Helmut Schmidt nicht zu fragen. Stattdessen hielt er einen politischen Monolog, beginnend mit der Weltlage, übergehend zu Europa, man ahnte schon, das Ganze würde in der Berliner Landespolitik enden, Schmidt interessiert auch die Stadtpolitik.
Plötzlich, der Altkanzler kritisierte gerade die Führungsschwäche der EU, fing meine Nase an zu bluten. Das Blut schoss geradezu heraus. Zum Glück hatte ich mit Rücksicht auf meinen neuen hanseatischen Arbeitgeber ein weißes Stofftaschentuch eingesteckt; das jedoch war schon vollgesogen, bevor Schmidt die viel zu geringe Bedeutung des europäischen Parlaments auch nur in Umrissen skizziert hatte. Das Bluten ließ nicht nach, ich dachte: ausgerechnet jetzt, ausgerechnet vor ihm so eine Schwäche, Kriegsdienstverweigerer vor Wehrmachtsoffizier! Die aufsteigende Beklemmung ließ meine Nase noch schlimmer bluten. Schmidt nahm von alldem keine Notiz, referierte, rauchte, referierte, und zwischendurch schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch.
Schließlich raunzte er mich an: «Was haben Sie denn da mit Ihrer Nase!», und riss zwei Tücher aus einer Kleenex-Box. Das brachte mir immerhin einen kleinen Zeitgewinn, doch als er ungerührt in die Tiefen der hauptstädtischen Landespolitik vordrang, war ich mit den Nerven herunter. Endlich kam Schmidt zum Schluss, und ich verließ fluchtartig das Büro, stahl mich an seiner Sekretärin vorbei und meinte im Augenwinkel noch ein Grinsen auf dem Gesicht seines Bodyguards zu erkennen.
Nie vorher und nie danach hatte ich solches Nasenbluten, und bis heute weiß ich nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil es gar nicht die erste Begegnung mit ihm war. In meinem Kopf war er schon lange präsent: Ähnlich wie viele andere meines Jahrgangs (1960) bin ich wegen Schmidt überhaupt ein politischer Mensch geworden, genauer gesagt: gegen ihn. Mit achtzehn, neunzehn fand ich ihn autoritär und ignorant gegenüber dem «Umweltschutz», wie die Ökologie zu der Zeit noch genannt wurde. Doch vor allem war er für mich, wie für Millionen andere, der Mann der Nachrüstung, der Kanzler, der es zuließ, dass die Amerikaner neue atomare Mittelstreckenraketen nach Deutschland brachten. Damals schrieb ich ein Flugblatt mit der Überschrift: «Ich heiße Schmidt und mache alles mit!»
Das sollte, was Schmidt angeht, mein erstes großes Missverständnis sein. Schließlich ließ er als Kanzler die Nachrüstung der Amerikaner nicht einfach zu, vielmehr umgekehrt: Es war Schmidt, der Washington erst darauf brachte, Pershing II und Cruise-Missiles auf deutschem Boden zu stationieren. Dabei war Schmidts Motiv nicht etwa Feindschaft gegenüber den Russen, sondern Skepsis gegenüber den Amerikanern. Er glaubte nicht, dass die USA im Falle eines atomaren Angriffs der Sowjetunion auf Europa mit interkontinentalen Raketen zurückschlagen würden; das nämlich hätte bedeutet, dass ein US-Präsident zur Rettung eines fast schon zerstörten Europas den nuklearen Overkill der USA heraufbeschwören muss. In der Logik der atomaren Abschreckung brauchte es daher genügend amerikanische Atomraketen mittlerer Reichweite auf deutschem Boden, damit die USA im Ernstfall sofort mittendrin stehen würden. Aus heutiger Sicht mag das alles unverständlich und so vergangen wirken wie die Punischen Kriege, doch Anfang der achtziger Jahre gehörte solches Spezialwissen zum politischen Grundwortschatz.
Schmidt hat also im atomaren Poker den Einsatz erhöht, damit Deutschland nicht zum Verlierer wird. Ob das richtig oder falsch war, sei dahingestellt. Jedenfalls zeugt es von eminenter Kaltblütigkeit, in einem Wettrüsten mitzuspielen, das im äußersten Fall zur Vernichtung der ganzen Menschheit führen kann. Und es verlangt einigen Mut. Immerhin hat sich Schmidt mit seinem Kurs gegen die Mehrheit seiner Partei, der SPD, gestellt, in der er am Ende ein einsamer Mann war. Nur eine Handvoll Stimmen erhielt der scheidende Kanzler im November 1983 auf dem Kölner Parteitag noch für seine Position. Es gehörte zu der Zeit ohnehin mehr Courage dazu, für die Nachrüstung zu sein als dagegen. Die Mehrheitsmeinung, insbesondere die veröffentlichte Meinung, war pazifistisch gestimmt.
Dennoch konnte sich Schmidts Politik durchsetzen. Und der nukleare Rüstungswettlauf hat nicht zum Atomkrieg geführt, sondern dazu beigetragen, dass die Sowjetunion wenige Jahre später unter dem Druck des ruinösen Wettrüstens zusammengebrochen ist. Dass Helmut Schmidt damals die Rolle des Aufrüsters spielte, hat mir seine wahren Auffassungen zum Thema Krieg und Frieden lange verborgen gehalten; heute weiß ich, dass er ein Beinahe-Pazifist ist, dass die Haltung des rechten Sozialdemokraten zu den Deutschen und zum Militärbündnis NATO denen des vormaligen Linksradikalen Joschka Fischer verblüffend ähnelt, dass er ein Mann ist, der ein Jahrhundert Kriegs- und Lebenserfahrung in sich trägt. Auch von dem, was an seinem Denken Vergangenheit zu werden beginnt und was bleiben wird, handelt dieses Buch.
Fast wie regieren
Unserer ersten leibhaftigen Begegnung folgten bis heute noch einige hundert weitere, die meisten davon in jener Sitzung, die Woche für Woche freitags um zwölf Uhr in einem kleinen Raum im Pressehaus des Hamburger Speersort stattfindet, der Freitagskonferenz des politischen Ressorts der ZEIT. Anwesend sind meist auch der Chefredakteur, seine Stellvertreter, zudem Herausgeber sowie ehemalige Chefredakteure in Mannschaftsstärke.
Diese Freitagsrunde ist nicht nur im Journalismus einzigartig, von ihr sagt Helmut Schmidt, sie sei oft besser als Kabinettssitzungen. Die Diskussionen dienen weniger dem operativen Zeitungsgeschäft als einer politischen Selbstvergewisserung, sind mehr ein Als-ob-Regieren. Wenn von «wir» die Rede ist, bleibt meist unklar, ob es sich um «wir, die ZEIT» handelt, «wir, die Deutschen», «wir, der Westen» oder sogar, wie einmal gesagt wurde, «wir, die NATO». Schmidt ist zudem nicht der Einzige in der Runde, der aus der Politik kommt. Michael Naumann war einmal Kulturstaatsminister, und Theo Sommer, langjähriger Chefredakteur der Zeitung, hat einstmals unter Helmut Schmidt als Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium gedient.
Eine Vielfalt drängt sich da jede Woche in dem verrauchten Raum, wie man sie so nicht leicht woanders findet: Manche der Teilnehmer verkehren regelmäßig in internationalen Thinktanks, andere durchqueren auf dem Motorrad den Kongo, die Jüngste ist 27, der Älteste 92 Jahre alt. Mittlerweile weist die Runde auch zahlreiche nicht-deutsche Herkünfte auf, italienische, polnische, vietnamesische, türkische. Politisch gesehen, finden sich hier Linke und Rechte, Liberale und Grüne, kriegspolitisch vertreten sind Interventionisten, Pazifisten und Antiimperialisten. Das natürliche Zentrum aller Debatten über den Krieg bildet dabei Helmut Schmidt. Es macht eben einen immensen Unterschied, ob man das Thema abstrakt diskutiert oder mit jemandem, der weiß, wovon er redet, wenn er vom Krieg spricht.
Die fachlich versierten und rhetorisch scharfen Debatten mit ihren schnellen Wortwechseln führen dazu, dass früher oder später auch lange unausgesprochene Argumente auf den Tisch kommen, die Tabus, die dunklen Punkte. In den letzten Jahren allerdings ist in der zumeist äußerst lebhaften und gewiss nicht von übertriebener Bescheidenheit geprägten Gruppe etwas Neues eingezogen: Schweigen, dann und wann. Nicht, weil man sich nichts mehr zu sagen hätte, das hat man immer, vielmehr, weil an manchen Punkten keiner mehr eine Antwort weiß und keiner mehr so tun will, als hätte er doch eine. Besonders häufig passiert das beim Thema Afghanistan, weil dort ein Krieg schiefzugehen droht, aus dem man sich aus bündnispolitischen Gründen kaum einseitig zurückziehen kann. Das ist der erste Grund, warum dieses Buch entstanden ist: Wovon genau handelt eigentlich unser Schweigen?
Der zweite Grund und letzte Auslöser war eine Diskussion über den Libyen-Einsatz im März 2011, in deren Verlauf sich eine nie da gewesene Koalition gegen die deutsche Teilnahme ergab: Der Antiimperialist war dagegen, weil er argwöhnte, dass es wieder nur um die Öl-Interessen des Westens ginge; der Amerika-Freund war dagegen, weil er fürchtete, dass es gerade nicht um handfeste Interessen des Westens ging, sondern womöglich, kaum auszudenken, bloß um Werte; und der prinzipielle Antiinterventionist sorgte sich um die Reaktion der Moslems in der Region, wenn der Westen nach Afghanistan und Irak in einem weiteren Land des Mittleren Ostens eingreifen würde. Drei gegensätzliche Weltbilder, drei von sehr unterschiedlichen Biographien geprägte Haltungen wenden sich gemeinsam gegen einen Krieg, der vom gesamten westlichen Bündnis (außer Deutschland) getragen wird – mit dieser überraschenden Einigkeit gegen die Einheit des Westens war ganz offenkundig ein Wendepunkt in unseren Kriegsdebatten erreicht. Anscheinend funktionierten die alten geistigen Instrumente nicht mehr.
2.Die Deutschen, der Krieg und die weißen Jahrgänge
Biographie ist kein Argument, schon gar nicht beim Thema Krieg. Eine Redlichkeit ohne das Sprechen über die eigene Biographie gibt es hier aber auch nicht, denn wir alle haben schon ein Gefühl für Krieg und Frieden, lange bevor wir uns mit den Theorien oder mit der Ethik des Krieges beschäftigt haben.
Mein Vater ist 1936 geboren. In den sechziger Jahren zählte man ihn zu den «weißen Jahrgängen», das heißt zu denen, die während des Zweiten Weltkriegs zu jung waren, um eingezogen zu werden, und bei Einführung der Wehrpflicht im Jahre 1956 schon zu alt für den Dienst mit der Waffe. Wenn es Helden unter ihnen gab, dann waren es zivile Helden des Wiederaufbaus. Gleich nach den Trümmerfrauen kamen sie, jung und begierig zu zeigen, dass sie trotzdem Kerle waren. Geschichten von der Front oder auch nur aus der Kaserne wurden bei uns entsprechend selten erzählt.
Meine erste bewusste Begegnung mit dem Krieg fand Mitte der sechziger Jahre in der Vorratskammer meiner Großmutter statt. Sie war vollgepackt mit Konservendosen von Tengelmann, daneben drängten sich Mehl- und Zuckertüten, alles in einer für Kinderaugen unüberschaubaren Menge. «Oma, warum hast du so viele Dosen?», fragte ich, und sie antwortete mit großer Selbstverständlichkeit: «Falls wieder Krieg kommt …» Sie lebte in Essen-Altenessen, einer Region, die von Zechen und Stahlhütten geprägt war. Von hier wurde der Zweite Weltkrieg mit Kohle befeuert und mit Stahl gerüstet, und hierher kehrte der Krieg dann auch heim, mit Bombennächten und Hungerwintern, die Menschen mussten auf den Schienen nach verlorenen Kohlestücken suchen, auch meine Großmutter.
Mir war diese Nachkriegswelt zunächst zu natürlich, als dass ich mich wirklich über sie gewundert hätte: All die schnell gebauten Häuser der fünfziger Jahre, deren Hässlichkeit mir lange nicht bewusst war, die Kriegsversehrten, die einen im Bus mit ihren Ausweisen vom Sitzplatz wegwedelten und die uns Jungen zu neiden schienen, dass wir noch zwei Arme und zwei Beine hatten. Und dann die Bergleute, die nicht im Krieg gewesen waren, aber unter Tage ihren eigenen Überlebenskampf führten, die Blut in ihre Taschentücher husteten. Zum Nachkriegsalltag gehörten auch die dauernden Straßensperren wegen der Blindgänger, die bei Bauarbeiten gefunden wurden. Auch bei mir zu Hause: Mein Vater arbeitete im Landschaftsbau, und wann immer ein Bagger auf etwas Hartes, Metallisches traf, wurde erst einmal die Arbeit eingestellt. Als Kind schien mir das so etwas wie hitzefrei zu sein, nur gefährlicher. Ich lebte in einer Welt voller Offensichtlichkeiten, die zugleich zugestellt war mit Unaussprechlichem. Später stellte ich dann Fragen, die allerdings wenig erwünscht zu sein schienen. Oma, warum rauchst du so viel, warum trinkst du so viel, warum schlingst du dein Essen so, warum bist du so laut und grob, Oma, warum weinst du? Anders als die 68er-Generation interessierte uns die Frage, was die Älteren im Krieg gemacht hatten, weniger als die, was der Krieg aus ihnen gemacht hatte: oftmals seelisch Versehrte.
Den Großvater väterlicherseits konnte ich gar nichts fragen, er war kurz vor meiner Geburt gestorben. Während des Krieges Chemiker, besorgte er dem Reich Rohstoffe aus aller Welt. Ich lernte ihn über seinen Bücherschrank kennen, ein dunkles Ungetüm mit einer unheilverheißenden Bronzebüste von Julius Cäsar obendrauf, dessen Tür beim Öffnen unangenehm quietschte. Der Geruch alter Bücher versöhnte zunächst, doch was für eine seltsame Auswahl hatte er da hinterlassen: alle Bände von Friedrich Nietzsche, daneben Machiavellis «Fürst», die Erinnerungen von Bismarck, Spenglers «Untergang des Abendlandes» und dann: «Volk ohne Raum» von Hans Grimm. Der Schrank enthielt, alles in allem, eine bildungsbürgerliche Verführung zur Ideologie der Nazis.
Unsere Generation war nicht mehr zu verführen, ihr erschien der Krieg als etwas so rundum Krankes, Absurdes, Schreckliches, dass uns der Pazifismus sozusagen eingeboren war, bevor wir den Ausdruck «Pazifismus» überhaupt kannten. Das mochte auch damit zusammenhängen, dass wir die bessere Hälfte des Zweiten Weltkriegs, den Krieg gegen Hitler, im Alltag kaum mehr vorfanden: Die Befreier hatten sich längst in die Kasernen zurückgezogen. In den USA oder in Großbritannien, wo es gleichfalls Jugendrevolten gegen die Kriegsgeneration gegeben hatte, konnten vom Krieg auch Heldengeschichten erzählt werden, bei uns hingegen gab es nur Scham über diesen Krieg, der noch dazu die Ermordung von sechs Millionen Juden möglich gemacht hatte. Positive Geschichten vom Krieg mochten sich ehemalige Wehrmachtssoldaten erzählen: Wir fürchteten und ekelten uns davor.
Die Bundeswehr, die nun den kommunistischen Feind abschrecken sollte, sahen wir weniger in ihrer politischen Funktion denn als einen Ort überkommener Männlichkeit, gewissermaßen als eine verschärfte Form jenes Schulunterrichts, den uns vom Krieg übrig gebliebene Lehrer angedeihen ließen. Entsprechend häufig verweigerten in den sechziger Jahren Geborene, also jene, die heute die öffentliche Meinung und die Politik dominieren, den Wehrdienst. Mit weitreichenden Folgen. Die Kriegsdienstverweigerungsverhandlung wurde von drei mutmaßlich kriegserfahrenen, uns gegenüber angriffslustig gestimmten Männern durchgeführt. Und wer bis dahin nur ein halber oder lebensweltlicher Pazifist war, der war es danach mit Herz, Seele und Verstand. Im Kern jener absurden Veranstaltung namens Gewissensprüfung steckte nämlich eine große Weisheit: Bestanden hatte nicht derjenige, der die besten Argumente für seinen Pazifismus vorbringen konnte, so wie ich es bei meiner ersten Prüfung versuchte (ich fiel durch), sondern derjenige, der glaubhaft machen konnte, dass er ernstlich mit sich gerungen hatte. Dergestalt züchtete sich die Bundesrepublik ihre echten Pazifisten selber, gleichsam die neuen weißen Jahrgänge.
Mit zunehmendem Alter und wachsender Politisierung (so nannte man das damals, als Politik noch ein Muss war) gerieten wir hinein in den Kampf zwischen unseren beiden Vorgänger-Generationen, den Kriegsteilnehmern und ihren schärfsten Kritikern, den 68ern. Die Frage, ob man über den Krieg und die deutsche Schuld überhaupt öffentlich reden sollte, war in den siebziger Jahren schon zugunsten der 68er entschieden. Nun ging es nur noch darum, auf welche Weise man darüber sprach und über was genau. Die Älteren redeten in der Regel über das, was die Deutschen erlitten, die Jüngeren darüber, was die Deutschen verbrochen hatten.
Die Konfrontation verdeckte die gemeinsame Quintessenz, und die lautete auf beiden Seiten: Nie wieder Krieg! Es ist merkwürdig: Was als bitterste, Familien sprengende und Generationen trennende Kontroverse erschien, enthielt trotz allem einen tiefen Konsens. Der bestand darin, von den Deutschen als einem zugleich gefährlichen und gefährdeten Volk zu denken, das von den demokratischen Eliten in Schach gehalten werden musste; einem Volk, das womöglich in zwei Teilen besser aufgehoben war als in einer Einheit, das in Wohlstand gehalten werden sollte, damit es nicht wütend würde, das nicht wieder in den Krieg ziehen sollte, so wie ein trockener Alkoholiker nicht zur Weinbrandbohne greifen darf, ein Volk, das am besten immer genau das tun sollte, was seine Bündnispartner vormachten, und für das alle Sonderwege Abwege waren. Öffentlich wurde der Elitenkonsens der Bundesrepublik Deutschland so nie formuliert, in geschlossenen Räumen sehr wohl. Auf die Gefahr hin, hier gleich drei Politikern auf einmal zu nahe zu treten: In dieser Einschätzung der Deutschen gab es zwischen Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Joschka Fischer keine nennenswerten Unterschiede, und auch meine Generation hätte dem wohl mehrheitlich zugestimmt, wenn sie je danach gefragt worden wäre.
Jedenfalls bis zum 9. November 1989.
Die Deutsche Einheit oder: Hurra, wir sind harmlos
Es wäre angeberisch, heute zu behaupten, man habe schon immer eine gewisse Skepsis gegenüber der These gehabt, die Deutschen seien ein von Schuld für alle Zeit kontaminiertes, ein auf ewig gefährliches, zur Teilung verdammtes Volk. Trotzdem hatten wir, die wir damals, 1983, Mitte zwanzig waren, ein anderes Verhältnis zur dunklen Seite der deutschen Geschichte als die Älteren, die eigentliche Kriegs- und die 68er-Generation. Die einen hatten den Krieg durchlebt, für sie war Schuld eine persönliche Frage; für die 68er war die Schuldfrage eine Waffe gegen die eigenen Eltern; für uns nur eine Abstraktion und, in gewisser Weise, eine Zumutung. Die Politischeren unter uns hatten schon irgendwie verstanden, dass man als Deutscher historische Verantwortung auch ohne persönliche Schuld zu tragen hatte, nur macht man sich heute keine Vorstellung mehr davon, wie absurd das werden konnte, etwa wenn man ins Ausland kam. Anfang der achtziger Jahre unternahm ich allein als Rucksacktourist eine längere Reise nach Indonesien und lernte dort ein gleichaltriges holländisches Paar kennen. Wir verstanden uns sofort gut und reisten zusammen weiter von Insel zu Insel. Von außen sah alles ganz normal aus, so wie es heute unter jungen Deutschen und ihren Nachbarn vielleicht tatsächlich ist. Doch etwas war merkwürdig: Die beiden sprachen besser Deutsch als ich Englisch, dennoch weigerten sie sich, mit mir Deutsch zu sprechen, und bestanden auf der neutralen Drittsprache, wie sie sagten: aus historischen Gründen. Ich wollte erwidern, dass ich fünfzehn Jahre nach dem Krieg geboren war, dass auch meine Eltern durchaus zu jung gewesen waren, um Deiche zu bombardieren, dass ich außerdem gegen Neonazis … Ich schluckte alles runter und sagte nur: «Okay.» Da standen nun also drei junge Europäer vierzig Jahre nach dem Krieg auf den Hügeln der indonesischen Insel Lombok, 10 000 Kilometer von Deutschland entfernt, und verhandelten die Schuldfrage.