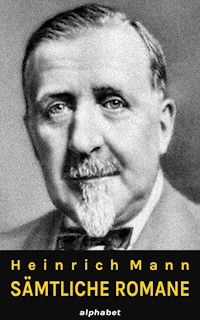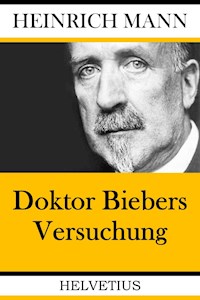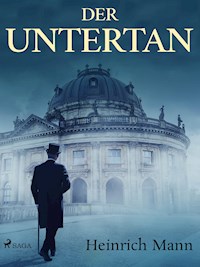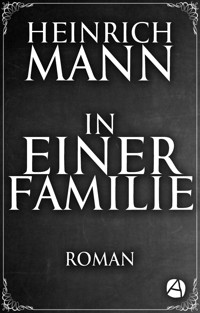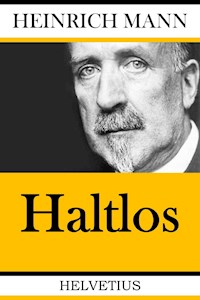
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luiz Heinrich Mann (1871-1950) war ein deutscher Schriftsteller aus der Familie Mann. Er war der ältere Bruder von Thomas Mann. Ab 1930 war Heinrich Mann Präsident der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, aus der er 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ausgeschlossen wurde. Mann, der bis dahin meist in München gelebt hatte, emigrierte zunächst nach Frankreich, dann in die USA. Im Exil verfasste er zahlreiche Arbeiten, darunter viele antifaschistische Texte. Seine Erzählkunst war vom französischen Roman des 19. Jahrhunderts geprägt. Seine Werke hatten oft gesellschaftskritische Intentionen. Die Frühwerke sind oft beißende Satiren auf bürgerliche Scheinmoral. Mann analysierte in den folgenden Werken die autoritären Strukturen des Deutschen Kaiserreichs im Zeitalter des Wilhelminismus. Resultat waren zunächst u. a. die Gesellschaftssatire «Professor Unrat», aber auch drei Romane, die heute als die Kaiserreich-Trilogie bekannt sind. Im Exil verfasste er die Romane «Die Jugend des Königs Henri Quatre» und «Die Vollendung des Königs Henri Quatre». Sein erzählerisches Werk steht neben einer reichen Betätigung als Essayist und Publizist. Er tendierte schon sehr früh zur Demokratie, stellte sich von Beginn dem Ersten Weltkrieg und frühzeitig dem Nationalsozialismus entgegen, dessen Anhänger Manns Werke öffentlich verbrannten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haltlos
HaltlosHaltlos
Er war schon im Begriffe gewesen, vorüberzuschreiten, aber ganz plötzlich trat er auf sie zu. Sehr förmlich: »Würden Sie mir die Ehre erweisen, von meinem Schirm Gebrauch zu machen, mein Fräulein?« – »Aber Sie sehen doch, daß es eben aufhört zu regnen und daß ich ohnehin ganz durchnäßt bin. «
Mit einem verwunderten Blick auf den Himmel klappte er den Schirm zusammen. Dann eine etwas steife Verbeugung. Und er setzte seinen Weg die Straße aufwärts fort. Am nächsten Schaufenster, hinreichend interessant, um als Vorwand zu dienen, blieb er stehen und blickte ihr nach, wie sie mit leichten, bestimmten Schritten über das Pflaster ging. Dabei zerrte er erregt an den kühnen Anfängen des Schnurrbartes.
Und wie prachtvoll ironisch sie eben lächelte! –
Er traf sie beiläufig ein halbes Jahr fast täglich an derselben Straßenecke. Das ging ihm mit fast allen andern Passanten ähnlich. Alle diese jungen Leute, die eine Anstellung in irgendeinem in der Nähe befindlichen Geschäft hatten und mit maschinenhafter Pünktlichkeit morgens um halb acht an den verhaßten Ort ihrer Tätigkeit wanderten, um ihn nach genau zwölf Stunden aufatmend zu verlassen, kannten sich – wenigstens vom Ansehen, oder auch genauer. Die meisten genauer. Denn es bestand die unausgesprochene Absicht, gegenseitig über die Langeweile des täglichen Weges sich hinwegzuhelfen. Dann, wenn die Bekanntschaft zu lange währte, um ihren Zweck noch zu erfüllen, in freundschaftlichem Übereinkommen: Changez les dames! Das gab aber doch Veranlassung zu heimlichen Herzensblutungen, unter Umständen also zu lyrischen Gedichten.
Sehr bald nach seiner Anstellung in der großen Buchhandlung am Ende des Weges, dicht am Obstmarkt, fiel dem jungen Manne auf, was den geselligen Gewohnheiten der Straße sich entzog. Erst kam, drei Schritte vor dem Eingang ins Geschäft, die angejahrte pockennarbige Delikatessenverkäuferin, die schon seit Jahren das sehnsüchtige Gefolge des kleinen kalten buckligen Krämers bildete, aus dem Gewölbe gegenüber. Die fiel ihm zuerst auf: Er hatte Sinn für das Häßliche. Dann aber folgte Laura. Willkürlich hatte er sie so genannt und neidisch Petrarcas gedacht: der war doch wenigstens des Namens gewiß.
Sie war bemerkenswert, gewiß; indessen verwandte er auf sie im Anfang um nichts mehr als die gewohnheitsmäßigen Blicke, mit denen er alle Vorübergehenden »studierte«.
Gleichgültig scheinbar, heimlich scharf. Erst allmählich hob sie sich ab für ihn von den andern. Das Mädchen, das Weib schlechthin, auch wenn es durch den Zufall, oder was war’s sonst, was sie ohne andre Begleitung ließ, ihm zugeteilt schien, hätte ihn minder beschäftigt. Er war sinnlich, gewiß; aber von einer krankhaften Sinnlichkeit. Monatelang zuweilen in vollständiger Keuschheit, mit Abscheu gegen alle geschlechtliche Berührung, lebte er, bis unter einem plötzlichen Sturm des Blutes er sich neigte, der ihn allnächtlich an die in gesundem Zustande ihm verächtlichen Orte der Fleischlichkeit trieb; wenn er ihn nicht ganz zu Boden warf zu einem fressenden geheimen Laster.
Nicht Sinnlichkeit also. Es war eine gewisse unbestimmte Ähnlichkeit zwischen ihr und – sich selbst, die er zu bemerken meinte. Ein scheinbar teilnahmsloses Hinwegsehen über den gesamten Menschheitspöbel, während man doch am Individuum, immer aus gemessener Entfernung natürlich, genaue Beobachtungen anstellte, scharfe Kritik übte. Und, vielleicht die Folge dieser Beobachtungen, ein unzufriedener, oft ironischer, zuweilen verachtender Zug des Gesichtes, zwischen Mundwinkel und Nasenflügel hin und her schielend. Und dann etwas schlecht Definierbares, was er »ein Schmerzensmal, wie von tieferer Erkenntnis der Stirne aufgeprägt« gern nannte.
Er gehörte nicht zu den naiv Empfindenden; es war ihm, als habe er nie zu ihnen gehört. Er hatte früh angefangen, sich selbst in Beobachtung zu nehmen, über seine Gefühle und Gedanken sich zu befragen. Er hatte, um die Richtigkeit seiner Wahrnehmungen festzustellen, frühzeitig zur Lektüre ihm teils noch unverständlicher Bücher gegriffen. Aber soviel, ohne große Mühe, fand er heraus, er sei berechtigt, das an sich selbst Beobachtete auf das außerhalb seines Ich Befindliche zu übertragen. Jawohl, dieselbe jämmerliche Unvollkommenheit und ebender vollkommene Jammer war es – im großen, den er im kleinen im eigenen Innern entdeckt. Da hatte er seine Weltanschauung. Eine jugendliche, in der von wacher, tastender Seele die noch fehlenden äußeren Erfahrungen ersetzt wurden. Es begegnete ihm von den Älteren, sprach er mal von seinen Ansichten, das recht brauchbare Schlagwort »Jugendlicher Pessimismus«.
Nur daß er abseits ging der glücklicheren Brüder, die mit ihrer Verachtung, so tief sie das ganze All umschattet, nicht imstande sind, das liebe Ich zu umfassen; das schwimmt in einem Meer von Licht über allem Dunkel. – Es war ihm immer schmerzlich bewußt seine Zugehörigkeit zur allgemeinen Weltgemeinheit, von der er der Schatten eines Atoms sei. Kein Grund, merkwürdigerweise, sich nicht dennoch als ein Besserer zu fühlen. Denn die Erkenntnis erhebt; so erklärte er’s sich.
So was Ähnliches also machte der Unbekannten, in deren Mienen er’s entdeckte, Platz in seiner Gedankenwelt. Seine Überlegenheit, die verächtlich lächelnd den Troß durchschritt, hier stand sie vor einem Hindernis, vor etwas Gleichberechtigtem. In den dunkeln Augen, vor allem, lag es wie ruhiges kaltes Bewußtsein des Auf-sich-selbst-angewiesen-Seins: Nichts wider sich zu haben als eine Welt. So deutete er das Zucken des roten starken Mundes, und der herbe, unfertige Leib schien in jeder Bewegung den festen Willen zu verkünden: Ich will allein bleiben, wie ich es bin, ganz allein – immer.
›Und wie prachtvoll ironisch sie eben lächelte!‹
Mehr als einmal hatte er Gelegenheit, dies oder ähnliches vor sich hin zu sprechen. Seine Anknüpfungsversuche waren vergeblich, sooft er sie wiederholte, mehr oder weniger ungeschickt. Aber weshalb eigentlich die Wiederholungen, immer noch mal, »zum unwiderruflich letzten Male«? Er war selbst über die Frage verwundert, als er sie sich vorlegte. Dann aber mußte er sich ihre Berechtigung zugestehen. Sie beide waren, nun, er wollte es kraß ausdrücken, mit sich selbst und der Welt zerfallene Menschen. Sie fanden, so gingen seine Gedanken, nicht einmal an seelisch ruhigen, zufrieden-oberflächlichen Gemütern einen Halt, ihre kranken Sinne dareinzubetten – wie sollten ihre zerfahrenen, mut- und glücklosen Geister imstande sein, sich gegenseitig zu stützen? Ganz sicher, das Sichkennenlernen war der erste Schritt zum Sichverderben. Folglich, das war so klar, gab es nur ein Mittel, vor gewaltigen Seelenkrisen sich gegenseitig zu bewahren: eine gänzliche Trennung, bevor man sich überhaupt kennengelernt – ein radikales Einander-nicht-mehr-Sehen.
Er stand während dieser Erwägungen am Geschäftspult; die linke Hand hielt ein paar Kontenblätter, aus denen eine Rechnung auszuziehen war. Die Rechte aber, ganz gewiß nicht wissend, was die Linke tat, hatte mechanisch ein abgerissenes Blättchen Papier ergriffen und begann mit hastigen großen Zügen und fast ohne Pausen die Strophen daraufzuwerfen:
Von ferne schon, sie sahn sich an Und wußten’s gleich, was ihrer harrte: Das Schicksal, wie so oft sie’s narrte, Lenkt seine nun zu ihrer Bahn.
Kaltdüster blickt ihr Aug wie seins, Wie ihr tanzt Hohn ihm um die Lippen – Sie stießen beide sich die Rippen An dieser glatten Welt des Scheins.
Sie suchten beide, wo nichts ist … Gar nichts?! – Sie konnten’s nicht verstehen, Daß mehr, als was sie um sich wehen Fühlten, man nicht verlangt vom Mist …
Sie beide stets der eignen Brust Vom alten Leide vorerzählend, Sie beide haltberaubt vom Elend Und tödlich dessen sich bewußt –
Fürwahr, ein trefflich taugend Paar! … Ganz nah, sie sehn sich an, und trüber Glimmen die Blicke, und vorüber Gehn sie sich langsam – schweigend – starr …
Ob die Verse gut oder schlecht, machte ihm wenig Schmerzen. Den »Kuß der Muse«, allerdings, meinte er hin und wieder zu genießen; wenn auch nicht in der weihevollen, präparierten Stimmung, wie sie ältere und jüngere Dichter uns schildern, sondern jählings, abgerissen, schludderig, wie die Liebkosung einer halbbetrunkenen Dirne. Aber er schenkte ihm keineswegs die Beachtung, welche ihm allgemein sonst von den glücklichen Empfängern zuteil wird. Er hatte einfach die Gewohnheit, lästige Gefühle und Gedanken, die nicht aufhören wollten ihn zu beschäftigen, zu versifizieren, in geschlossene, festgefügte Strophen einzusperren. So, da saßen sie, und er war sie los, ein für allemal. Das Mittel hatte sich stets bewährt. Nicht so heute. Kaum die zweite Zahlenreihe des großen Foliobogens, mit dem jetzt beide Hände sich beschäftigten, hatte er durchgearbeitet – langsam, um das noch schmerzende Hirn mit den lindernden Ziffern zu füllen … da brachen sie wieder herein, die alten Gedanken; nicht Vers- noch Zahlenwälle mochten sie dämmen.
Also, es half nichts, wieder eine Frage: Warum, trotz aller Vernunftgründe, die es als blöde und unsinnig bewiesen, dieses fortwährende An-sie-denken-Müssen, dieses Hasten nach einem ihrer spöttisch springenden oder schwermütig gleitenden Blicke … Er verstand sich nicht mehr. Er, der immer mit sich selbst so intim gewesen, bemerkte mit Schrecken, wie fremd er sich ward in dieser Zeit.
»So verscherzt man sich die allerletzte verständnisvolle Seele.« Die Worte kamen ruckweis, zugleich mit blaugrauem Zigarettenqualm, während schon das erste Zucken eines Gähnens an den Lippen arbeitete. Das machte die »konventionellen Lügen« zu Boden sinken. Übrigens doch wieder mal ’n Buch! Obgleich, bei allem Niederreißungstalent, der Mann hatte zu viele Ideale! Die wuchsen nicht auf dem Gipfel der wahren Erkenntnis … ebensowenig wie in den Sumpfgründen des denkfaulsten Indifferentismus. Darin berührten sich auch diese Extreme …