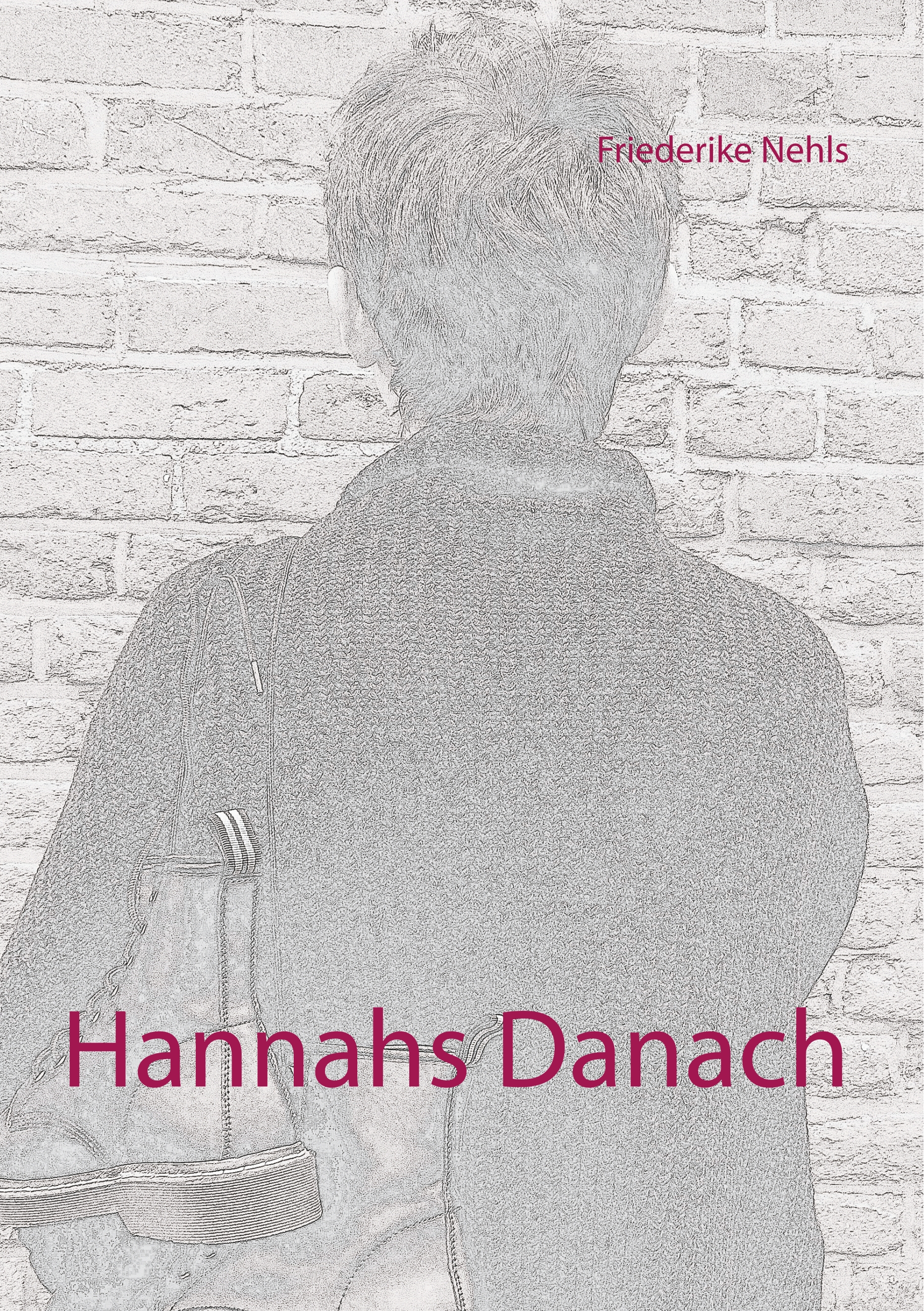
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hannahs Danach fängt da an, wo die meisten Geschichten aufhören, die von Holocaustüberlebenden erzählen. 1945. Der Krieg ist zu Ende und die Jüdin Hannah macht sich auf den Weg, die Vergangenheit zu verarbeiten und sich in der Gegenwart, in Deutschland, zurechtzufinden. Sie findet ihren Sohn, alte und neue Freunde, verliebt sich, erlebt Verrat und Hoffnung und findet sich am Ende selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Als erstes möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die mir die Zeit gegeben haben, meine Fantasien zu entwickeln, und mich gelehrt haben, Menschen nicht in Schubladen zu stecken und zu verschließen, sondern die Schubladen immer ein Stück offen zu halten.
Ich danke meiner Freundin Julia, die mich einfach gut kennt und wusste, dass ich in Sylvia eine kompetente Lektorin finden würde. Danke, Sylvia.
Und ich danke all den Menschen jüdischen Glaubens und/oder jüdischer Herkunft, die geblieben sind und auch kommen und weiter unsere Kultur und unser Land bereichern. Wir brauchen Euch. Danke.
Hanna, hörst Du mich? Wo immer Du sein magst, verzage nicht, Hanna! Die Wolken reißen auf, die Sonne bricht durch, Hanna! Aus Finsternis und Dunkelheit kommen wir zum Licht! In eine neue Welt, in eine Welt, in der die Menschen sich von Habgier, Hass und Brutalität frei gemacht haben. Sieh doch nur, Hanna, die Seelen der Menschen haben Flügel bekommen. Sie werden sich emporschwingen, hoch empor, dem Licht und der Hoffnung und der Zukunft entgegen, einer Zukunft, die Dir, mir und uns allen, die allen Menschen gehört. Schau nach oben, Hanna, schau nach oben!
Charlie Chaplins letzte Worte in dem Film: Der große Diktator (1942)
Inhaltsverzeichnis
Traum
Danach
Mittendrin
Weiter danach
Dort
Weiter danach
Kurz davor
Danach
Kurz davor
Drinnen
Weiter danach
Kurz danach und Doch noch mittendrin
Weiter danach
Weiter kurz danach
Danach
Kurz Danach
Danach
Kurz Danach
Wieder danach
Davor
Danach
Mein davor
Weiter danach
Davor
Weiter danach
Noch einmal davor
Weiter danach
Kurz danach
Weiter danach
Davor
Danach
Kurz davor
Weiter danach
Davor
Danach
Davor
Danach
Davor
Danach
Währenddessen
Weiter danach
Eine weile davor
Weiter danach
Davor
Weiter danach
Mittendrin
Weiter danach
Lange davor
Weiter danach
Drinnen
Weiter danach
Daneben
Weiter danach
Weiter daneben
Weiter danach
Daneben
Weiter danach
Dort
Weiter danach
Dort
Danach
Währenddessen
Danach
Davor
Danach
Davor
Danach
Dort
Danach
Kurz Danach
Weiter danach
Dort
Danach
Dort
Danach
Märchen
Danach
Traum
Jahre später
Traum
TRAUM
Das Wasser umschlingt ihren nur mit schwarzen schweren Schnürstiefeln bekleideten mageren Körper und zieht sie immer weiter runter in die Tiefe des dunklen Sees.
DANACH
Und da war er. Der Moment, vor dem ich mich am meisten fürchtete, und den ich doch wie keinen anderen so sehr herbeisehnte.
Durch nichts hatte er sich angekündigt. Nichts Außergewöhnliches war mir passiert, kein ungewohnter Traum als die, die ich immer wieder träumte, keine innere Stimme. Nichts. Nichts hatte den Moment angekündigt. Ich erschrak, so wie ich immer erschrak, wenn jemand vor meinem Haus erschien. Das Grummeln im Bauch setzte wieder ein, so wie es immer einsetzte, wenn jemand geklopft hatte. Es gab noch immer keinen Strom und die Klingel funktionierte nicht. Es klopfte erneut. Ich atmete tief ein und trat zur Tür, mit dem sicheren Glauben, gleich wieder erleichtert zu erkennen, dass jemand Unbedeutendes vorm Haus stand. Und doch hörte das Grummeln nicht auf und ich zögerte, bis ich die Tür öffnete. „Elli.“ Er war schneller an der Tür und versuchte ohne Erfolg an die Klinke zu kommen. „Das denke ich auch“, antwortete ich dem kleinen Jungen, der erwartungsvoll auf das Eintreten meiner Schwägerin hoffte. Ich streifte meine feuchten Hände an meiner Schürze ab, räusperte mich und öffnete die Tür, sicher, gleich wieder nicht zu wissen, ob ich enttäuscht oder erleichtert sein sollte, dass es eben doch nur jemand anderes war, der vor meiner Tür stand.
Die Tür ging auf. Da ich das Kämpfen meiner Erleichterung und Enttäuschung schon gewohnt war, setzten die widersprüchlichen Gefühle sofort ein, und es dauerte, bis ich verstand, wer da vor meiner Tür stand. Das einzige, was ich sofort erkannte, waren ihre Augen.
Groß, mit brauner Iris, umhüllt von dichten, schwarzen, langen Wimpern, sahen sie mich nur kurz an. Augen, so ähnlich denen, die mich jeden Tag so oft ansahen. Vom Rest des Körpers war nichts mir Bekanntes geblieben. Erschrocken und doch ruhig atmend, wollte ich Jakobs Hand greifen, doch er hatte sich hinter meinen Beinen versteckt und schlang seine kurzen Arme darum. Von dort aus sah er ängstlich auf die Frau, die vor der Tür stand, und nun zu ihm runter sah. „Wer ist das“, war die Frage, die er wohl in seiner kindlichen Sprache, ängstlich und doch neugierig, gestellt hatte. Ich räusperte mich und antwortete: „Deine Mutter.“
Ich weiß nicht, wie lange wir da so standen. Sie hielt Zeichnungen in der Hand. Zwei Blätter von ihnen rieselten zu Boden. Verlegen sah ich auf die heruntergefallenen Papiere und bekam sofort eine Gänsehaut, als ich erkannte, was dort so tadellos gezeichnet war. Eine Person von hinten, im gestreiften Kleid, blickte auf einen Stacheldrahtzaun.
MITTENDRIN
„Miriam, drucken.“ Ihre tiefe holländische Stimme, gepresst durch ihre vollen Lippen, drang in Hannahs Ohren. „Los.“ Sie nickte Hannah zu, die immer noch ihre Jacke gebündelt festhielt und weiter auf ihre Anweisungen wartete. Hannah sah auf die Frau auf der Pritsche. Miriam. In der Dunkelheit konnte Hannah ihre kurzen dichten schwarzen Haare genauso wenig erkennen wie ihre markante Nase, die hohlen Wangen und die schwarzen Augen und auch den Rest vom Rest des Körpers, der gerade so stark kämpfte, konnte sie nur spüren.
Hannah sah aus dem Fenster. Selbst der Mond war verschwunden, hatte sich hinter dicken Wolken versteckt und wollte wohl auch nicht sehen, was hier gerade passierte. Ein gepresstes holländisches Wort, welches wohl jetzt bedeutete, holte Hannahs Gedanken an die Pritsche zurück.
Sie nahm die zerknüllte Jacke und beugte sich zu Miriam runter. Nun glaubte sie Miriams Gesicht doch zu erkennen, welches sich wieder schmerzhaft verzog, und Hannah drückte ihr das Jackenbündel erneut in ihr weißes Gesicht. Vielleicht, Hannah dachte kurz nach, ja, vielleicht sollte sie ihr das Bündel fester ins Gesicht drücken. Miriam nicht nur ihre Schreie nehmen, sondern gleich ihr ganzes Leben oder zumindest das, was davon noch übrig war. Auf einen mehr oder weniger kam es ja nun wirklich nicht mehr an. Im Gegenteil. Sie würden ihr sogar dankbar sein. Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Bravo, Hannah, danke, Hannah. Eine Ration Brot extra, Hannah.
Ein Arm berührte ihren und holte sie erneut zurück in die Gegenwart.
Die tiefe dunkle Stimme bat sie, das Bündel wieder hoch zu nehmen.
Schnell und erschrocken folgte Hannah der holländischen Stimme und tat, was sie verlangte. Warum aber? Die Gesetzmäßigkeiten einer gesunden Zivilisation galten hier ja schon lange nicht mehr. Tat sie Miriam nicht vielleicht sogar einen Gefallen? „Gleich hast du es geschafft“, vernahm erneut Hannah die tiefe Stimme und doch schien sie verändert. Nicht mehr so rau? Hannah versuchte in ihrem Gesicht abzulesen, ob sie es richtig wahrnahm. Aber die Dunkelheit ließ es nicht zu. „Noch einmal.“ Erst als sie erneut Hannahs Arm berührte, merkte sie, dass sie angesprochen war, und presste zum letzten Mal das Bündel in Miriams Gesicht. Das Gestöhne unter Hannahs Händen schien kurz heftiger und die Jacke schaffte es kaum, den folgenden Schrei zu dämmen, und dann war sie still. Tot? Hannah merkte, wie ihr Zittern stärker wurde, und sie nahm zaghaft die Jacke wieder hoch. Miriam atmete schnell und erschöpft. „Los, nimm das Messer.“ Woher die Holländerin es hatte, wagte Hannah nicht zu fragen, sondern nahm den metallenen Gegenstand, hielt ihn unbeholfen in der Hand und folgte weiter den Anweisungen der großen herben Frau. Es schien ewig zu dauern, bis Hannah es schaffte, die glitschige Schnur zu durchtrennen.
„Los, nimm es und leg es ihr auf den Bauch. Sollte es anfangen zu weinen, leg es ihr sofort an die Brust.“ Sie hustete leise und Hannah nickte und sah zu, wie sie mit ihrer Jacke versuchte das Blut von dem Neugeborenen wegzuwischen. „Geschafft.“ Hannah atmete tief durch, nachdem sie getan hatte, was die Holländerin ihr befohlen hatte.
„Ach, wie schön, so wie Eva und Joseph, es fehlen nur noch die Tiere.“ Eine einzige der namenlosen Frauen war neugierig zu ihnen getreten. „Maria und Joseph“, verbesserte die Holländerin die Frau und schob sie unsacht weg. „Ruhe“, rief irgendwo eine andere.
Von dem Wunder, was hier soeben geschehen war, hatte wohl kaum eine etwas mitbekommen und wenn, war es nicht von Interesse. Ihr Schlaf war wichtiger. „Danke“, flüsterte Hannah und reichte der Holländerin das Stück Brot, welches sie in ihrem Kleid bewahrt hatte.
Sie biss hinein und gab Hannah den Rest zurück. „Gib es ihr, sie wird es brauchen.“ Emotionslos nahm sie die blutverschmierte Jacke und hielt sie Hannah hin, die nun ihre weniger verschmierten Hände versuchte daran abzuwischen. „Es ist ein Mädchen“, flüsterte sie Miriam zu und wandte sich ein letztes Mal an Hannah, mit der Bitte, dass sie sich zu ihrer Freundin und dem Baby legen sollte, um sie zu wärmen. Dann verschwand sie wieder in der Dunkelheit, aus der Hannah sie geholt hatte.
„Wir brauchen dich“, hatte Hannah ein paar Tage zuvor gefleht. Ein Stück Brot in der zitternden Hand. Woher Hannah wusste, dass sie Hebamme war, wusste sie nicht mehr, genauso wenig, dass sie Holländerin war. Mit ihr gesprochen hatte Hannah bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. Was, wenn sie kein Wort verstand? Hannah wusste, sie hatte keine Wahl, und reichte ihr das Stück Brot. Desinteressiert hob die Angesprochene ihre Schultern und sah an Hannah vorbei, während sie sich ihre kurzen blonden Stoppeln kratzte. Hannah sah zum Revers ihrer Jacke und dann in ihr Gesicht, dazu musste sie nach oben blicken, denn die Holländerin überragte sie um mindestens zwei Köpfe. Die blauen Augen sahen weiter uninteressiert an ihr vorbei und Hannah sah erneut den Wimpel an. Gelb, genau wie ihr eigener.
„Nach hinten.“ Sie hatte eine Stimme. Tief rau und mit einem starken holländischen Akzent. Hannah erschrak, als sie erkannte, wer da vor ihrer Pritsche aufgetaucht war, und fing eilig an, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzusuchen. „Nicht du.“ Sie zeigte auf Hannahs Pritschennachbarin. Erstaunt beobachtete Hannah, wie die angesprochene Namenlose ohne zu murren ihre wenigen Habseligkeiten und ihre Geschichte nahm und dahin verschwand, wohin die Holländerin zeigte. „Na, dann lasse ich den Zaun noch ein wenig warten.“ Hannah war nicht sicher, ob sie die Worte richtig verstanden hatte, und fragte auch nicht nach.
Inzwischen waren ein paar Tage vergangen, seitdem Hannah die Holländerin um Hilfe gebeten hatte, und Hannah hatte es aufgegeben, Miriam ihre Angst nehmen zu wollen. Womit hätte sie denn ihre Freundin auch beruhigen können. Ein Kind zur Welt zu bringen. Hier.
Hannah wusste nicht, ob sie erleichtert sein sollte, als sie zur Seite rutschte und der blonden Frau Platz machte. Sie überlegte kurz, ob sie sie nach ihrem Namen fragen sollte. Doch sie ließ es, es gab keine Namen hier drin, nur Nummern und Wimpel, die kamen und gingen.
Einzig Miriams Namen wusste sie. Eine der wenigen, die länger blieb, so wie sie selber. Es hatte gedauert, bis Hannah erkannte, dass Miriam im Gegensatz zu den anderen immer runder unter ihrem gestreiften Kleid wurde. Wobei, wirklich rund war sie nun wirklich nicht und wer sie nicht weiter beachtete, würde es auch nicht sehen. Wie sollte ein Baby darin wirklich wachsen können? Ihren eigenen Hunger unterdrückend, hatte Hannah Miriam einiges ihrer Rationen abgeben wollen, doch Miriam hatte es nur selten angenommen. Einzig die Holländerin war noch fester als all die anderen. Hatte sie schon mehreren Frauen geholfen und ihre Rationen bekommen. Hannah lenkte ihre Gedanken in andere Richtungen, es war auch egal. Sie war da.
„Wie heißt du?“, fragte Hannah dann doch mutig und wusste dennoch, dass sie ihren Namen sicher nicht nennen würde. Sie reagierte tatsächlich nicht und Hannah sah ihren Hinterkopf an, die kurzen blonden Haare erahnte sie nur in der schnell eingesetzten Dunkelheit.
„Sieht dir sehr ähnlich“, hatte Max gelacht und auf ein Plakat gezeigt.
„Komm, lass uns gehen“, hatte Hannah gedrängt und ihn weggezogen.
Was auf dem Hetzplakat geschrieben stand, daran konnte Hannah sich nicht erinnern, und an den überzeichneten Juden, der abgebildet war, wollte sie sich nicht erinnern. Und doch ließ sich das Bild nicht verdrängen, niemanden kannte sie, der so aussah mit wulstigen Lippen, großer klobiger Nase und verschmitztem Grinsen und doch musste sie zugeben, dass die Menschen hier hauptsächlich dunkelhaarig waren, vielleicht auch mittelblond, doch hellblond? Warum war sie hier, wer hatte sie verraten?
„Meinen Namen.“ Hannah erschrak, als sie die tiefe Stimme hörte.
„Meinen Namen habe ich meinen Kindern mitgegeben.“ Es dauerte einen Moment, bis Hannah verstand, was sie gesagt hatte. Deswegen.
Der Zaun. Hannah musste schlucken, erstaunt, noch etwas Mitleid zu haben, glaubte sie doch, jedes Mitgefühl war ihr dort ausgetrieben worden. „Wie viele?“, fragte Hannah leise und diesmal bekam sie keine Antwort. Sie griff in ihren Schuh und fühlte, ob die Zeichnung noch an ihrem Platz war. Vorsichtig und leise nahm sie das zusammengefaltete Blatt, drückte es an ihr Herz und fiel das erste Mal seit Wochen in einen mehr als eine Stunde dauernden Schlaf, und bekam nicht mit, wie die Frau vor ihr in eine ihrer letzten traumlosen Nächte weinte.
„Es reicht nicht.“ Miriam hielt das Baby auf ihrem Arm vor ihrem leeren Busen. „Wie auch.“ Hannah sah von Miriams ausgemergeltem Körper zu Marie.
So hatte sie die Holländerin still getauft. Marie, der Name ihrer ersten Puppe. Ein großer Porzellankopf umrahmt von gelben aufgemalten Haaren. Irgendwann hatte sie sie fallen lassen, ohne Absicht, aus Versehen. Der Kopf war in Hunderte Teile zersprungen. Keine andere Puppe hatte ihr über den Verlust helfen können. Marie war wieder da und nahm Miriam das Baby ab.
Sie sahen zu, wie Marie das kleine Wesen unter ihr Kleid schob. Unter dem gelben Wimpel und der Nummer erklangen tatsächlich schmatzende Geräusche. Hannah sah zu Miriam, sie gab ihre Gefühle nicht preis, nur Hannah war anzusehen, dass sie erleichtert war, dass das Baby tatsächlich satt zu werden schien.
Zwei Tage schaffte es das Fräulein unbemerkt zu überleben. Doch, obwohl Hannah und Miriam ihre kargen Rationen des Essens mit Marie teilten, reichte ihre Milch dann doch nicht. Das Weinen schallte durch die Baracke.
„Wo ist es?“ Die Tür war aufgestoßen worden und Agnes die Schreckliche, gefolgt von ihrem Hochstab, betrat die Baracke. Sie hatten es gehört. Wie hatten sie nur hoffen können, dass es nicht so war, oder waren sie verraten worden? Hatte eine von ihnen für ein Stück Brot ihre Seele verkauft? Zeit für weitere Gedanken blieb Hannah nicht, die erschrocken zu Miriam sah, die vergebens versuchte ihre Tochter zu beruhigen. „Zur Seite.“ Mithilfe ihres berüchtigten Stockes bahnte sich die Aufseherin ihren Weg durch die nun schaulustig gewordenen Mitgefangenen. Miriam versuchte das Baby hinter ihrem Rücken zu verstecken, doch ihr hungriges Weinen war nicht zu verbergen. Hannah versuchte sich neben Miriam zu stellen und fing laut an zu husten.
Jemand drückte ihr etwas in die Hand. Verwirrt sah Hannah auf den Gegenstand. Schwarze Schnürstiefel. Hannah kannte sie. Sie erkannte Marie, die sie kurz fest ansah, bevor sie Hannah unsacht zur Seite schob und etwas an sich nahm. „Du kannst noch mehr bekommen, ich will nicht mehr.“ Miriam schien zu perplex, um sich zu wehren, und sah genauso wie Hannah zu, wie Marie das weinende Baby schnappte und sich Agnes, die nun gefährlich nahe vor ihnen ankam, entgegenstellte.
Hannah schaffte es gerade noch Miriam wegzuziehen und ihr den Mund zuzuhalten, der nun klar geworden war, was hier passierte. Jemand versuchte die Stiefel zu schnappen, Hannah, die immer noch Schwierigkeiten hatte Miriam ruhig zu halten, trat kräftig zur Seite und klemmte die Schuhe zwischen ihre Füße und bekam nicht mit, wie Marie und das Baby weggeführt wurden. Die Barackentür wurde geöffnet und geschlossen.
WEITER DANACH
Unsere Köpfe berührten einander leicht, als wir uns nach den Zeichnungen bückten. Sie griff schneller, meine Hände zitterten so stark, dass ich Mühe hatte sie zu kontrollieren. Jakob hielt sich immer noch an meinem Bein fest. Obwohl ich das Wort Mutter sehr leise ausgesprochen hatte und wusste, dass er es nicht verstanden haben konnte, beobachtete er unseren Gast weiter neugierig. Sie drehte die zweite Zeichnung um. Ein weiteres gestreiftes Kleid, diesmal eine Frau von vorne. Unter dem Kleid mit einem Wimpel und einer Nummer schien etwas zu stecken, auf das die Frau mit einem entrückten Blick schaute. Marie. Beeindruckt sah ich auf die mit Kohle gemalte perfekte Zeichnung, bevor ich sie ihr reichte und sah, wie sie die andere Zeichnung davor steckte. Die Frau vor dem Stacheldrahtzaun.
DORT
Der Blick. Hannah kannte ihn, hatte ihn schon oft gesehen. Einige bekreuzigten sich an dieser Stelle, andere murmelten etwas vor sich hin, manche sahen einfach nur in den Himmel und einige schlossen kurz ihre Augen, bevor sie losliefen. Nichts von dem bei Miriam. Sie sah nur mit leeren Augen in die Ferne, zu dem, was hinterm Zaun lag. Ein weiterer Schritt nach vorne. „Nicht.“ Hannah nahm Miriams Arm und hielt ihn fest.
„Warum nicht?“ Miriams Blick änderte sich, nun sah sie fest zum elektrischen Zaun vor sich. Warum nicht. Hannah wusste auch keine Antwort. Was war noch zu erwarten. Hier! War es nicht vielleicht der klügere Schritt? Hannah wusste in dem Moment nicht ehrlich zu sagen, ob es nicht nur der Wunsch war, nicht allein zu bleiben, der sie davon abhielt Miriams Arm loszulassen. „Sie hatte noch nicht mal einen Namen.“ Miriams leere Augen sahen an Hannah vorbei. Sie machte einen Schritt weiter Richtung Zaun. „Nicht.“ Hannahs Griff wurde fester.
„Schau mal, vielleicht fliegt ihre Seele gerade in den Himmel.“ Hannah wusste, wie blöd ihre Worte klangen, doch sie hatte sich nicht vorbereiten können, und wenn, was hätte sie auch sagen sollen. Hannah sah von Miriam auf den Schornstein hinter ihnen, der grauen Rauch hinausspuckte. Seelen, die sich auf ihre Wege machten. „Komm mit mir, der Zaun kann warten, bitte, Miriam.“ Nun sah Miriam Hannah direkt in die Augen. „Warum, Hannah, warum, nenne mir einen Grund.“ Hannah trat von einem Fuß auf den anderen, wie erwartet waren Maries Stiefel eine Nummer zu groß, doch sie waren heile und fest. Hannah spürte die zusammengefaltete Zeichnung darin. Ihr Grund weiter zu leben.
„Wir werden die Sonne wiedersehen.“ Hannah war bewusst, dass auch diese Worte pathetisch klangen, doch ihr wollte kein weiterer Grund für Miriam einfallen. Miriam sah in den wolkenreichen Himmel und lachte sarkastisch auf. „Du glaubst wirklich daran?“ Hannah nickte und wusste doch, dass Miriam nicht daran glauben wollte.
WEITER DANACH
Das Grummeln hatte aufgehört, auch die Hände waren nicht mehr feucht, nur das Herz wollte nicht aufhören schneller zu schlagen. Sie stand immer noch vor der Tür, die Blätter nun geordnet in der Hand.
Ihr Gesicht schien immer blasser zu werden. „Bitte kommen Sie rein.“ Ich führte sie direkt ins Wohnzimmer zum Sofa. Doch sie blieb stehen, ihren Blick auf Jakob geheftet, der sich langsam von meinen Beinen löste. „Milch, ich.“ Genauso wenig wie mein Herz und meine immer noch unruhigen Hände, hatte ich auch meine Stimme nicht im Griff. Die Nervosität wollte mich nicht verlassen oder war es die pure Angst, die es mich nicht schaffen ließ, ganze Sätze herauszubringen.
„Ich habe frische Milch da“, versuchte ich es erneut. Jakob zupfte an meinem Rock, seine Sicherheit wiederbekommend, im Gegensatz zu mir. „Du bekommst natürlich auch ein Glas.“ Er hatte losgelassen und folgte mir in die Küche. Und jetzt? Ich stützte mich auf den Herd.
Weiter als bis zu diesem Moment hatte ich es mir nie vorgestellt. Alle möglichen Varianten waren durch meinen Kopf gekreist. Ein Brief von ihr. Ein Telefonat. Sie in der Bäckerei. Sie auf irgendeinem Weg im Dorf und auch so wie es tatsächlich gekommen war. Sie steht vor der Haustür. Jegliche weiteren Gedanken hatte ich erfolgreich verdrängt.
Mechanisch goss ich zwei Gläser Milch ein, so gut es meine zitternde Hand zuließ. Günthers Armbanduhr hatte mich die Flasche gekostet und erleichtert sah ich, dass ich nichts verschüttet hatte. Vorsichtig sah ich in die Stube. Sie stand immer noch und sortierte die Zeichnung in eine Mappe mit wohl weiteren Zeichnungen, auf einer von ihnen blieb ihr Blick haften.
KURZ DAVOR
„Vorwärts, los, Marsch.“ Die Worte knallten auf die laufenden Gefangenen. „Wo bringen sie uns hin?“ Hannah hatte sämtliche Geschichten, von denen sie gehört hatte, durchdacht, während sie weiter vorwärtsgetrieben wurden. „Sicher nicht ins Schlaraffenland.“ Die Frau neben ihr zog zwei kleine Kinder mit sich.
Jakob schien zu schlafen. Trotz des dicken Mantels spürte Hannah sein kleines Herz schlagen, ruhig und gleichmäßig. Im Gegensatz zu ihrem eigenen, welches raste.
„Dreckiges Judenpack.“ Der Marsch führte durch ein Dorf. Welches? Wo waren sie? Auf dem Weg in den Osten? Tatsächlich, die Sonne war neben ihr und warf lange Schatten von stolpernden, ängstlichen Menschen auf matschige Straßen. „Macht, dass ihr fortkommt.“ Hannah sah Frauen an ihren sauberen und gepflegten Gartenzäunen stehen.
Alte, junge und vereinzelt auch Kinder, alles, was vom Dorf übriggeblieben schien. „Na los, ab ins Lager und nie mehr zurück.“ Hannah sah zu dem Mädchen, welches die Worte ausgespuckt hatte. Eine gestreifte Katze auf dem Arm, zwei dicke blonde Zöpfe um ein noch wohlgenährtes Gesicht. Der Marsch stoppte und Hannah lief auf die Frau vor sich auf, die stehengeblieben war. Jakob bewegte sich unter Hannahs Mantel. Vorne schien jemand umgefallen zu sein.
Hannah konzentrierte sich auf das Baby unter ihrem Mantel, das wieder ruhig geworden war. „Aufstehen, sofort.“ Wieder die schneidige harte Stimme, irgendein Hannah unbekannter Dialekt. Ein Schuss. Jakob erschrak und fing an zu wimmern. Der Marsch ging weiter. Hannah griff in ihren Mantel und streichelte Jakobs kleinen Kopf. Er wimmerte weiter. Irgendetwas lag im Weg? Nicht irgendwas. Irgendjemand. So wie die anderen vor ihr, stieg auch Hannah darüber und versuchte nicht hinzusehen. Jakobs lauter werdendes Wimmern lenkte sie ab. „Bitte nicht weinen“, flüsterte Hannah. „Und nie mehr zurück.“ Die Stimme des Mädchens mit der Katze, echote durch Hannahs Kopf. Nur noch ein paar Häuser und das Dorf schien zu Ende zu sein.
„Bitte nicht weinen“, wiederholte Hannah und spürte Panik in sich aufkommen. Eine Hand. Ein Apfel. Hannah sah auf. Ein ebenfalls sauber gestrichener Zaun. Diesmal eine Frau davor und nicht dahinter. Äpfel in einer Schürze, die immer weniger wurden. Die Haare versteckt unter einem Kopftuch. Ihr Alter konnte Hannah nur schätzen. Ihre Blicke trafen einander. Warme grüne Augen in einem gütigen Gesicht, wie Hannah glaubte. Glauben wollte. Hoffte. „Merk es dir. Ihr Gesicht. Merk es dir. Ihr Haus. Merk es dir. Ihr Dorf.“ Hannah sah zum Haus. „Und nie wieder zurück.“ Zwei Sekunden, vielleicht drei. Hannah zählte nicht. Ein Griff. Ein Wort. „Jakob.“ Hannah sah nicht mehr zurück. Sie lief weiter.
Der Schmerz wollte der Erleichterung nicht weichen. Er überkam sie und hielt sie fest und Hannah glaubte, dass er sie nie wieder loslassen würde.
DANACH
„Ist das die Hexe.“ Die Gläser Milch schwappten über. Erschrocken sah ich von Jakob über die verschüttete Milch zu ihr.
Hatte sie Jakobs Frage gehört? Sie stand bei meiner Anrichte und hielt ein gerahmtes Foto in der Hand. Günther. Schnell stellte sie es wieder zurück. Günther in Uniform. „Mami“, zog er an meinem Rock und ich glaubte, er würde es noch einmal fragen. „Pst, Jakob“, fuhr ich ihn durch gepresste Lippen an. „Es gibt keine Hexen.“ Jakob setzte sich auf den kalten Fußboden und ich sah, wie seine Augen feucht wurden.
Noch nie hatte ich ihn so angeherrscht. Schnell reichte ich ihm ein volles Glas Milch und hoffte ihn so abzulenken. Meine Hand zitterte immer noch. „Doch, gibt es.“ Jetzt rollte eine Träne aus dem rechten Auge. Natürlich hatte ich ihm Märchen vorgelesen, aus dem alten Märchenbuch meiner Oma, in Sütterlin geschrieben, von ihnen verboten, hatte ich es dennoch aufgehoben, so wie einige andere Bücher auch. Dornröschen und die Feen, Schneewittchen und die Zwerge, Aschenputtel und die Tauben, Hänsel, Gretel und die Hexe. Ich streichelte seinen Kopf und sah zu, wie er langsam und vorsichtig von der kostbaren Flüssigkeit trank. „Hexen gibt es nur im Märchen“, erklärte ich und wusste es doch besser.
„Da sind ja wieder welche.“ Christinas hohe Stimme krächzte zu meinen Ohren und schien sich einzunisten. „Seht mal, echte Hexen“, krächzte sie weiter zu den wenig Neugierigen, die sich zu uns gesellt hatten. Wieder die gestreifte Katze auf ihrem nun auch nicht mehr ganz so wohlgenährten Arm.
Ich starrte in ihre Gesichter, in ihre Augen, das einzige, was ich noch erkennen würde. Inzwischen sahen sie sich alle so ähnlich. Jakob machte sich von meiner Hand los und wollte Christinas Katze streicheln gehen. Schnell nahm ich ihn auf den Arm ohne meinen Blick von den Schlürfenden loszulassen. Von Marschieren konnte keine Rede mehr sein. Die Rücken gebeugt, die Schritte langsam und die Bäuche leer, kamen sie diesmal aus der anderen Richtung. Ein Blick traf mich, leer und ausgelebt. Ich sah schnell weg. Nichts hatte ich mehr, was ich in ihre mageren Hände hätte drücken können. Alle Äpfel waren gegessen. „Los, schneller.“ Eine andere Stimme, bestimmt, aber die gleiche Uniform, das gleiche Gewehr. Ein Pferd zog einen Wagen, auf dem eine Decke erfolglos versuchte, seinen Inhalt zu verbergen. Zwei leblose Füße sahen hervor und verrieten, was noch darunter lag. „Zur Seite.“ Ein Soldat schob Christina zur Seite, die gerade ansetzte, auf eine der Frauen zu spucken.
„Eines Tages werde ich deine Katze nehmen und zu Ragout verarbeiten“, versuchte ich meine Gedanken von den Menschen, die an uns vorbeiliefen, zu lenken, und musste tatsächlich lächeln, bei dem Gedanken, ihr die Worte entgegen zu schmeißen. „Du Hexe“, fügte ich innerlich hinzu und wünschte mir den Mut sie anzuspucken. Anstatt dessen schwieg ich und ging schnell mit Jakob zurück in mein Haus, stürzte mich auf unser letztes Brot, doch die aufgekommene Übelkeit siegte und ich behielt den Bissen nicht in mir.
Nun war sie da. Sie schlief, ihren Kopf auf die Sofaecke gelehnt, einen unruhigen Schlaf. Ihren Mund leicht geöffnet, ihre Atmung unruhig, schüttelte sie sich ab und zu heftig. Auch ihre Lider, die schwarzen dichten Wimpern, wollten keine Ruhe finden und flatterten hin und her. „Trank?“ Ich erschrak, wie lange hatte ich hier schon gestanden? Jakob hielt sich erneut an meinem Bein fest. Ich sah zu ihm runter, die Tränen in seinen Augen waren verschwunden und schienen einem kleinen Milchbart gewichen. Normalerweise ein Moment, in dem ich lächeln würde. Doch ernst hob ich die Schultern. „Ich weiß nicht“, flüsterte ich und sah mit ihm gemeinsam weiter zu ihr. Seiner Mutter.
Ich atmete tief ein und aus. Mein Herz schien ruhiger geworden zu sein und obwohl meine Hände auch nicht mehr feucht waren, wischte ich sie mir imaginär an meiner Schürze ab. Was hatte ich eigentlich gemacht, bevor sie geklopft hatte? Wie spät war es eigentlich. Vor dem Wohnzimmerfenster sah ich die Sonne sich verabschieden. Ich trat zu ihr und wollte ihr die Beine hochlegen. Sie schlug nach mir.
Erschrocken wich ich zurück.
„Entschuldigung.“ Auch sie schien ebenfalls erschrocken zu sein und versuchte aufzustehen, doch ihr Kreislauf zwang sie zurück. „Ich muss gehen.“ Erneut versuchte sie aufzustehen. „Wohin?“ Hilflos sah ich zu ihr. „Ich“, stammelte ich weiter, „hole erst einmal das Glas Milch.“ Ohne auf eine Reaktion zu warten, lief ich mit Jakob am Bein in die Küche, um festzustellen, dass ich das Glas schon auf den Sofatisch gestellt hatte. Sie trank das Glas in kleinen Schlückchen halb leer. Jakob beobachtete sie weiter neugierig. „Möchtest du das Glas austrinken?“ Sie hielt Jakob das Glas hin und er sah fragend zu mir.
Ich nickte ihm zu und konnte aber kaum zusehen, wie er zu ihr trat und leicht zitternd das Glas nahm. Etwas blitzte in ihrem Gesicht auf, wie ein kurzer Sonnenstrahl, der über ihr Gesicht huschte. Ich spürte meinen Hals trocken werden, musste schlucken und sah aus dem Fenster, wo der Tag nun endgültig zur Neige ging. „Bitte bleiben Sie.“ Ich hatte den Mut wiedergefunden zu ihnen zu sehen. Sie nickte und sah zu Jakob, der sich inzwischen wieder an meinem Bein festhielt.
Dann legte sie wieder ihren Kopf auf die Lehne. Mutig trat ich zu ihr und diesmal ließ sie es sich gefallen, dass ich ihre Beine hochlegte.
„Nur bitte die Schuhe nicht berühren.“ Erschöpft schloss sie die Augen und ließ es sich gefallen, dass ich ihren mageren Körper zudeckte.
„Bleibt sie bei uns?“ Manchmal fiel es mir schwer seine Worte richtig zu verstehen und zu deuten. Doch diesmal verstand ich die Worte, welche er durch seine breite Zahnlücke gesprochen hatte. Ich war noch einmal zu ihr gegangen, um ihr eine brennende Kerze hinzustellen. Die Decke lag auf dem Boden, sie zuckte kurz, als ich ihr die Decke über die Beine legte, ließ aber die Augen geschlossen.
Obwohl die Nächte nicht mehr so kalt waren und die Monsterflieger nun nicht mehr über unser Haus flogen, kroch Jakob doch weiter jeden Abend zu mir ins Bett und ich hielt ihn nicht auf, sondern nahm wie jeden Abend seine kleine Hand in meine. „Ich weiß nicht, ob sie bleibt“, antwortete ich und streichelte über seinen nun fest schlafenden Kopf.
„Mami, Mami.“ Erschrocken fuhr ich hoch. „Sie ist vom Sofa tefallen.“ Jakob stand völlig aufgeregt an meinem Bett und zog an der Bettdecke. Schnell war ich hellwach und auf den Füßen, brauchte aber einen Moment, bis ich mich erinnerte, wen das Kind meinte. Mit Jakob auf dem Arm betrat ich das Wohnzimmer. Tatsächlich lag sie neben dem Sofa, die Beine angezogen, atmete sie weiter unruhig. Vorsichtig stellte ich Jakob auf den Boden, ging zu ihr und legte ihr erneut die Decke über ihren Körper und ließ meine Gefühle miteinander kämpfen.
Fragen schwirrten durch meinen Kopf. Wie lange würde sie bleiben?
Wie viel Zeit hatte ich noch? Ein lautes Klopfen befreite mich von meinen Gedanken. Das Grummeln setzte sofort wieder ein und auch meine Hände drohten feucht zu werden. Warum? Es dauerte ein weiteres lautes Klopfen, bis mir klar wurde, dass es nun ja keinen Grund mehr gab unruhig zu werden. Sie war da und wachte nun auch auf. Verwirrt setzte sie sich auf und brauchte einen Moment, um sich klar zu machen, wo sie war. „Ich gehe öffnen.“ Ein drittes Klopfen, fest und fordernd. „Open the door.“
Ich hatte den Türgriff schon fast in der Hand, als die Worte durch das Haus schallten. Er suchte nicht meinen Blick und sah an meinen Augen vorbei, eifrig mit einem Blatt in seiner Hand wedelnd. „What‘s your name?“ Immer noch wedelnd. Überrascht sah ich zu dem Mann in Uniform, der mir immer noch nicht in die Augen sehen wollte. „Your name“, wiederholte er unruhig. „Steht auf dem Klingelschild“, traute ich mich nicht zu antworten. Versucht freundlich nannte ich meinen Namen und merkte doch die Unruhe in mir aufsteigen. Er fing an, etwas von einem Zettel abzulesen, doch sein Deutsch war für mich kaum zu verstehen und doch nickte ich, als er mir das Blatt Papier reichte. Ein Lächeln um seinen Mundwinkel? Ich folgte seinem Blick. Jakob kam vorsichtig angelaufen und krallte sich erneut an meinem Bein fest. Ein Hupen schreckte uns auf. Wir sahen einen Jeep auf dem Weg vorm Haus. Scheinbar aufgeregt winkte ein weiterer Soldat aus dem Auto in unsere Richtung. „Don‘t talk, only the paper.“ Mein weniges Englisch reichte. Ich verstand, was er meinte. Kurz trafen sich unsere Blicke, sein Gesicht hatte die anfängliche Härte wieder angenommen. „See you later“, keine Floskel, ein Befehl.
„Was erwartest du denn?“ Vor ein paar Tagen hatte Wolfgang seiner Frau erst die Frage gestellt, während sie sich aufregte. „Wir sind ihre Feinde“, hatte er versucht zu erklären, während ich den Mehlsack aufschnitt, den zuvor ein Soldat in die Backstube geknallt hatte. „Ja, ja Frateisierungsverbot“, versuchte meine Schwägerin das schwere Wort erfolglos richtig auszusprechen.
Ohne sich umzudrehen, sprang er in den Jeep und ich sah, wie sie weiterfuhren, zum nächsten Haus gegenüber. Das Haus der Schneiders.
Diesmal stieg der andere Soldat aus und fing an mit einem Zettel zu wedeln. „Da wird niemand öffnen“, sagte ich zwar laut, aber wissend, dass sie es nicht hören würden. Ich sah zu der weißen Fahne, die sicher mal ein Bettlaken oder eine Tischdecke gewesen war und nun verwaist an einem Stock aus einem Fenster hing. Auch bei mir und Jakob hing ein weißes Laken, doch im Gegensatz zu den Schneiders hatte ich sie nicht zu früh hingehängt. Wie erwartet, öffnete niemand.
Fraternisierungsverbot, hörte ich die Stimme meiner Schwägerin und sah an mir herunter. Die Kälte kletterte unter mein Nachthemd.
Nachthemd. Ich hatte im Nachthemd geöffnet, auch Jakob trug noch sein Nachtgewand. Verlegen schloss ich schnell die Tür und ging in die Küche. Wieder stützte ich mich auf den Herd und fing an zu zittern, was nicht nur an der Kälte lag.
Ob es das Nachthemd war oder doch nur die Nerven, konnte ich nicht beantworten. Es schien auch egal, ich hatte keine Chance gegen das, was in mir ausbrach. Scheinbar unkontrolliert fing ich an lauthals zu lachen. Jakob, der mir gefolgt war, sah mich unsicher an, doch es änderte nichts. Ich lachte weiter und konnte nicht mehr aufhören.
Natürlich hatte ich ihre Anwesenheit nicht vergessen. Im Gegenteil, war sie auch ein Grund für das, was mit mir passierte. Ein nicht enden wollender Lachanfall. Nur kurz hörte ich auf, als sie die Küche betrat, um dann doch wieder wie geschüttelt weiterzulachen. Sie sah zu Jakob, der beschlossen hatte, nun auch zu lachen, was blieb ihm auch anderes übrig. Ich schien nun völlig übergeschnappt. „Es ist vorbei.“ Ich sah zu ihr und wollte ihren Namen nennen, doch ich wusste ihn nicht. Auch diese Erkenntnis ließ mich nicht aufhören. Im Gegenteil, ich lachte weiter. Inzwischen tat mir mein Bauch weh und Tränen liefen über mein Gesicht. „Es ist vorbei, endlich ist es vorbei.“ Nun sah sie mich nicht mehr verwirrt an, während sich unsere Blicke kurz trafen, sondern nickte mir zu und ich bildete mir ein, ein leichtes Lächeln in ihren Augen zu erkennen.
Bitte finden Sie sich heute um 12 Uhr am Dorfplatz ein! Bitte stand zwar am Anfang, aber dennoch war es ein Befehl. „Was das ist?“ Mit honigverschmierten Fingern tippte Jakob auf dem Blatt Papier herum.
„Was ist das“, verbesserte ich und sah wie Jakob nun in das Brot biss.
„Schön danach die Finger ablecken.“ Hatte meine Mutter mich jemals dazu aufgefordert? Eine ihrer wenigen Broschen hatte ich für das Glas Honig geben müssen. Ich sah auf die Aufforderung und erklärte Jakob nicht zu wissen, was uns erwarten würde. Ihr Teller war auch noch nicht aufgegessen. Langsam kaute sie auf einem Stück hartem Brot und beobachtete Jakob, der erstaunlich ruhig auf seinem Platz sitzenblieb.
„Sicher wird es nicht lange dauern.“ Wie konnte ich nur so ein Versprechen abgeben ohne zu wissen, was mich erwarten würde? Jakob stürzte sich regelrecht erneut auf meine Beine und krallte sich fest.
Mir blieb wenig Zeit, wissend, mein Zuspätkommen würden sie nicht dulden, und genauso glaubte ich zu wissen, dass ich Jakob lieber nicht mitnehmen wollte. Ich sah auf die Standuhr, die den Zeiten zu trotzen schien und immer weiter stündlich schlug. Es blieb keine Zeit mehr Jakob zu meinem Bruder und seiner Frau zu bringen. Und auf einmal blieb die Zeit stehen, obwohl ich das Pendel schlagen hörte. Jetzt war es also so weit. Ich sprach sie direkt an und bat sie aufzupassen und sie nickte mir zu. So einfach war es. Mein Hals wurde trocken und hastig trank ich einen Schluck gesammeltes Regenwasser. Der Kloß in meinem Hals wollte nicht verschwinden, sondern breitete sich noch aus. Sie würden nicht mehr da sein, wenn ich wiederkommen würde.
„Ich werde dir ein Märchen erzählen.“ Ihre Stimme klang weich und ich hörte keinen Dialekt heraus. Er nickte sie unsicher an und sie lächelte zurück, das erste Mal, dass auch ihre Augen zu lächeln schienen.
Die Uhr tickte weiter und ließ mir keine Zeit mehr meine furchtbaren Gedanken weiterzudenken. Ich musste los. Schnell nahm ich meinen Hut und meinen Mantel und sah noch einmal zu Jakob. Ein letztes Mal? Auch er sah zu mir und kam angelaufen. „Jakob mittommen.“ Verlegen sah ich zu ihr. Sie nickte mir zu. Ihr Lächeln war verschwunden.
„Ich bin auch noch sehr müde.“ Ihr Blick ging an uns vorbei. „Geh ruhig mit deiner ...“ Sie stockte und verlegen sahen wir einander an. „Schuhe holen.“ Jakob hatte mich losgelassen und zusammen sahen wir zu, wie er versuchte seine Schuhe anzuziehen.
„The child stays here.“ Wieder die Uniform der Sieger, doch diesmal steckte ein dunkelhäutiger Mann darin. Jakob sah fasziniert zu dem Mann und hätte ihn sicher gern berührt, doch die Angst, von mir getrennt zu werden, machte ihn mutlos. Wir waren nicht die einzigen gewesen, die unsanft auf einen Wagen gescheucht wurden. Ich erkannte einige Nachbarn und grüßte unsicher. Auch sie schienen nicht zu wissen, was auf uns zukommen sollte, und beobachteten weiter die Soldaten. Eine Frau, gefolgt von einem Mädchen, kam angelaufen. Erst als sie sich mir gegenübersetzten, erkannte ich sie.
Zumindest das, was von ihnen übriggeblieben war. Ihre Überheblichkeit schien verschwunden und hatte Trotz platzgemacht.
Sie grüßten niemanden und saßen mit versucht erhobenen Köpfen zwischen uns anderen. Der Motor wurde gestartet und wir setzten uns in Bewegung.
Den Jahreszeiten hatte der Krieg nichts anhaben können. Sie hatten sich nicht durcheinanderbringen lassen und so blühten vereinzelte Blumen links und rechts des Weges. Ich erkannte Mohn und blaue Feldblumen, auf deren Anblick ich versuchte mich zu konzentrieren, ahnend, dass etwas Schlimmes uns erwartete. Jakob nahm meine Hand und ich hielt sie fest. Sie tuschelte mit ihrer Mutter, den Kopf immer noch gerade erhoben, so wie damals auch.
KURZ DAVOR
„Er sieht Ihnen aber gar nicht ähnlich.“ Vier Augenpaare starrten auf den Jungen. Da das Dorf mittlerweile fast alle Männer in den Krieg entlassen hatte, half sie ihrem Mann bei der Ausübung seines Amtes.
Ich hatte keine Gedanken frei zu überlegen, was genau sein Amt war.
Vorher hieß es einfach Bürgermeister, doch mit den braunen Uniformen waren auch neue Titel gekommen. Neben dem penibel aufgeräumten Schreibtisch stand sie und schrieb mit, was wir besprachen. Ihre Tochter saß an einem weiteren Tisch und malte, ihre Haare ordentlich geflochten, ebenfalls in braune Uniform gekleidet, schien sie nicht zu interessieren, was wir besprachen. Die ganze Nacht hatte ich Worte gesucht und versucht sie auswendig zu lernen. Doch ganz andere sprudelten aus mir heraus. Unsortiert hoffte ich, dass sie einen Sinn ergaben. Bombenalarm in Berlin, das Haus meiner Cousine, zerstört.
Die Cousine tot, das Baby, oh Wunder, unversehrt. Der Vater irgendwo wahrscheinlich in Russland, seit Monaten kein Lebenszeichen mehr.
Die Tante selber Witwe, das einzige, was nicht gelogen war, nicht in der Lage, sich um ein Baby zu kümmern, dort in der Großstadt. Jakob auf meinem Arm schien aufzuwachen und ließ mich die Geschichte noch schneller vorantreiben. Ich sah zu dem Mädchen, das immer noch desinteressiert völlig talentfrei ein Tier malte: Eine gestreifte Katze, vermutete ich. Das Krankenhaus, fuhr ich fort, hoffend, dass mein lautes Herzklopfen nur ich hörte, zerstört. Ich atmete aus und wiederholte den Teil mit dem Krankenhaus, in dem sie entbunden hatte, ebenfalls zerstört. Die Papiere verschüttet. Jakobs einsetzendes Quengeln unterbrach meinen Redeschwall und übertönte mein Herz.
Ich sah ihn direkt an. Er blätterte in einem Ordner und nickte seiner Frau zu. Jakobs Weinen vermied eine peinliche Stille und ich wusste nicht, ob mir das helfen würde. „So, so.“ Sie hatte sich hingesetzt und schlug ihre Beine übereinander. Jakob hörte abrupt auf zu weinen und da war sie, die peinliche Stille. Selbst die Tochter hatte aufgehört zu malen und sah von ihren Eltern zu mir und zurück. Nach gefühlten hundert Minuten hustete er kurz auf und sah weiter in den Ordner vor sich.
„Sie werden sich ja sicher um Ersatzpapiere kümmern.“ Keine Frage, eine Aufforderung. „Ja, natürlich“, log ich. „Dann kommen Sie wieder.“ Er erhob sich und hob seinen rechten Arm. „Aber es kann noch eine Weile dauern“, hoffte ich Zeit zu gewinnen, aber bereute die Worte doch sofort, wie sollte ich auch ahnen, dass Jakob den Mann in seiner braunen Uniform, überhaupt nicht interessierte. „Heil Hitler, Herr Bürgermeister.“ Ich hob Jakob auf die andere Seite, um ebenfalls meinen rechten Arm ausstrecken zu können. „Heil Hitler, Herr Ortsgruppenleiter“, verbesserte das Kind mich und sah stolz zu ihrem Vater, der mich desinteressiert ansah. Ich nickte verlegen, drückte Jakob an meinen Körper und verließ, darauf achtend nicht zu schnell zu laufen, erst sein Büro und dann das Gebäude. Erst als ich mein Haus sah, rannte ich los.
DRINNEN
Sein Blick verriet, dass er keinen Widerspruch dulden würde. „The child stays here“, wiederholte er. „Einen Moment“, bat ich. Nein, bettelte ich. Es half nichts, er schob mich unsacht in einen weiteren Raum, in dem andere Kinder spielten. Eine Soldatin verteilte etwas an manche der Kinder, was sie neugierig auspackten und anfingen zu kauen. Jakob fing, wie erwartet, an zu weinen. Die Soldatin, ebenfalls etwas kauend, sah von Jakob zu mir. Ihr ausdrucksloses Gesicht verriet nicht, was sie dachte. Sie griff in einen Karton und sah zu Jakob, der sich an meinem Bein festhielt. Lächelte sie? Erst jetzt sah ich, was sie in der Hand hielt und Jakob zeigte. Ich musste würgen. Ein alter zerzauster Teddybär, ein Ohr zur Hälfte abgerissen, ein Auge fehlte ganz. Jakob nahm den Bären und drückte ihn an sich. Die Übelkeit breitete sich weiter aus, stellte ich mir vor, welchem Kind dieses Kuscheltier wohl zuvor erfolglos versucht hatte, seine Ängste zu nehmen. Wie wohl alle wusste auch ich, wo ich jetzt war. „Come on.“ Der dunkelhäutige Soldat ließ mir keine weitere Zeit Abschied zu nehmen und schob mich raus, dann nahm er sich einen Mundschutz, setzte ihn auf und überließ uns dem Geruch und dem Anblick.
WEITER DANACH
Sämtlicher Trotz war aus ihren Gesichtern gewichen. Selbst Jakob quasselte nicht, sondern sah still zu seinem neuen Kuscheltier.
Das gerade Gesehene ließ uns alle schweigen. Hatte ich noch am Morgen gelacht? Ja. Hysterisch zwar, schließlich wollten Angst und Erleichterung in Einklang gebracht werden, aber es war ein Lachen gewesen. Nie wieder würde ich das können. Das soeben Erlebte würde das nicht mehr zulassen. Verlegen streichelte ich über Jakobs Kopf und merkte, wie stark ich zitterte. Egal. Niemand wagte es den anderen anzusehen. Die Übelkeit wurde stärker. Der Auspuff gab den Geruch nach verbranntem Benzin frei und ich fing an ihn tief einzuatmen und in meine Nase zu ziehen, erschien es mir doch in dem Moment wie Parfum. Ich kannte viele unangenehme Düfte, der nach verbranntem Brot, Jakobs Hinterlassenschaften in seinen Windeln und sogar den Geruch des bevorstehenden Todes meiner kranken Mutter. Doch dieser Geruch übertraf alles und ich war sicher ihn niemals wieder abschütteln zu können, genauso wenig wie die Bilder, die sich nun unauslöschlich in meinem Kopf eingebrannt hatten. Christina hielt ebenfalls zitternd die Hand ihrer blassen Mutter. Kurz glaubte ich ein wenig Mitleid zu empfinden. Sie hatten ihn mitgenommen, den Ortsgruppenleiter, und nun das. Sie war doch auch noch ein Kind.
Unsere Blicke trafen einander und hielten sich kurz fest. „Alles Hexen.“ Keine Bilder, nur Worte, aber auch diese scheinbar unauslöschlich. Der Laster hielt an, entließ seine Insassen und nahm neue auf. Während ich Jakob runter hob, sah ich zu Christina, die ihre Mutter stützte, und genauso wie wir alle in den letzten Stunden um Jahre gealtert schien. Sie waren kaum am Dorfbrunnen vorbei, als die Mutter, immer noch von ihrer Tochter gestützt, sich übergab. „Warte einen Moment.“ Ohne auf eine Reaktion zu warten, setzte ich Jakob auf eine Bank am Brunnen und sah noch kurz, wie er anfing mit seinem neuen Freund zu sprechen. „Jetzt oder nie.“ Sie setzte sich auf einen Baumstumpf und ich zögerte kurz, bevor ich diesmal die Worte laut zu mir sagte: „Jetzt oder nie.“ Ich holte tief Luft und trat auf sie zu.
„Sie hatten recht.“ Christina sah verwirrt von mir zu der Angesprochenen und zurück. Nun sah auch ihre Mutter zu mir. Ein Tuch vor den Mund haltend, ihr Gesicht umrandet vom kalten nassen Schweiß. „Jakob sieht mir tatsächlich nicht ähnlich.“ Christinas Blick, verwirrt und doch glaubte ich etwas Kaltes darin zu sehen, wanderte weiter hin und her. Ich sah zu Jakob, der immer noch mit dem Teddybären beschäftigt war. „Er kann mir nicht ähnlichsehen, er ist der Sohn einer Jüdin und wissen Sie was“, kurz war ich selber erstaunt über meine Worte, die fest und klar meinen Mund verließen. Schon so oft gedacht und endlich ausgesprochen. „Sie hat überlebt und wartet auf uns zu Hause und deswegen“, ich drehte mich um, „kann ich mich nun auch nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Einen schönen Tag noch.“ Ich drehte mich nicht mehr um. Diesmal war ich es, die erhobenen Hauptes zu dem Kind ging, welches nun nicht mehr mir allein gehörte. „Nach Hause.“ Ein kleines Haus. Vier Räume, eine große Küche und ein kleiner Garten. Aber meins. „Wolfi bekommt die Bäckerei und du dafür das Haus“, hatte Mutter verkündet, einen Brotteig knetend, das faltige Gesicht bedeckt mit Mehlklecksen. Zu gerne hätte ich die Bäckerei übernommen, doch fand Mutter, schon seit dem ersten Weltkrieg Witwe, stand sie jeden Morgen bis fast zu ihrem Tod mit in der Backstube und half, wo sie konnte, dass ich als alleinstehende Frau wohl ungeeignet war. Also blieb mein Wunsch unerfüllt und doch stand ich jeden Morgen mit meinem Bruder in der Bäckerei und versorgte das Dorf mit Brot und Brötchen. „Hunger, Mami.“ Jakob zerrte an meiner Hand und brachte mich zurück in die Gegenwart. Er zog mich in Richtung Haus. Ob sie noch da war? Wollte ich, dass sie noch da war? Sie. Ich wusste nicht einmal ihren Namen.
Jakob zerrte weiter und ich ließ ihn los. Wie konnte ich ihn noch halten? Ich blieb stehen und sah zum Haus. Nichts deutete auf ihre Gegenwart hin und ich spürte kurz eine Leere, die durch meinen Körper wanderte.
„Tom, Mami.“ Jakob war angekommen und wartete auf mich. „Also gut“, sagte ich leise zu mir und machte mich auf den Weg. Sie war noch da und außer meinem erneuten innerlichen Erschrecken bei ihrem Anblick spürte ich kein weiteres Gefühl. Jakob hielt ihr sein neues Spielzeug hin und ich musste würgen, bei dem Gedanken an den Vormittag. „Ein-Auge-Teddy“, stellte ich vor, hoffend, die Bilder kurz aus meinem Kopf zu verbannen. Sie nickte und trat zu mir. „Ich heiße Hannah.“ Ihre dunklen Augen suchten meine und wir sahen einander.
Was hatten ihre Augen alles mit ansehen müssen, welche Dämonen musste sie besiegen? Ihre mageren knochigen Finger drohten zwischen meinen zu zerbrechen. „Ich heiße Irene“, antwortete ich verlegen und sah auf unsere Hände, die einander immer noch festhielten. Sie zog ihre Hand zu sich und sah auf ihre Finger. Unsicher tat ich es ihr nach.
Auch meine Finger waren einmal fleischiger gewesen. Auch mir hatte der Krieg die Fülle genommen. Wie konnte ich nur an mich denken? Beschämt sah ich, wie sie sich zu Jakob bückte. Wie lange war ich dort gewesen? Ein paar Stunden vielleicht? Wie lange war sie… „Und du bist Jakob.“ Sämtliche Gedanken an dort verschwanden, schneller als sie gekommen waren und waren nur noch bei dem kleinen Jungen, der scheinbar selbstbewusst Hannah zunickte. Ich spürte meine Hände feucht werden. Jetzt war es also wirklich soweit. Gedanklich fing ich an seinen Koffer zu packen. Was würde er brauchen? Was nicht? „Hunger, Mami.“ Es dauerte einen Augenblick, bis seine Worte mich erreichten. „Anna auch Hunger?“, fragte er und sah, wie ich, ihr Nicken.
Ich versuchte ein Lächeln. Es gelang mir kaum. „Dann zaubere ich ein Abendbrot.“ Froh über die Ablenkung machte ich mich daran, aus dem wenigen, was meine Speisekammer hergab, etwas zu zaubern, und zwang mich, meine Konzentration nur auf die Kartoffel in meiner Hand zu richten.
„Ist das Ihr Mann?“ Hannah stand in der Wohnstube und hielt ein gerahmtes Bild in der Hand. „Das war mein Mann“, antwortete ich, während ich versuchte den Herd anzufeuern. Nachdem ich es immer wieder aufschob einen Trauerflor daran zu befestigen, hatte ich es am Ende ganz gelassen. Wann sah ich auch je zu dem Foto?
„Günther war sein Name.“ Das Feuer im Herd brannte und spendete Wärme.
„Ein guter Name, Günther“, hatte meine Mutter festgestellt. Die schwere Lungenentzündung hatte sie ins Bett gezwungen. „Und ein guter Mann, Rinchen“, hatte sie betont, bevor ein neuer Hustenanfall ihr das Weitereden erschwerte. „Du wirst nicht mehr so viele Gelegenheiten haben“, hatte sie weiter hervorgehustet. Trocken, emotionslos und doch um mich besorgt, um ihr Rinchen, wie sie mich in den wenigen warmen Momenten nannte. Nicht mehr so viele Gelegenheiten? Es hatte noch nie eine einzige gegeben, abgesehen von einem kurzen harmlosen Kuss, irgendwann während der Volksschule.
Ich sah in die Fensterscheibe, die ein wenig mein Gesicht spiegelte, während die Lungen meiner Mutter weiter um Luft kämpften. Nichts Besonderes. Nichts besonders Hässliches, aber eben auch nichts besonders Hübsches. Eine zu runde Nase in einem zu runden Gesicht, grüne Augen, die wenig strahlten, Sommersprossen tanzten auf einem immer zu blassen Gesicht mit einem schmalen Mund, der nicht dazu passen wollte. Das Getuschel meiner wenigen Freundinnen, wenn sie über Männer oder Jungens sprachen, hatte mich immer gelangweilt.
Und während sie sich Fotos von Hollywoodstars wie Johnny Weismüller oder Laurence Olivier an ihre Wände hängten, hätte ich gerne den Mut gehabt Fotos von Greta Garbo oder Marlene Dietrich zu sammeln.
Günther war irgendwann in der Bäckerei erschienen. Unscheinbar und unbemerkt und doch nun jeden Tag brav sein Hörnchen kaufend.
Irgendwann fragte er mich, ob ich ein Glas Wein mit ihm trinken wollte.
Ich wollte nicht und doch sagte ich ja. Ein paar Monate später fragte er, ob ich seine Frau werden wollte. Ich wollte nicht und doch sagte ich auch diesmal wieder ja.
„Er ist im Krieg geblieben.“ Die Kartoffeln fingen an zu kochen und ich stellte die Flamme kleiner. Ich wischte meine Finger an der Schürze ab und trat zu ihr.
Die Heirat hatte im kleinen Kreis stattgefunden. Unser Führer hatte gerade beschlossen in Polen einzumarschieren, was meine Stimmung noch zusätzlich drückte.
Im Gegensatz zu der Stimmung meines Ehemannes, der es kaum erwarten konnte im Krieg mitzuspielen. Meine Mutter, kaum noch in der Lage frei zu atmen, hatte es sich nicht nehmen lassen ihr Brautkleid so umzunähen, dass es mir passte.





























