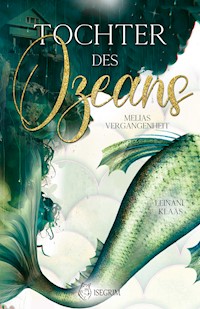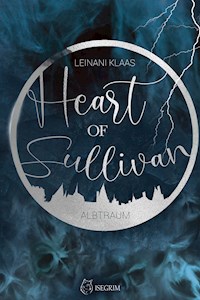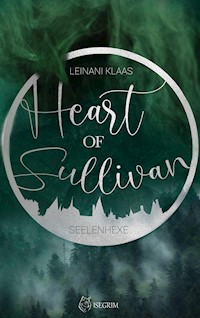
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ISEGRIM
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Seit Tagen beherrschen Dauerregen und dichte Nebelschwaden Hearts Heimatort am Rande des Düsterwalds. Nach und nach verändern sich die Bewohner: sie hören auf zu sprechen und werden zu willenlosen Geschöpfen. Auch Hearts Eltern und ihre beste Freundin sind unter den Opfern. Nur Heart bleibt bei klarem Verstand und muss mit ansehen wie ihr Dorf ausstirbt. Bei ihrer Suche nach Hilfe trifft sie auf eine alte Bekannte, die ihr von einem düsteren Fluch berichtet und schließlich auch auf Emma Waldorf, deren Heimatdorf ebenfalls durch den Nebel ausgelöscht wurde. Gemeinsam kommen sie einer bösen Kreatur auf die Spur und ein Kampf um Leben und Tod entbrennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vollständige e-Book Ausgabe 2019
© 2020 ISEGRIM Verlag
in der Spielberg Verlag GmbH, Neumarkt
Bildmaterial: © shutterstock.com
Covergestaltung: Ria Raven www.riaraven.de
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung
können ziviloder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook - ISBN: 978-3-95452-828-8
www.isegrim-buecher.de
Buchbloggerin, Buchhändlerin to be und Fantasy-Liebhaberin Leinani Klaas ist in den USA und in Deutschland groß geworden und träumte schon in jungen Jahren von einem eigenen Buch. Trotzdem brauchte es einige Jahre, bis es so weit war. »Heart of Sullivan« ist ihr erstes Buch, weitere sind bereits in Arbeit. Die Autorin liebt, schreibt und lebt mit Freund und Katze in Freiburg im Breisgau. Weitere Informationen über sie sind auf Instagram unter @leinanisbookcorner zu finden.
Für alle, die jeden Tag kämpfen.
»An sich ist nichts weder gut noch böse.Das Denken macht es erst dazu.«
William Shakespeare Hamlet II, 2. (Hamlet)
*
Leise prasselt der Regen gegen die Fensterscheibe und läuft in silbrigen Bahnen daran hinab. Tropf, tropf, tropf. Es regnet nun schon seit Wochen und die dunklen, grauen Wolken hängen ankerschwer am Himmel, drücken auf das kleine Dorf am Rande des nebelverhangenen Waldes und auf dessen Bewohner. Die feuchtnasse Luft dringt durch ihre Kleider bis auf ihre Knochen. Sie alle laufen mit gesenkten Köpfen durch die Straßen, den Blick zu Boden gerichtet. Keiner sieht den anderen mehr an, nur das Nötigste wird gesprochen und man zieht sich zurück, sobald die Arbeit erledigt ist.
Angefangen hat es mit dem Regen und den Wolkenmassen. Feuchter Nebel war aus dem Wald über das morastige Feld gekrochen, durch die Gassen und Straßen gewabert und ein Dorfbewohner nach dem anderen ist verstummt. Ist zu einem ›Silent Zombie‹ oder einfach ›Simbie‹ geworden. So nennt sie zumindest Heart.
Heart, das bin ich. Ich bin die einzige, die nicht verstummt ist oder wenigstens noch nicht. Aber ich wage es nicht zu hoffen, dass ich so viel Glück habe und verschont bleibe. Wenn doch, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwann verrückt werde. Schließlich spreche ich kaum noch mit jemandem oder besser gesagt, spricht niemand mehr mit mir. Ich versuche meine Freunde in Gespräche zu verwickeln, Smalltalk zu führen, meiner Familie beim Abendessen von neuen Büchern oder der Schule zu erzählen. Ständig. Wirklich. Aber keiner antwortet. Sie starren in die Ferne, wie auf Autopilot geschaltet, als sähen sie etwas, das mir verborgen bleibt. Es ist ein Wunder, dass die Lehrer in der Schule den Unterricht noch durchziehen und tatsächlich reden. Fast wie früher. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie nie eine Frage beantworten oder stellen. Es kommen ja auch kaum Fragen von den Schülern, außer von mir. Natürlich. Aber das Schlimmste ist die Sache mit der kleinen Buchhandlung. Einem gemütlichen, verwinkelten Geschäft in einem Eckhaus in der Kirschgasse, in dem man Tee aus losen Blüten und Blättern frisch aufgebrüht bekommen konnte. Dazu gab es immer diese kleinen, zuckrigen Teilchen, die die Mutter der Besitzerin frisch buk und nach denen es in der ganzen Buchhandlung duftete. Nach Butter, Zucker und frischem Teig. Wie ich das vermisse.
Die Verkäuferinnen bestellen zwar noch immer Bücher, aber die Gespräche mit ihnen bleiben aus. Sie starren stur vor sich hin und wandern langsam von einem Regal zum anderen. Manchmal versuche ich noch mit meiner Lieblingsverkäuferin über dieses oder jenes Buch zu reden, das ich gerade lese oder noch lesen möchte.
Und das hat auch eine Weile ganz gut geklappt. Denn sie ist eine der letzten gewesen, die sich ›verwandelt‹ hat. Aber nun hat es auch ihr die Sprache verschlagen.
Der Begriff ›verwandelt‹ stimmt übrigens nur so halb. Es ist ja nicht so, als wäre ihre Hautfarbe grün oder grau geworden. Die Haut hängt auch nicht in Fetzen an ihnen herab und sie schlurfen auch nicht gruselig stöhnend durch die Gegend - obwohl, schlurfen tun sie schon. Es ist einfach so, dass sie eben nicht mehr sprechen oder einander anschauen.
Mir graut vor dem Tag, an dem auch ich so werde. Aber noch ist es nicht so weit. Bis der Moment kommt, werde ich versuchen, dagegen anzukämpfen. Vielleicht kann ich bis dahin herausfinden, was die Ursache für unser Problem ist.
Ich halte mich nicht für eine Heldin oder so. Auch bin ich keine Biologin oder Chemikerin, ein Heilmittel kann ich also nicht herstellen, aber ich bin die einzige in ganz Illington, die noch bei Verstand ist und so schätze ich mal, bleibt es an mir hängen, die Stadt zu retten. Welch Ironie…
Montagmorgen.
Das Wetter ist immer noch schlecht. Es schüttet wie aus Eimern, im Düsterwald hängt der Nebel fest, wabert über die Spitzen der Schwarztannen und bauscht sich bedrohlich vor den ersten Häusern auf, die das Pech haben, direkt vor dem sumpfigen Feld erbaut worden zu sein.
Ich laufe mit den anderen Jugendlichen zur Schule. Obwohl mit der falsche Begriff ist… Jeder schlappt für sich alleine über den Bürgersteig.
Ich bin die einzige, deren warme Stiefel keine schrappenden Geräusche auf dem Asphalt machen und die schneller läuft als 1km/h Schneckentempo. Am liebsten würde ich den anderen in den Arsch treten. Aber ich weiß, dass das nichts bringt. Weil ich es schon ausprobiert habe. Sie reagieren nicht mal darauf. Unglaublich, oder?
Es ist zum Haare raufen.
Eigentlich ist dieser Tag genauso wie die letzten sechs, doch ich kann meine beste Freundin unter den anderen Simbies nicht finden. Normalerweise sticht ihr roter Lockenschopf aus der Masse hervor, aber heute nicht. Vielleicht ist sie schon in der Schule? Was ich aber eigentlich ausschließe.
»Hast du Elena gesehen?«
Ich gehe direkt neben Alissa, meiner Sandkastenfreundin, her und stupse sie an. Einen Versuch ist es ja wert.
Aber Fehlanzeige. Alissa hebt nicht mal den Kopf, schlurft einfach weiter und zählt wohl die Kiesel auf dem Boden.
Ich stöhne genervt. Egal wie lange das schon so geht, ich kann mich einfach nicht an diese Stille gewöhnen. Sie macht mir Angst.
Auf dem restlichen Weg erzähle ich ihr von dem Buch, das ich gerade lese, einfach nur um mich reden zu hören, um etwas anderes zu hören als den Wind in den Ästen oder die wenigen Vögel, die noch singen. Auf dem Asphalt haben sich Pfützen gebildet, in denen kleine Blätter schwimmen und in deren Wasser sich die grauen Wolken spiegeln. Graue Wolken, grauer Asphalt, grauer Regen.
Auch im Klassenzimmer fehlt jede Spur von Elena, aber es scheint keinen zu stören oder überhaupt aufzufallen. Der Lehrer steht an der Tafel und versucht uns mit so wenigen Worten wie möglich die Wahrscheinlichkeitsrechnung beizubringen. Funktioniert super…
Eigentlich könnte ich auch daheimbleiben und mir YouTube Videos über Schulthemen reinziehen. Das wäre um einiges lehrreicher. Definitiv. Herr Winter steht mit dem Stück Kreide in der Hand hinter seinem Pult und blinzelt uns an. Er hat wohl sein Repertoire an Wörtern für heute aufgebraucht. Auch gut…
Ich lehne mich zurück und presse fest die Augen zu. Es wird von Tag zu Tag schlimmer, die Leere, die Einsamkeit, niemanden mehr zu haben, mit dem man richtig Zeit verbringen kann. Ein beklemmendes Gefühl breitet sich in meinem Körper aus, das mir die Luft abschnürt und die Tränen in die Augen treibt.
Bloß nicht heulen, Heart!
Den restlichen Schultag bringe ich irgendwie hinter mich, ohne in Tränen auszubrechen. Ich bin fast schon ein bisschen stolz auf mich, aber den nervösen Tick mit der Zunge über die Oberlippe zu lecken, kann ich nicht unterdrücken.
Erst zu Hause werfe ich mich aufs Bett und schluchze, lasse die Tränen über meine Wangen rollen und kann einfach nicht mehr damit aufhören. Der Gedanke an meine Mutter, wie sie da im Wohnzimmer am Fenster steht und einfach nur in den Regen hinausschaut, als gäbe es was zu beobachten, reißt mich entzwei.
Ich habe versucht, sie in den Arm zu nehmen und ihren Duft einzuatmen, aber sie stand so stocksteif da, dass ich sie gleich wieder losgelassen habe. Es war einfach zu gruselig. Und Elena ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ich versuche zu lesen, Serien zu schauen, Gitarre zu spielen. Versuche mich abzulenken. Breche aber immer wieder nach wenigen Minuten ab. Ich kann nicht. Kann mich nicht konzentrieren. Also lege ich mich auf mein Bett und starre an die Decke. Wie sinnlos und einsam. Ich könnte auch einfach hier liegen bleiben. Für immer…
Ruckartig richte ich mich auf. Großer Fehler! Seeeehr großer Fehler! Das ist vermutlich der Anfang allen Unheils. Erst kommt das Gedankenkarussell, dann fühlt man sich einsam und verliert die Lust am Leben, weil ja sowieso alles unsinnig erscheint, dann legt man sich hin, bleibt einfach da, wo man gerade ist und zu guter Letzt wird man apathisch und verwandelt sich in so ein ferngesteuertes Wesen. Gruselig! Das darf mir einfach nicht passieren. Niemals… So schwer es mir auch fällt, - verdammt schwer - schwinge ich die Beine über die Bettkante und mache ein paar Kniebeugen, um meinen Kreislauf in Schwung zu bekommen. Auf, ab, auf und wieder ab. In den darauffolgenden Stunden unternehme ich alles, um mich wachzuhalten. Ich schaue YouTubeVideos, lese ein bisschen, übe mit meinem Hula-HoopReifen, dusche eiskalt, trinke einen Liter Schwarztee und am Abend, als die Schwärze das allgegenwärtige Grau ablöst, setze ich mich zu meinen Eltern aufs Sofa. Der Fernseher ist nicht angeschaltet und wir spiegeln uns in der schwarzen Mattscheibe. Aber das hält Mama und Papa nicht davon ab, auf die Kiste zu starren, als würde dort Bruce Willis wild um sich ballern. Als ich den roten Knopf auf der Fernbedienung drücke, geht der TV mit einem leisen Sirren an, aber meine Eltern zucken nicht einmal. Ich beobachte sie genau. Mit zusammengezogenen Augenbrauen und leicht verengten Augen betrachte ich die zwei steifen Körper neben mir. Ich lege den Daumen auf die Plus Taste und stelle langsam die Lautstärke hoch. Immer lauter und lauter, bis mir die Ohren dröhnen und ich das Gefühl habe, dass mein Trommelfell vibriert. Ich halte mir die Ohren zu und drücke gleichzeitig weiter auf die Taste.
»Unglaublich…«, zische ich die reglosen Gestalten an. Sie könnten auch tot sein, es würde keinen Unterschied machen. Erschrocken lasse ich die Fernbedienung fallen, wo sie geräuschlos im Teppich versinkt. Der Fernseher geht aus.
»Paps? Mami?«, flüstere ich in die plötzliche Stille hinein. Ich rüttele an Papas Schulter und taste dann nach der Stelle an seinem Hals, wo ich den Puls zu spüren hoffe. Atemlos drücke ich den Zeigefinger auf seine Haut und bete inständig, dass ich gleich das regelmäßige Pulsieren seines Blutes fühle. Der Augenblick zieht sich ins Unendliche und ich habe das Gefühl zu ersticken, bis ich endlich das sachte Klopfen an meiner Fingerkuppe spüre. Ich atme laut aus, muss aber trotzdem auch Mamas Puls fühlen. Beide leben. Zumindest ihre Körper tun es. Wenigstens das. Ich glaube, wenn die beiden tot auf dem Sofa säßen, würde ich mich erschießen… Ich lasse die Schultern rollen, es knackst leise in meinem Nacken und ich vermisse Papas starke Hände, die mich jetzt massieren würden. Eine ganze Weile sitzen wir drei stumm nebeneinander auf dem Sofa. Es ist dunkel im Wohnzimmer. Normalerweise würde meine Mutter jetzt aufstehen, um die Lichterketten anzuschalten.
Das Licht ist viel heimeliger und kuscheliger, pflegt Mama dann zu sagen, während sie sich wieder in die dicken Kissen kuschelt. Paps würde ihr über den Kopf streichen und lächeln. Normalerweise… Doch nun bleiben wir im Halbdunkeln sitzen, nur das warme Licht aus dem Flur erhellt das Zimmer ein wenig. Vielleicht sollte ich aufstehen und das Licht anmachen. Oder einfach sitzen bleiben, wie Mama und Papa. Ich bleibe sitzen.
*
Mein Rücken fühlt sich steif an und etwas piekst mich in die Seite. Schlaftrunken blinzele ich gegen die plötzliche Helligkeit an und öffne langsam die Augen. Draußen ist es wieder Tag geworden, aber ich liege noch immer im Wohnzimmer auf dem Sofa. Meine Eltern sind nicht mehr da, haben mich hier zurückgelassen. Mein Kopf fährt herum. Es ist 07:30 Uhr. Shit! In zwanzig Minuten muss ich in der Schule sein. Natürlich ist es schräg, dass ich überhaupt noch zur Schule gehe, mir die Mühe mache aufzustehen und den Tag zu bewältigen. Manchmal wundert es mich auch. Aber ich tue es aus Angst. Aus Angst sonst verrückt zu werden. Wenn ich den gewohnten Ablauf absolviere, bleibe ich vielleicht bei Verstand. Routine hilft mir hoffentlich…
Ich betrete fünf Minuten zu spät das Klassenzimmer. Keiner reagiert, nicht mal der Lehrer schaut mich an. Danke auch! Ich schaue mich um und mein Herz beginnt zu rasen, als ich Elenas leeren Platz sehe.
»Wo ist Elena?«, rufe ich laut.
Der Lehrer fährt unbeirrt mit seinem ›Unterricht‹ fort. Zorn steigt in mir auf. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich gehe auf den Mann hinter dem Pult zu und stelle mich direkt vor ihn. Sein Blick geht durch mich hindurch, als wäre ich gar nicht da. Am liebsten würde ich ihn packen und schütteln, aber trotz allem habe ich noch Respekt vor ihm. Er ist zwar apathisch und völlig in seiner eigenen Welt, aber immer noch mein Lehrer. Stattdessen schmeiße ich ein Stück Kreide gegen die Tafel. Irgendwie muss ich meinem Zorn - oder ist es Angst? - ja Luft machen. Dann wirbele ich herum und stürze an der Klasse vorbei aus dem Raum. Ich hetze durch den Schulflur, an dessen Wänden meine Schritte widerhallen. Ich flüchte nicht vor den Simbies da drinnen, nein! Ich bin auf dem Weg zu Elena. Ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Vielleicht ist sie krank. Vielleicht macht, was auch immer diese Apathie ausgelöst hat, irgendwann krank. Ich hetze durch die menschenleeren Straßen, vorbei an kahlen Bäumen und Autos, die seit Tagen keiner mehr benutzt hat und biege keuchend in Elenas Straße ein. Ich kann das Haus ihrer Familie schon sehen. Es brennt kein Licht darin. Stürmisch klingele ich immer wieder. Doch es öffnet keiner. Was habe ich auch anderes erwartet. Also schleiche ich um das Haus herum und spähe durch die Fenster. Ich fühle mich wie ein Einbrecher, obwohl ich genau weiß, dass niemand mich bemerken wird. Im ganzen Haus ist es dunkel und ich höre keine Geräusche. Früher war in diesem Haus Leben. Mehr als in allen anderen. Elenas drei kleine Geschwister waren ein wilder Haufen, immer auf der Suche nach einem Abenteuer. Ich klopfe gegen die Scheibe. Mehr aus Verzweiflung. Ich erwarte gar nicht, dass jemand öffnet. Dann fällt mir ein, wo der Ersatzschlüssel liegt und ich schließe damit die Haustür vorsichtig auf. Ein bisschen mulmig ist mir ja schon, so ohne Einladung das Haus zu betreten. Als erstes bemerke ich die Kälte. Es ist frostig kalt im Haus, kälter sogar als draußen und ich fange an zu zittern. Aus Gewohnheit streife ich die Schuhe von den Füßen und laufe dann die Zimmer im unteren Stockwerk ab. Gästeklo - leer. Wohnzimmer - leer. Die Tagesdecke liegt ordentlich auf dem grauen Sofa und die verschiedenen Fernbedienungen für Fernseher, Stereoanlage und Rollladen liegen akkurat nebeneinander auf dem DVDSchrank. Als nächstes schaue ich in die Küche - leer. Die Armaturen glänzen wie gerade frisch geputzt, nirgendwo stapelt sich Geschirr und auch der Teller mit dem frisch geschnittenen Obst, der sonst auf der Anrichte steht, ist weg. Als nächstes sind die Zimmer im ersten Obergeschoss dran. Dort wohnen Elenas Eltern und ihre jüngeren Geschwister. In jedem Zimmer ist es das Gleiche. Die Betten sind fein säuberlich gemacht, alle Klamotten sind weggeräumt und nicht mal in den Kinderzimmern liegen Spielsachen. Auch die zwei Bäder sind unberührt. Jetzt bleibt mir nur noch Elenas Zimmer. Ihr Reich ist unter dem Dach. Ein großer heller Raum, mit bodentiefen Sprossenfenstern, einem cremefarbenen Hochflorteppich und einem gewaltigen Kingsize Bett unter der Dachschräge. Ich schließe die Augen und verharre einen Moment am Fuß der Treppe, während ich mir Elenas Paradies vor Augen rufe. Wie meine Mutter, mag sie am liebsten das Licht von Lichterketten und hat über hundert Stück, ich habe sie alle zusammen mit ihr gezählt, im ganzen Raum verteilt. Sogar in ihrem Bad hängen sie. Jede von ihnen ist etwas ganz Besonderes, denn Elena hat jedes einzelne Schirmchen selbst gebastelt und bemalt, mit unendlich viel Hingabe. Mit klopfendem Herzen steige ich die Holztreppe hoch und überspringe die vierte Stufe, weil sie knarzt. Elenas Zimmertür ist plakatiert mit Anti-Amazon Schildern und Plakaten, die lauthals gegen Ausbeutung aufrufen. Ich schmunzele. Kann einfach nicht anders. Meine Erinnerungen driften ab, zu einem sonnigen Tag im Juli, an dem Elena den Postboten gestoppt und verlangt hat, seine Ware zu sehen. Der völlig ahnungslose Bote hat mit den Schultern gezuckt und ihr Einblick gewährt. Elena war mit zusammengekniffenen Lippen um den Wagen herumgelaufen und hat jedes der Päckchen inspiziert und alle Lieferungen von Amazon und Zalando konfisziert. So schnell hat der Bote gar nicht kucken können, wie meine beste Freundin mit der Beute unter dem Arm davongerannt ist. Ich weiß davon nicht etwa, weil ich dabei gewesen bin. Nein, sowas hat Elena schon alleine gemacht. Sondern weil sie in den Abendnachrichten gewesen ist und für einigen Wirbel gesorgt hat, wie ihn unser kleiner Ort noch nie gesehen hat.
Mit bebenden Fingern umschließe ich den kühlen Knauf der Tür und drehe ihn um. Leise schwingt sie nach innen auf und gibt den Blick auf ein Zimmer frei, bei dem sich mir die Härchen im Nacken zu berge stellen und ich mir automatisch über die Lippe lecke. Ich schaffe es kaum einen Schritt über die Türschwelle zu machen. Im Grunde ist Elena recht ordentlich, aber sie hat die Angewohnheit immer und überall ihre Malpinsel und Bastelutensilien zu verteilen. Wie der Rest der Wohnung ist dieses Zimmer makellos sauber und aufgeräumt. Nirgendwo liegen eine Schere oder Klebstoff herum, selbst der vertraute Geruch nach trocknender Farbe ist verschwunden.
»Elena?«, frage ich mit rauer Stimme. Obwohl ich die Antwort bereits kenne, schlägt mein Herz plötzlich schneller. Gegen Hoffnung kommt schließlich niemand an. Ich horche auf die Geräusche im Haus. Und meine Hoffnung fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus im Wind. Niemand ist hier. Das Haus ist verlassen. Verzweifelt rutsche ich am Türrahmen zu Boden und vergrabe mein Gesicht in den Händen. Ein Schluchzen entschlüpft meinen Lippen, obwohl ich mir fest versprochen habe tapfer zu sein. Ich kann spüren, wie die Hoffnungslosigkeit an mir nagt und versucht von mir Besitz zu ergreifen. Ich bin beinahe soweit es zuzulassen. Damit diese Einsamkeit endlich ein Ende hat. Es soll einfach vorbei sein. Mama, Paps. Und jetzt Elena. Ich habe so viele Menschen auf eine so grausame Art verloren, dass ich mir beinahe wünsche, dass sie tot sind. Besser tot und begraben, als wie ferngesteuerte Roboter durchs Leben zu schlurfen. Ohne Bewusstsein und Verstand.
*
Ziellos streife ich durch die nebelverhangenen Straßen und halte Ausschau nach Elenas rotem Lockenkopf. Ich spähe durch Hecken in leere Vorgärten, suche sie auf dem Spielplatz wo sie nachts gerne geschaukelt hat und dabei versucht hat den Sternen mit ihren Füßen nahe zu kommen und stehe schlussendlich mit klappernden Zähnen vor dem Café ihrer Tante.
Doch ›Breakfast bei Tillys‹ ist geschlossen. Das rechteckige Metallschild, auf dem in roter Farbe ›Closed‹ steht, scheint mich zu verhöhnen und mit spöttelnder Stimme zu sagen: »Hier ist sie auch nicht, kleine Heart.«
Meine Hände sind schon ganz klamm und ich ziehe die Enden meiner Ärmel nach vorne, bevor ich an die Tür klopfe. Ich beiße mir auf die Unterlippe, während ich darauf warte und hoffe, dass Tilly mich im hinteren Teil des Cafés hört. Tillys kleines Lokal bietet nicht nur selbstgemachte Sandwiches, Fair-Trade Kaffee und zu Halloween Kürbiskuchen an, sondern auch für jene, die dem spirituellen Glauben angehören, allerhand Krimskrams und übernatürliche Sitzungen. Tilly bezeichnet sich selbst als ›weiße Hexe‹, glaubt an ChiHeilung und die Kraft der Edelsteine. Sie hat mir zu meinem sechzehnten Geburtstag einen Silberring geschenkt, in den ein Mondstein eingelassen ist und gesagt »der Mondstein öffnet deinen Geist und weckt die verborgenen Kräfte in dir, mein Kind.« Eine Gänsehaut hat sich bei den Worten auf meinen Armen ausgebreitet, aber im nächsten Moment musste ich mir das Kichern verkneifen, denn Elena hat die Augen verdreht und eine Grimasse hinter dem Rücken ihrer Tante geschnitten. Bis jetzt haben sich jedenfalls keine verborgenen Kräfte in mir geregt, aber ich trage den Ring dennoch am Ringfinger, weil ich ihn so hübsch finde.