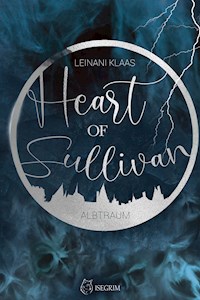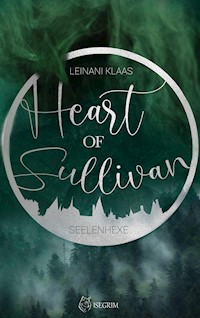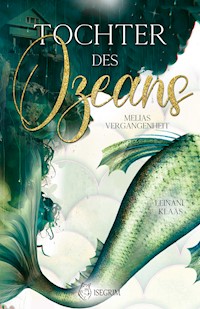
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ISEGRIM
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Eine mit der Gabe des Aiolos und des Poseidon wird unantastbar sein für die, die wir fürchten. Wer die Welt retten will, muss einen hohen Preis bezahlen - das hat Yara auf grausame Weise erfahren. Ihre folgenschwere Entscheidung in die Festung der Meerhexe einzudringen und ihre Familie zu retten, hat sie von allen getrennt, die sie liebt. Doch noch immer droht dem Unterwasserreich der Untergang und sie muss sich ihrem vorherbestimmten Schicksal entgegenstellen und erneut Opfer bringen. Wird sie sich und ihre Welt retten können? Was bedeutet ihr Leben, wenn hunderte davon abhängen? Yara kämpft mit ihrer Verantwortung und um ihr Herz …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT DER AUTORIN
Die alte Prophezeiung
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
GLOSSAR
DANKSAGUNG
Weitere Bücher der Autorin
Buchbloggerin, Buchhändlerin und Fantasy-Liebhaberin Leinani Klaas ist in den USA und in Deutschland groß geworden und träumte schon mit jungen Jahren von einem eigenen Buch. »Heart of Sullivan« und »Tochter des Ozeans« sind ihre ersten Bücher, weitere sind bereits in Arbeit. Die Autorin liebt, schreibt und lebt mit Freund und Katzen in Freiburg im Breisgau. Weitere Informationen über sie sind auf Instagram unter @leinanisbookcorner zu finden.
BAND 1: Tochter des Ozeans - Nereus Prophezeiung
BAND 2: Tochter des Ozeans - Melias Vergangenheit
Vollständige e-Book Ausgabe
© 2023 ISEGRIM VERLAG
in der Spielberg Verlag GmbH, Neumarkt
Bildmaterial: © shutterstock.com
Covergestaltung: Ria Raven www.riaraven.de
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN: 978-3-95452-845-5
www.isegrim-buecher.de
Für Delia!
Für Sandra und Maria!
VORWORT DER AUTORIN
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
Tochter des Ozeans – Melias Vergangenheit ist ein Jugendfantasyroman. Dennoch beinhaltet er Themen, die euch möglicherweise triggern könnten. Auch wenn sie hier reine Fiktion sind, passieren sie tagtäglich. Freiheitsberaubung, körperliche Misshandlung und psychische Beeinflussung sind real. Dennoch handelt es sich hier um ein Jugendbuch und die Themen werden entsprechend behandelt.
Die alte Prophezeiung
In jedem Jahrtausend wird zum Fest des Lichts und des Feuers, wenn der Tag am längsten und die Nacht am kürzesten währt und der Schleier zwischen den Welten sich lichtet, dem Meeresvolk ein Mädchen geboren.
Welches zur Stund, wenn Selene der Eos weicht, das Licht von Helios erblicken wird, der fortwährend über sie wacht.
Und das Kind des Meeres und des Landes vermag die Dunkelheit zu vertreiben und den Frieden zu bringen.
Die Eine mit der Gabe des Aiolos und des Poseidon wird unantastbar sein für die, die wir fürchten.
PROLOG
Schmerz.
Da war so unendlich viel Schmerz. Schmerz und Dunkelheit, die sie erstickten wie ein Kissen, das ein Mörder seinem Opfer schonungslos aufs Gesicht presst. Sie wurde verschluckt von diesem dunklen Etwas, wie ein schwarzes Loch Teilchen ansaugt, um sie zu verschlingen.
Dunkelheit, die dann plötzlich von Millionen von Sternen zerrissen wurde. Winzig kleine, stachelscharfe Sterne, die sich schmerzhaft in ihren Körper gruben.
Sie explodierten urplötzlich in tausende von ultravioletten Supernovae, gleißend hell, stahlblau und verdrängten die Dunkelheit in die letzten Winkel. Die Leuchtkraft nahm milliardenfach zu und für kurze Zeit war es so unerträglich hell wie eine ganze Galaxie.
Das Licht waberte und pulsierte wie eine Feuerqualle, blendete, nahm ihr die Sicht und brachte ihre Nerven zum Zerreißen.
Und dann zog es sich so schnell zurück wie es gekommen war. Zurück blieben nur die Dunkelheit und die dumpfe Ahnung eines Schmerzes, der sich langsam, aber unaufhaltbar, durch Nervenbahnen und Zellen fraß, wie ätzende Säure durch Metall.
Doch das war nur die trügerische Ruhe vor dem Sturm, eine Verschnaufpause. Gerade lang genug, um sich in Sicherheit zu wähnen, bevor der Terror erneut ausbrach und sich wie ein brüllendes Tier aufbäumte, mit seinen Krallen und Zähnen zuschlug, Schmerz und Qualen verursachte. Ihr Herz flatterte nervös, geriet immer wieder ins Stocken und hastete weiter wie eine verschreckte Springmaus. Die Angst raubte ihr den Verstand, nahm ihr die Freiheit zu denken. Nicht einmal die Augen konnte sie aufreißen. Sie war völlig ahnungslos und was noch viel schlimmer war: Sie war hoffnungslos.
Die Hoffnung hatte sich schon vor einer Ewigkeit verabschiedet, war mit einem leisen Puff zerronnen und hatte sie im Stich gelassen. Richtig so, hätte sie gedacht, wenn sie gekonnt hätte. Geflohen wäre sie auch gerne. Ganz weit weg, ohne noch einmal zurückzublicken. Doch stattdessen zog sie sich immer weiter in sich selbst zurück und versuchte sich zu verstecken. Aber mit jeder neuen Attacke wurde sie aus ihrem Loch gerissen und ins Hier und Jetzt zurückbefördert. Wo auch immer dieses Hier war … Der Schmerz war wie ein Tritt zurück ins Leben. Und dafür hasste sie ihn fast noch mehr als für die Pein.
Aber selbst, wenn die Hoffnung die Beine in die Hände genommen hatte, war da noch ein Zipfel ihres alten Überlebenswillens. Ein ganz kleiner, fast nur ein Fussel, aber er war da und sorgte dafür, dass sie nicht komplett aufgeben konnte.
Leise flüsterte er ihr einen Namen zu, immer und immer wieder.
Und da stieß das Ungeheuer zu. Trieb ihr die Klauen in die Eingeweide, zerfetzte sie und wütete in ihrem Fleisch. Sie schrie! Brüllte, bis ihre Kehle ganz wund wurde und sie Blut spuckte. Sie würgte, keuchte, um dann weiter zu schreien. Der Schrei der sich ihrer Kehle entrang, war mehr ein heißeres Krächzen. Etwas bohrte sich in ihre Stirn, zerbrach knirschend den Knochen und wühlte sich in das empfindliche Nervengewebe. Der Schmerz explodierte erneut in abertausende von Lichtern und sie verdrehte die Augen nach innen. Mit den Händen versuchte sie sich an den Kopf zu greifen, wollte das Ding wegschlagen, aber ihre Arme ließen sich nicht bewegen, genauso wenig wie ihre Beine. Es war alles wie immer und doch so viel schlimmer. Mit jedem Mal wurde es unerträglicher. Ihr Körper bäumte sich auf und wurde von den Bändern zurückgehalten, als Nadeln in ihre Nacken, in die Mitte zwischen ihren Schulterblättern und ihren unteren Rücken stachen und bis zu ihrem zentralen Nervensystem vordangen.
Sie keuchte. Der Wunsch nach dem erlösenden Tod erfüllte sie. Sterben. Einfach nur sterben. Bitte!
Sterben …
HILFE!
JENNA!
KAPITEL 1
Die Olympier – Im engeren Sinne nur jene Götter, die auf dem Olymp residieren, zwölf an der Zahl
Die Geräusche um mich herum dröhnten in meinen Ohren, als ich die Augen aufschlug. Und blinzelte. Und noch mal blinzelte. Dann presste ich die Lider fest zusammen, bevor ich sie erneut aufschlug, aber der Schleier nahm mir noch immer die Sicht und ich konnte den Raum, in dem ich mich befand, nicht richtig erkennen. Da war viel Weiß und helles Licht, kaum Konturen, die das Weiß durchbrachen und klare Linien schufen. Als ich versuchte die Hand zu heben, um mir die Augen zu reiben, schnitt mir etwas ins Handgelenk und hielt es an Ort und Stelle. Auch als ich es mit dem anderen Arm probierte, hielt ihn etwas zurück. Genauso wie meinen linken und rechten Fuß. Ich war gefesselt! Mein Herz machte einen nervösen Satz gegen meinen Brustkorb, auch das tat ziemlich weh. Da erst bemerkte ich die schneidenden Schmerzen, die sich in meinem ganzen Körper auszubreiten begannen, und verzog das Gesicht. Es fühlte sich an, als würde mein Körper in Flammen stehen und gleichzeitig in Eiswasser getaucht werden. Alles brannte, stach und ziepte. Was war hier los?
Etwas drängte nach oben. Und dann brachen die Erinnerungen wie ein einstürzendes Kartenhaus über mich herein. Helena, der Stromstoß, der mich lahmgelegt hatte und … Bei den Göttern! Halie!? Ein Stromstoß hatte auch sie erwischt und … und … Halie war tot! Sie war tot. Während ich noch am Leben war. Leben. Und Halie, meine Freundin, meine Tante war … nicht mehr am Leben. Ein Teil von mir wollte nicht wahrhaben, nicht akzeptieren, was geschehen war. Ich presste den Kopf fester in das harte Polster, auf dem ich lag. Vielleicht … Nein, hör auf. Begreife, dass sie nicht mehr lebt! Und dass es deine Schuld ist!
Schuldgefühle nagten an mir. Halie wäre nicht zurückgekommen, wenn ich nicht so verdammt unfähig gewesen wäre und dann würde sie jetzt noch leben. Es war meine Schuld! Ich war schuld daran, dass meine Tante gestorben war. Dieses Wissen war um ein vielfaches Schlimmer als der körperliche Schmerz, der mich quälte. Tränen quollen mir aus den blinden Augen und rannen über meine Wangen und den Hals. Das salzige Nass brannte scharf auf meiner Haut und ich stieß ein Zischen aus. Doch das Weinen half, meine Sicht klarte ein wenig auf, bis ich mehr von meiner Umgebung wahrnehmen konnte als bloß verschwommene Kleckse in einem Meer aus Weiß. Hohe weiße Schränke, die sich bis unter die Decke erhoben und so steril strahlten, dass es mich beinahe blendete, schälten sich aus dem Nichts. Ich ließ den Blick wandern, drehte vorsichtig den Kopf, um die bohrenden Schmerzen nicht weiter zu reizen, und suchte. Doch ich fand nicht, wonach ich Ausschau hielt. Es gab keine Tür in diesem Raum. Kein Fenster, keinen Ausgang. Nichts, durch das man das Zimmer hätte betreten oder auch verlassen können. Ob das gut war oder nicht, konnte ich noch nicht entscheiden, denn jeder Gedanke und jede Überlegung hallte nach wie ein wütender Schrei meiner Nervenenden. Aber das konnte mein Gedankenkarussell nicht stoppen. Das hier war definitiv ein Krankenhaus oder Labor und keines von beiden bedeutete etwas Gutes. Schließlich war ich gefesselt und hatte Schmerzen am ganzen Körper. Das hier konnte gar nicht gut für mich aussehen.
Neben mir piepste ein Apparat in nervtötender Monotonie vor sich hin und ein Kasten rechts von mir stieß zischende Geräusche aus.
Vorsichtig hob ich den Kopf, doch ein heftiger Schmerz durchzuckte meine Schädeldecke und spaltete sie beinahe entzwei. Mir wurde schwindelig und schwarz vor Augen bei diesem Gefühl. Ich merkte, wie Klauen nach mir griffen, mich in den Sumpf der Ohnmacht ziehen wollten, aber ich kämpfte dagegen an. Presste die Zähne zusammen, um das Bewusstsein nicht zu verlieren. Hier lief etwas gewaltig schief. Und was auch immer es war, das hier vor sich ging, ich wollte auf keinen Fall ohnmächtig da liegen, wenn es wieder passierte.
Die Fixierung schnitt mir in die empfindliche Haut meiner Handgelenke, als ich versuchte mich aufzurichten, mein Rücken war schon ganz steif von der harten Liege, auf die man mich verfrachtet hatte. Probehalber drehte ich meinen Arm hin und her. Keine Chance, der Riemen saß fest. Mit einem verzweifelten Stöhnen, sank ich zurück und schloss entmutigt die Augen.
Warum? Warum war ich hier? Und wo war dieses hier? Bittere Tränen stiegen mir erneut in die Augen und ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Wieso konnte ich nicht sicher und behütet … Ja, wo eigentlich? Rockaway Beach war nicht gerade zu meinem Zuhause geworden. Sicher und geborgen hatte ich mich da eher selten gefühlt und die Einrichtung in England … Nein, das war auch kein heimeliges Zuhause, obwohl ich mich da vergleichsweise geschützt gefühlt hatte. Tränen rannen mir jetzt in Sturzbächen über die geschundenen Wangen und ein tiefes Gefühl von grenzenloser Verlorenheit übermannte mich so heftig und endgültig, dass es mir fast den Verstand raubte.
Ich würgte ein aufsteigendes Wimmern ab und biss mir auf die Lippe, bis ich Blut schmeckte. Erst dann, als der stechende Schmerz durch meine Lippe fuhr, ebbte die Verzweiflung langsam ab und ich konnte wieder klar denken. Obwohl noch immer jede Faser in meinem Kopf schmerzte, wenn ich mich konzentrierte, versuchte ich mir ein Bild von meiner Lage zu machen.
Verletzt und gefesselt an einem Ort, den ich nicht benennen konnte. Keinerlei Möglichkeiten mich zu befreien oder zu entkommen. Kein sichtbarer Ausgang. Ich trug ein Patientenhemd. Das ließ auf ein Krankenhaus schließen. Das war schlecht. Und mir tat mein Kopf so unendlich weh.
Im selben Moment ertönte von irgendwoher ein hohes Piepsen, das mich zusammenzucken ließ, dicht gefolgt von einem Geräusch, das wie entweichende Luft klang. Hastig versuchte ich mich schlafend zu stellen, was gar nicht so einfach war, mit verstopfter Nase und tränenverschmiertem Gesicht. Wer auch immer da kam, sollte denken, dass ich nichts von dem mitbekam, was um mich herum geschah. Durch halb geschlossene Lider spähte ich in den Raum, dabei klopfte mein Herz wie wild gegen meine Brust. Einer der Schränke schwang zur Seite und dahinter erschien ein Durchgang, durch den ich einen kurzen Blick auf den sich anschließenden Raum erhaschen konnte, bevor eine große hagere Gestalt erschien und mir die Sicht nahm. Er warf mir einen kurzen Blick zu, bei dem es mir eiskalt den Rücken hinab lief und drehte sich dann um. »Sie scheint noch immer nicht bei Bewusstsein zu sein.«
Wieder erfasste mich ein Schauer. Seine Stimme klang wie ein rostiges Türscharnier, das dringend geölt werden musste.
Leise Schritte näherten sich meiner Liege und ich schloss vorsichtshalber ganz die Augen und wartete. Mein Magen verkrampfte sich, bei der Erinnerung an den Schmerz und als sich zwei kühle Finger um mein Handgelenk schlossen, wäre ich beinahe zusammengezuckt. Doch nichts passierte, die Finger verharrten für einen kurzen Moment an der Innenseite meines Handgelenks, bevor sie sich wieder lösten.
»Sie hat einen Puls von 128, Mister Reddeman. Ich denke sie wird bald zu sich kommen.«
So viel dazu, unbemerkt wach zu bleiben.
»Geben Sie ihr 2mg Lorazepam. Ich will nicht, dass sie durchdreht, wenn sie aufwacht«, ordnete der Kerl mit knarzender Stimme an.
Götter, was? Nein, bitte kein Tavor! Alles nur das nicht.
Schweiß bildete sich auf meiner Oberlippe und jetzt hätte ich gerne meine Tarnung aufgegeben, nur damit sie mir kein Tavor spritzten. Aber die Tatsache, dass sie nicht wussten, dass ich wach war und somit jedes ihrer Worte hören konnte, musste ich ausnutzen. Vielleicht sagte einer von ihnen etwas Nützliches, irgendetwas, das mir später weiterhalf.
Ich öffnete die Augen wieder einen Spalt breit und erkannte das Profil einer sehr jungen Frau mit leuchtend rotem Haar, die gerade eine Flüssigkeit in einen Beutel neben meinem Bett spritzte. Erst jetzt bemerkte ich, dass ein durchsichtiger Schlauch zu meiner Armbeuge führte und darin verschwand.
Das alles hier war so fürchterlich falsch, so ganz und gar vollkommen falsch.
Wieso nur hatte ich mich auf diese ganze Geschichte eingelassen? Nur weil ich nicht egoistisch und selbstsüchtig hatte sein wollen? Am liebsten hätte ich geschrien. Die ganze Verzweiflung und Angst hinausgebrüllt.
»Wie sehen ihre Verletzungen aus, Margret?«
Ich konnte den Blick, mit dem sie mich musterte, förmlich spüren. Er brannte auf meiner Haut.
»Sie heilt sehr langsam. Die Schürfwunden im Gesicht nässen noch, aber der Fibrinbelag hat sich verringert und es bildet sich Schorf. Der Nasenbruch heilt, die Hämatome sind mittlerweile gelb bis grün. Aber sie hat eine offene Wunde an der Unterlippe. Die scheint neu zu sein.«
Kurz trat Stille ein, dann sagte der große Mann - war es Mister Reddeman?: »Die ist neu. Sie muss sich auf die Lippe gebissen haben. Tragen Sie später Bepanthen auf und behalten Sie das im Blick. Wie sieht es mit den Verletzungen an den Armen und Beinen aus?«
Vorsichtige Hände glitten über die Haut an meinen Armen und Beinen und ich musste an mich halten, um nicht Nimm deine Pfoten weg zu knurren.
»Nicht besser als die Wunden im Gesicht, Mister Reddeman. Ich nehme den Verband vom Knie.« Ihre Stimme klang beinahe mitleidig. Ich fand es erstaunlich, wie sie Mitleid mit mir haben, aber mich dennoch hier drin festhalten konnte. Keine Sekunde glaubte ich, dass ich hier zu meinem eigenen Wohl war!
Es ziepte unangenehm, als sie den Verband vom Knie wickelte und abzog.
Sie sog scharf die Luft ein.
»Am besten schauen Sie sich das selbst an, Mister Reddeman. Das sieht gar nicht gut aus.«
Was sah nicht gut aus? Bei den Göttern, was hatten die mit mir gemacht?
Mister Reddeman raschelte neben mir herum und dann tauchten seine Hände in blauen Latex-Handschuhen vor meinem Gesicht auf. Alles in mir krampfte sich zusammen, als sich seine Hände um mein Knie legten und mir wurde speiübel. Das konnte auch an dem Lorazepam liegen, das langsam zu wirken begann. Denn ich merkte, wie ich mich langsam wie in Watte gepackt fühlte und alles weich und ruhig in mir wurde. Mein Herzschlag normalisierte sich und ich schloss benommen die Augen, um mich von dem sanften Gefühl treiben zu lassen. Nicht mal die Hände des Mannes beunruhigten mich noch.
Alles wäre schön gewesen und ich hätte mich gerne auf der sanften Welle davon treiben lassen, wenn mein Magen nicht rebelliert hätte. Spucke begann sich in meinem Mund zu sammeln.
Während die beiden an meinem Knie herumfummelten und sich seltsame Anweisungen gaben, bemerkten sie nicht, wie ich krampfhaft schluckte, um einen Würgereiz zu unterdrücken. Ich holte tief Luft und scherte mich nicht mehr drum, dass sie merken könnten, dass ich doch nicht schlief. Denn sollte ich mich übergeben, war es sowieso aus mit meinem Versteckspiel.
»Sollten wir ihr nicht etwas gegen die Schmerzen geben?«
»Geben Sie ihr Ibuprofen und …«
Ich konnte es nicht länger zurückhalten, mein Magen krampfte sich in Wellen zusammen und ich schaffte es gerade noch den Kopf zur Seite zu drehen, dann erbrach ich mich heftig auf den Boden neben der Liege. Ein Teil landete zweifelsohne auf dem Nachthemd, das ich trug. Meine Bewegungsfreiheit war äußert beschränkt.
»Scheiße!«, fluchte Mister Reddeman. »Lösen Sie die Fixierung an den Handgelenken, schnell, Margret. Sie erstickt!«
Ich würgte noch immer, als sie endlich meine Hände befreit hatte und mir in eine aufrechte Position half. Jemand hielt mir eine silberne Schale unter die Nase, die ich mich zitternden Händen ergriff. Es schüttelte mich, als ein erneuter Schwall meine Speiseröhre hinaufschoss und mir in die Nase drang. Ich keuchte und schniefte und schaffte es nicht, in die Schale zu erbrechen.
»Helfen Sie ihr! Ich hole einen Waschlappen.«
Magret nahm mir mit behandschuhten Händen die Schale ab und hielt sie mir direkt unters Kinn, dabei stützte sich mich ab und schaffte es irgendwie, mir gleichzeitig den Rücken zu streicheln.
Ein Lappen klatsche mir gegen die Stirn und kühlende Nässe tropfte auf mein Gesicht.
»Lehn dich zurück«, sagte Magret ruhig und drückte mich sanft gegen die Liege, deren Rückenteil hochgestellt worden war. Erschöpft sank ich dagegen, dankbar nicht mehr aus eigener Kraft die Körperspannung halten zu müssen. Ich war so erschöpft.
»Wie konnte das passieren?«, fragte Mister Reddeman und obwohl ich mir sicher war, dass die Frage nicht an mich gerichtet war, krächzte ich: »Lorazepam vertrage ich nicht.«
Dann schloss ich die Augen und sank in einen erlösenden Dämmerschlaf.
KAPITEL 2
Zeus – Mächtigster aller griechischen Götter und oberster olympischer Gott
Ich zwang mich die Augen zu öffnen und war erstaunt vom Halbdunkel, das mich umgab. Ich blinzelte. Die Abwesenheit des stechend hellen Lichts beruhigte meine Nerven und das Bohren in meinem Körper verebbte langsam. Aber es verwirrte mich auch. Ich lag einen Augenblick lang regungslos da, bis sich meine Augen etwas an das Zwielicht im Raum gewöhnt hatten, dann erst unternahm ich einen ersten Versuch mich aufzusetzen. Und zu meinem Erstaunen, und meiner grenzenlosen Erleichterung, hinderte mich nichts daran. Weder Fixierungen noch fremde Hände. Dafür erfasste mich fast augenblicklich ein übelkeitserregender Schwindel und die dunklen Schemen des Zimmers verschwammen vor meinen Augen zu Schlieren auf einer Leinwand. Ich grub meine Finger in die Matratze, auf der ich saß, klammerte mich beinahe haltsuchend daran fest und kämpfte gegen den Schwindel an.
Ich zählte bis zehn, wippte mit den Füßen und atmete tief ein und aus. Die Luft schmeckte sauber, ein bisschen salzig vielleicht, fast wie eine frische Brise, die vom Meer hergetragen worden war. Sofort bildete sich ein Knoten in meinem Magen, als ich an das Meer dachte und die Erinnerungen versuchten sich grob in mein Sichtfeld zu drängen. Aber die Angst und die Schuldgefühle die damit verbunden waren, konnte ich jetzt nicht verkraften. Schwungvoller als beabsichtig kam ich auf die Beine. Meine Füße machten ein klatschendes Geräusch als sie auf kühlem Steinboden aufkamen und ich schwankte noch, als ich anfing durch den Raum zu stolpern, um das Zimmer zu erforschen. Hilfe, war mir schwindelig! Nicht nur drehte sich alles in meinem Kopf, auch sah ich helle Flackerlicher durch das Dunkel tanzen. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen sank ich auf dem kalten Boden zusammen und atmete gegen den Brechreiz an. Bis ich aufstehen konnte, ohne umzukippen, brauchte es viele Atemzüge und selbst dann musste ich noch oft blinzeln, damit die Welt aufhörte sich zu drehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffte ich es, kleine Schritte zu tun. Mit nach vorne ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern tapste ich durch den dunklen Raum, bis ich mit den Händen eine Wand erreichte. Sie fühlte sich leicht rau an, gar nicht wie die spiegelglatten Armaturen, die mich neulich geblendet hatten. Wann das wohl gewesen war?
Ich tastete mich langsam, einen Schritt nach dem anderen, erst nach links, fand aber nicht wonach ich suchte und als ich zum Ende der Wand kam, ging ich wieder zurück. Endlich ertastete ich eine Unebenheit und mit bebenden Fingern legte ich den Schalter um.
Mit einem leisen Surren erwachte die Lampe an der Decke und tauchte das Zimmer in warmes Licht. Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte. Erleichterung? Angst? Panik? Müdigkeit?
Ich befand mich nicht mehr in dem sterilen Laborzimmer, in dem ich auf eine Liege gefesselt gewesen war, sondern in einem kleinen und freundlicheren Raum. Er war spärlich eingerichtet, alles diente einem Zweck, aber das Holz und die gelben Wände wirkten so viel angenehmer. Vielleicht fand ich den Raum auch nur deshalb so einladend, weil er nicht nach Krankenhaus oder Schmerzen aussah. Im Vergleich zu vorher war das hier das verdammte Paradies. Gleichzeitig aber auch ein Gefängnis!
Zwei Türen waren in die Wände eingelassen. Die eine war verschlossen und blieb es auch, egal wie sehr ich daran zog, zerrte oder drückte. Dagegentreten brachte auch nichts. Mein immer noch verletztes Bein schmerzte protestierend. Ich humpelte langsam durch den Raum.
Die andere Tür ließ sich problemlos öffnen und schwang nach außen auf. Mein Herz machte einen Satz, obwohl mir klar war, dass diese Tür bestimmt nicht in die Freiheit führte. Wozu gab es sonst die verschlossene Tür?
Hier befand sich ein kleines Bad und … Mein Herz blieb beinahe stehen. Ein Fenster! Kein großes und es war auch relativ weit oben eingelassen, aber wenn ich mich auf den Klodeckel stellte, konnte ich hinausschauen. Gierig presste ich mein Gesicht gegen die glatte Schreibe. Schmerz zuckte durch meine Nase. Was hatte die rothaarige Frau vorhin gesagt? Nasenbruch?
»Aua«, stöhnte ich.
Vorsichtig tastete ich mit den Fingerspitzen über meine Nase. Ein kleines Pflaster klebte darüber und wenn ich dagegen drückte, tat es immer noch ziemlich weh.
Die Scheibe beschlug, als ich dagegen atmete. Rasch wischte ich darüber, um einen Blick hinaus ins Freie werfen zu können. Doch es musste mitten in der Nacht sein, da war nichts, außer tiefer Schwärze. Enttäuscht lehnte ich die Stirn gegen das kühle, glatte Glas und atmete ein paar Mal ein und aus. Ganz ruhig, sagte ich mir selbst. Meine Hände zitterten, als ich wieder vom Klodeckel stieg und mich darauf niederließ. Immerhin liegst du nicht mehr gefesselt auf einer Untersuchungsliege und die Schmerzen sind auch ein bisschen erträglicher geworden. Aber wem machte ich hier etwas vor? Vor lauter Angst zitterten jetzt nicht mehr nur meine Hände. Ich war immer noch gefangen! An einem Ort, von dem ich nicht wusste, was er war oder wo er sich befand. Ich spürte wie mir Tränen in die Augen traten und wollte ihnen schon schluchzend nachgeben, da hörte ich eine leise Stimme in meinem Kopf: Heulen bringt nichts.
Natürlich schnitt mir die Erinnerung an jenen Tag im Wald tief ins Herz, aber ich wusste, dass es stimmte. Auch wenn das hier ein guter Grund zum Durchdrehen war, meine Kraft für Weinen und Jammern zu verschwenden, wäre leichtsinnig. Ich musste unbedingt einen klaren Kopf behalten. Ich atmete tief durch, rieb meine kalten Hände gegeneinander und stand langsam auf. Der Schwindel setzte sofort ein, mäßigte sich aber auch gleich wieder. Ich warf einen letzten Blick gen Fenster und versprach mir, wieder auf das Klo zu steigen, wenn die Sonne aufgegangen war.
Obwohl ich immer noch Angst hatte und mich Sorgen und Ungewissheit plagten, legte ich mich zurück ins Bett und zwang mich zu schlafen. Mein Körper brauchte Erholung, denn ich würde nicht kampflos aufgeben.
Niemals!
Ich wurde wach, als jemand die Tür ins Schloss fallen ließ und mit klirrenden Schlüsseln auf das Bett zukam. Binnen weniger Sekunden saß ich hellwach im Bett, bereit sofort aufzuspringen.
»Guten Morgen, Sonnenschein. Schön, dass du wach bist. Ich bringe dir dein Frühstück.«
Ich musste den Kerl wie blöd angestarrt haben, denn er grinste und sagte: »Sag mir, wenn du genug gestarrt hast.«
Mein Blick verdüsterte sich. War das hier jetzt ein schlechter Witz oder stand wirklich ein Junge vor meinem Bett, der nicht viel älter sein konnte als ich, und versuchte Witze zu reißen?
Ich öffnete ein paar Mal den Mund, schloss ihn aber immer wieder.
Die ganze Situation erschien mir so surreal, dass ich mir unter der Bettdecke in den Oberschenkel kniff. Nein, definitiv kein schlechter Witz.
»Wer bist du?«
»Du kannst mich Finn nennen, Sonnenschein.«
Er stellte ein Tablett auf dem kleinen Tisch ab und grinste immer noch. Er trug weiße Hosen und einen Kasack, der sich um seine Schultern spannte. Ich hatte nie verstanden, weshalb Pflegepersonal so unförmige Kleidung tragen musste. Aber absurderweise standen ihm die Sachen. Ich hob den Blick zu seinem Gesicht und sah, wie er mich verschmitzt angrinste.
»Nenn mich nicht Sonnenschein!«, fuhr ich ihn an.
»Und wie soll ich dich dann nennen? Zuckerpuppe? Babe?«
Mir klappte der Mund auf und vorsichtshalber kniff ich mich noch einmal. Autsch!
»Verarscht du mich gerade?«
Ich war so perplex, dass ich nicht einmal protestierte als Finn sich an das Fußende des Bettes setzte. Ich hatte beschlossen, es nicht mein Bett zu nennen. Er strich eine Falte in seinem Oberteil glatt, ehe er mir, wieder mit diesem Tausend-Watt-Lächeln, antwortete.
»Warum sollte ich, Zuckerschnecke?« Er zwinkerte mir verschwörerisch zu. Seine dunklen Augen glitzerten amüsiert. Innerlich schüttelte es mich. Wer war dieser Kerl? In meinem Kopf ratterte es und ich beschloss ihn auszufragen, anstatt weiter mit ihm zu diskutieren.
»Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort?«
Nun war er es, der das Gesicht verzog und mich abschätzend musterte.
»Hast wohl dein Gedächtnis verloren, was? Hattest du einen Autounfall?«
Unfall? Wovon redete er?
»Macht nichts.« Er schenkte mir wieder dieses strahlende Lächeln, als er aufstand. »Dafür bist du ganz süß. Also wenn man sich die blauen Flecken und so mal wegdenkt. Aber das wird schon wieder. Iss dein Frühstück, dann wird alles besser werden.«
Er schloss die Tür von innen auf und war schon auf halbem Weg nach draußen, da drehte er sich wieder um. »Ach, und Sonnenschein. Es gehört sich nicht, anderen Leuten auf den Hintern zu starren.«
»Was? Ich habe nicht …« Mir blieben die Worte im Hals stecken.
In welcher Welt lebte dieser Typ? Oder gab es hier versteckte Kameras? War das hier eine Reality Show, in die man mich heimlich gesteckt hatte? Aber nein, dafür waren die Schmerzen zu echt gewesen. Trotzdem kniff ich mich zum dritten Mal an diesem Morgen in den Oberschenkel, nur um ganz sicher zu sein, dass ich keinen furchtbar skurrilen Traum hatte.
Obwohl mein Magen noch immer verkrampft war vor lauter Anspannung, setzte ich mich an den Tisch, um zu essen. Während ich lustlos auf einem Butterbrot herumkaute, versuchte ich meine Gedanken zu sortieren. Erst war ich in einem Zimmer gewesen, das an ein Labor erinnerte, und jetzt saß ich an einem runden Tisch und aß ein Frühstück, das mir von einem seltsamen Typen gebracht worden war, der glaubte, dass ich einen Autounfall gehabt hatte? Autounfall. Ich schnaubte, aber lächelte kurz. Unwissentlich hatte Finn eine meiner unzähligen Fragen beantwortet. Ich steckte in einem Krankenhaus fest. Das war mir hundert Mal lieber als ein Labor und Untersuchungen. Nachdenklich tastete ich mein Bein ab. Vielleicht hatten sie gar keine Versuche an mir durchgeführt, sondern mich nur behandelt. Ja, klar. Und deswegen schlossen sie meine Tür ab.
Irgendetwas passte nicht zusammen. Meine Finger wanderten über den Verband an meinem Schienbein und flatterten dann zu meiner gebrochenen Nase. Womöglich hatte ich wirklich einen Unfall gehabt und erinnerte mich an nichts. Woher konnte ich wissen, dass die Dinge, an die ich mich zu erinnern glaubte, stimmten?
Nereïden. Pah. Das konnte doch nur eine Ausgeburt meiner Fantasie sein. Und griechische Gottheiten, die im Clinch mit einer Meereshexe standen und deshalb die Hilfe einer Minderjährigen brauchten, die angeblich ihre Prophezeite war, klang viel unglaubwürdiger als ein Unfall. Ein Unfall, bei dem ich mir stark den Kopf gestoßen hatte. Sehr stark. Aber wieso kam dann niemand, um mich zu besuchen? Brenda, Megan und … Es gelang mir nicht, ihren Namen zu denken. Oder waren sie auch nur Einbildung? Aber wieso sollte man mich dann einsperren!
Erinnerungen flatterten durch meinen Kopf. Bilder von einer düsteren Festung, einem Verlies unter der Erde und von Halies rosa Haaren.
Ich seufzte tief und lehnte mich auf dem Stuhl zurück. Wem machte ich hier eigentlich was vor?
Ich rieb mir über die Augen. Mir nicht.
Aber ›was wäre wenn‹ zu spielen, wenn auch nur mit mir selbst, war besser als sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Also webte ich mir einen Teppich aus Fantasien und Hoffnungen zusammen. Mal angenommen, ich hatte einen tragischen Unfall gehabt, bei dem ich mein Gedächtnis verloren hatte und nur mal angenommen, all die Sachen, die ich glaubte zu wissen, waren frei erfunden, dann musste da draußen irgendwo eine sorgende und liebende Familie auf mich warten, die bald kommen und mich nach Hause holen würde.
Ich pickte mit den Fingerspitzen die Krümel vom Teller. Es war ein Wegwerfteil aus Pappe, nicht aus Keramik, und Besteck gab es auch keines. Die Brote waren schon aufgeschnitten und hergerichtet gewesen. Obwohl hergerichtet vermutlich der falsche Begriff für das hier war: Zwei Butterbrote, eine Scheibe Gurke und eine kleine Tomate. Das wars. Nicht einmal Wasser hatten sie mir gebracht.
Gerade begann ich mich zu fragen, was ich den ganzen Tag hier tun sollte, als von außen die Tür aufgeschlossen wurde. Ich blieb stocksteif sitzen und wartete mit pochendem Herzen auf meinen Besuch.
Doch es war nur der Blödmann Finn, der sein strahlendes Lächeln anknipste als er auf mich zukam.
»Na, hat‘s geschmeckt, Sonnenschein?«
Die Stuhlbeine quietschten über den Boden als ich zurückrutschte, um Abstand zwischen ihn und mich zu bringen.
Das brachte ihn zum Lachen. »Hey, ich beiße nicht. Außer du bittest mich darum.« Er ließ seine Augenbrauen tanzen.
»Sag mal, bezahlen sie dich dafür, hier den Clown zu spielen?«
Finns Lächeln verrutschte ein bisschen und er musterte mich kurz abschätzig. Aber das war mir egal. Verdammt, was glaubte der Typ was ich hier machte? Urlaub? Das hier war schließlich nicht Disneyland.
»Der Doc kommt gleich.«
Er schnappte sich das leere Tablett und ging ohne einen weiteren Spruch. Laut fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.
Na, hoffentlich hatte ich ihn jetzt soweit vergrault, dass er seine Sprüche bleiben ließ.
KAPITEL 3
Poseidon – Gott des Meeres, olympischer Gott, trägt einen Dreizack
»Streck bitte den rechten Arm aus.«
»Nein.«
»Tu einfach, was ich dir sage, dann geht alles ganz schnell.«
»Nein!«
»Yara, streck den Arm aus.«
»Nur über meine Leiche.«
Er holte tief Luft. »Ich möchte nur deinen Blutdruck und Puls messen. Ich will dir nicht weh tun.«
Alles in mir stäubte sich dagegen, diesem Mann zu gehorchen. Wie er da stand, in seinem weißen Kittel, fast zwei Meter groß und mit einem gewaltigen Schnurrbart, jagte er mir jedes Mal aufs Neue Angst ein. Er hielt eine Blutdruckmanschette in Händen, die er mir um den Oberarm legen wollte. Aber ich weigerte mich, ihn auch nur in die Nähe meines Arms zu lassen. Es reichte schon, dass er vor dem Bett stand und mich anschaute. Außerdem gingen ihn meine Werte gar nichts an.
»Das glaube ich Ihnen aber nicht.« Entschlossen verschränkte ich die Arme vor der Brust. Ich war bereit ihn zu beißen, wenn er mir auch nur einen Schritt näherkam.
Er seufzte und zog ein kleines Gerät aus der Tasche. Ich zuckte instinktiv zurück, aber er hob es nur an den Mund und sagte: »Patientin Y17.0.04 ist erneut unkooperativ. Weigert sich …«
»Ich heiße Yara Bright und ich bin keine PATIENTIN. Ich bin eine Gefangene!«, rief ich laut und deutlich.
»Yara!« Er ließ das Diktiergerät sinken. »Ich bin nur hier, um deine Vitalfunktionen zu dokumentieren und deine Verletzungen zu untersuchen.«
»Die Sie mir zugefügt haben!«, blaffte ich zurück.
»Ich habe nichts dergleichen getan.«
»Dann eben Ihre Kollegen.«
Das war unser morgendliches Ritual, er betrat mein Zimmer, wollte mich untersuchen und ich weigerte mich so lange bis er wieder ging. Danach saß ich stundenlang allein in meinem Zimmer und versuchte nicht durchzudrehen, bis Finn kam, um mir das Mittagessen zu bringen. Leider hatte er seine übertriebene Fröhlichkeit genau so wenig abgelegt wie seine Arroganz. Er nannte mich immer noch hartnäckig Sonnenschein oder Zuckerpuppe, grinste, versuchte zu flirten und brachte mich damit auf die Palme. In den wenigen Momenten, in denen er mich nicht tierische nervte, hatte ich herausgefunden, dass er neunzehn Jahre alt war, Biologie im ersten Semester studierte und hier jobbte, um sich das Studium zu finanzieren. Er schien wirklich zu glauben, dass ich einen Unfall gehabt hatte, bei dem meine Erinnerungen verloren gegangen waren, und ich spielte einfach mit und mimte die Unwissende. Aber leider stand er auf der Gehaltsliste so weit unten, dass er keinen Zugriff auf Akten oder Informationen hatte. So fand ich kaum wichtige Dinge heraus, außer an einem Abend. Es war schon recht spät, als er mit dem Abendessen ins Zimmer kam. Alles war wie immer, er schloss hinter sich die Tür, stellte das Tablett mit den Broten auf den Tisch und grinste mich an. Aber heute wirkte er irgendwie aufgekratzt, noch mehr als sonst.
»Was ist denn mit dir los?«, fragte ich so nett ich konnte. Seine Art hätte ansteckend wirken können, wenn meine Situation nicht so deprimierend und ausweglos gewesen wäre.
Er schenkte mir ein breites Lächeln und lehnte sich gegen den Tisch. »Ich habe heute Geburtstag, Zuckerpuppe und wir feiern bei meinem Alten daheim. Da hat man einen guten Ausblick aufs Meer. Wird ziemlich cool. Ich würde dich ja einladen …«
Er ließ den Satz unbeendet. Ich musste schlucken, als ich an meine letzte Party dachte. Damals war alles noch so viel einfacher gewesen.
Finn schien mir meine Traurigkeit anzusehen, denn er kam auf mich zu und streckte die Hand aus.
»Fass mich nicht an!« Mit einem Satz war ich aus dem Bett gesprungen und presste mich an die Wand. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Er blinzelte überrascht.
»Sorry, ich wollte nur …«
Ich seufzte. »Schon okay.« War es nicht, aber ich wollte es mir mit ihm nicht verspielen. Er war der einzige Mensch, der mir nichts Böses wollte und der mir vielleicht doch irgendwann das ein oder andere verraten konnte. Und ja, seine übertriebene Art war vielleicht oft nervig, aber wenigsten eine Ablenkung.
»Tut mir leid. Ist nur alles ein bisschen viel. Naja, also, alles Gute zum Geburtstag.«
Damit brachte ich ihn wieder zum Grinsen und ich atmete erleichtert aus.
»Danke, Süße.«
Die Härchen in meinem Nacken stellten sich auf.
»Welcher Tag ist heute eigentlich? Kommen viele Leute zu deiner Party? Oh man, ich hätte auch echt mal wieder Lust auszugehen.«
Mit klopfendem Herzen hielt ich die Luft an und wartete.
»Fragst du mich gerade, ob ich mit dir ausgehen möchte?«. Er lachte leise und seine Augen glitzerten, als er mich jetzt musterte.
Bestimmt nicht! »Ja, vielleicht.«
Ich schenkte ihm ein kleines, schüchternes Lächeln, von dem ich hoffte, dass es ihn von meinem eigentlichen Plan ablenkte.
Dass ich nicht gerade verführerisch aussah, in meinem Patientenhemd, wusste ich selbst, aber immerhin waren die Blessuren in meinem Gesicht beinahe vollständig verheilt. Nur das Pflaster auf meiner Nase verriet noch, dass ich vor nicht allzu langer Zeit so ausgesehen hatte, als ob jemand mit einem Hammer auf mein Gesicht losgegangen war.
»Es kommen schon ziemlich viele Leute heute Abend. Full House. Und heute ist Freitag. Der perfekte Tag zum Feiern.«
»Cool.« Ich grinste ihn an. »Freitag der wievielte noch mal?« Ich tat so als würde ich mein Hemd richten, sah aber aus dem Augenwinkel, dass er die Stirn runzelte.
»Sorry, manchmal funktioniert mein Kopf noch nicht so richtig und ich vergesse immer wieder, was der Arzt mir gesagt hat. Der Unfall muss doch ziemlich heftig gewesen sein.« Ich schlug die Augen nieder.
»Macht ja nichts. Dafür hast du ja mich, wenn du mal wieder nicht weißt, was du willst.« Finn zwinkerte mir frech zu.
Innerlich knurrte ich, aber ich hielt mich zurück, in der Hoffnung, dass da noch mehr kam.
»Heute ist der 18. November und ich muss jetzt echt los. Sorry, Babe. Ich würde ja gerne noch bleiben, aber da warten Leute auf mich.«
Mein Herz klopfte wie verrückt. Der 18. November?
»Ah, hast du es weit bis zu deinem Dad?«
»Nee, der wohnt nicht weit von hier. Mit dem Auto sind es zwanzig, dreißig Minuten. Also. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Schaffst du das so lange ohne mich?« Wieder zwinkerte er mir zu.
»Mal schauen.« Ich zuckte mit den Schultern und unterdrückte ein Stöhnen.
»Also Ciao, Süße.«
Ich saß auf meinem Bett, die Hände ineinander verschlungen und starrte an die Wand. Der Hunger war mir vergangen.
Es war der 18. November. Seit fast einem Monat war ich jetzt von Rockaway Beach fort und ich mochte mir gar nicht ausmalen, was zu Hause los war. Vermutlich hielten sie mich bereits für tot. Und wenn nicht, quälten sie die Sorgen um mich. Bisher hatte ich es mir verboten, an Jenna zu denken, denn dann schnitt es mir tief ins Herz und ich bekam keine Luft mehr. Meine Vorsätze, nicht mehr zu weinen, schmolzen dahin. Als ihr schönes Gesicht in meinen Erinnerungen auftauchte und ich an ihre Wärme und an ihren Lavendelduft dachte, zerriss es mich in tausend Teile. Ich krümmte mich zusammen und versuchte die leere Stelle in meiner Brust zusammenzuhalten. Automatisch fuhr meine Hand zu meinem Hals, dorthin wo ihr silberner Ring an einer Kette gehangen hatte, und fasste ins Leere. Er war weg. Das wusste ich schon seit Tagen, doch es schmerzte jedes Mal aufs Neue, wenn ich den Verlust bemerkte. Die Vorstellung, jemand anderes würde ihn anfassen oder gar tragen, war unvorstellbar für mich und mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich zog die Decke bis ans Kinn hoch und wickelte mich darin ein wie ein Baby. Dann legte ich mich unter das Bett auf den glatten Boden. Im Schutz meines Verstecks wiegte ich mich vor und zurück und erlaubte den Tränen für diesen einen Moment über mein Gesicht zu laufen. Jenna. Halie. Und all die anderen. Ob ich sie wohl je wiedersehen würde? Jemals wieder Jennas Lachen hören würde, ihre sanften Berührungen fühlen würde?
Ich stellte mir vor, wie Finn, ahnungslos wie er war, in seinem Auto saß, den Feierabend genoss und auf dem Weg zu seiner Party war. Wenn ich neben ihm säße, würde ich das Fenster runterlassen, den Kopf in die hereinwehende Prise halten und tief die frische Luft einatmen. Wir würden laut Musik hören, vielleicht lachen und über irgendetwas belangloses reden. Und dann würde Jenna auf der Party sein, sie würde mir entgegenlaufen und mich fest in die Arme nehmen. Mit diesem Gedanken schlief ich ein.
KAPITEL 4
Hera – Gattin und Schwester des Zeus, olympische Göttin, Dargestellt mit Diadem und Zepter
»Wo ist sie?«
»Verdammt, sie kann doch nicht weg sein!«
»Dieser Taugenichts von einem Praktikanten.«
Laute Stimmen holten mich in die Realität zurück. Ich lag noch immer zusammengerollt wie eine Sushi Rolle unter dem Bett und fühlte jeden einzelnen Knochen in meinem Körper.
»Wenn der Kerl von seinem Wochenende zurückkommt, kann er was erleben.«
Das war die unverwechselbare Stimme von Mister Reddeman, die zu den zwei birkenbestockten Füßen gehörte, die eilig im Zimmer auf und ab gingen. Sie suchten mich! Das gefiel mir und hätte nicht Finns Job auf dem Spiel gestanden, wäre ich freiwillig nicht unter dem Bett hervorgekommen. Dabei ging es mir weniger um ihn als um das, was er mir möglicherweise noch verraten konnte.
»Ich bin hier«, krächzte ich und verhedderte mich bei dem Versuch samt Decke unter dem Bett hervorzurollen.
»Was machst du da unten?« Der Arzt ging neben dem Bett in die Hocke und spähte zu mir herunter.
»Yoga«, knurrte ich und strampelte mich endlich aus der Decke frei. »Nach was sieht‘s denn aus?«
In entgegengesetzte Richtung krabbelte ich unter dem Bett hervor. Mister Reddeman hatte seine Freunde Sir Blutdruckmanschette und ›Du siehst ja schon viel besser aus‹ – Krankenschwester mitgebracht.
»Hallo Yara. Was hast du denn unter dem Bett gemacht?«, fragte auch sie jetzt. Wie immer saß ihr leuchtend rotes Haar, das mir seltsam bekannt vorkam, wie eben frisch frisiert und wären da nicht die Erinnerungen an Höllenqualen gewesen, hätte mich ihr freundliches Lächeln täuschen können. Doch so musste ich mich zusammenreißen, um nicht wieder zu zittern. Sie mochten mir in den letzten Tagen zwar keinerlei Schmerz zugefügt haben, aber dennoch hielten sie mich hier fest und logen mich an. Ihr ›es ist nur zu deinem Besten, Yara‹, kaufte ich ihnen nicht ab. Vor allem, da mir niemand konkrete Antworten geben wollte, weshalb es besser für mich war, eingesperrt zu sein. Bei der Frage, warum ich überhaupt hier war, schien sie eine plötzliche Taubheit zu befallen und sie verließen eilig den Raum. Den Raum, den ich seit Tagen nicht verlassen hatte. Das Schlafzimmer und die angrenzende Nasszelle, die eigentlich keine war, da es dort nichts gab, mit dem man sich hätte nass machen können, waren seit dem Morgen als ich in diesem Bett aufgewacht war, alles was ich zu sehen bekam. Nicht einmal der Ausblick aus dem Fenster brachte mir Abwechslung. Jemand mit einer sadistischen Ader hatte außen ein Brett angebracht.
»Wenn du dann so weit wärst.« Mister Reddeman baute sich mitten im Zimmer auf. Die anderen beiden stellten sich hinter ihn und gemeinsam musterten sie mich abwartend. Ich wusste, worauf sie warteten. Jedes Mal wenn sie das Zimmer betreten hatten, war ich früher oder später ausgerastet und hatte getobt und geschrien. Anfangs hatte mir noch alles wehgetan dabei, doch jetzt verschaffte es mir ein gewisses Maß an Befriedigung sie so zu sehen. Auch wenn ich wusste, dass es kindisch war.
»Wofür denn?«, fragte ich argwöhnisch.
»Wir wollen dich nur ein bisschen untersuchen. Deine Wunden anschauen und so«, sagte die Krankenschwester.
»Niemals.« Bei dem bloßen Wort untersuchen stellten sich mir die Härchen auf den Armen auf.
»Heute habe ich wirklich keine Lust auf deine Sperenzchen. Entweder zu kooperierst oder wir betäuben dich. Wie du willst.« Um seine Worte zu unterstreichen, zog er eine Spritze aus seiner Kitteltasche und hielt sie hoch. Mir verschlug es beinahe den Atem.
»Betäuben?«, presste ich hervor. Kalter Schweiß sammelte sich auf meiner Stirn, meine Atmung ging flacher und ich brauchte all meine Kraft, um angesichts dieser Spritze nicht durchzudrehen. Angst vor dem, was sie wieder mit mir tun würden, verätzte meine Sinne und geschlagen taumelte ich nach vorne in die Arme der Krankenschwester. Sie redete auf den Arzt ein, der ihr daraufhin kühl Anweisungen erteilte, doch das zog an mir vorbei. Ich konnte nur an die Spritze und an den quälenden Schmerz denken. Ich hatte solche Angst vor dem, was jetzt passieren würde, dass ich kaum mitbekam, wie die Tür zum Flur aufgeschlossen wurde und ich zum ersten Mal das dahinter betrat. Die Krankenschwester stützte mich auf dem ganzen Weg und redete beruhigend auf mich ein. Vor und hinter uns, ging je einer der Ärzte, bewachte mich, versperrte jede Fluchtmöglichkeit. Als ob ich gewusst hätte, wohin ich fliehen sollte. Als ob ich hätte fliehen können.
Der neue Raum war seltsam. Leer, bis auf einen Schreibtisch und ein Pult mit vielen Knöpfen und blinkenden Lichtern. Das Außergewöhnlichste aber waren die komplett verglasten Wände, die den Raum umschlossen. So musste sich eine Heuschrecke in ihrem Terrarium fühlen. Dahinter war nichts. Nur ein leerer Raum, der das Terrarium, in dem wir standen, umgab. Vor dem Schreibtisch standen zwei Männer, starrten konzentriert auf das Pult, bewegten Schalter und drückten Knöpfe.
»Ist sie so weit?«, fragte einer von ihnen, ohne sich uns zuzuwenden. Sein Rücken war breit und durch den weißen Stoff seines Kittels zeichneten sich Muskeln ab, die man nur durch harte Arbeit bekommen konnte. Sein Haar war kurz geschoren, wie beim Militär, und alles an ihm, von seinem Aussehen über seine Körperhaltung, war respekteinflößend. Niemand mit dem man sich freiwillig anlegte.
»Ja, Sir«, sagte Mister Reddeman.
Etwas an dem zweiten Mann ließ mich meine Frage nach dem wofür vergessen. Ich konnte nicht recht sagen, was es war, das mir so bekannt vorkam, aber in diesem Moment schrillten meine Alarmglocken los. Ich kannte ihn, aber ohne sein Gesicht zu sehen, vermochte ich nicht zusagen, woher.
»Dann bringt sie rüber.«
Man drehte mich um, schubste mich wieder durch die Tür und führte mich in einen zweiten Raum, der wieder nur mit einer Schlüsselkarte zu öffnen war. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss, noch ehe ich mich richtig umgeschaut hatte, und ich saß erneut in der Falle. Erst jetzt, als ich wieder alleine war, lichtete sich der Schreck und ich begann mich zu fragen, was hier vor sich ging. Wofür sollte ich bereit sein? Was war das hier für ein Raum? Er war nackt und kahl. Fenster gab es keine, das Licht kam von Röhren in der Decke und es roch ungewöhnlich. Am Boden und an der Decke waren Gitter eingelassen, die glänzten wie frisch poliert. Es dauerte ganze zehn Sekunden, bis ich den Geruch zuordnen konnte. Es roch nach Salz. Da ertönte ein lauter Gong von irgendwoher, der mir durch Mark und Bein ging und in den Wänden fing es an zu rumoren. Im ersten Moment glaubte ich, dass sich die Wände in Bewegung gesetzt hatten, dann merke ich, dass es viel schlimmer war. Meine Füße wurden nass und binnen weniger Sekunden, stand ich kniehoch im Wasser. Der Schrei, der mir entfuhr, hallte von den Wänden wider. Alles in mir wehrte sich gegen den Gedanken. Gegen den Schrecken, der sich vor meinen Augen abspielte. Doch als das Wasser jetzt auch von oben aus den Gittern schoss und an den Wänden herablief, konnte ich die Augen nicht länger verschließen. Das hier war kein Terrarium, es war ein Aquarium. Mein Aquarium!
Das Wasser schoss in Sturzbächen von der Decke, klares, kaltes Nass, das mir in kürzester Zeit bis zum Bauch reichte. Es brannte in den offenen Schnitten und Kratzern. Was sollte das? Wollten sie mich umbringen? Ich drehte mich der Wand zu, hinter der sich der Kontrollraum und die anderen befanden, und starrte auf die dunkle, massive Wand, die keinen Blick auf das Dahinter zuließ. Aber ich war mir sicher, dass sie da waren, da saßen und mich sehen konnten, mich beobachteten. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Die Wassermassen drückten auf meinen Körper und der Wasserpegel stieg immer schneller. Ich kämpfte mich zur Wand durch, schwamm fast und schlug mit den Fäusten auf sie ein.
»Lasst mich raus!«, brüllte ich. Meine Angst schwoll an und ich keuchte immer schneller. »Bitte.«
Wasser drang mir in Mund und Nase, ließ mich husten und würgen. Es schmeckte bitter auf meiner Zunge. Immer wieder schnappte ich nach Luft, ruderte mit den Armen, um über Wasser zu bleiben, bis ich mit der Nase fast gegen die Decke stieß. Ein letztes Mal schnappte ich nach Luft, dann schloss sich das Wasser über mir und begrub mich unter sich. Mehrere Augenblicke schwebte ich reglos durch dieses stille, nasse Gefängnis, die Augen weit aufgerissen und hörte nur meinen donnernden Herzschlag. Luftblasen drangen aus meinem Mund nach oben und zerschellten an der Decke. Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde mir schwindeliger, die Ränder meines Sichtfeldes flimmerten, mir ging der Sauerstoff aus. Ich wollte nicht sterben, nicht so! Ich wollte, musste, Jenna wiedersehen, ich wollte meinen Schulabschluss machen, irgendetwas, vielleicht Kunst, studieren, die Welt erkunden, vielleicht irgendwann eine Familie gründen und eine unkonventionelle Ehe führen. Ich wollte so viel von diesem Leben, das wurde mir plötzlich in dieser aussichtslosen Situation klar. Dieses Leben, das ich in Rockaway Beach geführt hatte, so kurz es auch gewesen war, hatte mir gefallen und meine Augen für Träume und Wünsche geöffnet. Für Dinge, an die ich früher nicht einmal zu denken gewagt hatte. Jetzt wollte ich sie! Unwillkürlich, wie aus einem Instinkt heraus, öffnete ich den Mund und mein Körper, der nach Sauerstoff gierte, schnappte nach Luft. Doch nur Wasser füllte meine Lungen, drang in mich ein, durchflutete mich und füllte meine Zellen aus. Dann stieß ich das Wasser wieder aus, saugte es wieder ein und plötzlich war mir nach Lachen zumute. Ich war so dumm. Natürlich würde ich nicht sterben. Nicht weil man mich in ein Aquarium voller Wasser steckte. Das hier musste einen anderen Zweck haben. Ich kannte ihn nur noch nicht, aber ertränken wollten sie mich nicht. Die Erleichterung, die kurz aufgeflackert war, verebbte und wurde von Entsetzen abgelöst. Einem so heftigen Entsetzen, dass mir wieder schwarz vor Augen wurde. Ich sank auf den Boden hinab und kauerte mich dort zusammen.
Sie wussten was ich war!
Das volle Ausmaß dieser Erkenntnis traf mich hart und unerwartet. Ganz gleich, was ich gedacht hatte, das sicher nicht. Aber was hatte es zu bedeuten, dass sie zu wissen schienen, was ich war? Wer waren sie? Wieder erdrückte mich eine Erkenntnis, wieder rang ich nach Luft - dieses Mal aber vor Angst. Es fiel mir gerade unfassbar schwer, einen klaren Gedanken zu Ende zu führen. Alles wirbelte in meinem Kopf herum, ein wilder Sturm aus Worten und Sätzen, bei dem mir schwindelig wurde. Ich griff mir an die Schläfen und versuchte verzweifelt zur Ruhe zu kommen. Mein ganzer Körper zitterte, ich atmete immer hektischer das Wasser ein und meine Gedanken wurden so laut, dass ich die Augen panisch zusammenpresste. Nein, nein, nein. Und dann wurde es mit einem Mal so still in mir, dass ich mir beinahe wünschte, wieder die Stimmen in meinem Kopf zu hören. Denn so konnte der Gedanke klar und deutlich an die Oberfläche dringen. Mir wurde speiübel.
Sie wussten alles.
Helena hatte gewonnen.
Zumindest gegen mich. Wie es den anderen, Pronoe, Galene, Doris und auch Hecat und Hyrus ergangen war, ob sie es geschafft hatten zu fliehen, wusste ich nicht. Schmerzlich erinnerte ich mich an das letzte Mal, als ich meine meerische Familie gesehen hatte, und daran, was passiert war. Ich hielt es fast nicht aus, an Halie und Augustin zu denken, es tat so fürchterlich weh, dass mein angeschlagenes Herz brannte und wie wild schlug. Halie. Meine liebe, aufgeweckte und manchmal vorlaute, aber so liebenswerte Halie. Ich konnte es kaum ertragen, dass sie meinetwegen gestorben war. Dass Augustin meinetwegen tot war. Hoffnung war etwas, das ich in diesem Moment nicht hatte. Ich wagte nicht, auch nur zu hoffen, dass zumindest Augustin nur ohnmächtig gewesen war. Daran, dass ich ihretwegen überhaupt in diese Situation geraten war, konnte ich nicht denken. Es war nicht ihre Schuld und wenn, war es auch egal. Ich war hier und meine schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten. Ich presste die Oberarme fest vor meine Brust.