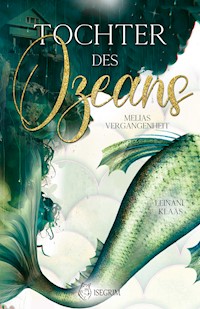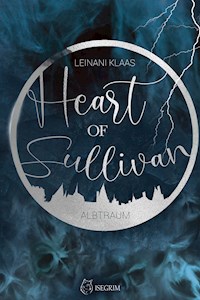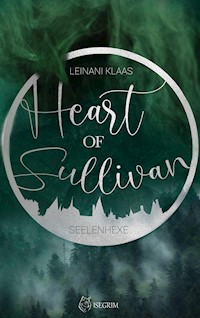Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ISEGRIM
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
„Und das Kind des Meeres und des Landes vermag die Dunkelheit zu vertreiben und den Frieden zu bringen.“ Als Clara kurz vor ihrem 18. Geburtstag endlich von einer Pflegefamilie aufgenommen wird, scheint sich für sie alles zum Positiven zu wenden. Doch im beschaulichen Rockaway Beach angekommen, fühlt sie sich vom Meer unnatürlich angezogen und die Ereignisse überschlagen sich. Plötzlich ist Clara Mittelpunkt eines jahrhundertealten Konflikts und in eine Prophezeiung verstrickt, die ihr Leben gefährden könnte. Wird sie das Risiko eingehen und in eine neue Welt eintauchen oder das sichere Leben an Land wählen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT DER AUTORIN
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
DANKSAGUNG
Vollständige e-Book Ausgabe
»Die Tochter des Ozeans«
© 2020 ISEGRIM VERLAG
in der Spielberg Verlag GmbH, Neumarkt
Covergestaltung: Ria Raven, www.riaraven.de
Coverillustrationen: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN: 978-3-95452-829-5
www.isegrim-buecher.de
»Ich liebe das Meer wie meine Seele,
denn das Meer ist meine Seele.«
Heinrich Heine
Buchbloggerin, Buchhändlerin to be und Fantasy-Liebhaberin Leinani Klaas ist in den USA und in Deutschland groß geworden und träumte schon in jungen Jahren von einem eigenen Buch. Trotzdem brauchte es einige Jahre, bis es so weit war. »Tochter des Ozeans« ist ihr zweites Buch, weitere sind bereits in Arbeit. Die Autorin liebt, schreibt und lebt mit Freund und Katze in Freiburg im Breisgau. Weitere Informationen über sie sind auf Instagram unter @leinanisbookcorner zu finden.
VORWORT DER AUTORIN
Tochter des Ozeans – Nereus Prophezeiung ist eine fiktive Geschichte, genau wie die Charaktere. Dennoch sind Gewalt, Misshandlung und psychische Erkrankungen real und ernst zu nehmen. Themen wie diese sind nicht für jede Person leicht zu lesen und können möglicherweise starke Gefühle auslösen. Darauf möchte ich hiermit hinweisen.
Für alle, die noch nach ihrem Platz im Leben suchen und bereit sind, mehr zu geben, als sie je bekommen haben. Euch allen widme ich dieses Buch. Seid stark!
»Normal ist ein von der Gesellschaft festgelegtes Mittelmaß, um ein Optimum zu beschreiben, das nur in unseren Köpfen existiert.«
(Teilnehmerin bei Instagram-Umfrage)
»Wenn jemand oder etwas der Norm entspricht. Kann somit auch zugleich ›langweilig‹ sein… ;)«
(Teilnehmer bei Instagram-Umfrage)
»Das, was ich ›kenne‹ und für mich alltäglich ist.«
(Teilnehmerin bei Instagram-Umfrage)
»Eigentlich ist nichts normal, alles ist besonders, einzigartig.«
(Teilnehmerin bei Instagram-Umfrage)
»Normal ist das, was ein Normaler als normal betrachtet.
Da sich jedoch jeder selbst als normal betrachtet,
ist es schwer zu sagen, was denn nun wirklich normal ist.«
(Anonym)
»Normal ist nur der Durchschnitt des allgemeinen Wahnsinns!«
(Anonym)
Und was ist für Dich normal?
In jedem Jahrtausend wird zum Fest des Lichts und des Feuers, wenn der Tag am längsten und die Nacht am kürzesten währt und der Schleier zwischen den Welten sich lichtet, dem Meeresvolk ein Mädchen geboren.
Welches zur Stund, wenn Selene der Eos weicht, das Licht von Helios erblicken wird, der fortwährend über sie wacht.
Und das Kind des Meeres und des Landes vermag die Dunkelheit zu vertreiben und den Frieden zu bringen.
Die Eine mit der Gabe des Aiolos und des Poseidon wird unantastbar sein für die, die wir fürchten.
PROLOG
»Yara, Yara, Yara. Ich bin Yara Bright!«
Sie wiederholte es wie ein Mantra. Immer und immer wieder. Sie hatte es in der letzten Zeit so oft wiederholt, wie oft genau wusste sie schon gar nicht mehr. Bestimmt tausendmal, aber so weit konnte sie noch gar nicht zählen.
»Yara, Yara Bright…«
Wenn sie sich schon an nichts anderes mehr erinnern konnte, dann durfte sie zumindest sich selbst nicht vergessen. Das war wichtig, das wusste sie. So viele Dinge hatte sie schon vergessen, zum Beispiel, welcher Tag heute war, ob es immer noch Sommer oder schon Herbst war. Sie konnte sich auch nicht mehr an die blendende Helligkeit der Sommersonne erinnern. Oder wie es sich anfühlte von ihren Sonnenstrahlen auf der Nase gekitzelt zu werden. Der Geruch von frisch gemähtem Gras und die prachtvolle Vielfalt der bunten Blumen im Garten waren aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Aber vor allem wusste sie nicht mehr, wie sie hierhergekommen war. Da war eine dunkle Lücke in ihrem Kopf, die die Erinnerungen daran verdrängte.
Ihr fehlte Nähe, körperliche, menschliche Nähe und sie sehnte sich nach Geborgenheit und der Wärme eines vertrauten Heimes.
Ihr war kalt, so kalt. Eiskalt! Sie saß zitternd auf dem nackten Betonboden, die Arme um die dünnen Beine geschlungen, die nur in kurzen sommerlichen Shorts steckten. Sie zitterte vor Kälte, aber auch vor Angst, bodenloser, schwarzer Angst, die ihren kleinen Körper packte und durchschüttelte.
»Yara… Yara… Mein Name ist Yara.«
Ihre piepsige, kraftlose Stimme verlor sich in der schummrigen Dunkelheit um sie herum.
Sie wiegte sich vor und zurück und flüsterte ihren Namen wie ein beruhigendes Kinderlied, wie eines das ihr Daddy im Auto mit ihr gesungen hatte, wenn er sie morgens in den Kindergarten gefahren hatte.
Ihr Körper war schon ganz steif gefroren und weiße Wölkchen bildeten sich beim Ausatmen in der Luft vor ihrem Gesicht.
»Yara, Yara, Yara…«
Eine neue Angstwelle ergriff sie und durchflutete ihr ganzes Sein, füllte sie aus bis in die kleinste Zelle. Sie hatte vor so vielem Angst. Davor ihren Namen zu vergessen, Angst vor der Dunkelheit, in der sie saß, und vor allem aber hatte sie Angst vor ihm.
Sie verstand nichts von dem, was er sagte oder ihr antat. Sie wusste auch nicht, warum sie hier eingesperrt war und warum er sie nicht gehen ließ. Ihr Verstand begriff das Ausmaß ihrer Situation nur bedingt.
Als sie vor Kälte erschauderte, fingen ihre Zähne an zu klappern. Sie schlugen aufeinander und das schaurige Geklapper hallte von den nackten Wänden wider, die sie umschlossen. So sehr sie sich auch bemühte die Zähne aufeinander zu pressen, sie schaffte es nicht, ihr Kiefer hatte sich verselbstständigt.
Und dann, mitten in die Dunkelheit hinein, ertönte das Geräusch von schweren Schritten auf einer Holztreppe, die nach unten kamen. Zu ihr.
Ihr Herzschlag verdoppelte sich und galoppierte los. Sie schnappte panisch nach Luft. Mit jedem knarzenden Schritt wuchs ihre Angst.
»Yara, ich heiße Yara Bright! Yara, Yar… Yaya…«
Vor Panik verhaspelte sie sich, verschluckte fast ihre Zunge.
Er kam!
Was würde er ihr dieses Mal antun? Würde er ihr wieder wehtun, sie auf Knien betteln lassen, sich ganz nah vor sie setzen und sie einfach aus seinen blutunterlaufenen Augen anstarren?
Egal was er tat, sie würde wieder ein Stück mehr vergessen und ein bisschen mehr von sich verlieren. Es würde immer so weitergehen, bis sie sich selbst ganz vergessen hatte und verloren war im Würgegriff der Zeit.
Jetzt waren die Schritte auf massivem Boden zu hören, kamen immer näher und näher.
Sie versuchte nicht zu schreien, das mochte er gar nicht.
Aber die Angst, die sich jetzt in ihr Gehirn fraß, war nicht mit der Angst von gerade eben zu vergleichen. Sie war viel schrecklicher und zerstörerischer.
Ein Schloss wurde klickend geöffnet. Sie zitterte heftiger.
Klick. Ein zweites Schloss wurde entriegelt. Sie bekam keine Luft mehr.
Klick. Schloss Nummer drei war offen. Ihr wurde schlecht.
Und mit einem lauten Scharren wurde der Riegel zurückgeschoben.
Als die Tür geöffnet wurde, war sie halb ohnmächtig vor Angst. Yara, der Name hallte durch ihren Kopf. Gelähmt starrte sie auf den schmalen Streifen Helligkeit, der plötzlich durch den Türspalt sickerte.
Flimmerndes Licht der brummenden Leuchtstoffröhren drang ins Zimmer, als die Tür aufgezogen wurde.
Von der plötzlichen Helligkeit geblendet, nahm sie nur den verschwommenen Umriss einer großen, hageren Person wahr.
Aber das reichte, um sie in Tränen ausbrechen zulassen.
KAPITEL 1
Eos - Göttin der Morgenröte, fährt in ihrem Wagen über den
Himmel
Die Helligkeit durchdrang meine geschlossenen Lider und tauchte die Welt für einen Augenblick in rotes Licht. Geblendet blinzelte ich und erspähte durch schmale Augen den Sitz vor mir. Stöhnend richtete ich mich auf und versuchte mich in meinem engen Platz zu strecken. Mir schmerzte der Rücken, als ich mich gerade hinsetzte und als ich versuchte meine Glieder zu dehnen, stieß ich mit den Knien gegen den Sitz vor mir. Meine Zunge fühlte sich pelzig an. Igitt. Immer noch leicht benommen zog ich die verrutschte Schlafbrille vom Kopf und stopfte sie in die dazugehörige Netztasche. Die Ohropax ließ ich aber lieber in den Ohren, denn das laute Brummen der Maschine hörte ich sogar durch sie hindurch.
Verschlafen ließ ich meinen Blick durch das Flugzeug schweifen, das sich in dreizehntausend Metern Höhe über dem Erdboden befand. Die meisten Leute um mich herum waren wieder wach, schauten Filme oder unterhielten sich leise miteinander. Der kleine Quälgeist von Platz 30E hing seinem müde aussehenden Vater schlafend über dem Schoß und sabberte.
Einige Passagiere hatten sogar schon das Frühstück vor sich stehen und ich sah die zwei rothaarigen Stewardessen mit ihrem Getränkewagen den Gang runterkommen. Wasser! Ich brauchte Wasser.
Die Schlaftablette hatte ganze Arbeit geleistet und mich mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt. Ein Zustand, der mir absolut zuwider war, konnte doch jeder in solchen Momenten mit mir machen was er wollte. Ich hasste es, die Kontrolle zu verlieren. Und noch mehr hasste ich meine Paranoia, die mich immer wieder an meine Grenzen brachte und mich in den Wahnsinn trieb. Etwas, das ich über die Zeit hinweg zu verbergen gelernt hatte und das niemals an die Oberfläche drang, wenn ich es nicht zuließ! Naja, meistens jedenfalls. Manchmal überkam mich eine Welle der Angst ganz unerwartet und erwischte mich eiskalt.
Meine eiserne Regel lautete: Lass die Leute nicht sehen, wie verrückt du wirklich bist.
Nichtsdestotrotz war das hier mein erster Flug und meine Psychologin war der Meinung gewesen, dass jemand wie ich es besser ertragen würde, wenn man mich ruhigstellte.
In kleinen Schlucken genoss ich das prickelnde Wasser und schaute aus dem Fenster, hinaus auf die schneeweißen Wolken unter uns. Ich konnte das Land in der Tiefe nur schwer ausmachen, aber es sah jetzt schon ganz anders aus als meine Heimat. Brauner und trockener. Und viel, viel größer.
Manchmal war es immer noch unvorstellbar für mich, dass all das Wirklichkeit war. Es war wie ein riesengroßes, buntes Geschenk nur für mich alleine. Und selbst jetzt, mehr als drei Jahre danach, wollte oder konnte ich mich immer noch nicht daran gewöhnen, aus Angst, dass man es mir gleich wieder entreißen wollte.
Das war ein Grund, weshalb ich so minimalistisch wie möglich lebte. Ich besaß weder ein Smartphone noch einen MP3-Player oder anderen technischen Schnickschnack. Von der neusten Mode hatte ich keinen blassen Schimmer und es war mir auch egal. Es war nicht wichtig.
Das Einzige, aus dem ich mir wirklich etwas machte, waren Bücher. Es fühlte sich gut an, ein schweres gebundenes Buch in den Händen zu halten, die Seiten zwischen den Fingern zu spüren und mit der Fingerkuppe über die gedruckten Buchstaben zu fahren.
Ein Buch war für mich wie ein Anker und eine Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen und zu entspannen. Und Entspannung war etwas, das meine kaputte Seele brauchte. Doktor Jones war der festen Überzeugung, dass mich zu viel Hektik und Unruhe aus der Fassung bringen und mich um Längen zurückwerfen würden.
Und recht hatte sie, Horrorfilme zum Beispiel waren in der Tat der blanke Horror für mich. Noch Wochen nachdem Mallory, meine Zimmernachbarin, mich gezwungen hatte, heimlich mit ihr ›Chucky die Mörderpuppe‹ anzuschauen, war ich am helllichten Tag von Panikattacken heimgesucht worden. Man fand mich jedes Mal zusammengekauert unter der Treppe sitzend, nachts war ich mehrfach schweißgebadet und schreiend aus einem Albtraum aufgewacht. Mallory war tatsächlich das pure Unglück für mich gewesen. Noch eine Woche zuvor hatte Doktor Jones die Medikamente vorübergehend abgesetzt, wegen guter Fortschritte.
Aber nach dem Vorfall hatte sie mich, ohne zu zögern, wieder unter ›Drogen‹ gesetzt und hatte dieses Mal sogar die Dosis verdoppelt.
Und ich hatte meine lieben kleinen Helferlein, wie Doktor Jones das Bromazepam nannte, brav geschluckt. Die Albträume verschwanden, aber die Panikattacken bei Tag blieben.
Abgesehen von der leichten Verwirrtheit und dem verringerten Gefühlsempfinden plagten mich immer häufiger Halluzinationen. Die Wände schienen mich auszulachen und es war jenes männliche Lachen, das ich jahrelang gefürchtet hatte, denn es war der Vorbote für seine schlechte Laune gewesen, die er immer an mir ausgelassen hatte. Oder ich hörte schwere Schritte auf der Treppe, vor denen ich dann panisch davonrannte. Manchmal rannte ich soweit ich konnte. Und das war im Fall des Florence-Nightingale-Instituts für Bekloppte und ganzheitlich Irre ein beträchtliches Stück. Ein weitläufiger Park umgab das rote Backsteingebäude, damit die Verrückten von der offenen Station frische Luft schnappen oder verträumt auf einer der Bänke unter den Weiden sitzen konnten.
Der Park war von einer großen Mauer umgeben, die mit Stacheldraht abgesichert war.
Bis dorthin floh ich und warf mich blind vor Angst gegen den Stein, kratzte mir die Finger wund und kassierte jedes Mal eine Nacht in der Gummizelle dafür.
Mallory wurde in eine andere Einrichtung versetzt, nachdem man den Film bei ihr fand. Ich vermisste sie nicht.
Bei der Landung in Portland erbrach ich mich in meinen Spuckbeutel und blieb länger als alle anderen im Flugzeug sitzen. Ich wartete darauf, dass sich mein Magen beruhigte.
Ich fühlte mich, wie nach dem ersten Mal als ich Bromazepam eingenommen hatte.
Elend, einfach nur elend.
Eine Stewardess brachte mir stilles Wasser und redete sanft auf mich ein. Es war keine der beiden rothaarigen.
Schließlich musste ich das Flugzeug doch verlassen und gelangte mit wackeligen Beinen über die Gangway ins Innere des Flughafens. Dort roch es nach schlechtem Männerparfum und Reinigungsmittel.
Mein Magen rebellierte.
Während ich an der Gepäckausgabe in der großen Halle auf meinen kleinen Koffer wartete, behielt ich die Leute im Blick. Ich war noch nicht lange auf freiem Fuß und fühlte mich in der Öffentlichkeit immer unwohl und beobachtet. Ich konnte jeden neugierigen Blick wie Spinnenbeine auf meiner Haut spüren und das Getuschel der Leute drang in meine Ohren.
Ich kratzte mich am Oberarm und warf einen nervösen Blick über die Schulter, nur um festzustellen, dass meine Paranoia mich fest im Griff hatte. Keiner starrt dich an, beschwor ich mich selbst.
Ich schüttelte den Kopf wie ein Hund, um das Pfeifen in meinen Ohren loszuwerden.
Das hier war nicht das verfluchte Kaff Hexham, Northumberland in England. Hier kannte mich kein Mensch. Niemand wusste, wer ich war. Für die Reisenden war ich nur ein x-beliebiges Mädchen, mittlerer Größe und mit zu dünnen Beinen, das bestenfalls im Weg stand.
Die Leute nahmen nach und nach ihr Gepäck auf und verschwanden, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Es war ein wunderbares Gefühl so ignoriert zu werden.
Schließlich spuckte das Band meinen kleinen Koffer aus, den ich mit Leichtigkeit anhob und hinter mir herzog.
Gleich würde ich meine Adoptivfamilie treffen, meine neue Familie. Die einzigen Menschen wohlgemerkt, die ich mit dem Begriff Familie in Verbindung bringen konnte.
Ich war mäßig aufgeregt. Ich kannte Brenda und Dan bereits. Sie hatten mich zweimal in England besucht, das erste Mal waren sie zu zweit gekommen und eine Woche geblieben. Das zweite Mal hatten sie ihre Tochter Delilah mitgebracht.
Brenda und Dan mochte ich von Anfang an, sie lachten und redeten viel, nannten mich Darling und Sweety und umarmten mich ständig. Etwas, das ich selten zuließ, normalerweise hielt ich mir Menschen vom Leib. Körperliche Nähe und Berührungen vertrug ich ungefähr so gut wie Horrorfilme. Nämlich gar nicht. Vor allem wenn es ein Mann war, der mir zu nahekam.
Meinem ersten Psychologen in Hexham, Professor Doktor Bird, hatte ich in die Hand gebissen, nachdem er versucht hatte meine Schulter zu tätscheln.
Brenda und Dan aber waren sanft und strahlten eine Geborgenheit aus, bei der ich mich sofort wohlfühlte. Vor allem Brenda hatte ich ins Herz geschlossen. Ein gutes Zeichen, wie Doktor Jones fand.
Ihre Tochter war sehr still gewesen und ich glaube, dass die Irrenanstalt und ich ihr ziemliche Angst eingejagt hatten. Die nächsten Tage kam sie nicht mehr zu Besuch und ich hatte ihre Eltern für mich alleine.
KAPITEL 2
Helios - Sonnengott, lenkt den Sonnenwagen über den
Himmel, folgt der Eos
Zielstrebig steuerte ich auf die Empfangshalle zu, passierte eine letzte Schiebetür und fand mich in einer großen sonnendurchfluteten und lärmigen Halle wieder.
Überall standen Menschen, redeten durcheinander und freuten sich lautstark über das Wiedersehen, kleine Kinder schrien und…
»Clara! Hier drüben.«
Ich reckte den Hals nach der Stimme, war aber zu klein, um über das Gedränge hinwegsehen zu können. Ich wurde einfach von der Masse mitgezogen und weiter zum Ausgang gedrängt. Links rempelte mich eine Frau an und von hinten trat mir jemand auf die Ferse. Vollidioten.
In meinem Inneren spürte ich, wie meine Klaustrophobie in mir aufkeimte. Meine Eingeweide zogen sich zusammen und das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich hatte plötzlich das Gefühl zu groß für meinen Körper zu sein und bekam Schweißausbrüche.
Mit einem erstickten Schrei machte ich einen Satz nach vorne, drängte mich grob an den Leuten vorbei, setzte meine Ellenbogen ein und erkämpfte mir meinen Weg aus dem Gewühl. Hinter mir protestierte jemand. Leck mich doch!
Ich erreichte den Ausgang, stolperte ins Freie und rang gierig nach Sauerstoff. Dicke Abgase erfüllten meine Lungen. Autos, Shuttles und Taxis verpesteten die Luft um mich herum.
Aber allemal besser als die Enge der Empfangshalle.
Ich wollte da nicht wieder rein, aber ich musste meine neue Familie finden, die sich bestimmt schon wunderte, wo ich war. Wo ihre verrückte Adoptivtochter steckte.
»Clara, Sweety«, Brenda tauchte vor mir auf, ihr Blick war besorgt, »Wo läufst du denn hin?«
Ich suchte nach den richtigen Worten, um mein seltsames Verhalten zu erklären.
Ich fand sie nicht, aber Brenda verstand mich scheinbar auch so. Sie drückte mich an sich, typisch für sie und ich atmete ihren frischen Geruch ein, der den Knoten in meinem Magen ein wenig löste.
»Es ist so schön, dass du jetzt hier bist. Wir haben uns alle so auf dich gefreut. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug, Darling«, sagte Brenda sanft und schob mich auf Armeslänge von sich, um mich eingehend zu mustern, und lächelte schließlich.
»Warte hier, ich hole Dad. Dann können wir zusammen nach Hause fahren.«
Nach Hause. Wie das klang. Fremd, neu und sehr verlockend.
Ein letztes Mal betrachtete sie mich, als frage sie sich, ob sie mich hier alleine warten lassen könne, ohne dass ich ausflippte, und verschwand dann wieder durch die Glastüren.
Den Großteil der Autofahrt starrte ich aus dem Fenster, betrachtete voller Neugier die Landschaft, die an uns vorbeizog. Oregon war wunderschön und erinnerte mich an Zuhause, aber gleichzeitig war hier alles fremd und neu.
Außerhalb von Portland säumten dichte Laubwälder die breiten Highways und die Sonne schien durch die Blätter und Äste. Ich hatte mir die Westküste Amerikas anders vorgestellt. Trockener, brauner und irgendwie karger. Aber alles war grün und blühte, so wie in England, und trotzdem sah hier die Natur anders aus.
Andere Bäume und Pflanzen. Alles anders. Alles neu. Alles fremd! Ich schluckte die aufkeimende Angst hinunter und summte, mit geschlossenen Augen, leise die Melodie von ›Walk in the Sun‹. Mein Herzschlag beruhigte sich langsam und ich konnte wieder aus dem Fenster sehen ohne in Panik auszubrechen.
Wir entfernten uns immer mehr von der großen Stadt und die Gegend veränderte sich, wurde ländlicher und mehr so wie ich es mir vorgestellt hatte. Links und rechts von der Landstraße erstreckten sich weitläufige gelbe Felder und braune Äcker, weiße Farmerhäuser mit braunen Dächern wechselten sich mit Kuhund Pferdeweiden ab.
Die ganze Landschaft wurde von der Sonne erleuchtet und wirkte unwirklich, fast wie die gemalte Kulisse eines alten Films. Weniger grün, dafür aber mehr satte, trockene Töne. Im Vergleich zu England hätte man die Landschaft hier tatsächlich als karg bezeichnen können, auf mich aber übte diese Welt ihren ganz eigenen Zauber aus. Ich sah mich schon im Westernsattel sitzend über die weite Prärie reiten und träumte von einem kleinen Häuschen wie in ›Unsere kleine Farm‹, mit Hühnern und Schafen und einem Stall voller Kühe.
Ich blinzelte und das kleine Haus löste sich in Rauch auf, dafür eröffnete sich wieder eine neue Landschaft vor mir und ich setzte mich aufrechter hin. Wir fuhren jetzt mitten durch den Tillamook State Forest. Riesige Douglasien mit dicken Stämmen und tiefen Grüntönen wuchsen aus der Erde und säumten die Straße. Ein breiter Fluss schlängelte sich eine ganze Weile neben dem Wilson River Highway entlang, verschwand und tauchte wieder auf. Das klare grüne Band begleitete uns fast bis zum nächsten Ort, zweigte dann nach rechts ab und verließ uns. In den letzten Stunden hatte ich beinahe mehr von der Welt und ihrer Beschaffenheit gesehen als in meinem gesamten bisherigen Leben. Das stimmte mich gleichermaßen aufgeregt, wie sentimental.
Wir erreichten Tillamook, ein hübsches kleines Städtchen mit vielen Touristenläden und einer Fabrik mit dem Namen ›Tillamook Cheese‹ in dicken käsegelben Lettern, fuhren rechter Hand weiter auf dem Oregon Coast Highway und näherten uns der Küste. Ein Straßenschild warnte vor Tsunami Gefahr und verwies auf eine Tsunami Evacuation Route. Ich musste grinsen, meine verschrobene Fantasie ging mit mir durch und ich stellte mir schreiende Menschen vor, die panisch wegrannten, im Hintergrund eine riesige, dunkle Welle…
»Jetzt sind wir gleich da. Nur noch wenige Minuten und du siehst dein neues Zuhause«, unterbrach Dan mein Gedankenspiel. Er freute sich richtig und Brenda, die Mom genannt werden wollte, schaute lächelnd zu mir nach hinten.
Ich konnte nur nicken, denn plötzlich geschah etwas mit mir. Ein Loch öffnete sich unter meiner Brust und raubte mir beinahe den Atem. Ein Ziehen breitete sich in meinem Körper aus, etwas zog und zerrte an einem inneren Punkt.
Links neben dem Highway hatte sich der Tillamook Bay eröffnet, wie Mom mir erklärte.
Erst hielt ich es für einen großen See, doch dann erkannte ich das Meer.
Mir blieb die Luft weg. Das Meer war unfassbar schön, endlos weit und tief blau. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen.
Mit jedem Stück, das wir dem Wasser näherkamen, wurde der Sog in mir stärker, etwas schien nach mir zu rufen. Und ich, die noch nie am Meer gewesen war, geschweige denn darin geschwommen war, verspürte den sehnlichen Wunsch, über den Strand zu laufen, den Sand unter meinen Füßen zu fühlen und mich schließlich in die Wellen zu stürzen. Ich wurde ganz hibbelig und konnte mich kaum noch auf meinem Sitz halten.
»Dan, Bren… Mom, können wir kurz am Meer halten, bitte?«
Ich sah im Rückspiegel wie Dan die Stirn runzelte.
»Ich war noch nie am Meer«, fügte ich hinzu und hoffte, dass das als Erklärung reichte.
Ich hatte Glück.
»In Ordnung, aber nur kurz. Du bist sicher erschöpft und möchtest dein neues Zimmer sehen.« Dans Stimme war weich und er zwinkerte mir durch den Rückspiegel zu. Ich lächelte zurück.
Nein, erschöpft war ich nicht. Ich war platt von dem langen Flug, aber erschöpft nicht. Vielmehr war ich nun hellwach vor Aufregung.
Wir fuhren in Rockaway Beach ein, einem niedlichen kleinen Ort mit vielen bunten Häuschen entlang der Straße. Wäre ich nicht ganz wo anders mit meinen Gedanken gewesen, dann hätte mir dieser kleine, süße Ort bestimmt gefallen, aber so starrte ich nur auf das wogende Meer, das immer wieder zwischen den einzelnen Häusern auftauchte und mir zuzuzwinkern schien.
Der Wind blies kräftig, sodass kleine Schaumkrönchen auf den Wellen tanzten, die bei jeder Bewegung in der Sonne glitzerten. Dan bog in eine Straße ein und parkte den SUV auf einem breiten Parkplatz hinter einer Düne. Ich zögerte eine Sekunde, dann schnallte ich mich mit fahrigen Fingern ab, stieß die Tür auf und sprang aus dem Wagen.
Kühle, windige Luft umfing mich, zog einzelne Strähnen meiner Haare aus dem Dutt, peitschte sie mir ums Gesicht und fuhr in meine Kleidung. Sie schmeckte salzig auf meinen Lippen und ich roch den würzigen Duft der Strandpflanzen, die auf den Dünen hin und her wogten.
Meine Schuhe versanken im weichen Sand, als ich die Düne emporkletterte, die mir die Sicht auf den Ozean versperrte. Die Aussicht war umwerfend. Einen Augenblick lang verharrte ich auf der Kuppe, den Blick auf das wogende Meer nur wenige Meter vor mir, gerichtet. Das Wasser schimmerte in allen Farbnuancen von Grün über Türkis bis hin zu einem tiefen Blau. Es war überwältigend das Rauschen in den Ohren zu hören und dem Spiel der Wellen zuzuschauen, auf und ab, Wellenberg und Wellental. Weiter draußen ragten zwei hohe Felsen aus dem Meer, an denen sich die rauen Gezeiten des Pazifiks brachen und in schaumigem Wasser brandeten.
Dort draußen war das Wasser dunkelblau, fast schwarz. Der Sog in meiner Brust hatte sich ins Unermessliche gesteigert und tat fast schon weh, so sehr sehnte ich mich nach dem kühlen Nass. Diese Gefühle jagten mir Angst ein. Ich war kein Mensch mit Sehnsüchten oder innigen Wünschen, ich nahm das Leben wie es kam. Denn ich wusste, mehr als jeder andere, wie schnell es vorbei sein konnte. Und doch stand ich hier, mit einem unbändigen Verlangen im Herzen. Kurz schloss ich die Augen und gab mich der Sehnsucht hin, ließ das Rauschen der Wellen auf mich wirken und atmete die salzige Luft. Dann ballte ich die Hände zu Fäusten und grub die Fingernägel in die Haut, holte tief Luft und riss den Blick von den blaugrünen Wellen, dann rannte ich zurück zum Auto.
Jetzt war ich erschöpft und unglaublich müde. Ich lehnte den Kopf an den Sitz und schloss die Augen.
Zuhause war ein hübsches, mintfarbenes Haus, mit weißen Fensterrahmen und einer weißen Garagenwand, im Pacific View Drive. Aus meinem Zimmer, das direkt über der Garage im ersten Stock lag, hatte ich einen herrlichen Blick auf das Meer. Jemand hatte einen Schaukelstuhl ins Zimmer gestellt, ansonsten gab es ein Bett mit Nachttisch, einen Schreibtisch und einen großen Einbauschrank, der zu meinem Schrecken voller modischer Klamotten war. Ich vermutete, dass Mom mit Delilah einkaufen gewesen war, denn die beiden waren immer gut gekleidet. Der Inhalt meines Koffers hatte bequem in zwei Schubladen Platz.
Ich stand etwas verloren vor dem Schrank, als Delilah eintrat. Sie setzte sich auf mein gemachtes Bett und mustere mich.
»Sie haben dir ein Auto gekauft!«, begrüßte sie mich.
Hi, ich freue mich auch dich kennenzulernen, dachte ich.
Ihr Ton war neutral, aber ich hatte den Eindruck als würde ihr das ganz und gar nicht gefallen. Als würde sie mir einen Vorwurf machen.
»Es ist dein Begrüßungsgeschenk. Sie wollen, dass du runterkommst und es dir anschaust. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, wir nehmen dich ja schließlich hier auf. Man sollte meinen, das sei nett genug!«
Ein kalter Schauer lief mir bei ihren Worten über den Rücken.
Sie musterte mich einen Augenblick lang eindringlich und unter ihrem stechenden Blick fühlte ich mich unwohl und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann zuckte sie mit den Schultern, schwang ihre schwarzen Locken zurück und stolzierte aus dem Zimmer.
Ich konnte ihr nur mit hochgezogenen Brauen nachschauen.
Na toll, da hatte jemand ganz klar zu verstehen gegeben was er von mir hielt. Kopfschüttelnd strich ich mein Bett wieder glatt. Die Überdecke war hellgrau und ganz weich, vorsichtig ließ ich meine Fingerspitzen darüber gleiten und schloss die Augen. Jetzt war ich in Amerika, ich war einmal um die halbe Erdkugel geflogen, in weniger als einem Tag hatte ich alles hinter mir gelassen. Ein Gefühl von Einsamkeit überkam mich, ich hatte Fernweh und wusste nicht einmal genau wonach. Nach Hexham bestimmt nicht und auch nicht nach der Irrenanstalt. Vielleicht vermisste ich Doktor Jones oder meine Betreuerin, aber auch das konnte ich mir nicht so recht vorstellen.
Ich fühlte mich einfach leer und sehr fehl am Platz.
Aber ich durfte mich nicht beschweren, denn ich hatte es selbst so gewollt.
Nachdem ich auf die Offene Station verlegt worden war, hatte ich Ausflüge in die Stadt unternehmen dürfen. Natürlich unter Beaufsichtigung. Wollte ja keiner die Irren alleine auf die guten Bürger von Hexham loslassen. Für die armen war es auch so schon schwer genug, dass es in ihrem ordentlichen, vornehmen Ort eine Psychiatrie gab.
Für mich waren diese Ausflüge, so wenige es auch gewesen waren, bei weitem schlimmer als für die Einwohner.
Auf den Straßen hatten sie jedes Mal über mich getuschelt, so laut, dass ich jedes Wort hatte hören können. Sie hatten mit dem Finger auf mich gezeigt und mich mit offenem Mund angestarrt. Es war, als ob ein blinkendes Leuchtreklamen Schild über mir gehangen hätte.
Verehrte Damen und Herren, sehen Sie hier! Heute, extra für Sie, das Entführungsopfer. Kommen Sie näher und sehen Sie! Eintritt frei.
Ich war mitten auf dem Gehweg zusammengebrochen, nachdem zwei ältere Damen darüber geredet hatten, ob ich jemals ein normales Leben würde führen können oder ob ich nicht für immer gezeichnet blieb.
Jeder kannte mein Gesicht und meine Geschichte aus den Nachrichten. Ich war fast schon eine Berühmtheit.
Ein paar der Artikel hatte ich auf Wunsch zusammen mit Doktor Jones gelesen und war erstaunt, wieviel mehr die Medien über mich wussten als ich selbst.
Doktor Jones hatte mir zwar erklärt, dass es sich oft um Spekulation handelte oder man nur versuchte meine Geschichte auszuschlachten, trotzdem kam ich mit dem Medienhype um mich nicht zurecht.
Ich wollte die Einrichtung auf keinen Fall mehr verlassen und blieb die meiste Zeit in meinem Zimmer, schaute aus dem Fenster in den Park und wünschte mir, jemand anderes zu sein.
Aber ich konnte nicht auf ewig dort bleiben. Doktor Jones erklärte mir, dass ich dank der guten Fortschritte, die Institution bald verlassen durfte. Ich überlegte tatsächlich wie ich das verhindern konnte. Allerdings war ich eine miserable Schauspielerin und meine Psychologin kannte mich nach dreieinhalb Jahren zu gut, als dass ich ihr etwas hätte vormachen können.
Gemeinsam beschlossen wir, mich möglichst weit wegzuschicken, in ein anderes englischsprachiges Land. Gegen Australien entschied ich mich sofort wegen der Hitze, aber Kanada und ein Teil der USA kamen in die engere Auswahl. Man suchte nach Familien mit gleichaltrigen Kindern in einer ruhigen Gegend, die eine Jugendliche adoptieren wollten.
Ein abgelegener Ort sollte es sein, einer, in dem man vermutlich noch nie von mir gehört hatte.
Ein paar Familien lernte ich über Skype kennen, aber die Moores waren die einzigen, die ich einladen wollte und es hatte von Anfang an gepasst.
»Clara, Liebling. Kommst du bitte vors Haus.« Moms Stimme drang die Treppe empor.
Und da ich ein braves, dankbares Mädchen war, das keinen Ärger machen wollte, schob ich die Einsamkeit gut verpackt in einen hinteren Winkel meines Gehirns, band meine Haare zu einem unordentlichen Dutt zusammen und kam ihrer Bitte nach.
Die ganze Familie stand versammelt vor dem Haus, Dan mit einem stolzen Ausdruck im Gesicht, wie ihn Männer in Autozeitschriften immer haben. Mom wirkte aufgeregt und lächelte mich fröhlich an. Nur Delilah stand abseits und hatte die Arme in die Hüften gestemmt. Ihr Blick ließ keine Zweifel an meiner These.
Sie alle standen um ein silbernes Auto herum, das frisch poliert wirkte und eine große rosa Schleife auf der Kühlerhaube hatte.
»Tada«, rief Mom und klatschte in die Hände. »Der Wagen ist für dich. Frisch aus der Werkstatt.«
»Und er ist erst drei Jahre alt, stand die meiste Zeit in der Garage« fügte Dan hinzu.
Sie strahlten mich beide mit einer so aufrichtigen Freude an, dass ich ihnen nur ungern das Herz brach.
»Ein Fahrrad hätte es auch getan«, murmelte ich.
»Was sagst du, Liebes?« Moms Augen wurden groß. Ich stöhnte.
»Ich freu mich wirklich und das ist super lieb von euch. Aber… aber ich kann gar nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein.« Meine Stimme wurde immer leiser, bis sie fast gänzlich versagte.
Drei Paar Augen starrten mich ungläubig an.
Delilah brach als erste das Schweigen: »Welche Siebzehnjährige hat denn bitteschön keinen Führerschein?« Ihre Stimme triefte vor Verachtung.
Ich wandte mich ihr direkt zu und schaute ihr fest in die Augen:
»Wann bitte hätte ich denn den Führerschein machen sollen? Ich war acht Jahre eingesperrt und danach hatte ich wirklich anderes zu tun!«
Sie wurde feuerrot im Gesicht und stürmte ins Haus. Blöde Kuh!
Keiner achtete auf sie, meine neuen Eltern kamen stattdessen auf mich zu.
»Es tut uns so leid! Daran hätten wir denken sollen«, sagte Mom sanft. »Bis du deinen Führerschein gemacht hast, wird dich Delilah mit zur Schule nehmen.«
»Da freut sie sich bestimmt«, seufzte ich.
»Nimm sie bitte nicht so ernst, ja. Sie muss sich noch daran gewöhnen, sie hatte es in letzter Zeit nicht einfach.« Dan berührte mich leicht an der Schulter und lächelte aufmunternd.
Ich nickte zwar, hatte aber kein Mitleid mit meiner Adoptivschwester.
Ich hatte in England genug solcher Mädchen kennengelernt, um zu wissen, wie ich mit ihnen umgehen musste. Zwar hatte ich keine Lust auf Zickenkrieg, aber ich würde mich nicht fertigmachen lassen. Nie mehr!
Das Wochenende verbrachte ich die meiste Zeit lesend in meinem neuen Zimmer oder mit Dan im Garten, wo er mir seine Beete zeigte und versuchte, mich dafür zu begeistern.
Mir blieb auch nicht viel anderes übrig. Mom war wegen eines Meetings nach LA geflogen und Delilah war die meiste Zeit nicht zu Hause. Nicht, dass es mich störte, aber wenn sie nicht so ein Problem mit mir gehabt hätte, dann hätte sie mich vielleicht mitgenommen und ihren Freunden vorgestellt. So aber würde ich am Montag in der Schule vollkommen die Neue sein. Vermutlich erzählte sie ihren Freunden schon, wie verrückt ich war.
Das nahm mir nicht gerade die Angst vor dem ersten Schultag. Im Gegenteil, meine Paranoia freute sich über das gefundene Fressen und ärgerte mich mit Erinnerungen an früher.
Als ich in das Florence-Nightingale-Institut kam, war ich vierzehn und hätte damals in der neunten Klasse sein sollen, aber die Schulleitung steckte mich wegen der versäumten acht Jahre in die fünfte Klasse, ohne mich vorher auszufragen oder auch nur mein Wissen zu testen.
Man glaubt ja gar nicht, wie fies kleine Kinder sein können. Sie haben jede meiner Ängste gerochen und mich damit schamlos fertiggemacht.
Das war auch der Grund, warum man ein halbes Jahr lang nicht merkte, dass ich unterfordert war, denn ich sprach kein Wort.
Es war Doktor Jones gewesen, die feststellte, dass ich gar nicht so weit zurück war mit dem Schulstoff. Sie war bis dahin auch die einzige, mit der ich überhaupt redete. Sie merkte schnell, dass ich viel wusste und zu sagen hatte.
Nach und nach öffnete ich mich ihr und erzählte, dass er mich unterrichtet hatte. Ihm hatte viel an meiner Bildung gelegen und er hatte mich täglich, auch am Wochenende, in Mathematik und Schreiben, Erdkunde und Politik unterwiesen. Auch Kunst, klassische Musik und Tanz hatte er mir nahegebracht. Ich war eine sehr gute Schülerin gewesen. Er hatte mich mit dem heißen Bügeleisen darauf getrimmt keine Fehler zu machen.
Doktor Jones setzte sich dafür ein, dass man mich in eine höhere Klasse schickte. Aber auch dort wurde ich fertiggemacht. Ich habe nie erfahren, was die anderen Kinder gegen mich hatten und Doktor Jones hat es mir nie erklärt. Aber nachdem mein Schulzeug samt Tasche in Flammen aufging, bekam ich Einzelunterricht.
Ich hatte also meine starke Abneigung gegen Gruppenunterricht nicht von irgendwo her. Ich glaubte aber, dass es jetzt besser werden würde.
Nicht, dass ich eine Optimistin wäre, ich hoffte einfach nur, dass es in einer Schule für normale Jugendliche nicht so zuging.
KAPITEL 3
Selene – Mondgöttin, folgt Helios am Abend über den Himmel
Am Montagmorgen nahm mich Delilah in ihrem Auto mit zur Schule. Ich konnte die feindseligen Blicke auf mir spüren, hatte mich aber entschlossen sie zu ignorieren.
Ich betrachtete lieber die Gegend bis zur Neah-Kah-Nie High-School und versuchte mich nicht auf das quälende Gefühl in meiner Brust zu konzentrieren, das immer stärker wurde, desto näher wir dem Ozean kamen. Doch mein Blick wanderte von selbst immer wieder zum in der Sonne glitzernden Wasser.
Gedankenverloren schaute ich aus dem Fenster und bekam nicht mit, dass wir die Schule erreichten.
Erst als Delilah die Fahrertür zuschlug, registrierte ich meine Umgebung.
»Halt, Delilah. Warte!«, rief ich ihr nach, sie drehte sich widerwillig um, lief aber langsam rückwärts weiter und signalisierte mir damit, dass sie keine Lust hatte, mit mir zu reden oder mit mir zur Schule zu laufen.
»Bitte, hilf mir. Sag mir wenigstens, wo das Sekretariat ist.«
Ich konnte sehen, wie sie die Augen verdrehte und ich war mir sicher, dass sie mich hier auf dem großen Parkplatz stehen lassen würde.
Zu meiner Überraschung winkte sie mich zu sich und als ich bei ihr ankam, sagte sie: »Bis zum Sekretariat bring ich dich. Ab da sollen die sich um dich kümmern.«
Ihre Blicke waren kühl und sie sprach kein Wort mehr, während wir zum Schulgebäude gingen.
»Wusstest du, dass man deine Familie wegen dir ausgesucht hat«, setzte ich zu einem Gespräch an.
»Willst du damit sagen, dass es meine Schuld ist?« Sie funkelte mich böse an.
»Was? Nein! Man hoffte nur, dass meine Wiedereingliederung besser verlaufen würde, wenn ich eine Gleichaltrige an der Seite hätte. Die mich vielleicht ihren Freunden vorstellt, mich ein bisschen rumführt und…«
»Deinen Babysitter spielt«, unterbrach mich meine Adoptivschwester.
Ich schaute ihr etwas verlegen in die grünen Augen und zuckte mit den Schultern.
»Dann hätte man mich zumindest vorher fragen sollen, ob ich Bock darauf habe, mich mit einer Irren abzugeben! Wir sind da. Bis nach der Schule. Ciao.«
Sie machte auf dem Absatz kehrt und stolzierte davon.
Und wieder einmal schaute ich ihr sprachlos hinterher. Das konnte ja noch heiter werden…
Ich klammerte mich mit beiden Händen an meiner Schultasche fest und spähte durch die Glasscheibe ins Innere des Sekretariats. Eine nett aussehende junge Frau saß hinter ihrem Schreibtisch und tippte in ihren Computer. Neben der Tastatur stand eine große Minnie Mouse Tasse und aus irgendeinem Grund gab mir das die nötige Kraft die Türe aufzudrücken. Es klingelte leise als sie sich öffnete und während ich eintrat, erhob sich die Sekretärin und lächelte mich wissend an.
»Hallo, ich bin Clara White. Heute ist mein erster Schultag und ich habe noch keine Unterlagen bekommen.« Ich fühlte mich irgendwie blöd, so wie immer, wenn ich mich jemandem vorstellen musste.
Sie nickte und legte einen Stapel Blätter vor mich.
»Herzlich willkommen an unserer Schule. Hier sind dein Stundenplan, die Hausordnung und alles Weitere, was du benötigst, um dich bei uns zurecht zu finden. Deinen Schülerausweis trägst du am besten immer bei dir. Ich bin Miss Bishop. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden.«
Sie lächelte mich herzlich an und zog meinen Stundenplan aus dem Stapel, den sie zwischen uns auf das Pult gelegt hatte. Sie tippte mit der Spitze ihres Kulis auf das Blatt und ich grinste automatisch. Ihr Kugelschreiber war mit Walt Disney Motiven bedruckt.
»Deine erste Stunde hast du in Raum 12. Den Gang runter, die zweite Tür rechts. Beeil dich besser, es wird gleich zum Unterricht klingeln.«
Damit war ich entlassen. Ich raffte mein Zeug zusammen und bedankte mich bei ihr.
Der Vormittag verlief ereignislos. Die Lehrer waren okay, die Schüler nett, aber nicht übermäßig freundlich und ließen mich die meiste Zeit in Ruhe. Ich hätte nichts gegen die ein oder andere Bekanntschaft gehabt, war aber selbst zu schüchtern, um auf die anderen zuzugehen.
So kam es, dass ich in der Mittagspause alleine in der Cafeteria stand und da ich nicht den Mut aufbrachte, mich einfach irgendwo dazuzusetzen, endete ich alleine auf einer Bank vor der Cafeteria.
Ich packte mein Mittagessen aus und dachte an die vergangenen Stunden. Es ging hier tatsächlich anders zu. Viel ruhiger, geradezu langweilig. Ich verbuchte das als ein gutes Omen. In der Nacht, hatte ich schlecht geschlafen und geträumt, dass die Schüler furchtbare Monster mit Fratzen sein würden, die nur darauf warteten, mich aufzufressen.
Ich richtete gerade meinen Dutt neu, als eine laut tratschende Mädchengruppe über den Rasen Richtung Cafeteria schlenderte. Allen voran meine liebe Adoptivschwester.
Die Art wie ihr die anderen folgten, erinnerte mich an eine Ente mit ihren Küken. Quak Quak Quak.
Ich konnte ein paar Gesprächsfetzen aufschnappen, die der Wind zu mir herüber trug, und hörte öfters den Namen Grayson. Ich belauschte sie neugierig.
Aber als sie in meine Nähe kamen, versuchte ich mich klein zu machen und versteckte mich hinter meiner Brotdose. Delilah entdeckte mich trotzdem.
»Geht schon mal rein. Ich muss noch kurz telefonieren«, befahl Mama-Ente. Und ihre Babys gehorchten und watschelten brav quakend weiter.
Delilah wartete bis sie außer Sicht waren und kam dann zu mir rüber stolziert.
Ein wenig verlegen, als wüsste sie selbst nicht so recht was sie wollte, blieb sie vor mir stehen.
»Hey, geht’s … äh, geht’s dir gut?« Sie wippte nervös auf und ab.
Ich nickte. »Ja, alles in Ordnung.«
»Du wirst nicht fertiggemacht, oder so?«, fragte sie leise. Ihre Stimme hatte einen sonderbaren Ton angenommen.
Meine Augen wurden groß. »Was? Nein! Warum?«
»Na, weil du hier ganz alleine sitzt. Ist ja auch egal. Wollte nur mal hören, ob es dir gut geht.«
Ich schaute sie etwas verblüfft an. Diese Wendung kam unerwartet und ich witterte schon Gefahr, weshalb ich sofort den Schutzpanzer hochfuhr.
»Nein, mir geht es wirklich gut. Ich habe einfach nur noch niemand Nettes kennengelernt.«
Der Seitenhieb war unbeabsichtigt gewesen, doch sie nahm ihn scheinbar persönlich. Denn sie straffte die Schultern und ging wortlos davon.
»Bis später!«, rief ich Delilah nach und erinnerte sie an ihr Versprechen mich wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich hätte meine linke Hand darauf verwettet, dass sie mich auf der Heimfahrt am liebsten in den nächstbesten Graben schmeißen würde.
Am Nachmittag hatte ich zwei Stunden Sport, das erste Fach an diesem Tag, in dem ich mich aktiv beteiligte. Ich liebte Sport. Obwohl ich nicht super durchtrainiert war, mochte ich körperliche Betätigungen mehr als still auf einem Stuhl zu sitzen und auf die Tafel zu starren.
Zwei Mädchen, die auch am Morgen in meinem Mathekurs gesessen hatten, bauten mit mir die Geräte auf und fragten mich, wie mir Rockaway Beach und die Schule gefielen.
Wir unterhielten uns eine Weile über belangloses Zeug, ein paar Mal fragten sie mich Dinge über England, aber ich reagierte ziemlich abweisend bei dem Thema und da ließen sie es bleiben. Sie waren nett und ich freute mich wirklich, dass sie mit mir redeten, aber ich hatte keine Lust über meine Zeit in der Psychiatrie zu sprechen. Zumal sie darüber nichts zu wissen schienen und mich für normal hielten. Dabei wollte ich es vorerst auch belassen.
Jenna und Megan begleiteten mich trotzdem bis auf den Parkplatz, wo Delilah schon ungeduldig in ihrem Wagen wartete.
»Sorry, ich muss dann.«
Doch bevor ich losrennen konnte, hielt mich die größere, Jenna, an der Schulter fest. Sofort breitete sich eine Wärme von der Stelle aus, an der sie mich berührte. Ich schaute sie mit großen Augen an. Denn ihre Berührung war alles andere als unangenehm. Seltsam.
»Du fährst mit der da mit?« Etwas an der Art wie sie das sagte, ließ mich aufhorchen.
Ich runzelte die Stirn und nickte. Sie zog ihre Hand zurück und plötzlich fühlte ich mich ganz kalt und leer.
»DAS ist Delilah Moore.« Jetzt klang sie verblüfft.
»Ich weiß, wer sie ist. Sie ist meine Adoptivschwester.«
»Na dann, herzlichen Glückwunsch. Da hast du ja den Jackpot gezogen«, sagte Megan lachend und schlug mir eine Hand auf den Rücken.
Ich zuckte zusammen und wich vor ihrer Berührung zurück. Doch bevor ich fragen konnte, was sie mit ihrer Aussage meinte, hupte Delilah und winkte mir genervt zu.
»Ich muss noch kurz in den Supermarkt. Du kannst im Auto warten«, erklärte Delilah, ohne mich anzuschauen.
»Danke, ich habe auch keine Lust mit dir Zeit zu verbringen«, gab ich zurück und sah, wie sie die Augen verdrehte.
Als sie das Auto parkte, schnappte ich mir meine Tasche und stieg aus.
»Was wird das?«, fragte mein liebenswürdiges Schwesterlein mit hochgezogener Augenbraue. Diesen abwertenden Blick beherrschte sie mindestens genauso gut wie das Augenverdrehen.
»Ich laufe«, antwortete ich und setzte mich in Bewegung. Ich glaubte nicht, dass sie mich aufhalten würde und wenn, war es mir auch egal.
Bevor ich die Straße überquerte, schaute ich noch mal über die Schulter. Delilah stand immer noch neben ihrem Auto und starrte mir nach. Ich grinste.
Für einen so kleinen Ort war ziemlich viel los. Menschen schlenderten den Bürgersteig entlang, unterhielten sich, traten aus dem ein oder anderen Laden heraus und wirkten dabei zufrieden.
Vor mir liefen zwei Mütter mit ihren Kinderwägen, die sich angeregt miteinander unterhielten. Ich fühlte mich zum ersten Mal nicht unwohl zwischen den Menschen und in der Öffentlichkeit.
Im Gegenteil, es war schön, sich einfach normal zu fühlen und dazuzugehören.
In Rockaway Beach gab es mehrere kleine bunte Touristenläden, mit allerlei Kram, den man gerne aus dem Urlaub mitbrachte. Ich selbst hatte eine kleine Glasflasche mit einem schönen Segelschiff darin auf meinem Nachttisch stehen. Doktor Jones hatte sie mir von einem Wochenendausflug auf Rügen mitgebracht und ich hing sehr daran. Wenn mir mein Zimmer in England manchmal zu klein geworden war und ich mich fürchterlich einsam gefühlt hatte, hatte ich davon geträumt mit diesem Segelschiff davonzufahren, weit fort aus England in eine schönere, bessere Welt, in der ich normal war und meine Eltern noch lebten und mich liebhatten.
Mir war klar, dass ich mich selbst zurückhielt, denn eigentlich wäre ich am liebsten direkt ans Meer gelaufen, das immer wieder zwischen den Häusern zu erkennen war. Doch ich wollte meine Selbstbeherrschung testen. Schon bald war ich an den meisten Läden vorbeigelaufen, die Shoppingstraße war nicht besonders lang und es gab nichts weiter, womit ich mich hätte ablenken können. Also gab ich meinem inneren Drängen nach, ließ mich vom Meer anlocken und verließ die Hauptstraße.
Der Weg an den Strand war leicht zu finden, nur einen Steinwurf entfernt von der Straße. Wieder stand ich wie gefangen da, völlig eingenommen vom Anblick des Meeres. Meine Gedanken standen still und ich vergaß beinahe zu atmen. Verträumt starrte ich hinaus aufs Wasser. Minuten vergingen bis mir bewusst wurde, wie seltsam ich mich verhielt. Und dennoch war es wie nach Hause zu kommen, eine innere Ruhe hatte sich in mir ausgebreitet und ich fühlte mich vollkommen wohl. So wohl wie noch nie in meinem Leben.
Ich wäre gerne ins Meer gewatet, ließ ich mich aber einige Schritte davor im trockenen Sand nieder. Obwohl es erst Anfang September war, war es hier in Oregon schon recht kühl, nicht kalt, aber ohne meine Jacke hätte ich beinahe gefröstelt. Nicht, dass ich es aus England gewöhnt war, im September zu schwitzen.
Ich fasste mein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und holte meine Hausaufgaben hervor, die ich schnell erledigte, damit mir noch Zeit blieb, bevor ich nach Hause musste.
Die Möwen kreisten durch die Luft und ab und zu war ihr Kreischen zu hören. Hinter mir wehte der Wind durch die Gräser auf den Dünen und trug ihren würzigen Duft zu mir. Ansonsten waren nur das Rauschen der Wellen und das ferne Brummen der Autos auf der Hauptstraße zu hören. Zufrieden lag ich im Sand, döste vor mich hin und ließ mich von den Geräuschen einlullen. So nah am Wasser war der Sog in meiner Brust sanfter geworden, war zu einem erträglichen Summen im Hintergrund verklungen. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben ruhig und entspannt.
Die Sonne wärmte meine Haut durch den Stoff und mir wurde angenehm warm. Doch es wurde immer wärmer und wärmer, bis es fast unerträglich heiß wurde und mein Körper zu glühen begann. Wo kam diese Hitze plötzlich her? Eben noch hatte ich es ohne Jacke kaum ausgehalten und jetzt hätte ich mich am liebsten komplett ausgezogen. Die Hitze breitete sich in mir aus, erfüllte jede Zelle und schien mich von innen heraus zu verbrennen. Ich wollte aufspringen und meinen erhitzten Körper im Wasser abkühlen, den Schmerz lindern. Doch noch bevor ich die Augen öffnen konnte, legten sich kühle, nasse Hände auf mein Gesicht, berührten die erhitzten Stellen und mein Herzschlag beruhigte sich. Sanft liebkosten die Hände meine Wangen, streichelten mein Haar und kühlten meinen Nacken. Und ein Gesang, wie aus einer anderen Welt, drang aus der Ferne in mein Ohr.
Lieblich und rein, so verlockend, dass der Sog in mir wieder stärker und wilder wurde. Die Worte waren fremd und doch vertraut, wie ein Wiegenlied, an das man sich nur noch schwach erinnerte. Ich wollte für immer so liegen bleiben und bewegte mich nicht, aus Angst die Stimme und die Hände zu vertreiben.
»Galene, komm nach Hause. Es wird Zeit, es ist bald soweit«, flüsterte eine sanfte Stimme. Die Hände zogen sich zögernd zurück und der Gesang wurde immer leiser bis er ganz verklang. Schlagartig riss ich die Augen auf und setzte mich so abrupt auf, dass mir schwindelig wurde. Ich musste eingeschlafen sein. Aber der Traum war so real gewesen, dass ich einige Sekunden brauchte, um mich zurechtzufinden. Der Schwindel verklang so schnell, wie er gekommen war.
So real träumte ich sonst nie, auch wenn ich eine sehr lebhafte und blühende Fantasie hatte.
Verwirrt schüttelte ich den Kopf und wunderte mich über mich selbst. Doch als ich den verrutschten Haargummi aus den Haaren zog, erschrak ich.
Das Haar um mein Gesicht war feucht und an meinem Hals liefen Wassertropfen hinunter in mein Shirt. Ich leckte meinen Finger ab. Salzige Erkenntnis verteilte sich auf meiner Zunge und ließ mich erstarren. Kein Schweiß, sondern Salzwasser!
Ich war mir sicher, obwohl ich noch nie Meerwasser probiert hatte, aber Schweiß schmeckte anders.
Hektisch blickte ich nach links und rechts, weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Der Strand war wie leergefegt. Auch Schuhabdrücke waren keine im Sand zu erkennen. Ich war alleine! Trotzdem fühlte ich mich nicht so. Immer noch spürte ich die Präsenz dieser Person um mich herum, wie ein Wehklagen, tief in meinem Herzen.
Aber wie war das Meerwasser in meine Haare gekommen?
Von den Händen hatte ich doch nur geträumt, genauso wie vom Gesang.
Es hatte niemand neben mir gesessen, während ich vor mich hingeträumt hatte. Niemand hatte mich berührt. Oder?
Panisch sprang ich auf, es lief mir eiskalt den Rücken runter und ich keuchte auf.
Hatte mich jemand beim Schlafen beobachtet und sogar angefasst?
Den Weg nach Hause rannte ich wie von der Tarantel gestochen und blickte mehrmals über die Schulter. Wonach ich Ausschau hielt, wusste ich selbst nicht. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass hier irgendetwas komplett falsch lief. Ich fühlte mich so verfolgt wie noch nie in meinem Leben und das wollte wirklich etwas heißen.
Und ich spürte immer noch dieses Kribbeln im Nacken, als würde mich jemand beobachten. Nicht mal ›Walk in the Sun‹ konnte mich beruhigen, geschweige denn, dass ich den Text zusammen bekam. Zweimal bog ich in die falsche Straße ab und wurde immer panischer, der Schweiß lief mir übers Gesicht und mein Herzschlag wurde immer schneller. Häuser und Bäume flogen rechts und links an mir vorbei und verschwammen vor meinen Augen, ich hörte nur noch das Blut in meinen Ohren rauschen.
Am liebsten hätte ich laut geschrien und wild um mich geschlagen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingerannt war, völlig kopflos sprintete ich in die nächste Straße. Sackgasse!
Tränen traten mir in die Augen und rollten mir über die Wangen. Ich wollte zurück nach England!
Ich fühlte, wie sich eine ausgewachsene Panikattacke in mir breitmachte und die Kontrolle über mein Denken und Handeln übernehmen wollte.