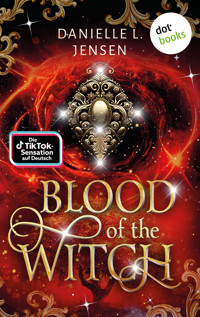Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Malediction
- Sprache: Deutsch
Der große Fantasyroman mit BookTok-Hype: »Heart of the Witch« von Danielle L. Jensen jetzt als eBook bei dotbooks. Ein gefährlicher Auftrag. Eine Liebe, die nicht sein darf. Eine Jägerin, die zur Gejagten wird. Ihre Stimme begeistert die Massen. Seit Cécile dem düsteren Troll-Königreich entkommen ist, ist sie zum gefeierten Bühnenstar geworden. Doch für ihre Freiheit musste sie einen hohen Preis zahlen: Sie hat Tristan zurückgelassen, der Prinz der Dunkelheit, der ihr Herz eroberte. Und sie musste dem grausamen Trollkönig versprechen, Anuschka zu finden – jene Hexe, die die Trolle einst in den Untergrund verbannte. Nur wenn ihr das gelingt, wird Cécile Tristan wiedersehen. Doch bei der Suche nach Anuschka entdeckt Cécile auch ihr eigenes Hexenerbe. Und plötzlich muss sie sich entscheiden: Auf welcher Seite wird sie stehen, wenn es zum Kampf zwischen Licht und Dunkelheit kommt? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romantic-Fantasy-Highlight »Heart of the Witch« von Danielle L. Jensen ist der zweite Roman in ihrer »Malediction«-Trilogie und wird Fans von Sarah J. Maas und Rebecca Yarros begeistern. Die Printausgabe und das Hörbuch sind bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein gefährlicher Auftrag. Eine Liebe, die nicht sein darf. Eine Jägerin, die zur Gejagten wird.
Ihre Stimme begeistert die Massen. Seit Cécile dem düsteren Troll-Königreich entkommen ist, ist sie zum gefeierten Bühnenstar geworden. Doch für ihre Freiheit musste sie einen hohen Preis zahlen: Sie hat Tristan zurückgelassen, der Prinz der Dunkelheit, der ihr Herz eroberte. Und sie musste dem grausamen Trollkönig versprechen, Anuschka zu finden – jene Hexe, die die Trolle einst in den Untergrund verbannte. Nur wenn ihr das gelingt, wird Cécile Tristan wiedersehen. Doch bei der Suche nach Anuschka entdeckt Cécile auch ihr eigenes Hexenerbe. Und plötzlich muss sie sich entscheiden: Auf welcher Seite wird sie stehen, wenn es zum Kampf zwischen Licht und Dunkelheit kommt?
»Heart of the Witch« erscheint außerdem als Hörbuch und Printausgabe bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über die Autorin:
Danielle L. Jensen ist Autorin mehrerer Romantasy-Reihen. Bekannt wurde sie mit ihrer »Malediction«-Trilogie, die prompt die Bestsellerlisten stürmte. Nun erscheint die Erfolgsserie des BookTok-Stars erstmals auch auf Deutsch.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin in ihrer
»Malediction«-Reihe bisher die Romane »Song of the Witch« und »Heart of the Witch«; als Print- und Hörbuchausgaben auch bei SAGA Egmont erhältlich.
***
eBook-Ausgabe August 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2015 unter dem Originaltitel »Hidden Huntress« bei Strange Chemistry, einem Imprint von Angry Robot, Nottingham.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2015 by Danielle L. Jensen
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2024 Danielle L. Jensen und SAGA Egmont
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von © Adobe Stock / safia sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-142-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Heart of the Witch« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Danielle L. Jensen
Heart of the Witch
Roman. Malediction 2
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Fricke
dotbooks.
Widmung
Für meine Mom, die die schrecklichen ersten und die polierten letzten Entwürfe liest sowie die vielen, vielen Versionen dazwischen. Danke für alles, was du tust.
Kapitel 1
Cécile
Meine Stimme verhallte, doch die Erinnerung daran schien noch durch das Theater zu wabern, während ich anmutig zusammensackte und darauf vertraute, dass mich Julian auffing, auch wenn er das eigentlich gar nicht tun wollte. Der Bühnenboden fühlte sich glatt und kalt unter meiner Wange an, was aufgrund der Wärme Hunderter Leiber an einem Ort sehr wohltuend war. Ich versuchte, flach zu atmen, und ignorierte den Gestank von zu viel Parfum und zu wenig Körperpflege, als ich mich tot stellte. Julians Stimme ersetzte die meine. Sein Klagelied drang mir in die Ohren und wehte durch das Theater. Doch ich hörte nur mit halbem Ohr zu und dachte an das allzu reale Leid eines anderen, der in weiter Ferne weilte.
Das Publikum jubelte. »Bravo!«, schrie jemand, und ich hätte beinahe gelächelt, als eine herabfallende Blume meine Wange streifte. Der Vorhang fiel zu. Kurz darauf schlug ich widerstrebend die Lider auf und wurde durch den roten Samt in die unangenehme Realität zurückgeholt.
»Du hast heute Abend irgendwie abgelenkt gewirkt«, bemerkte Julian und zog mich kurzerhand auf die Beine. »Und in etwa so gefühlvoll wie mein linker Stiefel. Sie wird nicht erfreut sein.«
»Ich weiß«, murmelte ich und strich mein Kostüm glatt. »Es war eine lange Nacht.«
»Schockierend.« Julian verdrehte die Augen. »Es ist schon anstrengend, sich mit jedem reichen Mann und jeder reichen Frau der Stadt anzufreunden.« Er nahm erneut meine Hand, nickte den Bühnenarbeitern zu, und wir setzten beide ein Lächeln auf, als der Vorhang hochgezogen wurde. »Cécile! Cécile!«, brüllte das Publikum. Ich winkte blind und warf dem Meer aus Gesichtern eine Kusshand entgegen, bevor ich in einen tiefen Knicks sank. Julian ging auf ein Knie und küsste unter tosendem Applaus der Menge meine behandschuhten Finger. Dann fiel der Vorhang ein letztes Mal.
Kaum hatte der Stoff den Bühnenboden berührt, zog Julian seine Hand weg und stand auf. »Schon lustig, dass sie selbst dann deinen Namen rufen, wenn du einen schlechten Tag hast«, murmelte er, wobei sein attraktives Gesicht vor Zorn dunkel anlief. »Mich behandeln sie hingegen wie eine Requisite.«
»Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt«, widersprach ich. »Du hast sehr viele Verehrerinnen und Bewunderer. Alle Männer sind eifersüchtig auf dich, und jede Frau wünscht sich, sie würde an meiner statt in deinen Armen liegen.«
»Erspar mir die Plattitüden.«
Ich zuckte nur mit den Achseln, wandte ihm den Rücken zu und ging von der Bühne. Es war genau zwei Monate her, seit ich in Trianon eingetroffen war, und fast drei waren seit meiner dramatischen Flucht aus Trollus vergangen. Obwohl ich von Anfang an einen Plan gehabt hatte, den ich für umsetzbar und geeignet befand, war ich meinem Ziel, Anushka zu finden, noch keinen Schritt näher gekommen. Demzufolge stellte Julians Eifersucht die kleinste meiner Sorgen dar.
Hinter der Bühne herrschte das übliche organisierte Chaos – nur dass jetzt, da das Stück vorbei war, der Wein in Strömen floss. Halb bekleidete Chormädchen drängten sich um Julian und plapperten gleichzeitig auf ihn ein, sodass ihr Lob über seinen Auftritt kaum zu verstehen war. Ich freute mich darüber – denn er bekam nicht die Anerkennung, die er verdiente. Mich ignorierten sie, was völlig in Ordnung war, denn ich wollte nur noch hier weg. Den Blick fest auf meine Garderobe gerichtet, bahnte ich mir einen Weg durch die Menge, bis mich der Klang meines Namens erstarren ließ.
»Cécile!«
Ganz langsam drehte ich mich auf dem Absatz um und beobachtete, wie alle auseinanderstoben, als meine Mutter den Raum durchquerte. Sie drückte mir feste Küsse auf beide Wangen und zog mich in eine enge Umarmung. Dabei presste sie die kräftigen Finger schmerzhaft auf die lange fahle Narbe, die von Grans Heilung meiner Verletzungen übrig geblieben war. »Das war absolut grauenhaft«, zischte sie mir mit heißem Atem ins Ohr. »Sei froh, dass heute niemand mit Geschmack im Publikum war.«
»Selbstverständlich war niemand Wichtiges da«, flüsterte ich zurück. »Andernfalls hättest du ja auch auf der Bühne gestanden.«
»Sei dankbar, dass du auftreten durftest.« Sie löste sich von mir. »War sie heute nicht großartig?«, fragte sie in den Raum hinein. »Ein Naturtalent. Eine solche Stimme gab es noch nie.«
Alle murmelten zustimmend, und einige gingen sogar so weit zu klatschen. Meine Mutter strahlte sie an. Auch wenn sie mich kritisierte, wo sie nur konnte, tolerierte sie es nicht, wenn ein anderer auch nur ein schlechtes Wort über mich verlor.
»Ja, in der Tat. Gut gemacht, Cécile!« Eine Männerstimme erregte meine Aufmerksamkeit, und als ich um meine Mutter herumspähte, sah ich den Marquis durch den Raum spazieren. Er war ein unscheinbarer Mann, so bemerkenswert und einprägsam wie graue Farbe, abgesehen von der Tatsache, dass meine Mutter normalerweise an seinem Arm hing.
Ich machte einen Knicks. »Vielen Dank, Mylord.«
Er gebot mir mit einer Handbewegung, mich zu erheben, und beäugte die Chormädchen. »Eine großartige Vorstellung, meine Liebe. Hätte Genevieve nicht direkt neben mir gesessen, hätte ich schwören können, sie würde auf der Bühne stehen.«
Die Gesichtszüge meiner Mutter verkrampften, und ich spürte, wie ich blass wurde. »Zu freundlich.«
Alle starrten einander so lange schweigend an, dass es schon peinlich wurde.
»Wir sollten gehen«, ließ meine Mutter schließlich mit schriller, übertrieben fröhlicher Stimme verlauten. »Wir sind bereits spät dran. Cécile, Liebling, ich werde heute Abend nicht zu Hause sein, du musst also nicht aufbleiben.«
Ich nickte und sah dem Marquis hinterher, der meine Mutter durch den Hinterausgang eskortierte. Kurz fragte ich mich, ob er wohl wusste, dass sie mit meinem Vater verheiratet war, und ob es ihn interessierte, falls er es tat. Er war seit Jahren der Gönner meiner Mutter, doch ich hatte erst bei meiner Ankunft in Trianon von seiner Existenz erfahren. Ob diese Information meiner Familie vorenthalten wurde oder ob sie mich im Dunkeln tappen ließ, vermochte ich nicht zu sagen. Seufzend begab ich mich auf den Weg zu meiner Garderobe und schloss die Tür hinter mir.
Nachdem ich mich auf den Stuhl vor dem Spiegel gesetzt hatte, zog ich mir langsam die Bühnenhandschuhe aus und griff nach einem kurzen Paar aus Spitze, welches ich normalerweise trug, um mein Bindungsmal zu verbergen. Das silberne Tattoo glänzte im Kerzenlicht, und ich ließ die Schultern hängen.
Wie viele Qualen konnte eine Person ertragen, bevor sie zerbrach? In meinem Hinterkopf saß ein Knoten andauernder Pein – Schmerz, der mit wilder Angst und Wut durchzogen war und niemals verschwand, nie auch nur nachzulassen schien. Es war eine ständige Erinnerung daran, dass Tristan in Trollus litt, damit ich in Trianon in Sicherheit sein konnte. Es verbildlichte unentwegt, dass es mir nicht gelang, ihm zu helfen.
»Cécile?«
Ich drehte mich um und bedeckte mein Tattoo instinktiv mit der anderen Hand, bis ich bemerkte, dass es sich um Sabine handelte, und die Arme wieder an den Seiten herabhängen ließ. Sie runzelte die Stirn, als sie mein Gesicht erblickte, betrat den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Trotz der Proteste ihrer Eltern hatte meine älteste und liebste Freundin darauf bestanden, mich nach Trianon zu begleiten. Sie war schon immer eine talentierte Näherin gewesen und hatte bewiesen, dass sie auch einen Hang für Frisuren und Schminke besaß, daher hatte ich das Ensemble davon überzeugen können, sie als meine Garderobiere einzustellen.
Während ich mich erholte, hatte meine Familie allen im Hollow erzählt, ich hätte wegen des Umzugs nach Trianon kalte Füße bekommen und wäre nach Courville an der Südspitze der Insel geflohen. Allerdings war es nie eine Option gewesen, Sabine mein Geheimnis nicht zu verraten. Nach allem, was sie in der Zeit, die ich verschwunden gewesen war, durchgemacht hatte, konnte ich sie nicht in dem Glauben lassen, sie hätte das alles nur aufgrund meines Lampenfiebers ertragen müssen.
»So schlecht warst du gar nicht«, meinte sie, tunkte einen Lappen in einen Cremetiegel und machte sich daran, mich abzuschminken, bevor sie mir meine Goldkette um den Hals legte. »Eigentlich warst du überhaupt nicht schlecht. Nur nicht so gut wie sonst. Wer könnte das unter diesen Umständen auch sein?«
Ich nickte, und uns war beiden bewusst, dass es nicht die Worte meiner Mutter waren, die mir auf der Seele lasteten.
»Und Genevieve ist eine dumme alte Hexe, wenn sie etwas anderes behauptet.«
Offensichtlich war die geflüsterte Kritik meiner Mutter auch an andere Ohren gelangt. »Sie will nur das Beste für mich«, erwiderte ich und konnte mir den Drang, sie zu verteidigen, selbst nicht erklären. Es handelte sich dabei um eine alte Angewohnheit aus der Kindheit, die ich einfach nicht loswurde.
»Das denkst du vielleicht, weil du ihre Tochter bist, aber …« Sabine zögerte und sah mich über den Spiegel hinweg mit ihren braunen Augen an. »Jeder weiß, dass sie eifersüchtig auf dich ist – ihr Stern geht unter, während deiner aufsteigt.« Sie lächelte mich an. »Es sieht auf der Bühne auch besser aus, wenn du Julians Geliebte spielst. Genevieve ist alt genug, um seine Mutter sein zu können, und das Publikum – nun ja, es ist nicht blind.«
»Sie ist trotzdem besser als ich.«
Ihr Lächeln verblasste. »Nur, weil du wegen dem, was mit ihm passiert, deine Leidenschaft verloren hast.«
Sie sprach Tristans Namen nie aus.
»Wenn du so gesungen hättest wie früher …« Sabine schnaubte frustriert. »Du hast so hart für all das hier gearbeitet, Cécile, und ich weiß, dass du es liebst. Die Gewissheit, dass du dein Leben zum Wohl irgendeiner Kreatur wegwirfst, macht mich so wütend.«
Ich war stinksauer gewesen, als wir uns zum ersten Mal deswegen gestritten hatten, und hatte Tristans und meine Entscheidungen mit Zähnen und Klauen verteidigt. Doch seitdem war ich auch dazu in der Lage gewesen, alles aus Sabines Perspektive zu betrachten. In ihr hallte vor allem das Schlimmste nach – meine Entscheidung, alles andere zu vernachlässigen, um meine Häscher zu befreien. Das konnte sie einfach nicht verstehen.
»Ich will ja nicht nur ihm helfen.« Mir gingen zahlreiche Namen durch den Kopf. So viele Gesichter, und alle verließen sich auf mich. Tristan, Marc, Victoria, Vincent …
»Das mag ja sein, aber er ist es, der dich verändert hat.«
In ihrem Tonfall und in ihrer angespannten Miene lag etwas, das mich dazu bewog, mich zu ihr umzudrehen.
»Du magst diese Frau ja um ihretwillen jagen, aber du hast nur seinetwegen aufgehört, dein Leben weiterzuführen.« Sabine beugte sich vor und nahm meine Hände in ihre. »Weil du in ihn verliebt bist, hast du deine Leidenschaft fürs Singen verloren, und ich wünschte mir …« Sie unterbrach sich und starrte unsere ineinander verwobenen Hände an.
Ich wusste, dass sie mich nicht angreifen wollte, sondern sich nur das Beste für mich wünschte, war es jedoch leid, meine Entscheidungen immer wieder rechtfertigen zu müssen. »Ich werde nicht aufhören, ihn zu lieben, nur um meine Auftritte zu verbessern«, fauchte ich, entzog ihr die Hände und bereute meinen Tonfall augenblicklich. »Entschuldige. Aber ich wünschte wirklich, du würdest einfach akzeptieren, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.«
»Ich weiß.« Sie richtete sich wieder auf. »Und ich wünschte, ich könnte mehr tun, um dir dabei zu helfen, wieder glücklich zu werden.«
Glücklich werden … Nicht die Hexe finden. Sabine war ein entscheidender Bestandteil meines Plans gewesen, Anushka auszumachen – schließlich war niemand besser darin als sie, Gerüchte und Informationen aufzustöbern –, doch sie hatte von Anfang an deutlich gemacht, dass sie mich dabei unter keinen Umständen unterstützen würde.
»Du tust schon genug, indem du mir zuhörst.« Ich hielt ihre Hand fest und drückte einen Kuss darauf. »Und indem du mich zurechtmachst.«
Wir sahen einander in die Augen und waren uns überdeutlich bewusst, dass diese Schwerfälligkeit zwischen uns etwas Neues und Fremdartiges darstellte. Dabei sehnten wir uns beide nach der Zeit zurück, in der es sie nicht gegeben hatte.
»Begleite uns heute Abend«, bat sie und klang beinahe verzweifelt. »Nur dieses eine Mal. Kannst du die Trolle nicht vergessen und dich mit uns niederen Menschen abgeben? Wir wollen uns in Pigalle die Zukunft vorhersagen lassen. Eine der Tänzerinnen hat von einem Gast gehört, dass es dort eine Frau gibt, die einem die Zukunft aus der Hand lesen kann.«
»Ich gebe doch einer Scharlatanin nicht meine schwer verdienten Münzen.« Ich zwang mich dazu, meinen Protest amüsiert klingen zu lassen. »Aber falls sie zufälligerweise rotes Haar und blaue Augen hat und weiser wirkt, als sie es dem Alter nach sein sollte, gib mir Bescheid.«
Wenn es doch nur so einfach wäre …
***
Ich blieb noch eine Weile in meiner Garderobe, um allen die Gelegenheit zu geben, ins Foyer zu gelangen oder das Theater zu verlassen. Ich wollte auf unter keinen Umständen die Gäste unterhalten müssen. Auch hatte ich den Versuch aufgegeben, Anushka am Arm eines reichen Adligen vorzufinden, der sich ebenfalls heute Abend in der Oper befand. Oder auf einer der hausinternen Feiern. Oder in einem privaten Salon. All das hatte mir nur unzählige Bewunderer eingebracht sowie den Ruf, die Männer zappeln zu lassen. Daher brauchte ich eine neue Strategie, und zwar schnell.
Mit der Kapuze meines Umhangs auf dem Kopf eilte ich durch den Hinterausgang des Theaters und die Stufen hinab.
»Na, das hat ja gedauert.«
Ich schenkte Chris ein Lächeln, als er aus den Schatten heraustrat. Er trug noch seine Arbeitskleidung, und an seinen Stiefeln klebten Schlamm sowie Dung. »Kein Herumlungern«, merkte ich an und deutete auf das Schild, welches im Allgemeinen ignoriert wurde.
»Ich habe nicht herumgelungert, sondern gewartet«, entgegnete er.
»Das sagen sie alle.« Ich hüpfte die letzten Stufen hinunter und ging neben ihm her. »Hast du etwas?« Während sich Sabine darauf konzentrierte, mehr über die Geschichte der Frauen, auf die ich sie angesetzt hatte, herauszufinden, ging Chris mit der Hartnäckigkeit eines Hexenjägers des Regenten Gerüchten über magische Aktivitäten nach.
Er nickte, trat in den Schatten und reichte mir eine geschwungene Statue, versehen mit einer Halskette aus Kräutern. »Lass mich raten«, sagte ich. »Ein Fruchtbarkeitszauber.«
»Leg ihn unter dein Kissen, und du wirst mir garantiert viele kräftige Söhne schenken.« In seiner Stimme schwang Belustigung mit und nicht länger die Erwartungsfreude, die er nach unserer Ankunft in Trianon verspürt hatte.
Ich hielt die Statue einen Moment lang fest und schüttelte dann den Kopf. »Sonst noch etwas?«
Er gab mir ein Armband aus miteinander verwobenen Zweigen. »Sie hat es als Hexenbann bezeichnet. Es stammt von einer Eberesche. Wenn du es trägst, kann dich keine Hexe mit Magie belegen.«
Ich starrte das seltsame Objekt stirnrunzelnd an und steckte es mir in die Tasche. Was für ein Unsinn. »Wie viel hast du dafür bezahlt?«
Er nannte mir eine Summe, woraufhin ich zusammenzuckte, und holte die restlichen Münzen aus der Tasche. Inzwischen gab ich fast die Hälfte meines Lohns für Tränke, Tand und dergleichen aus, hatte jedoch nichts als eine dubiose Sammlung an Klimperkram davon. Die wenigen echten Hexen, auf die sie gestoßen waren, hatten nichts über eine geheimnisvolle rothaarige Hexe oder Flüche gewusst und sich geweigert, mich in ihre Künste einzuweihen.
»Konntest du etwas Neues herausfinden?«, wollte er wissen.
Ich schüttelte den Kopf. »Keiner kennt eine Frau, die so aussieht wie sie, eine unbekannte oder zweifelhafte Vergangenheit besitzt oder die unerklärlicherweise seit fünf Jahrhunderten in der Gesellschaft verkehrt.«
Chris seufzte. »Ich bringe dich nach Hause.«
Wir schritten weiter. Auf dem Weg wurde es abwechselnd hell und dunkel, wenn wir in den goldenen Lichtkegel einer der Gaslaternen traten und diesen wieder verließen. Doch als wir die Straße erreichten, über die ich zum leeren Stadthaus meiner Mutter gelangen würde, blieb ich stehen. Mir war nach einer Veränderung zumute. »Lass uns doch mal nachsehen, ob Fred im Papagei ist.«
Chris musterte mich erstaunt, widersprach jedoch nicht, daher liefen wir die Straße entlang, in der das Lieblingslokal meines Bruders lag. Nachdem wir einen Bogen um eine Rangelei vor der Tür gemacht hatten, betraten wir die gut besuchte Taverne. Bei so gut wie allen Gästen handelte es sich um Soldaten – dies war kein Ort, an dem Künstler wie ich normalerweise anzutreffen waren –, doch jeder wusste, dass ich Frédéric de Troyes’ kleine Schwester war, darum würde mich hier auch niemand belästigen.
»Cécile! Christophe!«, rief Fred, sobald er uns bemerkte. Er ließ die Schankmaid los, die er im Arm gehalten hatte, und bestellte eine Runde Bier, um uns kurz darauf Krüge in die Hände zu drücken. Danach setzte er die Lügengeschichte fort, die er dem Mädchen gerade erzählte, bevor er mich genauer in Augenschein nahm.
»Du solltest lieber wieder an die Arbeit gehen, bevor ich noch rausgeworfen werde«, meinte er zur Schankmaid und wartete, bis sie anderen Gästen Getränke servierte, bevor er zu mir gewandt sagte: »Du siehst schrecklich aus, Cécile. Wieso liegst du nicht zu Hause im Bett?«
Ich schnitt eine Grimasse und wusste genau, dass er mit zu Hause das Hollow meinte und nicht das Stadthaus unserer Mutter. Er war noch schlimmer als Sabine, denn er sprach sich nicht nur gegen meine Suche nach Anushka aus, sondern hatte auch etwas dagegen, dass ich mich überhaupt in Trianon aufhielt. »Fang jetzt nicht wieder damit an.«
Er stellte seinen Bierkrug lautstark auf dem Tresen ab und warf einer Gruppe von Männern einen finsteren Blick zu, die mich im Vorbeigehen angerempelt hatte. Seine aggressive Ausstrahlung verriet mir, dass er nur nach einem Grund für eine Prügelei suchte. Egal, welchem. Er war neuerdings andauernd wütend. Auf meine Mutter, auf mich, auf die ganze Welt.
»Du hörst ja doch nicht auf mich«, murmelte er. »Dann mach doch, was du willst.«
Chris zog mich am Ellbogen zu einem Tisch im hinteren Teil des Raums. »Fred will dich nur beschützen, Cécile«, sagte er. »Er gibt sich die Schuld an dem, was passiert ist. Weil er nicht für dich da war.«
»Ich weiß.« Seine erste Reaktion, nachdem er meine Geschichte gehört hatte, war der Schwur gewesen, Trollus mitsamt aller Einwohner niederzubrennen. Daraufhin war eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen uns entbrandet, da ich das genaue Gegenteil zu tun beabsichtigte. Diese hatte man wahrscheinlich noch drei Farmen weiter vernehmen können. Er war nicht nur gegen meine Entscheidung, sondern verstand sie auch nicht. Genau das machte Fred wütend. Andererseits brauchte es neuerdings sowieso nicht viel, um ihn in die Luft gehen zu lassen – und ich wusste ganz genau, dass das nichts mit den Trollen zu tun hatte. Irgendetwas war weit vor meinem Verschwinden passiert. Etwas, das sich in seiner Anfangszeit in Trianon zugetragen hatte. Zu einhundert Prozent war meine Mutter daran beteiligt gewesen. Er hasste sie, und manchmal hatte ich fast den Eindruck, er würde glauben, ich hätte ihn verraten, weil ich beschlossen hatte, in Trianon zu leben und mit ihr zusammenzuarbeiten.
Als wir an dem klebrigen Tisch saßen, machte ich mich daran, meinen Bierkrug zu leeren, weil ich hoffte, dadurch die Gedanken an meinen Bruder und alles andere zu vergessen.
»Übertreib’s nicht«, warnte mich Chris, der nur an seinem Bier nippte. »Wenn ich das richtig verstehe, ist irgendwas passiert und Fred hat normalerweise nicht so schlechte Laune.«
»Stimmt.« Ich bedeutete einer Schankmaid, mir noch etwas zu trinken zu bringen. »Es ist nichts passiert, und genau das ist das Problem.« Ich trank mehrere große Schlucke. »Es ist nur ein weiterer Tag vergangen, an dem ich meinem Ziel, sie zu finden, keinen Schritt näher gekommen bin. Ein weiterer Tag, an dem Tristan Gott weiß welche Qualen erleidet, während ich auf einer Bühne vor einem Haufen Bewunderer singe. Wie ich das alles hasse!«
»Das ist nun mal der einzige Weg, wie du es dir leisten kannst, in Trianon zu bleiben. Außerdem dachte ich, du stehst gern auf der Bühne?«
Ich kniff die Lider zu und nickte. »Doch das sollte nicht so sein.«
»Cécile.« Chris streckte einen Arm aus und versuchte, mir den Krug zu entreißen, doch ich zog ihn zur Seite und trank ihn rasch aus. Er verzog das Gesicht. »Dir ist hoffentlich bewusst, dass er sich bestimmt nicht wünscht, du wärst seinetwegen jeden wachen Augenblick des Tages unglücklich.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte ich und kramte Geld aus meiner Tasche, um die Schankmaid, die jeden Moment mit meinem neuen Bier kommen müsste, zu bezahlen.
»Wir haben alles probiert.« Offenbar wechselte er die Taktik. »Seit zwei Monaten verkehrst du in Kreisen, von denen du glaubtest, sie dort antreffen zu können, und konntest keine Spur von ihr finden. Du hast unzählige Listen von Frauen, deren Hintergrund du mit Sabine überprüft hast, wobei jedoch nichts als Klatsch herausgekommen ist. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Hexen, echte ebenso wie falsche, wir bereits gesprochen haben. Keine von ihnen wollte uns helfen.«
»Die meisten konnten es nicht.« Während meiner Genesungsphase hatte ich meine Gran gedrängt, mir alles beizubringen, was sie über Magie wusste. Sie hatte mich gelehrt, wie man die Elemente ausbalancierte oder warum bestimmte Pflanzen die ihnen innewohnende Wirkung besaßen. Zudem hatte sie mir gezeigt, wie man einen Zauber in einem Augenblick des Übergangs wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Vollmond und den Sonnenwenden wirkte, um die Menge der aus der Erde gewonnenen Macht zu maximieren. Besonders viel wusste sie nicht darüber – und fast alles drehte sich um das Heilen von Verletzungen und das Kurieren von Krankheiten –, allerdings gewann ich genug Kenntnisse, um Magie zu erkennen, wenn sie in meiner Gegenwart gewirkt wurde.
»Ich will damit sagen«, fuhr Chris fort, »dass du genug getan hast. Vielleicht wird es Zeit, dein Leben anzugehen und nach vorn zu blicken.«
Ich stellte meinen leeren Krug sehr lautstark ab und machte mir gar nicht erst die Mühe, mir meine Wut nicht anmerken zu lassen. So etwas hätte ich von Sabine erwartet, jedoch nicht von Chris. Für sie glich das alles noch immer einem halben Märchen, aber er hatte Trollus mit eigenen Augen erblickt. Er wusste, was auf dem Spiel stand. »Schlägst du allen Ernstes vor, dass ich aufgebe?«
»Ich weiß es nicht.« Er wandte den Blick ab. »Er will doch eigentlich gar nicht, dass du den Fluch brichst. Vielleicht wäre es für alle Beteiligten besser, wenn du die Suche einfach aufgibst.«
»Besser für die Menschen, meinst du wohl«, fauchte ich, allerdings kamen mir die Worte nur nuschelnd über die Lippen. »Wie kannst du nur so egoistisch sein?«
Chris lief puterrot an. Er umklammerte den Rand der Tischplatte und beugte sich zu mir vor. »Wenn du einen egoistischen Menschen sehen willst, dann schau in den Spiegel. Ich bin nicht derjenige, der die ganze Welt aufgrund einer Liebesaffäre in die Sklaverei schicken will!« Mit diesen Worten stürmte er durch die anderen Gäste drängend davon und ward nicht mehr gesehen.
Ich starrte blind in meinen leeren Krug und ignorierte die Feuchtigkeit des verschütteten Biers und Weins, die die Ärmel meines Kleides durchdrang. Hatte Chris recht? War ich egoistisch? Vor zwei Monaten war ich nach Trianon aufgebrochen, um Anushka zu jagen, zu töten und so den Fluch zu brechen. Für mich hatte nie ein Zweifel daran bestanden, dass ich nicht das Richtige tat, und diese Gewissheit war zu keinem Zeitpunkt ins Wanken geraten.
Oder doch?
Ich wollte, dass Tristan frei leben konnte, so viel stand fest. Meine dort gefundenen Freunde ebenfalls. Marc, die Zwillinge, Pierre und die Herzogin Sylvie. Zoé und Élise. Eigentlich alle Halbblute. Sie sollten vom Fluch befreit werden. Doch die anderen? Ich musste an Angoulême, König Thibault und insbesondere den Dämon, der Tristans kleiner Bruder war, denken, und auf einmal stand mir der kalte Schweiß auf der Stirn. Sie würde ich nur zu gern bis in alle Ewigkeit eingesperrt wissen.
Genau das war hierbei das Problem. Wenn ich einen von ihnen freiließ, folgte der Rest, und die Konsequenzen hätte ich zu verbuchen.
Schmerz breitete sich in meinem Brustkorb aus, woraufhin ich meinen Bierkrug von mir wegschob. Ich vermisste ihn. Dabei ging es nicht nur mein Herz, sondern auch als Verbündeten. Mir fehlte seine überragende und hartnäckige Intelligenz – sein Verstand, den ich so sehr bewunderte. Was hätte ich für seine Fähigkeit gegeben, den Kern dieses Rätsels zu erkennen.
Der Raum drehte sich, als ich mich umschaute, und mein Magen protestierte. Ich holte tief Luft, um meine Sinne zu beruhigen, was ich augenblicklich bereute. Der Gestank von schalem Bier und Schweiß bestürmte meine Nasenlöcher, und ich musste würgen. »Verfluchte Felsen und Himmel.« Ich stand mühsam auf und bahnte mir einen Weg durch die Menge, wobei ich nur noch die Tür im Blick und frische Luft im Sinn hatte.
Ich würde es nicht schaffen.
Dieser Gedanke spornte mich an, und ich ignorierte die Beschwerden aller, an denen ich mich vorbeidrängelte. Als ich die Tür erreichte, riss ich sie auf und taumelte in die kühle Luft hinaus. Dort fiel ich auf die Knie und erbrach mich in den Rinnstein.
»Ich muss gestehen«, sagte eine Stimme hinter mir, »dass dies nicht ganz der Pose entspricht, in der ich Euch anzutreffen gedachte.«
Ich wischte mir den Mund am Ärmel ab und sah über die Schulter hinweg. Ein Mann, gekleidet in einen Umhang, stand einige Schritte hinter mir. Sein Gesicht blieb unter seiner Kapuze halb im Schatten verborgen. »Was wollt Ihr?«
»Lediglich eine Nachricht überbringen.« Ein Lächeln breitete sich um seine Lippen aus. »An Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Cécile de Montigny.«
Kapitel 2
Cécile
Ich rappelte mich auf und blieb mit meinen Spitzenhandschuhen an der Ziegelsteinmauer hängen, als ich mich daran abstützte. »Wer seid Ihr?«
»Ein Bote.«
»Auf wessen Geheiß?«, wollte ich wissen, wenngleich ich es längst wusste.
»Seiner Majestät König Thibault.« Der Mann neigte den Kopf. »Er schickt seiner abwesenden Schwiegertochter seine wärmsten und herzlichsten Grüße. Trollus ist seit Eurer hastigen Abreise nicht mehr wie vorher.«
»Seid Ihr hier, um mich zu töten?« War dies der Augenblick der Abrechnung?
Der Bote lachte auf. »Euch töten? Ganz gewiss nicht. Wenn ich Euch töten wollte, dann würdet Ihr längst nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ich neige nicht dazu, das Unausweichliche hinauszuzögern.«
»Was wollt Ihr dann?« Ich war nicht im Geringsten beruhigt. »Und wie kommt es, dass Ihr über sie alle sprechen könnt?«
»Seine Majestät würde gern …«, setzte er an, doch da kam Chris aus der Tür gelaufen. »Cécile!«, rief er und sah sich panisch um. Sein Blick fiel auf mich und den Boten. »Hey!«, brüllte er. »Lass sie in Ruhe!«
Er wollte auf uns zulaufen, doch ich hob warnend eine Hand. »Er ist ein Bote des Königs.«
Chris riss die Augen auf. »Was will er?«
Der Bote beäugte Chris, als hätte er mit ihm gerechnet, und seine Reaktion auf Chris’ Anwesenheit beunruhigte mich, denn sie bedeutete, dass er wusste, wer mein Freund war. »Seine Majestät würde sich gern mit Cécile treffen.«
»Nein!«, stieß Chris hervor und übertönte damit fast meine Frage: »Wann?«
Der Bote lächelte. »Heute Nacht.«
»Auf gar keinen Fall«, sagte Chris. »Ich werde ganz bestimmt nicht zulassen, dass du nach Trollus zurückkehrst.«
»Nur bis zur Flussstraße«, erläuterte der Bote. »Die Tore nach Trollus sind für Menschen weiterhin verschlossen.«
Das wussten wir bereits. Chris’ Vater Jérôme war zwar noch immer an seine Eide gebunden und konnte nicht über Trollus sprechen, hatte sich jedoch im Laufe der Jahre genügend Mittel und Wege angeeignet, um diese zu umgehen. Im Zuge dessen hatte er uns erklärt, dass der Handel nun an der Flussmündung und von den Agenten des Königs durchgeführt wurde. Diese Veränderung schnitt uns von unserer einzigen Quelle ab, die uns regelmäßig mit Updates aus der Stadt versorgt hatte.
Chris schüttelte den Kopf. »Das ist noch zu nah.«
»Diese Entscheidung treffe immer noch ich«, erklärte ich, während sich meine Gedanken überschlugen. Was wollte der König? Würde Tristan ebenfalls dort sein? Würde ich ihn sehen? Allein die Chance darauf reichte aus, mich eine Entscheidung treffen zu lassen. »Ich werde gehen.«
»Das geht nicht«, zischte Chris. »Tristan hat dich davor gewarnt. Er sagte, wenn du je wieder zurückkehrst, werden sie dich töten.«
Ich schüttelte langsam den Kopf. »Nein. Würde mich der König tot sehen wollen, wäre ich es längst. Ihm muss es um etwas anderes gehen.« Und ich wäre jede Wette eingegangen, dass ich genau wusste, worum es sich dabei handelte.
***
Der Bote eskortierte uns aus der Stadt und hinaus aufs Land, wo mehrere Pferde an den Bäumen angebunden waren. Trotz der späten Stunde ließen uns die Wachen das Tor passieren, ohne Fragen zu stellen, was zweifellos an Gold lag, das tief unter Trollus abgebaut worden war.
Wir kamen in stetigem Tempo voran, während unser Weg vom Mondlicht erhellt wurde, das hinter dunklen Wolken hervordrang. Es war eine gute Nacht zum Wirken von Zaubern, da die runde Silberscheibe am Himmel die Menge an Macht, die eine Hexe anzapfen konnte, stark vervielfachte. Nicht, dass mir das gegen die Trolle irgendetwas nützen würde.
Die dunkelste Stunde der Nacht war angebrochen, als wir zwischen den Bäumen hervorkamen und die Brücke über den Steinschlag hinweg erblickten. Unsere Eskorte folgte uns nicht, als wir abstiegen und uns langsam den Weg nach unten zum Wasser bahnten.
»Was wollen die wohl von dir?«, flüsterte Chris und hielt mich am Arm fest, als ich über ein paar Felsen kletterte. Die Ebbe setzte gerade ein, doch das Wasser stand immer noch so hoch, dass es gerade mal wenige Meter Sand zwischen den herabgestürzten Steinen und den sanften Wellen gab. Der Gestank des Abwassers war sehr intensiv, da die Stadt es nur bei Flut abließ, damit potenzielle Beweise weggespült wurden.
»Ich glaube, sie wollen raus.« Vor uns strömte Wasser unter einem Steinvorsprung heraus, und der Fluss schnitt eine Schneise durch den Sand, bevor er ins Meer floss. Unter diesem Vorsprung befand sich der Eingang nach Trollus. Ein Stück weiter schwebte eine einsame Lichtkugel und schien auf uns zu warten. Sie war eine Erinnerung daran, dass hier das Tor zwischen den Welten lag, die Grenze zwischen Realität und Fantasie. Zu einem Traum oder, je nachdem, wer dort wartete, einem Albtraum. Ich steckte meine Fackel in den Sand und bedeutete Chris, dasselbe zu tun, bevor wir vorsichtig näher heranschritten.
Ein kleines Trollkind saß im Schneidersitz mitten auf der Straße. Der Junge blickte auf, als er uns bemerkte, und wir sahen uns einer jüngeren Version Tristans gegenüber. Bis auf den Schwung seiner Lippen … Sie erinnerten mich an seine Halbschwester Lessa. Es handelte sich um das Gesicht eines Engels, hinter dem sich der Verstand eines Monsters verbarg.
»Guten Abend, Eure Hoheit«, sagte ich und blieb mit genügend Sicherheitsabstand vor der Barriere stehen, um einen tiefen Knicks zu vollführen. »Verbeug dich«, zischte ich Chris zu.
Prinz Roland de Montigny legte den Kopf schief und beäugte uns, als wären wir Insekten. »Guten Abend, Cécile.«
Warum war Roland hier? Wo steckte der König?
»Du bist dahinten im Dunkeln sehr schlecht zu sehen«, sagte er. »Komm näher.«
Ich leckte mir über die trockenen Lippen. Die Barriere sperrte ihn ein, aber ich wollte mich dem Monster nicht nähern, das mich beinahe umgebracht hatte. Roland stand auf. »Komm näher«, wiederholte er. »Ich will dich ansehen.«
»Bleib hier«, raunte ich Chris zu und ging auf die Barriere zu, obwohl mir jeder Instinkt davon abriet. Mein Herz raste, und mir liefen Schweißtropfen den Rücken hinunter. Er war nur ein Kind, dennoch hatte ich grässliche Angst vor ihm. Mehr noch als vor dem König oder Angoulême, denn sie waren immerhin bei Verstand. Selbst wenn er sich noch so ruhig und zivilisiert gab, war die Kreatur, die da vor mir stand, alles andere als das. Roland war verrückt, unvorhersehbar, verräterisch und sehr, sehr gefährlich.
»Näher«, säuselte er. »Näher.«
Meine Stiefelsohlen schabten über den Boden, als ich ganz langsam weiterging und mir nicht sicher war, wo genau sich die Barriere befand. Schlagartig spürte ich, wie die Luft dicker wurde, und trat einen Schritt zurück, wobei mir das Herz bis zum Hals schlug. Wie eine Schlange, deren Beute nicht länger in ihrer Reichweite war, entspannte sich sein kleiner Körper und schien nicht mehr zum Sprung bereit zu sein. Er hatte darauf gehofft, mich erreichen und das beenden zu können, was er an jenem schicksalhaften Tag in der Unterstadt angefangen hatte.
Ich hob eine Hand. »Ihr könnt mich von hier aus gut genug sehen.«
Roland ignorierte meine Hand und meine Worte, zog die Lippen zurück und präsentierte mir kleine, gerade weiße Zähne. »Hast du Angst?«
Ich hatte sogar furchtbare Angst.
»Wo ist Euer Bruder?«, fragte ich. »Wo ist Tristan?«
Rolands Grinsen wurde noch breiter. »Sie haben im Gefängnis ein ganz besonderes Loch für ihn ausgehoben.« Er kicherte, und das Geräusch klang schrill, kindisch und furchterregend. »Er kommt nicht oft an die frische Luft.«
Kurz darauf schlug er sich eine Hand vor den Mund, fand das Ganze aber offenbar zu witzig, sodass sein Kichern in lautstarkes Lachen überging, das von den Tunnelwänden widerhallte. Ich wich einen Schritt zurück und wäre beinahe gegen Chris geprallt, der sich während des Wortwechsels näher an mich herangeschlichen hatte. Sein Gesicht war kreidebleich. Zwar hatte ich ihm von Roland erzählt, doch nichts hätte ihn auf diese Kreatur vorbereiten können.
Ich wandte mich abermals Roland zu. »Ihr findet es anscheinend lustig, dass Euer großer Bruder, der auch der Thronerbe ist, im Gefängnis sitzt?«
Das Lachen des Jungen endete schlagartig. »Tristan ist nicht länger der Thronerbe. Das bin jetzt ich.«
Ich schüttelte den Kopf, doch nicht, um zu verneinen, dass er die Wahrheit sprach. Vielmehr packte mich schieres Entsetzen bei der Vorstellung, der Teufel mir gegenüber könnte eines Tages über das Königreich herrschen. Auf jeden Fall schien ihn meine Geste zu erzürnen.
»Ich werde König sein!«, kreischte er und wollte sich auf mich stürzen. Ich machte einen Satz nach hinten, blieb jedoch mit meinem Stiefelabsatz im Rocksaum hängen und ging zu Boden. Chris fing mich an den Armen auf und schleifte mich außer Reichweite. Aus dieser Position heraus konnte ich jedoch immer noch sehen, wie sich Roland wieder und wieder gegen die Barriere warf und mit den Fäusten dagegenschlug. Diese platzten auf und heilten sofort wieder. Sein Blut bespritzte die Magie, die ihn einsperrte, und machte sie dadurch sichtbar. Die Felsen bebten und erzitterten, als seine Macht auf den Fluch eindrosch, und dämpften seine Schreie. Aber nichts konnte uns den wilden Zorn ersparen, der sich auf seinem Gesicht widerspiegelte – eine Miene, die keinerlei Anzeichen von Vernunft mehr aufwies.
»Gott steh uns bei«, flüsterte Chris, und wir fassten uns bei diesem Anblick an den Händen.
Das Hämmern erlosch. Rolands Gesicht wurde glatt und gelassen. Er drehte sich um und verbeugte sich tief vor dem Trolllicht, das die Straße entlanggeschwebt kam. »Vater.«
Der König erschien. »Du machst ziemlich viel Lärm, Junge.«
Roland runzelte die Stirn. »Sie hat gesagt, Tristan wäre der Thronerbe und nicht ich.«
»Hat sie das?« Der König blickte durch die blutbeschmierte Barriere hindurch und sah mir in die Augen. »Menschen sind Lügner, Roland. Das weißt du doch. Und jetzt geh zurück in die Stadt. Der Herzog wartet auf dich.«
Eine Antwort, die zeitgleich keine war. Noch bestand Hoffnung für Tristan.
Roland warf mir einen letzten triumphierenden Blick zu und verschwand schnellen Schrittes in der Dunkelheit.
»Was wollt Ihr?«, verlangte ich zu erfahren und stand auf. »Warum habt Ihr mich herbringen lassen?«
»Oh, ich glaube, du weißt, warum«, erwiderte der König. Er holte ein Taschentuch hervor und wischte das Blut von der Barriere. Dabei musterte er uns interessiert, sagte jedoch nichts. Ich erwiderte seinen Blick, bis ich es nicht länger aushielt. »Wo ist Tristan? Ich will ihn sehen.«
Sein Glucksen waberte um mich herum. »Du würdest eine jämmerliche Politikerin abgeben, Cécile, da du deine Wünsche viel zu offen aussprichst.«
»Ich dachte, alle Menschen wären Lügner?«
Er zuckte mit den Achseln. »Das stimmt, aber du bist ein ehrlicher Geist, was mehr ist, als ich von mir behaupten kann. Oder von irgendeinem Troll.« Seine Lichtkugel wurde heller, bis im Tunnel beinahe Tageslicht herrschte. »Man wünscht sich immer das, was man nicht haben kann. Und wenn man nicht zur Lüge imstande ist, wird die Fähigkeit, zu täuschen, zu einem weitaus bedeutungsvolleren Talent. Man lernt sie sehr zu schätzen. Aber all diese philosophischen Betrachtungen müssen wir uns für einen anderen Tag aufsparen. Ich habe, was du willst; und du, meine Liebe, solltest dazu in der Lage sein, mir zu bringen, was ich verlange. Daher schlage ich einen Austausch vor.«
Ich schüttelte entschieden den Kopf. »Ich bin nicht so dumm, mir einzubilden, es könnte derart einfach sein, Thibault. Und auch nicht so egoistisch, auch nur in Betracht zu ziehen, Euch auf die Welt loszulassen, nur um ein Leben zu retten.«
Das war eine Lüge, denn ich zog jeden wachen Moment in Betracht, genau das zu tun.
Der König legte den Kopf schief und nickte bedächtig. »Sag mir, Cécile, was genau an meiner Freilassung jagt dir solche Angst ein?«
»Alles.« Meine Stimme klang schrill und fremd. »Ihr seid ein grausamer, herzloser Tyrann. Ich habe gesehen, wie Ihr herrscht – mir ist alles über Eure Gesetze bekannt. Wenn ich Euch befreie, werdet Ihr jeden Einzelnen von uns abschlachten.«
»Sei nicht albern«, fiel mir der König ins Wort. »Das Letzte, was ich vorhabe, ist die Auslöschung der Menschheit. Schließlich brauche ich euch. Glaubst du etwa, der Herzog d’Angloulême würde ein Feld pflügen? Oder dein guter Freund Marc, der Comte de Courville, möchte tagein, tagaus Straßen pflastern?« Er tat meine Ängste mit einer Handbewegung als völligen Irrsinn ab. »Willst du mir etwa weismachen, der Regent von Trianon hätte keine Gesetze erlassen oder seine Aristokratie würde das gemeine Volk weniger respektlos behandeln als wir das unsere?«
Er zeigte mit einem Finger auf mich. »Du nennst mich einen Tyrannen, aber ich kann dir versichern, dass es in Trollus nicht ein Individuum gibt, das hungern muss oder kein Dach über dem Kopf hat. Jeder Einzelne von ihnen bekommt eine Ausbildung und Arbeit. Kann dein Regent dasselbe von sich behaupten?«
Ich kaute auf der Unterlippe herum. »Und was ist mit Freiheit? Der Regent erlaubt keine Sklaverei auf der Insel.«
Der König verzog das Gesicht. »Wieso fragst du jene, die im Pigalle-Viertel verhungern, nicht mal, wie viel ihnen ihre Freiheit wert ist? Oder die, die in den Gräben neben den Landstraßen erfrieren?« Er stützte sich mit einer Hand an der Barriere ab. »Ihr würdet nur eine Aristokratie gegen eine andere austauschen. Männer wie dein Vater würden weiterhin Schweine züchten und auf dem Markt verkaufen. Deine Mutter würde weiterhin auf der Bühne für alle singen, die sich den Eintritt leisten können. Für die meisten würde sich so gut wie gar nichts ändern.« Er seufzte schwer. »Wie viel bist du bereit, für deine unberechtigten Ängste zu opfern?«
»Hör nicht auf ihn«, sagte Chris hinter mir. »Er will nur seine eigenen Interessen sichern.«
»Und du willst das nicht, Christophe Girard?« Zwar sprach der König mit Chris, doch sein Blick ruhte weiterhin auf mir. Er wollte jede meiner Reaktionen in sich aufnehmen. »Erzähl mir nicht«, fuhr er fort, »dass du dir nicht überlegt hättest, wie du davon profitieren kannst, indem du Cécile und meinen Sohn voneinander fernhältst.«
»Tristans Freiheit ist die geringste meiner Sorgen«, entgegnete Chris, doch ich bekam seine Worte kaum mit. Waren meine Ängste wirklich unbegründet? Ich schloss die Augen und erinnerte mich an die Gemälde, die mir Tristan gezeigt hatte und auf denen zu sehen gewesen war, wie das Leben der Menschen unter der Regentschaft der Trolle ausgesehen hatte. Ich dachte an die Abbildungen der Menschen, die nach dem Einsturz um Erlösung gefleht hatten, und an die darauffolgenden Gräueltaten. Würde es unter König Thibault genauso ablaufen? Besser? Oder noch schlimmer? Ich mahlte mit den Kiefern.
Doch seine nächsten Worte änderten alles.
»Ich habe nicht die Absicht, in den Krieg zu ziehen, um mein Königreich zurückzuerobern«, erklärte der König. »Die Macht über die Insel wird mir auf friedlichem Weg übertragen werden.«
Mir fiel die Kinnlade herunter. »Wie könnt Ihr so etwas auch nur behaupten?«
Er schüttelte sachte den Kopf. »Dieses Wissen behalte ich vorerst für mich – schließlich möchte ich nicht, dass meine Pläne vereitelt werden. Denn das«, ergänzte er, »würde Gewalt gegen deinesgleichen erforderlich machen, was ich gern vermeiden möchte. Ich habe genug Blutvergießen miterlebt und bin es leid.«
Diese Worte hatten definitiv nicht zu den Dingen gehört, mit denen ich gerechnet hatte: das Angebot einer friedlichen Lösung aus dem Munde jemandes, der nicht imstande dazu war zu lügen. Dennoch schaffte ich es nicht, ihm zu glauben. Allerdings wäre ich eine Närrin gewesen, wenn ich nicht versucht hätte, auch den Rest seiner Pläne in Erfahrung zu bringen.
»Ich habe nach Anushka gesucht«, sagte ich unverhofft.
Der König nickte. »Verrate mir doch, Cécile, wie sich deine Suche von der Tausender Männer und Frauen unterschieden hat, die sie in den letzten fünfhundert Jahren zu finden versuchten. Glaubst du, wir wären nicht jedem Gerücht nachgegangen, hätten nicht in jedes Gesicht geblickt, hätten uns nicht in die exklusivsten Kreise eingeschleust? Denkst du, wir hätten keine Geburtsurkunden studiert oder jemanden gefunden, der über die Kindheit jeder Frau mit unklarer Vergangenheit Bericht erstatten konnte?«
Ich öffnete den Mund und schloss ihn gleich daraufhin wieder.
»Du bist einzigartig, Cécile, und so sollte auch deine Suche sein«, sagte er leise.
Damit meinte er Magie. Die Trolle hatten wahrscheinlich noch nie eine Hexe auf die Suche nach ihr angesetzt, und falls doch, dann keine, die derart entschlossen war wie ich.
»Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll«, gab ich zu und versuchte gar nicht erst, die Verbitterung aus meiner Stimme zu verbannen. »Und keiner will es mir beibringen.« Ich hatte alle Grimoires in Trollus zurücklassen müssen, und die wenigen Zauber, an die ich mich erinnerte, halfen mir bei meiner Suche nicht weiter. Zwar wusste ich mehr als früher, dies sprach ich jedoch nicht offen aus.
Der König griff unter seinen Mantel, und mein Herz setzte einen Schlag lang aus, als ich das Buch erblickte, das er hervorholte: Anushkas Grimoire. Er hielt es durch die Barriere, und ich wollte eifrig danach greifen, als er es ruckartig zurückzog. »Zuerst musst du mir dein Wort geben.«
Ein leichtes Lächeln stahl sich auf meine Züge. »Habt Ihr Angst, ich könnte ihre Magie gegen Euch einsetzen?«
Er wedelte mit dem blutigen Taschentuch herum. »Dafür dürfte dir eine der benötigten Zutaten fehlen. Nein, bevor ich dir dieses widerliche Machwerk aushändige, musst du mir versprechen, dass du es für die Jagd auf Anushka nutzen wirst. Dass du vor nichts haltmachst, um sie zu finden und zu mir zu bringen.«
»Tu es nicht, Cécile!«, rief Chris. »Wenn du ihm etwas versprichst, ist es bindend.«
»Ich verspreche Euch gar nichts, solange ich Tristan nicht gesehen habe«, erwiderte ich.
»Du wirst ihn zu sehen bekommen, wenn du Fortschritte machst.«
»Dann höre ich auf der Stelle mit der Suche auf, bis Ihr mich ihn sehen lasst.« Ich reckte trotzig das Kinn in die Höhe. Hierbei handelte es sich vielleicht um meine einzige Chance, und ich würde nicht kampflos aufgeben.
»Ich hatte gehofft, du wärst vernünftig.« Der König seufzte. »Aber wie du willst. Bringt ihn her!«, rief er hinter sich in den Tunnel hinein. Wenige Augenblicke später hörte ich Stiefel über den Stein näher kommen, aber auch das Geräusch von etwas Schwerem, das über den Boden geschleift wurde.
Chris umklammerte meinen Arm. »Sei stark. Das wird nicht leicht.«
Als ob ich das nicht gewusst hätte. Seit Monaten spürte ich Tristans Qualen, wenn er auf Befehl seines Vaters hin bestraft wurde. Ich hatte mit angesehen, wie die silbernen Markierungen auf meinen Fingern trüber wurden, wenn seine Kraft auf eine Art und Weise abgesaugt wurde, die ich mir nur zu gut vorstellen konnte. Doch nichts von alldem hatte mich auf den Anblick vorbereitet, wie er barfuß und mit nacktem Oberkörper von den bewaffneten Wachen hergezerrt und seinem Vater zu Füßen geworfen wurde.
Ein Schluchzen entrang sich meiner Kehle, als mein Blick über seinen ausgezehrten Körper wanderte, der dreckig und mit getrocknetem Blut bedeckt war. Seine Arme waren dreifach verschnürt worden. Diese Fesseln enthielten Eisendornen, die sich durch Fleisch und Knochen bohrten. Frisches Blut sickerte um das Metall herum und fiel als scharlachrote Tropfen auf den Sand unter ihm. Der König griff nach unten und zog ihm die Kapuze vom Kopf. Tristan rührte sich nicht und lag zusammengesunken an der Barriere. Eine Brise wehte vom Meer herüber und an mir vorbei, um sein mit Dreck verkrustetes Haar aufzuwirbeln.
Ganz langsam hob er den Kopf und sah mich an. »Cécile«, krächzte er. »Ich sagte doch, dass du nie mehr zurückkommen solltest.«
Kapitel 3
Cécile
Nur Chris’ fester Griff um meinen Arm verhinderte, dass ich durch die Barriere stürzte. »Verdammt sollt Ihr sein!«, schrie ich den König an. »Wer tut seinem eigenen Sohn so etwas an? Wie könnt Ihr nur damit leben?«
Wie konnte ich mit dem Wissen leben, dass Tristan meinetwegen in dieser Lage war und dass ich nichts dagegen unternommen hatte?
»Er kann von Glück reden, dass ich es ertrage, ihn am Leben zu lassen«, erklärte der König gleichmütig. »Tristan hat sich des Verrats auf höchster Ebene schuldig gemacht. Er hat sich gegen seinen Vater und seinen König verschworen. Er hat eine Rebellion angestachelt, durch die es zu zahlreichen Todesopfern kam. Er hat ein Duell gegen mich begonnen, das mich beinahe das Leben gekostet hätte.«
»Ihr habt ihm keine andere Wahl gelassen«, entgegnete ich verbittert.
Der König schüttelte langsam den Kopf. »Er hatte immer eine Wahl. Doch er hat sich für dich entschieden. Jetzt muss er die Konsequenzen tragen.«
Tristan stemmte sich mühsam auf die Knie, und ich bemerkte erleichtert, dass noch immer ein Funke in seinen Augen zu erkennen war. Er war nicht gebrochen. Jedenfalls noch nicht. »Hör nicht auf ihn, Cécile.« Seine Stimme klang unsäglich rau, weil er sie so wenig genutzt – oder so viel geschrien hatte. »Du musst jetzt gehen.«
»Ich kann dich nicht so zurücklassen«, erwiderte ich.
Tristan verzog das Gesicht. »Bring sie von hier weg, Christophe. Weit weg. Du hast versprochen, auf sie aufzupassen, aber das hier ist das genaue Gegenteil davon.«
»Er hat recht.« Chris zog mich an den Armen nach hinten. Ich wehrte mich gegen ihn, bohrte die Fersen in den Stein und den Sand, doch er war stärker.
»Lass mich los!«, rief ich.
Tristan machte ein konzentriertes Gesicht, das zu der Entschlossenheit passte, die mir unsere Verbindung vermittelte. »Du hast mir dein Wort gegeben, Christophe«, sagte er. »Ich erwarte, dass du es hältst.«
»Verdammter Troll«, murmelte Chris. Er ignorierte meine auf ihn einhämmernden Fäuste, warf mich über seine Schulter und marschierte den Strand entlang.
»Setz mich ab«, verlangte ich, denn ich hatte Tristan schon einmal im Stich gelassen und wollte es nie wieder tun. Daher biss ich die Zähne aufeinander und rief die Mächte der Erde an, zog sie tief in mir zusammen.
Die Flamme der Fackel loderte auf und wurde vom Winde verweht, der vom Meer aus herüberwaberte, der Fluss kehrte die Richtung um, während die Wellen tosten, um sich um Chris’ Stiefel herum zu sammeln. Der Vollmond schenkte mir genug Macht, um es mit Tristans aufnehmen zu können, und ich hatte vor, sie zu benutzen.
Chris erstarrte.
»Du wirst dich nicht einmischen«, sagte ich.
»Christophe!«, schrie Tristan. »Bring Cécile von hier weg.«
Stöhnend fasste sich Chris an den Kopf und ließ mich ins Wasser fallen.
»Du wirst noch seinen Verstand brechen«, warnte mich der König, und als ich aufgestanden war, bemerkte ich, dass er sich das Ganze interessiert ansah.
Chris fiel im Wasser auf die Knie und umklammerte die Steine darin. »Bitte«, stieß er stöhnend hervor. »Das tut weh.«
Ich ließ ein wenig nach, da mein Freund nicht leiden sollte, nur damit ich beweisen konnte, dass ich recht hatte. »Hör auf mit dem, wozu du ihn verpflichtet hast, Tristan«, verlangte ich. »Du hast nicht das Recht, Entscheidungen für mich zu treffen.«
Er starrte mich an und nickte dann knapp. »Dann bleib.«
Ich wandte mich wieder dem König zu. »Was wollt Ihr?«
»Das sagte ich doch schon«, antwortete er. »Gib mir dein Wort, dass du alles in deiner Macht Stehende tun wirst, um Anushka zu finden und zu mir zu bringen. Im Gegenzug werde ich dir und Tristan gestatten, wieder zusammen zu sein.«
»Tu das nicht, Cécile!« Tristan stemmte eine blutige Hand gegen die Barriere. »Du weißt, was passieren wird, wenn du den Fluch brichst. Dann entlässt du nicht nur uns aus diesem Gefängnis, sondern erlaubst es auch den anderen, wieder frei durch diese Welt zu streifen.«
»Sie weiß, was du ihr gesagt hast.« Der König blickte auf seinen Sohn herab, als wäre er sich nicht sicher, wie viel Tristan wirklich enthüllt hatte. »Welche Loyalität ist sie dem Regenten von Trianon schuldig? Was hat er je für sie getan? Ist es den Preis wert«, er sah erneut mich an, »ihn an der Macht zu halten?«
Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich tun sollte. »Er sagt, er kann die Insel friedlich einnehmen.« Mein Blick zuckte zum König. »Er sagt, er hat einen Plan.«
Bei meinen Worten konnte ich deutlich Tristans Schock spüren, und er hob den Kopf, um seinen Vater anzusehen, der daraufhin nickte. »Es ist die Wahrheit. Wenn meine Pläne umgesetzt sind, wird mir Trianon abgetreten, ohne dass Gewalt gegen die Bewohner der Insel angewendet werden muss.«
Mehrere Augenblicke verstrichen, dann ließ Tristan den Kopf hängen. »Das ist ein Trick. Glaub ihm kein Wort.«
»Aber, Tristan!« Ich wünschte mir so sehr, dass der König die Wahrheit sagte – sehnte mich verzweifelt nach einer einfachen Lösung dieser hoffnungslosen Situation.
»Bitte«, flehte Tristan. »Versprich ihm nichts. Wenn du es tust, gehört ihm dein Wille. Verschwinde einfach von hier, und komm nie wieder zurück.«
Ich zitterte am ganzen Leib, und mir schossen alle möglichen Optionen durch den Kopf. Tristan konnte die Zukunft nicht voraussehen, er wusste nicht mit Sicherheit, ob sich die Geschichte wiederholen würde. War es möglich, dass der König meinte, was er versprach?
»Ich flehe dich an, Cécile«, sagte Tristan mit bebender Stimme. »Wenn du mich liebst, dann gib ihm nicht, was er haben will.«
Meine Augen brannten. »Wenn ich mich weigere«, wollte ich vom König wissen, »was passiert dann?«
Seine Miene verhärtete sich. »Willst du das wirklich wissen?«
»Ja.« Ich musste das Wort förmlich aus meiner Kehle herausreißen, die vor Entsetzen wie zugeschnürt war.
»Wie du wünschst.« Eine unsichtbare magische Hand rammte Tristan gegen die Barriere, woraufhin er vor Schmerz das Gesicht verzog. Ich konnte deutlich erkennen, wie er sich wehrte und die Muskeln anspannte, um sich zu befreien. Frisches Blut quoll rings um die in seine Arme gebohrten Dornen hervor.
»Nein!«, kreischte ich. »Nein, nein, nein. Hört auf! Bitte, tut ihm nicht weh!« Ich stürzte gegen die Mauer, die sie einsperrte, und prallte gegen steinharte Magie. Der König hatte eine eigene Barriere errichtet, um mich fernzuhalten. Mit leisem, entsetztem Wimmern beobachtete ich, wie eine der Wachen eine mit Eisenstacheln besetzte Peitsche zückte.
»Ich frage dich noch einmal, Cécile: Ist es den Preis wert?« Der König nickte der Wache zu, kurz darauf landete die Peitsche auf Tristans Schultern und riss ihm die Haut auf. Er verzog das Gesicht, sah mir jedoch tief in die Augen. »Tu es nicht. Was auch immer er tut, stimm ihm bloß nicht zu.«
Die Peitsche fuhr abermals auf ihn nieder. Blut spritzte auf, und Tristan knirschte vor Schmerzen mit den Zähnen. Er wird ihn nicht umbringen,sagte mir mein logischer Verstand, doch Logik war im Angesicht von Tristans Schmerz kein wirklicher Trost.
Der König nickte, und die Wache schlug erneut zu. Und gleich noch einmal. Anfangs ertrug Tristan es nahezu schweigend, doch ich spürte seine Reaktion bei jedem Schlag. Eine Sekunde, bevor der erste Schrei aus seiner Kehle drang, bemerkte ich, wie er brach. Trotzdem wurde er weiter ausgepeitscht.
Es war zu viel für mich.
»Halt! Ich verspreche es. Ich werde sie finden.« Meine Worte verließen meinen Mund so rasch, dass sie sich überschlugen, dennoch vernahm sie der König. Die Peitsche verharrte mitten im Schlag, und Tristan sackte zu Boden. Blut lief an seinem Rücken herunter, da die durch Eisen verursachten Wunden nicht heilen wollten.
»Du tust alles in deiner Macht Stehende?«, hakte der König nach. »Und du bringst sie her? Ich würde mir zu gern anhören, wie die Hexe mit heraushängenden Eingeweiden noch schreien kann, würde mich aber auch mit ihrem Tod auf andere Weise zufriedengeben.«
Ich nickte benommen. »Ich verspreche, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um sie zu finden und hierherzubringen.«
»Braves Mädchen.« Er warf Anushkas Grimoire durch die Barriere. Der Foliant landete mit einem dumpfen Knall auf dem feuchten Boden.
Ich ignorierte ihn und sank auf Hände sowie Knie. »Tristan?«
Er hatte die Lider halb geöffnet und starrte mich an.
»Es tut mir so leid«, flüsterte ich. »Ich konnte es nicht länger ertragen.«
Dann drehte er den Kopf weg. Er war mir nicht etwa dankbar, dass ich seine Qualen beendet hatte, sondern wütend auf mich und enttäuscht von mir.
»Bringt ihn zurück in den Palast, und lasst ihn säubern.« Der König sah mit ausdrucksloser Miene zu, wie die Wachen Tristan zwischen sich nahmen und die Flussstraße entlangtrugen. Als sie weg waren, wandte er sich mir zu. »Mach dich lieber an die Arbeit, kleine Hexe. Du musst ein Versprechen halten.«
Kapitel 4
Tristan
Nicht die Würde zu verlieren, wenn man in Ketten durch die Stadt geschleift wurde, über die man eigentlich irgendwann einmal hätte herrschen sollen, und den eigenen Dreck der letzten Wochen am Leib kleben hatte, war nicht gerade leicht. Ich war allerdings der Ansicht, dies auf dem Weg zwischen meiner Gefängniszelle und der Flussstraße gut hinbekommen zu haben. Was leider nicht für den Rückweg galt. Meine Schreie waren alles andere als würdevoll gewesen; und die Spuren, die meine Schmerzenstränen hinterlassen hatten, mochten zwar das Mitleid einiger erregt haben, hatten mir jedoch garantiert keinen Respekt verschafft. Den ich, nebenbei bemerkt, auch nicht verdiente.
Ich war der gefallene Prinz. Ein doppelter Verräter, da ich in einem einzigen Moment sowohl meinen Vater als auch meine Sache verraten und dafür gesorgt hatte, für den Rest meines Lebens, wie immer dieser auch ausfallen mochte, ein Außenseiter zu bleiben. Und das für ein Menschenmädchen, das ich über alles liebte. Darüber hinaus schienen all die Qualen umsonst gewesen zu sein.
Mein Kiefer schmerzte, als ich die Zähne zusammenbiss, zum Teil wegen der Schmerzen, die meinen Körper noch immer peinigten, aber vor allem wegen der Erinnerung an ihren Gesichtsausdruck. Entsetzen und Mitleid hatten sich in ihren strahlend blauen Augen abgezeichnet, waren jedoch unter der Last des Versprechens, das sie meinetwegen abgegeben hatte, verblasst. Die Last einer Entscheidung, die eigentlich ich hätte treffen müssen, doch weil ich zu schwach gewesen war, um die Misshandlungen meines Vaters zu ertragen, hatte sie es an meiner statt tun müssen. Ich war nicht einmal Manns genug gewesen, um ihr in die Augen zu blicken und meine Niederlage anzuerkennen. Stattdessen hatte ich mich weggedreht und das Gefühl gehabt, nicht nur sie enttäuscht zu haben, sondern bei allem gescheitert zu sein, was ich mir je vorgenommen oder in mir gesehen hatte.
Die Wachen ließen mich auf den Boden fallen, und ich schaffte es nur mit Mühe, nicht aufzuschreien. Mein Blick blieb starr auf den vertrauten Teppich unter meinen Knien gerichtet.
»Geht«, sagte eine Stimme, die ich überall wiedererkennen würde. Die Wachen grummelten, doch ihre Stiefel verschwanden aus meinem Blickfeld, und die Tür hinter mir fiel zu. Es kostete mich einige Anstrengung, den Kopf weit genug zu heben, um den vor mir stehenden Troll anzusehen. »Hallo, Cousin«, sagte ich mit heiserer Stimme.
»Du siehst furchtbar aus«, erwiderte Marc, dessen entstelltes Gesicht grimmig wirkte. »Kannst du aufstehen?«
»Ich glaube, ich bleibe lieber, wo ich bin.« Der Teppich schabte über meine Wange, als ich den Kopf darauflegte. »Warum bin ich hier?«, fragte ich, weil es mir eben erst eingefallen war.
»Das kann ich dir nicht sagen – ich hatte gehofft, du könntest mir verraten, warum dein Vater deine Verlegung angeordnet hat.« Marc kam auf mich zu, und ich verdrehte ein Auge beim Klang der gegeneinander klirrenden Metallschlüssel, um reglos liegen zu bleiben, als er vier der sechs Fesseln an meinen Armen öffnete. »Wappne dich«, warnte er mich und riss eine der Fesseln auf. Ein feuchtes Schmatzen drang in meine Ohren, und ich verlor das Bewusstsein.
Als ich einige Augenblicke später wieder zu mir kam, lagen die Fesseln als blutverkrusteter, rostiger Haufen auf dem Boden. Die beiden an meinen Handgelenken verbliebenen schmerzten zwar noch, und der Juckreiz durch das verfluchte Eisen machte mich fast verrückt, aber die Erleichterung, die anderen vier losgeworden zu sein, war enorm. Sie hatten sich angefühlt, als hätte man mir Eisenbänder um die Brust geschlungen, die mir nur flache Atemzüge erlaubten, aber nie so tiefe, dass ich genug Luft bekam. Gierig griff ich auf meine Magie zu und nutzte sie, um mich hinzuknien.
»Besser? Er hat angeordnet, dass diese beiden bleiben müssen.«
Ich nickte. »Viel besser.«
»Ich habe dir ein Bad vorbereiten lassen.« Er deutete auf die dampfende Badewanne. »Dabei hatte ich dummerweise nicht an deine Verletzungen gedacht.«
»Schon gut.« Ich stand langsam auf. »Mir ist ohnehin nicht nach einer Unterhaltung zumute. Schick meine Dienstboten rein, wenn du gehst.«
»Du hast leider keine Dienstboten mehr.«
Ich wandte mich von der Badewanne ab und starrte ihn an. »Wie bitte?«
»Sie haben sich alle geweigert, für dich zu arbeiten.«
»Alle?« Dieser Verlust schmerzte erstaunlich stark. »Dann habe ich also nur noch dich.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: