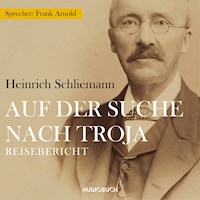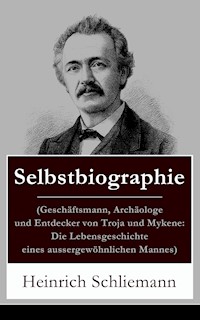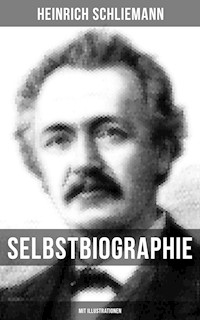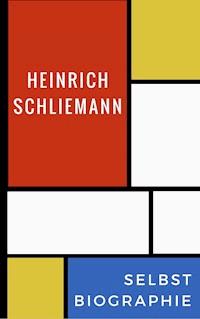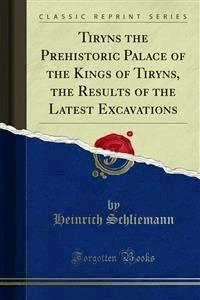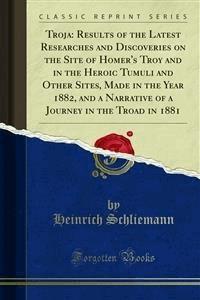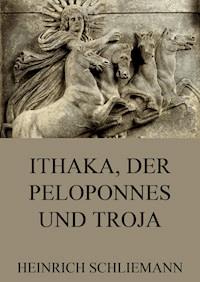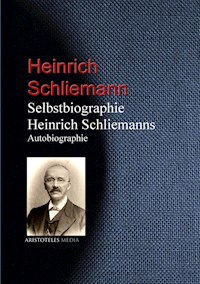Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit zahlreichen Illustrationen Eine spannende und lehrreiche Autobiographie des Entdeckers von Troja, die auch Einblicke in seine Jugend und seine erfolgreichen Aktivitäten als Kaufmann vermittelt. Heinrich Schliemann (1822–1890) war ein deutscher Kaufmann, Archäologe und Pionier der Archäologie. 1873 erklärte Schliemann, Troja an der Westküste Anatoliens gefunden zu haben. Den eigentlichen Ruhm erlangte er allerdings durch den Fund des angeblichen Schatzes des Priamos im selben Jahr. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Schliemann
Selbstbiographie
Heinrich Schliemann
Selbstbiographie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: F. A. Brockhaus, 1944 2. Auflage, ISBN 978-3-962818-67-8
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur ersten Auflage
1. Kindheit und kaufmännische Laufbahn
2. Erste Reise nach Ithaka, dem Peloponnes und Troja
3. Troja
4. Mykenä
5. Troja
6. Tiryns
7. Letzte Lebensjahre
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort zur ersten Auflage
Als wenige Wochen nach dem Tode meines unvergesslichen Mannes Herr F. A. Brockhaus mir den Wunsch äußerte, die im Buche »Ilios« enthaltene Selbstbiographie zugänglicher als bisher zu machen, glaubte ich diesen Plan nicht von der Hand weisen zu sollen, schon um der Teilnahme zu danken, welche der Lebensgang und das Lebenswerk Heinrich Schliemanns und nun sein jähes Ende allerorten und weit über die Kreise seiner Fachgenossen und Freunde hinaus erregt hat. Es war mir eine wehmütige Freude, in schweren Stunden in die Erinnerung zurückzurufen, wie wir miteinander tastend in Troja und Mykenä das Werk begannen und wie unserm Bemühen der Erfolg günstig war. Aber es gibt Zeiten, wo die Feder versagt. Darum übertrug ich die Ausführung des Planes des Herrn Brockhaus Herrn Dr. Alfred Brückner, der bei einem Aufenthalte in Troja im vergangenen Jahre meinem Manne nahegetreten war. Von ihm rührt die Vervollständigung der Selbstbiographie her.
Athen, 23. September 1891
Sophie Schliemann
1. Kindheit und kaufmännische Laufbahn
1822–1866
Ankershagen – Sagen von Ankershagen – Herkulanum und Pompeji – Troja – Minna Meincke – Peter Hüppert – Schul- und Lehrlingsjahre – Schiffsjunge auf der Brigg Dorothea – Laufbursche in Amsterdam – Studium moderner Sprachen – Agentur in Petersburg – Brand in Memel – Studium des Griechischen – Reise nach dem Orient – Reise um die Erde
Wenn ich dieses Werk – so leitet Heinrich Schliemann sein Buch »Ilios« ein – mit einer Geschichte des eignen Lebens beginne, so ist es nicht Eitelkeit, die dazu mich veranlasst, wohl aber der Wunsch, klar darzulegen, dass die ganze Arbeit meines spätern Lebens durch die Eindrücke meiner frühesten Kindheit bestimmt worden, ja, dass sie die notwendige Folge derselben gewesen ist; wurden doch, sozusagen, Hacke und Schaufel für die Ausgrabung Trojas und der Königsgräber von Mykenä schon in dem kleinen deutschen Dorfe geschmiedet und geschärft, in dem ich acht Jahre meiner ersten Jugend verbrachte. So erscheint es mir auch nicht überflüssig, zu erzählen, wie ich allmählich in den Besitz der Mittel gelangt bin, vermöge deren ich im Herbste des Lebens die großen Pläne ausführen konnte, die ich als armer, kleiner Knabe entworfen hatte. Ich wurde am 6. Januar 1822 in dem Städtchen Neu-Buckow in Mecklenburg-Schwerin geboren, wo mein Vater, Ernst Schliemann, protestantischer Prediger war und von wo er im Jahre 1823 in derselben Eigenschaft an die Pfarre von Ankershagen, einem in demselben Großherzogtum zwischen Waren und Penzlin belegenen Dorfe, berufen wurde. In diesem Dorfe verbrachte ich die acht folgenden Jahre meines Lebens, und die in meiner Natur begründete Neigung für alles Geheimnisvolle und Wunderbare wurde durch die Wunder, welche jener Ort enthielt, zu einer wahren Leidenschaft entflammt. In unserm Gartenhause sollte der Geist von meines Vaters Vorgänger, dem Pastor von Rußdorf, »umgehen«; und dicht hinter unserm Garten befand sich ein kleiner Teich, das sogenannte »Silberschälchen«, dem um Mitternacht eine gespenstische Jungfrau, die eine silberne Schale trug, entsteigen sollte. Außerdem hatte das Dorf einen kleinen, von einem Graben umzogenen Hügel aufzuweisen, wahrscheinlich ein Grab aus heidnischer Vorzeit, ein sogenanntes Hünengrab, in dem der Sage nach ein alter Raubritter sein Lieblingskind in einer goldenen Wiege begraben hatte. Ungeheure Schätze aber sollten neben den Ruinen eines alten runden Turmes in dem Garten des Guteigentümers verborgen liegen; mein Glaube an das Vorhandensein aller dieser Schätze war so fest, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Vater über seine Geldverlegenheiten klagen hörte, verwundert fragte, weshalb er denn nicht die silberne Schale oder die goldene Wiege ausgraben und sich dadurch reich machen wollte? Auch ein altes mittelalterliches Schloss befand sich in Ankershagen, mit geheimen Gängen in seinen sechs Fuß starken Mauern und einem unterirdischen Wege, der eine starke deutsche Meile lang sein und unter dem tiefen See bei Speck durchführen sollte; es hieß, furchtbare Gespenster gingen da um, und alle Dorfleute sprachen nur mit Zittern von diesen Schrecknissen. Einer alten Sage nach war das Schloss einst von einem Raubritter, namens Henning von Holstein, bewohnt worden, der, im Volke »Henning Bradenkirl« genannt, weit und breit im Lande gefürchtet wurde, da er, wo er nur konnte, zu rauben und zu plündern pflegte. So verdross es ihn denn auch nicht wenig, dass der Herzog von Mecklenburg manchen Kaufmann, der an seinem Schlosse vorbeiziehen musste, durch einen Geleitsbrief gegen seine Vergewaltigungen schützte, und um dafür an dem Herzog Rache nehmen zu können, lud er ihn einst mit heuchlerischer Demut auf sein Schloss zu Gaste. Der Herzog nahm die Einladung an und machte sich an dem bestimmten Tage mit einem großen Gefolge auf den Weg. Des Ritters Kuhhirte jedoch, der von seines Herrn Absicht, den Gast zu ermorden, Kunde erlangt halte, verbarg sich in dem Gebüsch am Wege, erwartete hier hinter einem, etwa eine Viertelmeile von unsern, Hause gelegenen Hügel den Herzog und verriet demselben Hennings verbrecherischen Plan. Der Herzog kehrte augenblicklich um. Von diesem Ereignis sollte der Hügel seinen jetzigen Namen »der Wartensberg« erhalten haben. Als aber der Ritter entdeckte, dass der Kuhhirte seine Pläne durchkreuzt hatte, ließ er den Mann bei lebendigem Leibe langsam in einer großen eisernen Pfanne braten und gab dem Unglücklichen, erzählt die Sage weiter, als er in Todesqualen sich wand, noch einen letzten grausamen Stoß mit dem linken Fuße. Bald danach kam der Herzog mit einem Regiment Soldaten, belagerte und stürmte das Schloss, und als Ritter Henning sah, dass an kein Entkommen mehr für ihn zu denken sei, packte er alle seine Schätze in einen großen Kasten und vergrub denselben dicht neben dem runden Turme in seinem Garten, dessen Ruinen heute noch zu sehen sind. Dann gab er sich selbst den Tod. Eine lange Reihe flacher Steine auf unserm Kirchhofe sollte des Missetäters Grab bezeichnen, aus dem jahrhundertelang sein linkes, mit einem schwarzen Seidenstrumpfe bekleidetes Bein immer wieder herausgewachsen war. Sowohl der Küster Prange als auch der Totengräber Wöllert beschworen hoch und teuer, dass sie als Knaben selbst das Bein abgeschnitten und mit dem Knochen Birnen von den Bäumen abgeschlagen hätten, dass aber im Anfange dieses Jahrhunderts das Bein plötzlich zu wachsen aufgehört habe. Natürlich glaubte ich auch all dies in kindlicher Einfalt, ja bat sogar oft genug meinen Vater, dass er das Grab selber öffnen oder auch mir nur erlauben möge, dies zu tun, um endlich sehen zu können, warum das Bein nicht mehr herauswachsen wolle.
Einen ungemein tiefen Eindruck auf mein empfängliches Gemüt machte auch ein Tonrelief an einer der Hintermauern des Schlosses, das einen Mann darstellte und nach dem Volksglauben das Bildnis des Henning Bradenkirl war. Keine Farbe wollte auf demselben haften, und so hieß es denn, dass es mit dem Blute des Kuhhirten bedeckt sei, das nicht weggetilgt werden könne. Ein vermauerter Kamin im Saale wurde als die Stelle bezeichnet, wo der Kuhhirte in der eisernen Pfanne gebraten worden war. Trotz aller Bemühungen, die Fugen dieses schrecklichen Kamins verschwinden zu machen, sollten dieselben stets sichtbar geblieben sein – und auch hierin wurde ein Zeichen des Himmels gesehen, dass die teuflische Tat niemals vergessen werden sollte. Noch einem anderen Märchen schenkte ich damals unbedenklich Glauben, wonach Herr von Gundlach, der Besitzer des benachbarten Gutes Rumshagen, einen Hügel neben der Dorfkirche aufgegraben und darin große hölzerne Fässer, die sehr starkes altrömisches Bier enthielten, vorgefunden hatte.
Obgleich mein Vater weder Philologe noch Archäologe war, hatte er ein leidenschaftliches Interesse für die Geschichte des Altertums; oft erzählte er mir mit warmer Begeisterung von dem tragischen Untergange von Herkulanum und Pompeji und schien denjenigen für den glücklichsten Menschen zu halten, der Mittel und Zeit genug hätte, die Ausgrabungen, die dort vorgenommen wurden, zu besuchen. Oft auch erzählte er mir bewundernd die Taten der Homerischen Helden und die Ereignisse des Trojanischen Krieges, und stets fand er dann in mir einen eifrigen Verfechter der Sache Trojas. Mit Betrübnis vernahm ich von ihm, dass Troja so gänzlich zerstört worden, dass es ohne eine Spur zu hinterlassen vom Erdboden verschwunden sei. Aber als er mir, dem damals beinahe achtjährigen Knaben, zum Weihnachtsfeste 1829 Dr. Georg Ludwig Jerrers »Weltgeschichte für Kinder« schenkte, und ich in dem Buche eine Abbildung des brennenden Troja fand, mit seinen ungeheuern Mauern und dem Skäischen Tore, dem fliehenden Äneas, der den Vater Anchises auf dem Rücken trägt und den kleinen Askanios an der Hand führt, da rief ich voller Freude: »Vater, du hast dich geirrt! Jerrer muss Troja gesehen haben, er hätte es ja sonst hier nicht abbilden können.« »Mein Sohn«, antwortete er, »das ist nur ein erfundenes Bild.« Aber auf meine Frage, ob denn das alte Troja einst wirklich so starke Mauern gehabt habe, wie sie auf jenem Bilde dargestellt waren, bejahte er dies. »Vater«, sagte ich darauf, »wenn solche Mauern einmal dagewesen sind, so können sie nicht ganz vernichtet sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen.« Nun behauptete er wohl das Gegenteil, aber ich blieb fest bei meiner Ansicht, und endlich kamen wir überein, dass ich dereinst Troja ausgraben sollte.
Wes das Herz voll ist, sei es nun Freude oder Schmerz, des geht der Mund über, und eines Kindes Mund vorzugsweise: so geschah es denn, dass ich meinen Spielkameraden bald von nichts anderm mehr erzählte, als von Troja und den geheimnisvollen wunderbaren Dingen, deren es in unserm Dorfe eine solche Fülle gab. Sie verlachten mich alle miteinander, bis auf zwei junge Mädchen, Luise und Minna Meincke, die Töchter eines Gutspächters in Zahren, einem etwa eine Viertelmeile von Ankershagen entfernten Dorfe; die erstere war sechs Jahr älter, die zweite aber ebenso alt wie ich. Sie dachten nicht daran, mich zu verspotten: im Gegenteil! stets lauschten sie mit gespannter Aufmerksamkeit meinen wunderbaren Erzählungen. Minna war es vorzugsweise, die das größte Verständnis für mich zeigte, und die bereitwillig und eifrig auf alle meine gewaltigen Zukunftspläne einging. So wuchs eine warme Zuneigung zwischen uns auf, und in kindlicher Einfalt gelobten wir uns bald ewige Liebe und Treue. Im Winter 1829/30 vereinte uns ein gemeinsamer Tanzunterricht abwechselnd in dem Hause meiner kleinen Braut, in unserer Pfarrwohnung oder in dem alten Spukschlosse, das damals von dem Gutspächter Heldt bewohnt wurde, und in dem wir mit lebhaftem Interesse Hennings blutiges Steinbildnis, die verhängnisvollen Fugen des schrecklichen Kamins, die geheimen Gänge in den Mauern und den Zugang zu dem unterirdischen Wege betrachteten. Fand die Tanzstunde in unserm Hause statt, so gingen wir wohl auf den Kirchhof vor unserer Tür, um zu sehen, ob noch immer Hennings Fuß nicht wieder aus der Erde wüchse, oder wir staunten mit ehrfürchtiger Bewunderung die alten Kirchenbücher an, die von der Hand Johann Christians und Gottfriederich Heinrichs von Schröder (Vater und Sohn) geschrieben worden waren, die vom Jahre 1709 –1799 als meines Vaters Amtsvorgänger gewirkt hatten; die ältesten Geburts-, Ehe- und Totenlisten hatten für uns einen ganz besonderen Reiz. Manchmal auch besuchten wir des jüngern Pastors von Schröder Tochter, die, damals vierundachtzig Jahr alt, dicht neben unserm Hause wohnte, um sie über die Vergangenheit des Dorfes zu befragen oder die Porträts ihrer Vorfahren zu betrachten, von denen dasjenige ihrer Mutter, der im Jahre 1795 verstorbenen Olgartha Christine von Schröder, uns vor allen anderen anzog; einmal, weil es uns als ein Meisterwerk der Kunst erschien, dann aber auch, weil es eine gewisse Ähnlichkeit mit Minna zeigte.
Nicht selten statteten wir dann auch dem Dorfschneider Wöllert, der einäugig war, nur ein Bein hatte und deshalb allgemein »Peter Hüppert« genannt wurde, einen Besuch ab. Er war ohne jegliche Bildung, hatte aber ein so wunderbares Gedächtnis, dass er, wenn er meinen Vater predigen gehört hatte, die ganze Rede Wort für Wort wiederholen konnte. Dieser Mann, der, wenn ihm der Weg zu Schul- und Universitätsbildung offengestanden hätte, ohne Zweifel ein bedeutender Gelehrter geworden wäre, war voll Witz und regte unsere Wissbegier im höchsten Maße durch seinen unerschöpflichen Vorrat von Anekdoten an, die er mit bewundernswertem oratorischen Geschick zu erzählen verstand. Ich gebe hier nur eine derselben wieder: so erzählte er uns, dass, da er immer gewünscht habe, zu erfahren, wohin die Störche im Winter zögen, er einmal noch bei Lebzeiten des Vorgängers meines Vaters, des Pastors von Rußdorf, einen der Störche, die auf unserer Scheune zu bauen pflegten, eingefangen und ihm ein Stück Pergament an den Fuß gebunden habe, auf welches der Küster Prange seinem Wunsche gemäß niedergeschrieben hatte, dass er, der Küster, und Wöllert, der Schneider des Dorfes Ankershagen in Mecklenburg-Schwerin, hierdurch den Eigentümer des Hauses, auf dem der Storch sein Nest im Winter habe, freundlich ersuchten, ihnen den Namen seines Landes mitzuteilen. Als er im nächsten Frühjahr den Storch wieder einfing, fand sich ein anderes Stück Pergament an dem Fuße des Vogels befestigt mit folgender in schlechten deutschen Versen abgefassten Antwort:
Schwerin Mecklenburg ist uns nicht bekannt, Das Land, wo sich der Storch befand, Nennt sich Sankt-Johannes-Land.
Natürlich glaubten wir dies alles, und würden gern Jahre unseres Lebens darum gegeben haben, nur um zu erfahren, wo das geheimnisvolle Sankt-Johannes-Land sich befände. Wenn diese und ähnliche Anekdoten unsere Kenntnis der Geographie auch nicht gerade bereichern konnten, so regten sie wenigstens den Wunsch in uns an, dieselbe zu lernen, und erhöhten noch unsere Leidenschaft für alles Geheimnisvolle.
Von dem Tanzunterricht hatten weder Minna noch ich den geringsten Nutzen, wir lernten beide nichts: sei es nun, dass uns die natürliche Anlage für diese Kunst fehlte, oder dass wir durch unsere wichtigen archäologischen Studien und unsere Zukunftspläne zu sehr in Anspruch genommen wurden.
Es stand zwischen uns schon fest, dass wir, sobald wir erwachsen wären, uns heiraten würden, und dass wir dann unverzüglich alle Geheimnisse von Ankershagen erforschen, die goldene Wiege, die silberne Schale, Hennings ungeheure Schätze und sein Grab, zuletzt aber die Stadt Troja ausgraben wollten; nichts Schöneres konnten wir uns vorstellen, als so unser ganzes Leben mit dem Suchen nach den Resten der Vergangenheit zuzubringen.
Gott sei es gedankt, dass mich der feste Glaube an das Vorhandensein jenes Troja in allen Wechselfällen meiner ereignisreichen Laufbahn nie verlassen hat! – aber erst im Herbste meines Lebens und dann auch ohne Minna – und weit, weit von ihr entfernt – sollte ich unsere Kinderträume von vor fünfzig Jahren ausführen dürfen.
Mein Vater konnte nicht griechisch, aber er war im Lateinischen gut bewandert und benutzte jeden freien Augenblick, auch mich darin zu unterrichten. Als ich kaum neun Jahre alt war, starb meine geliebte Mutter: es war dies ein unersetzlicher Verlust und wohl das größte Unglück, das mich und meine sechs Geschwister treffen konnte.
Meiner Mutter Tod fiel noch mit einem anderen schweren Missgeschick zusammen, infolgedessen alle unsere Bekannten uns plötzlich den Rücken wandten und den Verkehr mit uns aufgaben. Ich grämte mich nicht sehr um die übrigen: aber, dass ich die Familie Meincke nicht mehr sehen, dass ich mich ganz von Minna trennen, sie nie wiedersehen sollte – das war mir tausendmal schmerzlicher als meiner Mutter Tod, den ich dann auch bald in dem überwältigenden Kummer um Minnas Verlust vergaß. In Tränen gebadet stand ich täglich stundenlang allein vor dem Bilde Olgarthas von Schröder und gedachte voll Trauer der glücklichen Tage, die ich in Minnas Gesellschaft verlebt halte. Die ganze Zukunft erschien mir finster und trübe, alle geheimnisvollen Wunder von Ankershagen, ja Troja selbst hatte eine Zeit lang keinen Reiz mehr für mich. Mein Vater, dem meine tiefe Niedergeschlagenheit nicht entging, schickte mich nun auf zwei Jahre zu seinem Bruder, dem Prediger Friedrich Schliemann, der die Pfarre des Dorfes Kalkhorst in Mecklenburg innehatte. Hier wurde mir ein Jahr lang das Glück zuteil, den Kandidaten Carl Andres aus Neustrelitz zum Lehrer zu haben; unter der Leitung dieses vortrefflichen Philologen machte ich so bedeutende Fortschritte, dass ich schon zu Weihnachten 1832 meinem Vater einen, wenn auch nicht korrekten, lateinischen Aufsatz über die Hauptereignisse des Trojanischen Krieges und die Abenteuer des Odysseus und Agamemnon als Geschenk überreichen konnte. Im Alter von elf Jahren kam ich auf das Gymnasium von Neustrelitz, wo ich nach Tertia gesetzt wurde. Aber gerade zu jener Zeit traf unsere Familie ein sehr schweres Unglück, und da ich fürchtete, dass meines Vaters Mittel nicht ausreichen würden, um mich noch eine Reihe von Jahren auf dem Gymnasium und dann auf der Universität zu unterhalten, verließ ich ersteres nach drei Monaten schon wieder, um in die Realschule der Stadt überzugehen, wo ich sogleich in die zweite Klasse aufgenommen wurde. Zu Ostern 1835 in die erste Klasse versetzt, verließ ich im Frühjahr 1836 im Alter von vierzehn Jahren die Anstalt, um in dem Städtchen Fürstenberg in Mecklenburg-Strelitz als Lehrling in den kleinen Krämerladen von Ernst Ludwig Holtz einzutreten.
Einige Tage vor meiner Abreise von Neustrelitz, am Karfreitag 1836, traf ich in dem Hause des Hofmusikus C. E. Laue zufällig mit Minna Meincke zusammen, die ich seit mehr denn fünf Jahren nicht gesehen hatte. Nie werde ich dieses, das letzte Zusammentreffen, das uns überhaupt werden sollte, je vergessen! Sie war jetzt vierzehn Jahre alt und, seitdem ich sie zuletzt gesehen, sehr gewachsen. Sie war einfach schwarz gekleidet, und gerade diese Einfachheit ihrer Kleidung schien ihre bestrickende Schönheit noch zu erhöhen. Als wir einander in die Augen sahen, brachen wir beide in einen Strom von Tränen aus und fielen, keines Wortes mächtig, einander in die Arme. Mehrmals versuchten wir zu sprechen, aber unsere Aufregung war zu groß; wir konnten kein Wort hervorbringen. Bald jedoch traten Minnas Eltern in das Zimmer, und so mussten wir uns trennen – aber es währte eine geraume Zeit, ehe ich mich von meiner Aufregung wieder erholt hatte. Jetzt war ich sicher, dass Minna mich noch liebte, und dieser Gedanke feuerte meinen Ehrgeiz an: von jenem Augenblick an fühlte ich eine grenzenlose Energie und das feste Vertrauen in mir, dass ich durch unermüdlichen Eifer in der Welt vorwärtskommen und mich Minnas würdig zeigen werde. Das einzige, was ich damals von Gott erflehte, war, dass sie nicht heiraten möchte, bevor ich mir eine unabhängige Stellung errungen haben würde.