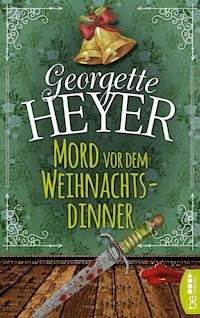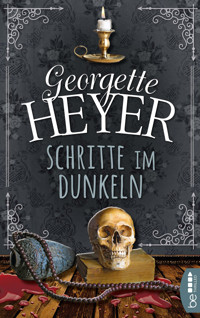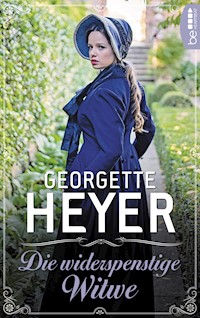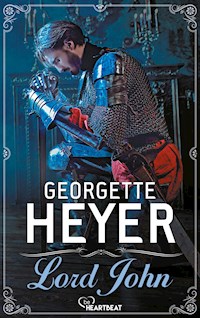6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
England, 1818: Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich Frederica aufopferungsvoll um ihre Geschwister, auch wenn ihr eigenes Glück darunter leidet. Schließlich ist sie bereits 24 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet! Stattdessen hat sie sich vorgenommen, für ihre bildhübsche Schwester Charis einen standesgemäßen Gatten zu finden.
Sie bittet den einflussreichen Marquis von Alverstoke um Hilfe. Aus einer Laune heraus beschließt er, die beiden Schwestern in die Gesellschaft einzuführen. Der zynische Lebemann ist fasziniert von Fredericas resoluter und charmanter Art - noch nie hat er eine Frau getroffen, die ihm ebenbürtig ist. Und bald schon verliert er selbst sein Herz ...
Georgette Heyers "Heiratsmarkt" (im Original: "Frederica") besticht durch liebevoll gezeichnete Charaktere und bietet einen amüsanten Einblick in die Heiratspolitik der Londoner Gesellschaft während der Epoche des englischen Regency.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
Über dieses Buch
England, 1818: Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich Frederica aufopferungsvoll um ihre Geschwister, auch wenn ihr eigenes Glück darunter leidet. Schließlich ist sie bereits 24 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet! Stattdessen hat sie sich vorgenommen, für ihre bildhübsche Schwester Charis einen standesgemäßen Gatten zu finden.
Sie bittet den einflussreichen Marquis von Alverstoke um Hilfe. Aus einer Laune heraus beschließt dieser, die beiden Schwestern in die Gesellschaft einzuführen. Der zynische Lebemann ist fasziniert von Fredericas resoluter und charmanter Art - noch nie hat er eine Frau getroffen, die ihm ebenbürtig ist. Und bald schon verliert er selbst sein Herz ...
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Heiratsmarkt
Aus dem Englischen von Emi Ehm
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1965
Die Originalausgabe FREDERICA erschien 1965 bei Bodley Head
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1966.
Textredaktion: Birthe Schreiber
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung einer Illustration © Richard Jenkins Photography, London
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3174-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. KAPITEL
Vor fünf Tagen hatte die verwitwete Lady Buxted ihren Bruder, den höchst ehrenwerten Marquis von Alverstoke, in einem Brief dringend gebeten, sie so bald wie nur irgend möglich zu besuchen. Nun konnte sie erleichtert aufatmen, denn ihre jüngste Tochter kündete soeben die Ankunft von Onkel Vernon an:
„Er trägt einen Mantel mit Dutzenden von Schultercapes, und er sieht überhaupt todschick aus. Außerdem fährt er ein smartes neues Karriol, Mama, und einfach alles an ihm ist wundervoll!“, erklärte Miss Kitty, die Nase platt an die Fensterscheibe gedrückt. „Er ist doch wirklich umwerfend, oder, Mama?“
Lady Buxted antwortete tadelnd, solche Worte schickten sich nicht für eine junge Dame von Stand, und beorderte ihre Tochter ins Schulzimmer.
Lady Buxted gehörte nicht zu den Verehrerinnen ihres Bruders, und die Nachricht, dass er seine zweirädrige Kutsche persönlich zum Grosvenor Place gelenkt hatte, trug nicht gerade dazu bei, ihn in ihrer Gunst steigen zu lassen.
Es war ein schöner Frühlingsmorgen, aber es wehte ein scharfer Wind, und kein Mensch, der den Marquis kannte, hätte angenommen, dass er seine Vollblüter länger als einige Minuten warten lassen würde. Das verhieß nichts Gutes für den Plan, den die Lady im Sinn hatte. Denn Alverstoke war zweifellos das egoistischste und ungefälligste Geschöpf unter Gottes Sonne.
Ihre Schwester, Lady Jevington, eine gebieterische Matrone jenseits der vierzig, teilte diese Einschätzung nur unter Vorbehalt. Auch sie hielt ihren einzigen Bruder für egoistisch und ungefällig, aber sie sah beim besten Willen keinen Grund, warum er für Louisa mehr tun sollte als für sie selbst. Was Louisas zwei Söhne und drei Töchter betraf, so konnte Lady Jevington ihrem Bruder keinen Vorwurf daraus machen, dass er sich für keinen der Sprösslinge interessierte. Es war wirklich unmöglich, sich für derart gewöhnliche Kinder zu interessieren. Dass er ihre eigenen Nachkommen jedoch genauso wenig beachtete, deutete in der Tat auf eine egoistische Veranlagung hin.
Jeder Mensch hätte angenommen, dass ein reicher Junggeselle ersten Standes nur zu froh gewesen wäre, einen so vielversprechenden Neffen, wie es ihr geliebter Gregory war, in den erlesenen Kreis aufzunehmen, dem Alverstoke angehörte. Er hätte sich ebenfalls bemüht, die liebe Anna in die vornehme Welt einzuführen.
Dass Anna ohne die geringste Hilfe seinerseits dennoch standesgemäß verlobt worden war, milderte ihre Entrüstung keineswegs. Allerdings musste sie zugeben, ihr altmodischer Ehemann erinnere sie zu Recht daran, dass sie die leichtfertige Gesellschaft missbilligte, zu der Alverstoke gehörte. Sie hatte auch häufig der Hoffnung Ausdruck verliehen, Gregory würde dort niemals hineingeraten. Dennoch konnte sie es Alverstoke noch immer nicht verzeihen, dass er es nicht einmal versucht hatte, Gregory dort einzuführen. Sie sagte, es hätte sie keinen Deut gekümmert, wenn sie nicht mit gutem Grund annehmen müsste, dass Alverstoke seinen jungen Vetter und Erben Endymion nicht nur als Kornett in die Life Guards eingekauft hatte, sondern ihm außerdem noch eine schöne Apanage zukommen ließ.
Worauf Lord Jevington antwortete, er sei durchaus imstande, für seinen Sohn selbst zu sorgen, der ohnehin keinen wie immer gearteten Anspruch an seinen Onkel hatte. Er persönlich könne es Alverstoke nur hoch anrechnen, dass er so vernünftig war und sich davor zurückhielt, den Eltern des ehrenwerten Gregory Sandridge finanzielle Hilfe anzubieten. Diese würden das nur als Kränkung empfinden.
Das stimmte durchaus; trotzdem war Lady Jevington der Meinung, wenn Alverstoke auch nur ein Körnchen Anstandsgefühl besäße, dann hätte er für seine Gunst nicht einen bloßen Vetter statt seines ältesten Neffen ausgewählt. Ihrer Meinung nach wäre in einer besser organisierten Gesellschaft sein Erbe ohnehin der Sohn der ältesten Schwester, nicht aber ein entfernt verwandter Vetter.
Lady Buxted freilich hätte Gregory nicht gern in so unfairer Weise erhoben gesehen, stimmte jedoch im Allgemeinen ihrer Schwester zu. Beide Damen waren sich einig in ihrer Verachtung des Mr. Endymion Dauntry, den sie zu einem ausgemachten Klotz stempelten. Ob aber ihre Feindseligkeit diesem untadeligen jungen Mann gegenüber ihrer Abneigung gegen seine verwitwete Mama entsprang oder aber seinem schönen Gesicht und der prachtvollen Figur galt –, war eine Frage, die lieber niemand stellte, denn beides stellte sowohl Gregory Sandridge wie auch den jungen Lord Buxted in den Schatten.
Jedenfalls waren Alverstokes beide älteren Schwestern aus welchem Grund auch immer überzeugt, man hätte keinen unwürdigeren Erben für die Würden des Marquis finden können als Endymion. Beide hatten keine Mühe gescheut, die Aufmerksamkeit ihres Bruders auf sämtliche hübschen und standesgemäßen jungen Damen zu lenken, die Jahr um Jahr auf die elegante Welt losgelassen wurden.
Alverstokes Gewohnheitssünde war es jedoch, sich äußerst schnell zu langweilen. Dieses Laster hatte selbst seine Schwestern besiegt. Keine der beiden konnte annehmen, wenn sie die zahlreichen strahlenden Schönheiten, die unter seinem Schutz gelebt hatten, Revue passieren ließ, dass er weiblichen Reizen gegenüber unempfänglich war. Keine von beiden war jedoch auch so dumm, allzu optimistisch zu werden, wenn er ausnahmsweise einmal eine Neigung zu irgendeiner Perle an Geburt, Schönheit und Reichtum zu entwickeln schien, die ihm die eine oder andere seiner Schwestern unter die Nase schob. Er war durchaus imstande, die betreffende Dame einige Wochen lang zum Gegenstand seiner Galanterie zu machen, dann aber plötzlich abzuspringen und zu vergessen, dass es sie überhaupt gab.
Als es seinen Schwestern dämmerte, dass vorsichtige Eltern ihn scheel ansahen und man ihn allgemein für gefährlich hielt, gaben sie ihre Versuche auf, ihm eine Frau zu verschaffen. Sie widmeten ihre Energien stattdessen der leichteren Aufgabe, seine Trägheit zu beklagen, seinen Egoismus zu verdammen und ihn wegen seiner moralischen Verirrungen, soweit sie ihnen zu Ohren kamen, zu schelten.
Nur seine jüngste Schwester hielt sich davor zurück. Die hatte verschiedene schmeichelhafte Heiratsanträge abgelehnt, nach eigenem Belieben einen bloßen Landedelmann geheiratet hatte und kam nur noch selten in die Metropole. Darum wurde sie von ihren beiden älteren Schwestern für eine quantité négligeable gehalten. Wenn sie von ihr sprachen – was selten vorkam –, dann nur von der armen Eliza. Obwohl sie wussten, dass Alverstoke Eliza lieber hatte als sie, kam es ihnen nicht in den Sinn, sie um ihre Hilfe bei den Heiratsplänen für den Bruder zu ersuchen. Wäre es ihnen aber doch eingefallen, dann hätten sie den Gedanken in dem wohlbegründeten Glauben abgetan, dass ihn schon lange kein Mensch mehr auch nur im Geringsten beeinflusst hatte.
Diesmal jedoch hatte Lady Buxted ihn nicht zu sich befohlen, um ihm eine Strafpredigt zu halten. Ja, sie hatte beschlossen, überhaupt nichts zu sagen, was ihn hätte verstimmen können. Aber während sie im Salon auf ihn wartete, folgte der Hoffnung, die ungeachtet ihrer Erfahrung in ihrer Brust aufgekeimt war, als sie von seiner Ankunft hörte, sofort eine andere Überlegung. Es sah ihm wieder einmal ähnlich, fünf Tage verstreichen zu lassen, bevor er sich die Mühe machte, einer Aufforderung zu folgen. Es hätte ja immerhin höchst dringlich sein können. Nur mit Mühe zwang sie ihr Gesicht zum Ausdruck liebevoller Begrüßung. Noch schwerer fiel es ihr, Herzlichkeit in die Stimme einfließen zu lassen, als er unangemeldet ins Zimmer hereinschlenderte.
Auch das sah ihm ähnlich, dieses nachlässige Benehmen, das Ihre Gnaden, pedantisch auf gute Formen bedacht, sehr bedauerte. Sie sah nicht ein, wieso er sich in ihrem Haus benahm, als gehörte es ihm.
Sie unterdrückte ihren Ärger, streckte ihm die Hand entgegen und sagte: „Vernon! Mein Lieber, was für eine reizende Überraschung!“
„Was ist daran überraschend?“, fragte er und zog die schwarzen Brauen hoch. „Hast du mich denn nicht gebeten zu kommen?“
Zwar blieb das Lächeln auf den Lippen Lady Buxteds festgefroren, aber sie antwortete ziemlich scharf: „Sicher, aber schon vor so vielen Tagen, dass ich angenommen habe, du seist nicht in London!“
„Oh doch!“, sagte er und erwiderte ihr Lächeln mit äußerster Süße.
Lady Buxted ließ sich dadurch nicht täuschen, hielt es aber für klug, die absichtliche Provokation zu ignorieren, die sie sehr gut erkannte. Sie klopfte mit der flachen Hand neben sich auf das Sofa und lud ihren Bruder damit ein, sich neben sie zu setzen.
Er jedoch ging zum Kamin, beugte sich vor, um sich die Hände zu wärmen, und sagte: „Ich kann mich nicht lange aufhalten, Louisa. Was willst du von mir?“
Da sie sich entschlossen hatte, auf ihre Bitte taktvoll, Schritt für Schritt loszusteuern, machte sie diese direkte Frage wütend und brachte sie aus dem Konzept. Sie zögerte. Mit einem Glitzern in seinen harten grauen Augen schaute er auf und sagte: „Also?!“
Sie war glücklicherweise nicht gezwungen, ihm sofort zu antworten, denn eben kam ihr Butler mit Erfrischungen herein, die seiner Meinung nach jetzt passend waren. Er stellte das schwere Tablett auf einem Seitentisch ab und informierte den Marquis im vertraulichen Ton , er habe sich erlaubt, sowohl den Mountain wie den Sherry hereinzubringen. Währenddessen hatte Lady Buxted Zeit, sich zu sammeln.
Etwas grollend vermerkte sie, dass es ihrem Bruder beliebte, sie in Reithose und Stiefeln zu besuchen – einem Anzug, der bedauerlicherweise genauso formlos war wie sein Eintritt in den Salon. Dass seine Stiefel glänzend poliert waren, sein Halstuch äußerst sorgfältig gelegt war und der Schnitt seiner wie angegossen sitzenden Jacke offenkundig aus Meisterhand stammte, erhöhte nur ihren Verdruss.
Wäre ihm wie alles Übrige auch seine Erscheinung gleichgültig gewesen, dann hätte sie ihm verzeihen können, dass er es nicht für nötig hielt, ihr zu Ehren den für Morgenbesuche vorgeschriebenen Anzug zu tragen. Aber ein Mensch, der immer so elegant aussah wie er und dessen Stil von so vielen modebewussten Herren kopiert wurde, konnte modische Vorschriften unmöglich übergehen. Ja, sie hatte ihn einmal in einem Anfall von Erbitterung gefragt, ob ihm überhaupt an irgendetwas außer seiner Kleidung läge. Er hatte sich die Frage lange überlegt. Dann erwiderte er, dass seine Kleidung zwar an erster Stelle stehe, ihm aber auch viel an seinen Pferden läge.
Er war zu dem Tischchen hinübergegangen. Als sich der Butler zurückgezogen hatte, wandte er sich um und fragte: „Sherry, Louisa?“
„Mein lieber Vernon, jetzt könntest du wirklich schon wissen, dass ich Sherry nie anrühre!“
„Wirklich? Aber ich habe ja ein so entsetzlich schlechtes Gedächtnis!“
„Nicht, wenn du dich an etwas erinnern willst!“
„Nein – dann nicht!“, stimmte er ihr zu. Er sah zu ihr hinüber, und beim Anblick ihrer zusammengepressten Lippen und der Zornesröte lachte er plötzlich auf. „Was für ein Dummkopf du doch bist, teure Schwester! Ich habe noch nie einen Fisch geangelt, der bereitwilliger angebissen hätte als du! Was also darf es sein? Malaga?“
„Ich nehme ein halbes Glas Ratafia, wenn du ihn mir netterweise einschenken wolltest“, antwortete sie steif.
„Das geht mir zwar sehr gegen den Strich, aber ich werde nett sein. Was für ein scheußliches Getränk zu dieser Stunde! Das heißt, eigentlich immer“, fügte er nachdenklich hinzu. Er reichte ihr das Glas. Sein Gang war gemächlich, doch elastisch wie der des geborenen Sportlers.
„Also, worum geht es diesmal? Schleich nicht um den heißen Brei herum! Ich will nicht, dass sich meine Pferde erkälten.“
„So setz dich doch endlich“, sagte sie zornig.
„Schön, aber um Himmels willen, fasse dich kurz!“, antwortete er und wählte den Lehnstuhl an der anderen Seite des Kamins.
„Es hat sich zufällig ergeben, dass ich deine Hilfe benötige, Alverstoke“, sagte sie.
„Das, liebe Louisa, habe ich befürchtet, als ich deinen Brief las“, erwiderte er mit vorgetäuschter Liebenswürdigkeit.
„Natürlich hätte es auch sein können, dass du mich herbeorderst, um mir eine deiner Standpauken zu verpassen. Aber du hast deine Botschaft derart liebevoll abgefasst, dass ich diesen Verdacht fast sofort verbannte und mir daher nur die andere Version blieb: Du willst, dass ich etwas für dich tue.“
„Wenn ich recht verstehe, dann sollte ich froh sein, dass du dich an meine schriftliche Einladung zu einem Besuch überhaupt erinnerst!“, sagte sie und starrte ihn zornig an.
„Du kannst dir nicht vorstellen, Louisa, wie sehr es mich reizt, deine Dankbarkeit mit einem breiten Grinsen entgegenzunehmen!“, sagte er. „Aber man soll mir nicht nachsagen können, dass ich mich mit fremden Federn schmücke: Trevor hat mich hergejagt.“
„Soll das heißen, dass Mr. Trevor meinen Brief gelesen hat?“, fragte Lady Buxted empört. „Dein Sekretär?“
„Ich habe ihn ja dazu angestellt, meine Briefe zu lesen“, erklärte Seine Gnaden.
„Doch nicht diejenigen, die dir deine Nächsten und Liebsten schreiben!“
„Oh nein – die natürlich nicht!“, sagte er zustimmend.
Ihr Busen wogte. „Du bist der abscheu...“
Sie biss sich auf die Lippen und rang sichtlich um Fassung. Es gelang ihr mit heldenhafter Anstrengung, das Lächeln zurückzuzwingen und halbwegs amüsiert zu sagen: „Du Elender! Ich lasse mich einfach nicht von dir in Wut bringen! Ich möchte mich mit dir über Jane unterhalten.“
„Wer, zum Teufel, ist – oh ja, jetzt hab ich’s! Eine deiner Töchter!“
„Meine älteste und, wenn ich dich erinnern darf, deine Nichte, Alverstoke!“
„Das ist ungerecht, Louisa, daran brauche ich nicht erst erinnert zu werden!“
„Ich lasse das liebe Kind in dieser Saison debütieren“, verkündete sie, den Einwurf übergehend. „Ich werde sie natürlich auf einem der Empfänge bei Hof vorstellen – falls die Königin noch welche abhält. Aber es heißt, ihre Gesundheit sei jetzt so schlecht ...“
„Da wirst du etwas gegen ihre Sommersprossen tun müssen – wenn es diejenige ist, die ich für Jane halte“, unterbrach er sie. „Hast du es schon mit Zitronenwasser versucht?“
„Ich habe dich nicht hergebeten, um Janes Äußeres zu erörtern!“, fuhr sie ihn an.
„Nun, warum hast du mich denn hergebeten?“
„Um dich zu bitten, ihr zu Ehren einen Ball zu geben – im Alverstoke-Palais!“, enthüllte sie ihm und nahm die Hürde mit einem Satz.
„Was soll ich?!“
„Ich weiß sehr gut, was du sagen willst, aber überlege doch nur, Vernon! Sie ist nun einmal deine Nichte, und was wäre für ihren Einführungsball geeigneter als das Alverstoke-Palais?“
„Dieses Haus hier!“, erwiderte er prompt.
„Oh, sei nicht so unliebenswürdig! In diesem Raum könnten bestimmt nicht mehr als dreißig Paare tanzen. Stell dir bloß das ganze Getue und die Schererei vor!“
„Die stelle ich mir ja eben vor“, sagte Seine Gnaden.
„Aber das ist doch nicht zu vergleichen! Ich meine doch hier, wo ich sämtliche Möbel aus meinem Salon fortschaffen müsste. Ganz abgesehen davon, dass der Speisesaal für das Souper und das Wohnzimmer als Damengarderobe benützt werden müssten ... hingegen das Alverstoke-Palais, in dem ein so prachtvoller Ballsaal ist! Überdies, es ist auch mein Elternhaus!“
„Es ist aber auch mein Heim“, sagte der Marquis. „Mein Gedächtnis lässt mich zwar gelegentlich im Stich, aber ich kann mich noch sehr lebhaft an das erinnern, was du so treffend als Getue und Schererei bezeichnest. Damit waren die Bälle verbunden, die dort für Augusta, dich und Eliza gegeben wurden. Und daher, teure Schwester, lautet meine Antwort: Nein!“
„Hast du eigentlich gar kein Gefühl?“, fragte sie in einem tragischen Ton.
Er hatte eine emaillierte Schnupftabakdose aus der Tasche gezogen und studierte nun kritisch die Malerei auf dem Deckel.
„Nein, überhaupt keines. Ich frage mich, ob ich einen Fehler gemacht habe, als ich das hier kaufte? Damals gefiel es mir, aber jetzt finde ich es doch eine Spur zu kitschig.“ Er seufzte und öffnete die Dose mit geübtem Daumendruck. „Und ganz bestimmt mag ich diese Mischung nicht“, sagte er, schnupfte eine winzige Prise und wischte sich die Finger mit einem Ausdruck des Abscheus ab.
„Du wirst natürlich sagen, ich hätte auch klüger sein sollen, als mir von Mendlesham seine Sorte aufdrängen zu lassen. Da hast du völlig recht, man sollte sie sich immer selbst mischen.“
Er stand auf. „Also, wenn das alles ist, dann will ich mich von dir verabschieden.“
„Es ist nicht alles!“, stieß sie hervor und war sehr rot geworden. „Ich wusste natürlich, wie es ausgehen würde – oh, ich hab es ja gewusst!“
„Das stelle ich mir auch vor. Aber warum, zum Teufel, hast du dann meine Zeit verschwendet ...“
„Weil ich gehofft habe, dass du wenigstens einmal im Leben etwas – wenigstens etwas Gefühl zeigen würdest! Ein bisschen Fingerspitzengefühl für das, was du deiner Familie schuldig bist. Ja, wenigstens eine Spur Zuneigung zu der armen Jane!“
„Vergebliche Liebesmüh, Louisa! Mein Mangel an Gefühl bringt dich doch schon seit Jahren zur Verzweiflung. Ich hege nicht die geringste Zuneigung zu deiner armen Jane, die ich nur äußerst schwer erkennen würde, sollte ich sie unversehens treffen. Und dass die Buxteds zu meiner Familie gehören, ist mir neu.“
„Gehöre ich denn nicht zu deiner Familie?“, fragte sie. „Vergisst du, dass ich deine Schwester bin?“
„Nein. Es ist mir nie vergönnt gewesen, das vergessen zu dürfen. Oh, reg dich nur nicht schon wieder auf – du hast keine Ahnung, wie hässlich du aussiehst, wenn du in eine deiner Aufregungen gerätst! Tröste dich mit meiner Versicherung: Hätte Buxted dich auf dem Trockenen gelassen, hätte ich mich verpflichtet gefühlt, dich mit durchzuschleppen.“
Er schaute spöttisch auf sie herunter. „Ja, ich weiß, du möchtest mir auf der Stelle erzählen, dass du keinen roten Heller besitzt. Die schnöde Wahrheit jedoch ist, dass du recht gut dastehst, meine liebe Louisa, aber der hemmungsloseste Geizhals bist, den ich kenne. Und erdreiste dich nicht, von Zuneigung zu reden. Du hast für mich nicht mehr übrig als ich für dich.“
Durch diesen Frontalangriff völlig aus der Fassung gebracht, stammelte sie: „Wie kannst du nur so etwas sagen? Wo ich dir doch wirklich aufrichtig zugetan bin!“
„Da täuschst du dich selbst, Schwester: nicht mir, sondern meiner Börse!“
„Oh, wie kannst du nur so ungerecht sein? Und was meine guten Verhältnisse betrifft, kann ich behaupten, dass du, mit deiner rücksichtslosen Verschwendungssucht, erstaunt wärst zu hören, dass ich gezwungen bin, strikteste Sparsamkeit walten zu lassen! Was glaubst du wohl, warum ich nach dem Tod Buxteds aus unserem wunderschönen Haus in der Albemarle Street ausgezogen bin und jetzt in diesem abseits gelegenen Haus lebe?“
Er lächelte. „Da nicht der geringste Grund für diesen Umzug bestand, kann ich nur annehmen, dass deine unheilbare Liebe zum Knausern dich dazu bewog.“
„Wenn du damit meinst, dass ich gezwungen war, meine Ausgaben einzuschränken ...“
„Nein, sondern dass du der Versuchung einfach nicht widerstehen konntest, es zu tun.“
„Mit fünf Kindern, die auf mich angewiesen sind ...“ Sie brach ab, von dem spöttischen Ausdruck seiner Augen gewarnt, dass es unklug wäre, sich über dieses Thema weiter auszulassen.
„Eben!“, sagte er mitfühlend. „Wir werden uns jetzt lieber trennen, nicht?“
„Manchmal glaube ich“, sagte Lady Buxted mit unterdrückter Heftigkeit, „du bist das hassenswerteste, unnatürlichste Geschöpf, das je gelebt hat! Hätte Endymion sich an dich gewandt, dann wärst du zweifellos die Gefälligkeit in Person gewesen!“
Diese bitteren Worte schienen den Marquis sehr zu treffen. Nach einem verblüfften Augenblick riss er sich aber zusammen und empfahl seiner Schwester mit schwankender, doch besänftigender Stimme, sich mit einem Beruhigungsmittel zu Bett zu begeben.
„Denn du bist völlig aufgelöst, glaube mir! Lass dir versichern: Falls mich Endymion je bitten sollte, ihm zu Ehren einen Ball zu geben, dann werde ich Schritte unternehmen, um ihn zu entmündigen !“
„Oh, wie grässlich du bist!“, rief sie aus. „Du weißt sehr gut, dass ich nicht gemeint – was ich gemeint habe, war ... dass ...“
„Nein, nein, erkläre es mir nicht!“, unterbrach er sie. „Das ist wirklich ganz unnötig! Ich verstehe dich ganz genau – ja, und das schon seit Jahren! Du, und vermutlich auch Augusta, habt euch eingeredet, dass ich eine besondere Vorliebe für Endymion hege ...“
„Dieses, dieses Mondkalb!“
„Du bist zu streng. Er ist bloß schwer von Begriff!“
„Ja, wir wissen alle, dass du ihn für einen Musterknaben an Vollkommenheit hältst!“, sagte sie böse und zerknäulte ihr Taschentuch in den Händen.
Alverstoke hatte träge sein Monokel am Ende des langen Bandes hin- und hergeschaukelt, aber nach diesem Einwurf hob er es ihn zum Auge hoch, damit er das flammend rote Gesicht seiner Schwester betrachten konnte.
„Welch seltsame Deutung meiner Worte!“, bemerkte er.
„Erzähle mir doch nichts!“, erwiderte Lady Buxted, jetzt in voller Fahrt. „Was dein kostbarer Endymion auch immer will, er bekommt es um nichts und wieder nichts! Deine Schwestern hingegen ...“
„Ich unterbreche dich zwar ungern, Louisa“, murmelte Seine Gnaden nicht ganz aufrichtig, „aber das halte ich für äußerst zweifelhaft. Ich bin nämlich durchaus nicht wohlwollend.“
„Und gibst du ihm vielleicht keine Apanage, wie? Oh nein, wirklich!“
„Also das ist es, was dich so in Rage bringt, ja? Was für ein wirres Geschöpf du doch bist! In dem einen Augenblick wirfst du mir vor, dass ich meiner Familie gegenüber schäbig bin, und im nächsten fährst du auf mich los, weil ich meine Verpflichtung meinem Erben gegenüber einhalte!“
„Diesem Klotz!“, stieß sie hervor. „Wenn der Chef der Familie werden sollte – das ertrage ich einfach nicht!“
„Na, rege dich doch darüber nicht jetzt schon auf!“, empfahl er ihr. „Sehr wahrscheinlich wirst du es gar nicht ertragen müssen, denn wie die Chancen stehen, stirbst du früher als ich. Wie du weißt, bist du mir fünf Jahre voraus.“
Lady Buxted, unfähig, angemessene Worte zu finden, flüchtete sich in einen Tränenausbruch. Zwischen ihrem Schluchzen stieß sie Vorwürfe gegen ihren Bruder wegen seiner Unfreundlichkeit aus. Aber wenn sie gemeint hatte, sein Herz durch diese Taktik zu erweichen, irrte sie gewaltig. Unter allem, was ihn anödete, standen weibliche Tränen und Vorwürfe an erster Stelle.
Mit einer nicht gerade überzeugend klingenden Besorgnis sagte er, wenn er vermutet hätte, dass sie sich unpässlich fühle, dann würde er ihr seine Gegenwart nicht aufgedrängt haben. Damit verabschiedete er sich. Auf seinem Weg begleitete ihn die inbrünstig geäußerte Hoffnung seiner Schwester, sie wolle es zumindest noch erleben, dass er das bekomme, was er verdiene.
Sowie sich die Tür hinter dem Marquis geschlossen hatte, hörte sie auf zu weinen. Sie hätte ihren Gleichmut einigermaßen wiedergefunden, doch beliebte es ihrem älteren Sohn, kurz darauf hereinzukommen. Er fragte sie mit einem bedauerlichen Mangel an Takt, ob sein Onkel sie besucht habe und, wenn ja, was er auf ihren Vorschlag erwidert hatte. Als er erfuhr, dass Alverstoke genauso ungefällig war, wie sie es immer schon vorausgesehen hatte, setzte er eine ernste Miene auf. Er bemerkte jedoch, er könne es nicht bedauern, denn nachdem er sich die Sache sorgfältig überlegt habe, könne ihm der Plan nicht gefallen.
Lady Buxted war von Natur aus kein liebendes Gemüt. Sie war genauso egoistisch wie ihr Bruder, jedoch bei Weitem nicht so ehrlich. Sie gestand sich ihre eigenen Fehler nicht ein, ja erkannte gar nicht, dass sie welche besaß.
Sie hatte sich seit Langem eingeredet, dass ihr Leben ein einziges Opfer für ihre vaterlosen Kinder sei. Durch ein einfaches Mittel gelang es ihr, in den Augen der unkritischen Mehrzahl als aufopfernde Mutter dazustehen. Sie versah die Namen ihrer beiden Söhne und drei Töchter mit liebevoll schmückenden Beiwörtern und sprach liebevoll von ihnen - freilich nicht unbedingt zu ihnen. Aller Welt tat sie kund, sie kenne keinen Gedanken, kein Streben, das sich nicht um ihre Sprösslinge drehe.
Von ihren Kindern war Carlton, den sie etwas zu häufig als ihren Erstgeborenen bezeichnete, ihr Liebling. Er hatte ihr noch nie Ursache zur geringsten Besorgnis gegeben. Aus einem stumpfsinnigen kleinen Jungen, der seine Mama so hinnahm, wie sie sich selbst einschätzte, war ein würdiger junger Mann geworden, der ein tiefes Gefühl für Verantwortung und einen ernsten Charakter besaß. Der ersparte ihm nicht nur die Pannen, in die sein lebhafterer Vetter Gregory geriet. Er machte es ihm auch unmöglich zu verstehen, was Gregory oder sonst einer seiner Altersgenossen für ein Vergnügen an Streichen und Herumtreiberei fanden.
Carltons Verstand war mäßig, sein Denkprozess langsam und umständlich, aber eingebildet war er nicht. Sein einziger Stolz war, so vernünftig zu sein. Auch fühlte er keine Eifersucht auf seinen jüngeren Bruder George, obwohl er klar erkannte, dass dieser weitaus mehr Intelligenz besaß. Ja, er war sogar stolz auf George und hielt ihn für einen sehr scharfsinnigen Jungen. Seine Studien hatten ihm wohl gezeigt, dass ein so schwungvolles Temperament, wie es George besaß, diesen vielversprechenden Jungen durchaus vom Pfad der Tugend abbringen konnte. Er enthüllte seiner Mutter aber weder diese Befürchtung noch teilte er ihr seine Absicht mit, ein wachsames Auge auf George zu haben, wenn dessen Schulzeit zu Ende ging. Er vertraute sich ihr nicht an und setzte sich auch nicht mit ihr auseinander. Selbst zu seiner Schwester Jane hatte er noch nie ein kritisches Wort über seine Mutter geäußert.
Er war vierundzwanzig Jahre alt. Da er bisher aber noch nie die leiseste Absicht gezeigt hatte, sich durchzusetzen, war es für seine Mutter eine unangenehme Überraschung, als er jetzt seine Meinung äußerte. Er sagte, er sehe keinen Grund, warum Janes Debütantenball im Hause seines Onkels und auf dessen Kosten abgehalten werden sollte. Mit einem Schlag schwand ihre Zuneigung zu ihm. Da ihr Zorn ohnehin schon geweckt war, hätten sie einander bald in den Haaren gelegen, hätte er sich nicht klugerweise aus dem Gefecht zurückgezogen.
Es bereitete ihm Kummer, als er kurz darauf entdeckte, dass Jane die Gefühle ihrer Mutter in dieser Sache teilte. Sie versicherte, es sei abscheulich von Onkel Vernon, dass er sich so ungefällig und knauserig zeigte, aus Geiz keine paar hundert Pfund auszugeben.
„Ich bin überzeugt, Jane“, sagte Buxted ernst, „dass du viel zu viel Geschmack hast, um meinem Onkel so tief verpflichtet sein zu wollen.“
„Ach, papperlapapp!“, rief sie zornig aus. „Bitte sehr, warum sollte ich ihm nicht verpflichtet sein? Schließlich ist es doch wirklich nichts als seine Pflicht!“
Seine Oberlippe schien noch länger zu werden, wie immer, wenn ihm etwas missfiel. Er sagte mit Einhalt gebietender Stimme: „Ich kann deine Enttäuschung verstehen. Ich möchte aber glauben, dass du eine Gesellschaft hier, in deinem eigenen Heim, viel unterhaltsamer finden wirst als eine riesige Veranstaltung im Alverstoke-Palais. Dort würdest du bestimmt mehr als die Hälfte der Gäste gar nicht kennen.“
Seine zweite Schwester, Maria, die an ihr eigenes Debüt dachte, war ebenso empört wie Jane und konnte sich nicht zurückhalten. Sie wartete kaum ab, bis er seine gemessene Rede beendet hatte, und fragte ihn auch schon, warum er denn einen solchen Unsinn zusammenrede. „Unterhaltsamer, hier einen knickrigen, lächerlichen Ball mit nur fünfzig Gästen abzuhalten, statt ihr Gesellschaftsdebüt im Alverstoke-Palais zu feiern? Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf“, sagte sie Seiner Gnaden. „Es wird das Allerschäbigste daraus, denn du weißt ja, wie Mama ist! Wenn aber mein Onkel einen Ball gäbe, denk bloß, wie prunkvoll das wäre! Einfach Hunderte von Gästen und alle miteinander allerersten Standes! Austern und Geleespeisen und Chantillies und Cremes ...“
„Auch zum Ball eingeladen?“, warf Carlton mit plumpem Humor ein.
„Und Champagner!“, stimmte Jane ein, ihn überhaupt nicht beachtend. „Und ich hätte oben an der großen Treppe gestanden, mit Mama und dem Onkel, in einem weißen, mit Rosenknospen aufgeputzten Satinkleid und rosa Gaze und einem Kranz!“
Diese wunderbare Vision ließ ihr die Tränen in die Augen steigen, erweckte jedoch weder bei Maria noch bei Carlton Begeisterung. Maria wandte ein, dass sie mit ihren Sommersprossen und ihrem sandfarbenen Haar recht komisch aussehen würde; und Carlton sagte, er staune, dass seine Schwestern so viel von weltlichem Tand hielten. Keine würdigte das einer Antwort. Als er aber noch hinzufügte, er seinerseits sei froh, dass sich Alverstoke geweigert hatte, den Ball zu geben, waren sie genauso erzürnt wie Mama, nur viel stimmgewaltiger. Also ging er und ließ seine Schwestern, die seine Langweiligkeit bedauerten, über Rosenknospen und rosa Gazeschleier streiten. Nur in dem einen Punkt waren sie einer Meinung: Ihr Onkel benahm sich zwar abscheulich, doch sicherlich sei es Mamas Schuld gewesen, weil sie ihn aufgebracht hatte. Daran zweifelte keine der beiden jungen Damen auch nur einen Augenblick lang.
2. KAPITEL
Als der Marquis wenig später sein Haus betrat, fiel sein Blick als Erstes auf einen Brief, der auf einem der beiden Konsolentischchen aus Ebenholz und Goldbronze lag. Die Anschrift war in großen, schwungvollen Buchstaben geschrieben, und die blassblaue Oblate, die das Schreiben versiegelte, war nicht aufgebrochen. Mr. Charles Trevor, der vortreffliche Sekretär des Marquis, hatte auf einen Blick erkannt, dass es von einer der zarten Schönheiten stammte, die zeitweise die sprunghafte Aufmerksamkeit Seiner Gnaden fesselten. Alverstoke übergab Hut, Handschuhe und den verschwenderisch mit Schultercapes versehenen Kutschiermantel, der Miss Kitty Buxteds Bewunderung erregt hatte, den Händen des wartenden Lakaien. Dann nahm er den Brief an sich und schlenderte damit in die Bibliothek. Als er die Oblate brach und das kreuz und quer beschriebene Blatt entfaltete, stieg Ambraduft in seine empfindliche Nase. Sein Gesicht nahm einen Ausdruck des Widerwillens an, er hielt den Brief auf Armeslänge von sich weg und tastete nach seinem Monokel. Flüchtig überflog er das Schreiben und warf es dann ins Feuer. Fanny, entschied er, wurde allmählich unerträglich langweilig. Eine blendende Erscheinung, aber wie so viele erstklassige Kurtisanen bekam sie nie genug. Jetzt wollte sie ein Paar cremefarbener Pferde für ihren Landauer – vergangene Woche war es ein Diamantkollier gewesen. Das hatte er ihr geschenkt, und es würde als Abschiedsgeschenk dienen.
Der widerliche Duft, mit dem sie ihren Brief besprengt hatte, schien an seinen Fingern zu haften. Er wischte sie eben sorgfältig ab, als Charles Trevor hereinkam. Der Lord blickte auf, und als er den fragenden Blick seines Sekretärs sah, erklärte er ihm sehr freundlich, dass er Ambra nicht ausstehen konnte.
Mr. Trevor erwiderte zwar nichts, aber die Bedrückung war ihm so deutlich anzusehen, dass Alverstoke sagte: „Stimmt! Ich weiß, was Sie denken, Charles, und Sie haben völlig recht – es ist Zeit, dass ich der schönen Fanny den Laufpass gebe.“ Er seufzte. „Ein nettes Stückchen Wild, aber ebenso dumm wie habsüchtig.“
Wieder sagte Mr. Trevor nichts. Es wäre ihm sehr schwergefallen, sich äußern zu müssen, denn er war sich über das delikate Thema nicht im Klaren. Als Moralist konnte er die Lebensweise seines Arbeitgebers nur beklagen und als Mensch mit tief verwurzelten ritterlichen Idealen tat ihm die schöne Fanny leid. Aber als Mann, der genau wusste, wie großzügig Seine Lordschaft der Dame gegenüber gewesen war, musste er zugeben, dass sie keinen Grund zur Klage hatte.
Charles Trevor war der Sohn einer großen Familie. Er verdankte seine gegenwärtige Stellung dem Umstand, dass sein Vater kurz nach der Weihe den Posten eines Lehrers und Erziehers bei dem Vater des gegenwärtigen Marquis erhalten und ihn auf einer ausgedehnten Kavalierstour begleitet hatte. Ein behaglicher Lebensunterhalt war nicht sein einziger Lohn. Sein adeliger Schüler blieb ihm aufrichtig zugetan und wurde Pate seines ältesten Sohnes. Er erzog dann seinen eigenen Sohn in der vagen Überzeugung, Seine Hochwürden, Laurence Trevor, besitze einen Anspruch auf dessen Gönnerschaft.
Als daher Seine Hochwürden Laurence dem gegenwärtigen Marquis Charles als einen passenden Anwärter auf den Posten eines Sekretärs vorschlug, hatte ihn Alverstoke bereitwillig aufgenommen. Charles hegte nicht den Wunsch, Geistlicher zu werden, war jedoch ein ernsthafter junger Mann von untadeliger Moral. Alles, was er über Alverstoke gehört hatte, nährte in ihm die Befürchtung, seine Ernennung würde sich nur als Demütigung seiner moralischen Grundsätze erweisen. Da er aber außer Vernunft auch eine große Kindesliebe besaß und er wusste, dass es für einen mäßig bemittelten Geistlichen keine leichte Aufgabe war, für einen sechsten Sohn zu sorgen, behielt er seine Befürchtungen für sich und versicherte seinem Vater, er würde sein Bestes tun, um dessen Erwartungen nicht zu enttäuschen. Er tröstete sich mit der Überlegung, dass es für ihn als Bewohner des Alverstoke-Palais sicherlich leichter sein musste, eine günstige Gelegenheit zu finden und am Schopf zu packen, als wenn er müßig in einer Landpfarre herumsaß.
Da sein Interesse der Politik galt, hatte sich die günstige Gelegenheit bisher noch nicht geboten, denn der Marquis teilte Charles’ Ehrgeiz durchaus nicht und erschien daher nur selten im Oberhaus. Aber Charles durfte die kurzen Reden schreiben, von denen sein Gönner meinte, es zieme sich, sie zu halten. So konnte er ihn zumindest hier und da mit seinen eigenen politischen Überzeugungen beglücken.
Mit der Zeit schloss Charles Alverstoke mehr und mehr in sein Herz. Alverstoke interessierte sich zwar nicht für seine Angelegenheiten, aber Charles musste zugeben, dass dieser wenig Ansprüche an seine Pflichterfüllung stellte, liebenswürdig und nie unangenehm hochnäsig war. Wenn er die Briefe eines Studienkollegen las, der eine ähnliche Stellung innehatte dann wusste Charles, dass er selbst Glück gehabt hatte. Dessen Dienstgeber schien seinen Freund nämlich als eine Kreuzung zwischen einem schwarzen Sklaven und einem höheren Dienstboten zu betrachten. Alverstoke konnte einen anmaßenden Emporkömmling vernichtend abblitzen lassen. Wenn sich sein Sekretär hingegen einmal irrte, dann wies er in einer einwandfreien Art auf seinen Fehler hin - ohne jede Andeutung einer gesellschaftlichen Überlegenheit. Charles’ Freund wurden kurz angebundene Befehle hingeworfen – Charles dagegen wurde höflich ersucht. Sosehr es Charles auch versuchen mochte, er konnte sich Alverstokes Charme nicht entziehen, so wenig, wie er ihm die Bewunderung für seine Reitkunst und seine Leistungen auf vielen sportlichen Gebieten vorenthalten konnte.
„Aus Ihrem zögernden Ausdruck und schüchtern einfältigen Benehmen schließe ich“, sagte der Marquis mit einem leicht amüsierten Blick, „dass Sie sich gezwungen sehen, mich noch an eine weitere Verpflichtung zu erinnern. Ich gebe Ihnen einen Rat: Tun Sie es nicht! Ich werde es äußerst ungnädig aufnehmen und sehr wahrscheinlich wütend werden.“
Ein Grinsen vertrieb den Ernst aus Mr. Trevors Gesicht. „Das werden Sie nie, Sir“, sagte er schlicht. „Und eine Verpflichtung ist es nicht – zumindest meiner Meinung nach. Nur dachte ich, Sie möchten es gern wissen.“
„Oh, wirklich? Meiner Erfahrung nach ist dieser Satz immer, wenn er geäußert wird, das Vorspiel zu irgendetwas, das ich lieber nicht weiß.“
„Das stimmt“, sagte Mr. Trevor. „Aber ich möchte, dass Sie diesen Brief doch lesen. Ich habe nämlich Miss Merriville versprochen, dass Sie es tun werden!“
„Und wer ist Miss Merriville?“, frage Seine Gnaden.
„Sie sagte, Sie wüssten es, Sir.“
„Charles, Sie sollten mich wirklich besser kennen, als anzunehmen, dass ich mir die Namen aller ...“ Er schwieg und runzelte die Stirn. „Merriville“, wiederholte er nachdenklich.
„Ich glaube, Sir, irgendeine Verwandte von Ihnen.“
„Sehr entfernt verwandt! Was, zum Teufel, will sie denn?“
Mr. Trevor reichte ihm einen versiegelten Brief. Der Marquis nahm ihn, sagte aber streng: „Es geschähe Ihnen ganz recht, wenn ich ihn ins Feuer werfen würde. Ich sollte es Ihnen überlassen, der Dame zu erklären, wie es kam, dass Sie doch nicht imstande waren, dafür zu sorgen, dass ich ihn lese!“ Er brach das Siegel und öffnete den Brief. Als er ihn gelesen hatte, sah er auf und richtete den Blick gequält auf Mr. Trevor. „Sind Sie eigentlich ein bisschen unpässlich, Charles? Gestern Abend gebummelt und heute nicht so ganz in Ordnung?“
„Nein, natürlich nicht!“, sagte Mr. Trevor entsetzt.
„Also – wieso benehmen Sie sich, um Himmels willen, plötzlich so eigenartig?“
„Ich bin ganz in Ordnung! Das heißt ...“
„Nein, das kann nicht stimmen. In den drei Jahren unseres Beisammenseins haben Sie es noch nie versäumt, mich bei meinen zudringlichen Verwandten zu verleugnen. Aber die Armen unter ihnen auch noch zu ermutigen ...“
„Das sind sie bestimmt nicht, Sir! Sie dürften vielleicht nicht gerade reich sein, doch ...“
„Arme Verwandte“, wiederholte Seine Gnaden energisch. „Wenn man bedenkt, dass schon meine Schwester glaubt, sie lebe am Grosvenor Place abseits von der Welt, was kann man dann von Leuten halten, die sich zur Upper Wimpole Street bekennen? Und wenn ...“, er warf einen Blick auf den Brief, „und wenn diese F. Merriville die Tochter des einzigen Familienmitglieds ist, das ich am allerwenigsten gekannt habe, dann können Sie sich darauf verlassen, dass sie keinen roten Heller besitzt und hofft, ich würde so nett sein und diesen Zustand kurieren.“
„Nein, nein!“, sagte Mr. Trevor. „Ich hoffe, ich weiß Besseres, als solche Leute zu ermutigen!“
„Ich auch“, stimmte ihm Seine Gnaden zu. Er hob fragend eine Braue. „Freunde von Ihnen, Charles?“
„Ich habe sie noch nie zuvor im Leben gesehen, Sir“, antwortete Mr. Trevor steif. „Ich darf Euer Gnaden versichern, dass ich es für sehr ungehörig hielte, Freunde von mir Ihrer Aufmerksamkeit aufzudrängen.“
„Na, na, nehmen Sie es nicht so krumm! Ich wollte Sie wirklich nicht kränken“, sagte Alverstoke milde.
„Nein, Sir, natürlich nicht!“, gab Mr. Trevor besänftigt zurück. „Entschuldigen Sie bitte! Die Sache ist so – nun, vielleicht erkläre ich Ihnen lieber, wie es kam, dass ich Miss Merriville kennenlernte.“
„Tun Sie das!“, sagte Alverstoke einladend.
„Sie überbrachte den Brief persönlich“, eröffnete ihm Mr. Trevor. „Die Kutsche hielt an, als ich gerade das Haus betreten wollte – Sie haben mir heute ja sehr wenig zu tun gegeben, und da dachte ich, Sie würden nichts dagegen haben, wenn ich ausginge, um mir einige neue Halstücher zu kaufen.“
„Wer hat Sie wohl auf solch einen Gedanken gebracht?“
Wieder entlockte er seinem gesetzten Sekretär ein Grinsen. „Sie, Sir. – Nun, kurz und gut, Miss Merriville, mit dem Brief in der Hand, stieg aus der Kutsche, als ich eben die Stufen hinaufging. Daher ...“
„Aha!“, warf Alverstoke ein. „Kein Lakai! Und wahrscheinlich ein Mietwagen.“
„Das, Sir, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls fragte ich sie, ob ich zu Diensten sein könnte – sagte ihr, dass ich Ihr Sekretär bin – und wir kamen ins Gespräch. Ich sagte, dass ich Ihnen ihren Brief übergeben würde, und – nun ja ...“
„Darauf sehen würde, dass ich ihn auch lese“, ergänzte Alverstoke. „Beschreiben Sie mir diese Zauberin, Charles!“
„Miss Merriville?“, sagte Mr. Trevor, offensichtlich verlegen. „Nun, ich habe sie mir nicht so genau angesehen, Sir! Sie war sehr, sehr höflich und natürlich und – und bestimmt nicht das, was Sie eine arme Verwandte nennen! Ich will sagen ...“ Er hielt inne und versuchte, sich ein Bild von Miss Merriville heraufzubeschwören. „Nun, ich kenne mich in solchen Dingen nicht sehr gut aus, aber mir schien, sie war elegant gekleidet. Ziemlich jung, glaube ich – obwohl es nicht ihre erste Saison sein dürfte. Wahrscheinlich nicht einmal“, fügte er nachdenklich hinzu, „ihre zweite Saison.“ Er seufzte und sagte ehrfürchtig: „Es war ihre Gefährtin, die es mir angetan hat, Sir!“
„Ja?“, sagte Alverstoke ermunternd, und in seinen Augen blitzte es vergnügt auf.
Mr. Trevor fiel es anscheinend schwer, sich auszudrücken, aber nach einer Pause, in der er offenkundig eine himmlische Vision vor sich sah, sagte er ernst: „Sir, ich habe noch nie ein derart liebliches Mädchen gesehen – oder auch nur geträumt! Diese Augen! So groß und blau! Ihre Haare – wie leuchtendes Gold. Außerdem das hübscheste Näschen und der Teint einfach köstlich! Und als sie sprach ...“
„Aber wie waren ihre Fesseln?“, unterbrach Seine Gnaden.
Mr. Trevor wurde rot und lachte. „Die Fesseln habe ich nicht gesehen, Sir, denn sie blieb in der Kutsche sitzen. Mich hat besonders der süße Ausdruck gepackt und ihre weiche Stimme. Ja, sie hat etwas sehr Einnehmendes an sich – wenn Sie mich recht verstehen!“
„So ziemlich.“
„Ja, also ... also, als sie sich vorneigte und lächelte und mich bat, Ihnen den Brief zu geben, versprach ich es ihr. Obwohl ich wusste, dass Sie durchaus nicht erfreut sein würden.“
„Sie tun mir unrecht, Charles. Ich gestehe, Sie haben zwar nicht den leisesten Wunsch in mir erweckt, mit Miss Merriville bekannt zu werden, aber ihre Gefährtin will ich unbedingt kennenlernen. Wer ist sie übrigens?“
„Ich bin mir nicht völlig sicher, Sir. Ich vermute jedoch, dass sie die Schwester Miss Merrivilles sein könnte, obwohl sie ihr überhaupt nicht ähnlich sieht. Miss Merriville nannte sie Charis.“
„Das bestärkt mich nur in meiner Abneigung gegen Miss Merriville. Von allen fürchterlichen Abkürzungen halte ich Carrie für die widerwärtigste.“
„Nein, nein!“, protestierte Mr. Trevor. „Sie haben sich verhört, Sir, natürlich nicht Carrie! Miss Merriville sagte ganz deutlich Charis! Und ich dachte mir, dass noch nie jemand richtiger benannt worden ist, denn das bedeutet nämlich ,Anmut‘. Sie wissen ja, griechisch!“
„Danke, Charles“, sagte Seine Gnaden demütig. „Wo wäre ich, wenn ich Sie nicht hätte!“
„Ich dachte, Sie hätten es vielleicht vergessen, Sir – da Sie ja doch ein so schlechtes Gedächtnis haben!“
Der Marquis nahm diesen sanften Hieb zur Kenntnis, indem er seine kräftige schlanke Hand in der Geste eines Fechters abwehrend hob. „Bravo, Charles – verdammt sei Ihre Unverschämtheit!“
Ermutigt sagte Mr. Trevor: „Miss Merriville hoffte, Sie sprechen in der Upper Wimpole Street vor, Sir – das werden Sie doch?!“
„Und ob – falls Sie mir versichern können, dass ich die schöne Charis dort antreffe.“
Das konnte Mr. Trevor zwar nicht, aber er drängte lieber nicht weiter, sondern zog sich zurück, nicht ohne Hoffnung für den Ausgang dieser Angelegenheit.
Später, als er sich die Sache überlegte, fiel ihm ein, dass er Charis, als er sie Alverstokes unheilvoller Aufmerksamkeit aussetzte, einen recht üblen Dienst erwiesen hatte. Den Versuch Alverstokes, ein Fräulein von vornehmer Geburt und zartem Alter zu verführen, so schön es auch sein mochte, fürchtete er nicht. Dergleichen liederliches Vorgehen gehörte nicht zu Seiner Gnaden galanten Abenteuern. Falls jedoch Charis sein Gefallen erregte, dann fürchtete Trevor, dass der Marquis sie zu einer seiner regelmäßigen Flirtereien verlocken würde. Er würde ihr schmeichelhafte Aufmerksamkeit erweisen und konnte sie vielleicht zu der Einbildung bringen, er habe eine dauernde Leidenschaft zu ihr gefasst. Wenn sich Mr. Trevor an den schmelzenden Blick Charis’ erinnerte, so hatte er das Gefühl, ihr Herz wäre leicht zu brechen, und sein Gewissen quälte ihn. Dann aber überlegte er sich, dass sie wohl kaum allein in der Welt stand, und entschied, man könne es ruhig ihren Eltern überlassen, sie vor einem berüchtigten Herzensbrecher zu beschützen. Außerdem standen sehr junge Frauenzimmer ganz obenan auf der Liste jener Dinge, die Alverstoke grässlich langweilig fand. In Bezug auf Miss Merriville hingegen war Mr. Trevor der Meinung, sie sei sehr gut imstande, sich selbst vorzusehen. Ihre schöne Gefährtin hatte ihn zwar geblendet, doch behielt er einen vagen Eindruck von einer selbstbewussten jungen Frau mit einer sanft geschwungenen Nase und freundlichen Augen zurück. Er glaubte nicht, dass sie leicht irrezuleiten war. Weitere Überlegungen überzeugten ihn davon, dass Alverstoke gar keinen Versuch machen würde, mit ihren Gefühlen zu spielen. Es war unwahrscheinlich, dass ein so berühmter Kenner der Schönheit wie Alverstoke ihr auch nur einen zweiten Blick gönnen würde. Und noch viel unwahrscheinlicher war es, dass er um ihretwillen in irgendeiner Weise einen Finger rührte.
In den nächsten Tagen hatte Seine Gnaden sie nicht erwähnt und ihr erst recht keinen Vormittagsbesuch abgestattet. Es sah allmählich so aus, als habe er sich entweder entschlossen, sie zu ignorieren – oder er hatte ihr Dasein überhaupt vergessen. Mr. Trevor war sich seiner Pflicht bewusst, ihn zu erinnern. Doch hielt er sich mit dem Gefühl, der Augenblick sei ungünstig, zurück. Seine Gnaden war gezwungen, drei Besuche zu ertragen – zwei von seinen älteren Schwestern und einen von der verwitweten Mutter seines Erben. Diese hatten ihn derart gelangweilt, dass sämtliche Angehörigen seines Haushalts sich hüteten, ihn wütend zu machen. „Denn ich versichere Ihnen, Mr. Wicken“, sagte der hochnäsige Kammerdiener Seiner Gnaden herablassend zum Butler Seiner Gnaden, „wenn er gereizt wird, kann Seine Gnaden einen ziemlichen Wirbel veranstalten, wie man so sagt.“
„Das weiß ich sehr gut, Mr. Knapp“, erwiderte sein Kollege, „da ich nun einmal Seine Gnaden schon von der Wiege auf kenne. Er erinnert mich an seinen Vater, den verstorbenen Lord, aber den kannten Sie natürlich nicht“, fügte er hinzu, um jede Anmaßung im Keim zu ersticken.
Seine Lordschaft war tatsächlich schwer geprüft worden. Lady Buxted – keine Frau, die eine Niederlage hinnahm – war unter dem fadenscheinigsten Vorwand in Begleitung ihrer ältesten Tochter ins Alverstoke-Palais gekommen. Diese war dann schließlich, da es ihr nicht gelungen war, das Herz ihres Onkels durch Schmeichelei zu erweichen, in Tränen aufgelöst. Sie gehörte jedoch nicht zu jenen wenigen glücklichen Frauenzimmern, die weinen konnten, ohne abscheulich auszusehen. Deshalb war er für ihre Tränen ebenso unempfänglich wie für den Bericht seiner Schwester über die beengten Verhältnisse, in die sie erniedrigt worden war. Nur die Armut, erklärte Lady Buxted, hatte sie gezwungen, sich in der überaus wichtigen Pflicht ihre teuerste Jane in die Gesellschaft einzuführen an ihren Bruder um Beistand zu wenden. Ihr Bruder hingegen gab zurück – und sprach mit äußerster Liebenswürdigkeit –, dass Geiz und nicht Armut das richtige Wort sei. Worauf Ihre Gnaden die Beherrschung verlor und ihm eine gehörige Szene machte. So jedenfalls drückte es James, der Erste Lakai, der in der Halle wartete, seinem unmittelbaren Untergebenen gegenüber aus.
Als zweite Besucherin Seiner Gnaden erschien Mrs. Dauntry. Auch sie war, wie ihre Base Lady Buxted, Witwe. Auch sie teilte deren Überzeugung, es sei Alverstokes heilige Pflicht, für ihre Sprösslinge zu sorgen. Damit aber war die Ähnlichkeit zwischen den beiden Damen auch schon zu Ende. Lady Buxted wurde – von gewöhnlichen Leuten – häufig als eine Vogelscheuche bezeichnet. Niemand aber hätte einen solchen Ausdruck auf Mrs. Dauntry anwenden können, die eine Erscheinung von äußerster Zerbrechlichkeit war und mit edler Tapferkeit alle ihr auferlegten Prüfungen ertrug. Als Mädchen war sie eine bekannte Schönheit gewesen, hatte aber den Hang, sich von Klagen anstecken zu lassen. Das hatte sie zu dem Glauben verführt, dass sie eine kränkliche Konstitution habe. Und nicht lange nach ihrer Hochzeit begann sie, wie es Lady Jevington und Lady Buxted unfreundlich formulierten, an sich herumzudoktern. Der allzu frühe Tod ihres Gemahls hatte ihre schlechte Gesundheit besiegelt. Sie unterlag nervösen Störungen und fing mit einer Reihe von Kuren und Diäten an. Und weil dazu so traurige Heilmittel wie Ziegenmolke (gegen eine eingebildete Schwindsucht) gehörten, war sie bald auf geisterhafte Ausmaße zusammengeschrumpft. Mit vierzig widmete sie sich schließlich ihrer Kränklichkeit so intensiv, dass sie, wenn ihr nicht gerade eine verlockende Unterhaltung geboten wurde, den größten Teil ihrer Tage anmutig auf einem Sofa liegend verbrachte. Sie hatte eine arme Verwandte zur Pflege und neben sich einen mit Flaschen und Fläschchen beladenen Tisch, die Zimtwasser, Baldrian, Asafötida-Tropfen, Lavendelkampfer-Wasser und alle möglichen, von Freundinnen oder Reklamen empfohlenen schmerzstillenden und stärkenden Mittel enthielten. Im Gegensatz zu Lady Buxted war sie weder aufbrausend noch ein Ellbogenmensch. Sie hatte eine schwache, klagende Stimme, die, wenn man ihr widersprach, nur noch schwächer und erschöpfter klang. Und sie war bereit, für ihre Kinder wie auch für sich selbst Unsummen zu verschleudern. Leider Gottes war ihr Erbe – von den Damen Jevington und Buxted als ein recht angenehmes Auskommen bezeichnet – nicht groß genug, um ohne kluges Einteilen und Sparen in dem Stil leben zu können, an den sie ihren Worten nach gewöhnt war. Da sie aber zu kränklich war, um sich mit diesen beiden Künsten zu befassen, steckte sie ständig in Schulden. Sie erhielt seit Jahren eine Pension von Alverstoke. Obwohl der Himmel wusste, wie sehr sie von seiner Großzügigkeit unabhängig zu sein wünschte, hatte sie wider Willen doch das Gefühl, es sei dessen Pflicht, auch für ihre beiden Töchter aufzukommen. Schließlich war ja ihr schöner Sohn Alverstokes Erbe.
Die ältere der beiden, Miss Chloë Dauntry wurde, erst in einigen Wochen siebzehn. Ihre Einführung in die Gesellschaft hatte Mrs. Dauntry so lange nicht beschäftigt, bis sie aus verschiedenen unklaren Quellen erfuhr, dass Alverstoke plane, einen prachtvollen Ball zu Ehren Miss Jane Buxteds zu geben. Mrs. Dauntry mochte ein schwaches Geschöpf sein. Aber wenn es hieß, ihre geliebten Kinder zu verteidigen, konnte sie zur Löwin werden. In dieser Rolle überfiel sie Alverstoke, bewaffnet mit ihrem mächtigsten Kampfmittel: dem Riechfläschchen.
Sie stellte keine Ansprüche, nein, so war sie nicht. Als er den Salon betrat, kam sie auf ihn zu. Sie hielt die Hände in köstlichem lavendelfarbenem Ziegenleder ausgestreckt und schleppte Schals und Faltenwürfe hinter sich her. „Teuerster Alverstoke!“, sagte sie, hob die riesigen, tief eingesunkenen Augen zu ihm auf und gönnte ihm ein wehmütiges Lächeln. „Mein gütiger Wohltäter! Wie kann ich dir danken?“
Er übersah ihre Linke völlig, drückte ihr nur kurz die Rechte und sagte: „Mir danken – wofür?“
„Das sieht dir ja so ähnlich!“, murmelte sie. „Aber du magst ja deine Großmut vergessen – ich kann es nicht! Oh, ich bin bei der armen Harriet und den Mädchen völlig in Ungnade, weil ich mich bei einem so kalten Wetter hinauswage. Aber ich hatte das Gefühl, es ist das Mindeste, was ich tun kann! Du bist ja viel zu gut!“
„Na, das ist wenigstens einmal etwas Neues“, bemerkte er. „Setz dich, Lucretia, und lass mich ohne Umschweife hören: Was habe ich ungeschickterweise begangen, das deine Dankbarkeit erregt?“
Es war bekannt, dass noch nie etwas die Heiligkeit der Stimme und des Betragens von Mrs. Dauntry aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Also antwortete sie, als sie anmutig in einen Sessel sank: „Du Schwindler! Ich kenne dich nur zu gut, um mich täuschen zu lassen. Du hast es nicht gern, wenn man dir dankt! Und wirklich, sollte ich dir all deine Güte zu mir und den Meinen danken, für deine unermüdliche Unterstützung, für deine Großherzigkeit meinen Geliebten gegenüber – ich fürchte, ich würde in deinen Augen todlangweilig werden! Chloë, das liebe Kind, nennt dich nur unseren Märchenonkel!“
„Das muss eine dumme Gans sein!“, antwortete er.
„Oh, sie meint, es gibt niemanden, der ihrem großartigen Vetter Alverstoke gleichkommt“, sagte Mrs. Dauntry und lächelte sanft. „Ich versichere dir, sie schwärmt für dich!“
„Das braucht dich nicht aufzuregen“, sagte er. „Darüber kommt sie schon hinweg.“
„Nein, du bist wirklich ein ganz Schlimmer!“, scherzte Mrs. Dauntry. „Du möchtest mir gern ausweichen, aber es gelingt dir einfach nicht. Du weißt sehr gut, dass ich hier bin, um dir zu danken. Ja, und auch, um mit dir zu schelten, weil du Endymion beigesprungen bist, wie ich, ach, es nicht konnte. Dieses wunderschöne Pferd! Bis aufs Haar vollkommen, sagt er. Es ist wirklich viel zu gütig von dir.“
„Deshalb also kommst du mir danken, ja?“, fragte Seine Gnaden mit einem höhnischen Blick. „Du hättest dich nicht wegen einer so unnötigen Mitteilung hinauswagen sollen. Ich habe, als er zum Militär ging, gesagt, ich würde dafür sorgen, dass er anständig beritten ist.“
„Wie großzügig von dir!“, seufzte sie. „Dessen ist er sich zutiefst bewusst. Was mich betrifft, so frage ich mich manchmal, was wohl damals aus mir geworden wäre, als mir mein geliebter Gemahl geraubt wurde – wenn ich mich nicht in jeder Schicksalsprüfung auf deine Unterstützung hätte verlassen können.“
„Soweit ich dich kenne, teure Base, bin ich überzeugt, du hättest keine Zeit verloren, irgendeine Unterstützung von anderer Seite zu entdecken“, antwortete er mit einer ebenso süßen Stimme, wie es die ihre war. Es entlockte ihm ein leises Lächeln, als er sah, dass sie sich auf die Lippen biss. Während er seine Schnupftabakdose öffnete, sagte er: „Und welche Prüfung quält dich derzeit?“
Daraufhin machte sie große Augen und gab verblüfft zurück: „Mein lieber Alverstoke, was meinst du wohl damit? Abgesehen von meinem elenden Gesundheitszustand – und wie du weißt, rede ich darüber nie – gibt es nichts, was mich plagt! Ich habe mein Anliegen vorgebracht und muss mich wieder verabschieden, bevor sich meine arme Harriet einbildet, ich hätte einen meiner albernen Krampfanfälle erlitten. Sie wartet in der Kutsche auf mich, denn sie ließ mich um keinen Preis allein fahren. Sie kümmert sich ja so rührend um mich! Ihr verwöhnt mich alle so sehr!“ Sie stand auf, zog den Schal fester um sich und streckte die Hand aus. Aber bevor er sie erfassen konnte, ließ sie sie sinken und rief aus: „Oh, da erinnere ich mich an etwas, das ich ja mit dir besprechen wollte! Gib mir einen Rat, Alverstoke! Ich bin in einer schrecklichen Lage.“
„Du beschämst mich, Lucretia“, sagte er. „Sooft auch ich dich enttäusche – du enttäuschst mich nicht!“
„Wie gern du mich doch zum Besten hältst! Aber ich bitte dich, sei ernst! Es handelt sich um Chloë.“
„Oh, in diesem Fall musst du mich entschuldigen“, sagte Seine Gnaden. „Ich habe keine Ahnung von Schulmädchen, also wäre mein Rat wohl nutzlos, fürchte ich.“
„Ach, auch du hältst sie für ein Schulmädchen! Ja, es scheint wirklich fast unglaublich, dass sie schon erwachsen ist. Aber das ist sie – sie ist fast siebzehn. Obwohl ich ja gedacht habe, dass ich sie erst nächstes Jahr herausbringe, sagen mir alle, es wäre falsch, das Debüt zu verschieben. Weißt du, es heißt, die Gesundheit der Königin sei jetzt derart schlecht, dass sie jeden Augenblick sterben kann! Selbst wenn dies nicht der Fall ist, dann wird sie nächstes Jahr den Empfängen nicht mehr gewachsen sein. Das bereitet mir Sorge. Natürlich muss ich das süße Kind bei Hof vorstellen – das hätte der arme Henry unbedingt gewünscht. Und wenn die Königin sterben sollte, so gibt es auch keine Empfänge mehr. Chloë aber im Carlton House debütieren zu lassen – das täte ich um nichts in der Welt! Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Selbst wenn die Herzogin von Gloucester den Platz der Königin einnehmen sollte – was der Prinzregent natürlich wünschen wird, da sie ja immer seine Lieblingsschwester war –, so wäre es doch nicht dasselbe. Und wer weiß, ob nicht diese abscheuliche Lady Hertford auf den Platz der Königin rückt!“
Alverstoke, der sich kaum Unwahrscheinlicheres vorstellen konnte, antwortete teilnahmsvoll: „Ja, nicht wahr?“
„Daher empfinde ich es als meine Pflicht, Chloë noch in dieser Saison einzuführen, koste es, was es wolle!“, sagte Mrs. Dauntry. „Ich habe gehofft, dass ich wenigstens nächstes Jahr so viel Geld haben werde, um die Sache würdig durchzuführen, aber das wird, ach, wohl kaum der Fall sein. Das liebe Kind! Die Auslagen für ein Kleid, in dem man sie gern sähe, übersteigen meine Mittel weit. Als ich ihr also erzählte, ich würde gezwungen sein, sie in einer meiner eigenen Hofroben vorzustellen , da war sie so lieb und beklagte sich überhaupt nicht. Es ging mir direkt zu Herzen! Ich musste einfach seufzen – sie ist so hübsch, dass ich mich wirklich danach sehne, sie so vorteilhaft wie nur möglich herauszuputzen. Wenn ich sie jedoch in dieser Saison herausbringen muss, kann ich das nicht.“
„In diesem Fall rate ich dir: Warte eben bis nächstes Jahr“, antwortete Alverstoke. „Sollte es dann keine Empfänge mehr geben, tröste dich mit der Überlegung, dass auch keine andere der schönen Debütantinnen ein Erlebnis genießen wird, das Chloë versagt bleibt.“
„Ah, nein! Wie könnte ich so unklug sein?“, entgegnete sie. „Irgendwie muss ich es möglich machen, sie noch in diesem Frühling debütieren zu lassen. Und überdies bei einer Tanzveranstaltung! Aber wie ich das in meiner Situation zustande bringen soll ...“ Sie brach ab, als käme ihr plötzlich eine Idee. „Ich frage mich, ob wohl Louisa Jane in dieser Saison herausbringen will? Bedauernswert sommersprossig, das arme Kind, und eine so klägliche Figur! Aber du kannst dich darauf verlassen, dass Louisa sich anstrengen wird, ihre Tochter würdig einzuführen. Obwohl sie ein schrecklicher Geizkragen ist und bestimmt um jeden Penny weint, den sie dafür aufwenden muss. Übrigens“, fügte sie hinzu und lachte leise, „es geht das Gerücht, dass du zu Ehren Janes einen Ball geben wirst!“
„Ach nein, wirklich?“, erwiderte Seine Gnaden. „Gerüchte sind doch, wie du ja weißt, nichts als Schall und Rauch ... Wie das Zitat weitergeht, weiß ich nicht. Lass dir hingegen versichern, liebe Lucretia, falls Einladungen zu einem Ball, der hier abgehalten wird, hinausgehen, dann wird Chloës Name nicht vergessen. Jetzt aber musst du mir erlauben, dich zu deiner Kutsche zu begleiten. Der Gedanke an die liebevolle Harriet, die dich geduldig erwartet, beginnt mich zu bedrücken.“
„Halt!“, sagte Mrs. Dauntry und hatte eine weitere Idee. „Wie wäre es, wenn Louisa und ich unsere Mittel sozusagen zusammenlegen und einen Ball zu Ehren unserer beiden Töchter geben? Ich fürchte zwar, meine liebliche Chloë wird die arme Jane absolut überstrahlen, aber ich wette, das macht Louisa nichts aus, wenn sie nur ein bisschen einsparen kann.“ Sie hob flehend die Hände und fügte mit einer Stimme, in der sich Schalkhaftigkeit und Schmeichelei angenehm vereinten, hinzu: „Wenn Louisa der Plan gefiele, würdest du uns, teuerster Vernon, dann erlauben, den Ball hier, in deinem herrlichen Ballsaal, abzuhalten?“
„Nein, teuerste Lucretia, das würde ich nicht!“, antwortete Seine Gnaden. „Aber sei nicht traurig! Glaube mir, es käme nicht dazu, da Louisa der Plan gar nicht gefallen würde. Ja, ich weiß, ich bin so abscheulich ungefällig, dass du einer Ohnmacht nahe bist – soll ich die getreue Harriet an deine Seite rufen?“
Das war ein bisschen zu viel, selbst für Mrs. Dauntry. Sie warf ihm einen zutiefst vorwurfsvollen Blick zu und ging.
Die dritte Besucherin des Marquis war Lady Jevington. Sie kam nicht, um eine Gunst von ihm zu erbitten, sondern um ihn zu beschwören, Lady Buxteds Zudringlichkeit ja nicht nachzugeben. Sie drückte sich gemäßigt und majestätisch aus. Sie sagte, sie habe nie erwartet, dass er bei der Einführung ihrer Anna in die Gesellschaft seine Hilfe anbieten würde, und sie habe ihn auch nicht darum gebeten. Sie könne es jedoch nur als absichtliche Brüskierung auffassen, falls er diesen Dienst nun Miss Buxted erwiese. Lady Jevington betonte mit größtem Nachdruck, dass Miss Buxted sich schließlich mit ihrer Base die Auszeichnung teilte, sein Patenkind zu sein. Und, fügte sie hinzu, falls ihn seine Vorliebe dazu verführen sollte, gar Chloë, die Tochter dieser gewissen Frauensperson, mit diesem besonderen Gunstbeweis zu würdigen, dann wolle sie fortan nichts mehr mit ihm zu tun haben.
„Augusta, damit überredest du mich fast dazu!“, sagte Seine Gnaden.
Die sanftmütig gesprochenen Worte wurden von dem süßesten Lächeln begleitet. Lady Jevington jedoch erhob sich in aufwallender Wut und fegte ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer.
„Und jetzt“, sagte der Marquis zu seinem Sekretär, „fehlt nur noch, dass auch Ihr Schützling einen Ball von mir verlangt!“
3. KAPITEL
Angesichts dieser Erlebnisse schien es nicht wahrscheinlich, dass der Marquis, der es selten für seine Pflicht hielt, jemandem anderen als sich selbst zu gefallen, auf Miss Merrivilles Appell reagieren würde. Charles Trevor wagte nicht, dem Gedächtnis seines Herrn nachzuhelfen. Aber, sei es nun aus Neugier, sei es, weil er sich eines Tages in der Nähe der Upper Wimpole Street befand – Alverstoke machte Miss Merriville seine Aufwartung.
Er wurde von einem alten Butler eingelassen, der ihn die enge Treppe zum Salon im ersten Stock hinaufführte und ihn anmeldete. Dieses geschah in einem Tempo, das deutlich Alter und Unpässlichkeit des Butlers verriet.
Als der Marquis auf der Schwelle stehen blieb und einen kurzen Blick auf seine Umgebung warf, spürte er seinen Verdacht bestätigt. Diese unbekannte Verwandtschaft war offensichtlich unbemittelt. Das Zimmer war nicht elegant, sondern sogar ziemlich schäbig eingerichtet. Da er diesbezüglich keine Erfahrung hatte, erkannte er die Zeichen nicht, die Leuten in weniger glücklichen Verhältnissen verraten hätten, dass das Haus zu einem der vielen gehörte, die für die Saison vermietet und so sparsam wie möglich ausgestattet wurden.