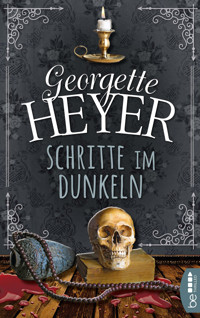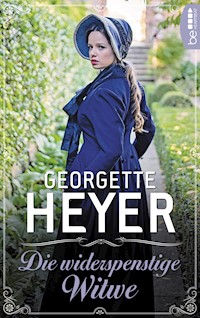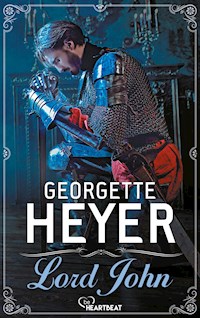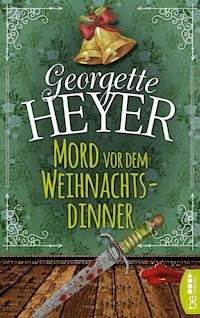
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgette-Heyer-Krimis
- Sprache: Deutsch
England, 1938: Nat Herriard ist ein menschenscheuer Sonderling und seine Familie besteht für ihn vor allem aus Erbschleichern, Verrückten und Parasiten. Kein Wunder also, dass sich auf seinem Landsitz "Lexham Manor" trotz aller Bemühungen der Angestellten nicht einmal an Weihnachten eine festliche Stimmung bei den geladenen Gästen einstellen will.
Und so ist zunächst auch niemand beunruhigt, dass der Hausherr am Heiligabend länger als üblich auf sich warten lässt. Noch wissen die Gäste nicht, dass Nat Herriard tot in seinem von innen abgeschlossenen Arbeitszimmer liegt. Er wurde ermordet und jeder der Gäste hat ein Motiv ...
Inspektor Hemingway steht vor einem Rätsel und muss seinen bisher schwersten Fall lösen.
Ein Festessen - vor allem für Fans des klassischen britischen Krimis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Über dieses Buch
England, 1938:
Nat Herriard ist ein menschenscheuer Sonderling und seine Familie besteht für ihn vor allem aus Erbschleichern, Verrückten und Parasiten. Kein Wunder also, dass sich auf seinem Landsitz „Lexham Manor“ trotz aller Bemühungen der Angestellten nicht einmal an Weihnachten eine festliche Stimmung bei den geladenen Gästen einstellen will. Und so ist zunächst auch niemand beunruhigt, dass der Hausherr am Heiligabend länger als üblich auf sich warten lässt. Noch wissen die Gäste nicht, dass Nat Herriard tot in seinem von innen abgeschlossenen Arbeitszimmer liegt. Er wurde ermordet und jeder der Gäste hat ein Motiv…
Inspektor Hemingway steht vor einem Rätsel und muss seinen bisher schwersten Fall lösen.
Ein Festessen – vor allem für Fans des klassischen britischen Krimis.
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren 1902, deren Regency-Romane allein in deutscher Sprache eine sehr hohe Auflage erzielten, lebte gänzlich zurückgezogen und publicityscheu in London. Als Historikerin hochgeschätzt, vom British Museum als Sachverständige konsultiert, schrieb sie an die 40 Romane mit geschichtlichem Hintergrund und eine Reihe unterhaltsamer Detektivromane. Georgette Heyer starb 1974.
Georgette Heyer
Mord vor dem Weihnachtsdinner
Aus dem Englischen von Anton und Adele Stuzka
beTHRILLED
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Originalausgabe ENVIOUS CASCA erschien 1941 bei Hodder and Stoughton Ltd
Copyright © 1941 Georgette Rougier
Die deutsche Erstausgabe mit dem Titel „Mord vor dem Dinner“ erschien 1961 beim Paul Zsolnay Verlag
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Umschlaggestaltung: © Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © thinkstockphoto: ermess | annaveroniq | Zoonar RF | d1sk
E-Book-Erstellung: Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3181-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Joseph Herriard empfand es als eine ganz große Befriedigung, dass die Stechpalmen im vollen Schmuck ihrer Beeren standen; ja, ihm schien dies ein gutes Omen für die beabsichtigte Wiedervereinigung der Familie zu sein. Seit Tagen sammelte er eifrig die stacheligen kleinen Zweige und brachte sie ins Haus. Sein rosiges Gesicht strahlte dabei vor Freude, und sein weißes Haar, das er ziemlich lang trug, war von den Dezemberwinden zerzaust. „Sieh dir bloß die Beeren an!“, pflegte er zu sagen, indem er die Zweige zuerst Nathaniel unter die Nase hielt und sie dann auf Mauds Kartentisch legte.
„Sehr nett, mein Lieber“, meinte dann Maud gleichgültig, während Nathaniel knurrte: „Nimm das verdammte Zeug weg, ich hasse Stechpalmen.“
Aber weder die Gleichgültigkeit seiner Frau noch die Zurückweisung durch seinen älteren Bruder vermochte Josephs kindische Freude an der Weihnachtszeit zu dämpfen. Als der bleigraue Adventshimmel dann auch noch Schnee ankündigte, fing er an, über die alten Weihnachtsbräuche zu sprechen und Vergleiche zwischen Lexham Manor und Dingley Dell zu ziehen. Dabei bestand zwischen den beiden Häusern nicht mehr Ähnlichkeit als etwa zwischen Mr. Wardel und Nathaniel Herriard. Lexham war ein Herrensitz aus der Tudorzeit, eine der Sehenswürdigkeiten seiner Umgebung. Das Haus befand sich noch nicht lange im Besitz der Familie; Nathaniel — er war durch seine Importgeschäfte mit Ostindien zu Wohlstand gelangt — hatte es, einige Jahre bevor er sich von der aktiven Mitarbeit in seinem blühenden Unternehmen zurückzog, erworben. Seine Nichte, Paula Herriard, die das Haus nicht mochte, konnte sich nicht vorstellen, aus welchen Gründen sich ein alter Junggeselle mit einem solchen Besitz belastete, es sei denn, er beabsichtigte, es Stephen, ihrem Bruder, zu hinterlassen. Dann aber, meinte sie, war es ein Jammer, dass Stephen, der den Besitz liebte, sich so wenig bemühte, zu dem alten Herrn nett zu sein.
Obwohl Stephen seinen Onkel gewöhnlich ärgerte, betrachtete man ihn als Nathaniels Erben. Er war sein einziger Neffe, und wenn Nathaniel sein Vermögen nicht seinem einzigen Bruder Joseph zu vermachen gedachte, sah es ganz so aus, als würde der riesige Besitz dereinst diesem unwürdigen Stephen zufallen.
Erhärtet wurde diese Annahme noch dadurch, dass Nathaniel seinen Neffen anscheinend viel besser leiden konnte als irgendein anderes Mitglied seiner Familie. Aber sonst gab es wenige Leute, die Stephen besonders mochten. Der einzige Mensch, der beharrlich daran glaubte, dass hinter Stephens rauer Schale hervorragende Eigenschaften schlummerten, war Joseph.
„In Stephen steckt sehr viel Gutes. Denkt an meine Worte. Der liebe, alte Bär wird uns eines Tages alle überraschen“, pflegte Joseph treuherzig zu sagen, wenn Stephen sich wieder einmal von seiner unmöglichsten Seite gezeigt hatte.
„Die Beschäftigung mit unerwartet schwachen Verstandeskräften gehört nicht zu meinem Zeitvertreib“, war eine von Stephens Antworten, bei denen er sich nicht einmal die Mühe machte, die Pfeife aus dem Munde zu nehmen.
Wenn Joseph daraufhin tapfer lächelte, sah Paula sich veranlasst, ihn zu verteidigen, aber Stephen lachte bloß kurz auf und vergrub sich in sein Buch. Während Paula ihm freimütig erklärte, was sie von seinem Benehmen halte, hatte Joseph sich bereits wieder soweit gefasst, dass er Stephens bissige Bemerkung schalkhaft als die Folge eines Leberanfalls bezeichnen konnte.
Maud bemerkte dann mit tonloser Stimme, dass Salz vor dem Frühstück gut gegen eine träge Leberfunktion sei. Worauf Stephen „Ach Gott“ seufzte. „Nicht auszudenken, dass es in diesem Hause einmal erträglich war!“
Die Schlussfolgerung dieser beleidigenden Bemerkung war unmissverständlich, aber sobald Stephen den Raum verlassen hatte, versicherte Joseph seiner Nichte Paula: „Ich glaube nicht, dass Stephen uns die Gastfreundschaft Nats wirklich missgönnt.“
Joseph und Maud hatten nicht immer in Lexham Manor gewohnt. Joseph war bis vor wenigen Jahren so etwas wie ein Zugvogel gewesen. Er erzählte oft von seinen verfehlten Berufen und seinem Herumwandern in der Welt. Und damit Stephen nur ja nicht zornig wurde, pflegte er vergangene Triumphe im Rampenlicht nur mit einem Seufzer, einem Lächeln und einem „Eheu fugaces!“ zu erwähnen.
Denn Joseph hatte auf der Bühne gestanden. In seiner Jugend war er zwar zum Anwalt bestimmt gewesen, hatte aber diesen Beruf aufgegeben, weil er glaubte, dass er als Kaffeepflanzer in Ostafrika glänzendere Aussichten hätte. Seit jenen Tagen hatte er in jeden nur vorstellbaren Beruf hineingeschnuppert, war vom Goldsucher bis zum Schauspieler fast alles gewesen. Warum er die Schauspielerei aufgegeben hatte, konnte sich niemand erklären, denn er schien von Natur aus dazu prädestiniert, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu zieren.
In dieser Zeit hatte er auch Maud kennengelernt und geheiratet. Obgleich es den jungen Herriards, die Maud nur als Fünfzigerin kannten, unvorstellbar schien, war sie dereinst eine passable Schauspielerin gewesen. Sie war mit den Jahren dick geworden, und heute waren in dem fetten Gesicht mit dem kleinen, zwischen tiefen Falten eingebetteten Mund, den rosigen Wangen und den hellblauen, fast starren Augen kaum noch Anzeichen von dem hübschen Mädchen von einst zu entdecken. Sie sprach selten von ihrer Jugend, und die wenigen Bemerkungen, die sie von Zeit zu Zeit fallen ließ, waren unzusammenhängend.
Für die jungen Herriards und Mathilda Clare, eine entfernte Cousine, waren Joseph und Maud nur legendäre Figuren gewesen, ehe sie das Meer vor zwei Jahren in Liverpool an die Ufer Englands spülte. Sie waren von Südamerika gekommen, zahlungsfähig zwar, aber ohne Aussichten. Es hatte sie nach Lexham Manor gezogen, und dort waren sie geblieben; keineswegs zu stolz, wie Joseph sagte, um Nathaniels Dauergäste zu sein.
Nathaniel hatte Bruder und Schwägerin mit einer überraschenden Bereitschaft aufgenommen. Vielleicht war er der Meinung gewesen, Lexham bedürfe einer Hausdame. Wenn dem wirklich so war, dann wurde er aber sehr enttäuscht, denn Maud zeigte keinerlei Neigung, die Zügel der Wirtschaftsführung in ihre kleinen Hände zu nehmen. Mauds Vorstellung von der menschlichen Glückseligkeit schien sich im Essen, Schlafen, in endlosen Patiencen und in der Lektüre von geschwätzigen Biografien königlicher Personen oder anderer Berühmtheiten zu erschöpfen.
Wenn Maud keinerlei Emotionen zeigte, so sprühte Joseph förmlich vor Energie. Beinahe alles an ihm war Güte. Aber zum Leidwesen Nathaniels, der nicht gesellig war, freute es ihn, große Gesellschaften zu arrangieren. Nichts bereitete ihm mehr Vergnügen, als das Haus voll mit jungen Leuten zu haben.
So war es denn auch Joseph, der die Idee gehabt hatte, jene Gesellschaft im Haus zu organisieren, die sich an diesem kalten Dezembertag zusammenfinden sollte. Joseph hatte so viele Jahre im Ausland verbracht, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als richtige englische Weihnachten zu erleben. Nathaniel, der seinem Treiben mit verächtlicher Miene zusah, meinte, nach seinen Erfahrungen bestünden richtige englische Weihnachten nur darin, dass sich Leute, die einander nicht ausstehen konnten, etliche Grobheiten sagten.
Es sprach sehr für Josephs Überredungskunst, dass Nathaniel „die jungen Leute“ schließlich doch einlud, Weihnachten auf Lexham Manor zu verbringen, zumal er erst einen Monat zuvor mit seinem Neffen Stephen Streit gehabt und es vor noch längerer Zeit ganz entschieden abgelehnt hatte, ein Theaterstück zu finanzieren, in welchem seine Nichte Paula auftreten wollte.
„Du weißt, Nat“, sagte Joseph, „alte, wunderliche Menschen wie du und ich können es sich nicht leisten, mit der jüngeren Generation herumzustreiten. Wo würden wir denn schließlich ohne sie sein? Trotz aller ihrer Fehler, segne ihre Herzen!“
„Ich kann es mir erlauben zu streiten, mit wem ich will“, erwiderte Nathaniel. „Ich sage ja nicht, dass Stephen und Paula nicht kommen dürfen, wenn sie es beide wünschen, aber ich möchte dieses Weibsstück Stephens nicht hier haben, das mit seinem ordinären Parfüm die Luft verpestet; und ich will nicht von Paula bedrängt werden, dass ich einem Stück auf die Beine helfe, das ein Bursche geschrieben hat, von dem ich niemals etwas gehört habe und von dem ich auch niemals etwas hören will.“
Nichtsdestoweniger ließ er sich nach einiger Zeit doch dazu überreden, Stephens „Weibsstück“ nach Lexham einzuladen. Zu guter Letzt kam eine ganz beträchtliche Anzahl von Gästen zusammen, die Weihnachten gemeinsam in Nathaniels Haus verbringen sollten, denn Paula brachte den unbekannten Dramatiker mit, der vom Hausherrn so sehr abgelehnt wurde; Mathilda Clare lud sich selbst ein, und Joseph überlegte im letzten Moment, dass es unhöflich wäre, mit der seit Jahren geübten Gepflogenheit zu brechen und Nathaniels Geschäftspartner, Edgar Mottisfont, nicht einzuladen.
Joseph verbrachte die letzten Tage vor Weihnachten damit, das Haus zu schmücken. Er kaufte Papierketten und hängte sie kreuzweise unter der Decke auf; und er holte ganze Büschel von Mistelzweigen herbei, um sie an allen strategisch wichtigen Punkten anzubringen. Mit dieser Arbeit war er gerade beschäftigt, als Mathilda Clare ankam. Er wollte eben in der Mitte der Halle eine wacklige Stufenleiter aufstellen, um sodann ein Bündel Mistelzweige am Luster zu befestigen, da trat Mathilda ein.
„Tilda, meine Liebe“, rief er aus, ließ die Leiter mit einem Krach zu Boden fallen und eilte, den ersten Gast zu begrüßen. „Herrlich, herrlich, herrlich, herrlich!“
Strahlend schob er einen Arm unter den ihren und führte sie in die Bibliothek, wo Nathaniel die Zeitung las. „Sieh, was uns die Feen beschert haben, Nat“, verkündete er.
Nathaniel sah über den Rand seiner Augengläser und sagte: „Ach, du bist's? Wie geht's? Freut mich, dich zu sehen.“
„Nun ja, das ist immerhin etwas“, entgegnete Mathilda und schüttelte ihm die Hand. „Übrigens schönen Dank, dass du mich eingeladen hast.“
„Ich nehme an, du willst etwas“, sagte Nathaniel, ohne die Miene zu verziehen.
„In keiner Weise“, erwiderte Mathilda und zündete sich eine Zigarette an. „Es ist nur so, dass Sarahs Schwester sich ein Bein brach; und Mrs. Jones konnte nicht aushelfen kommen.“
Da Sarah Miss Clares dienstbarer Hausgeist war, wurde mit dieser Feststellung ihr Besuch im Herrenhaus als genügend begründet aufgenommen. Joseph drückte Mathildas Arm. „Wir werden wirklich herrliche Weihnachten verbringen“, sagte er.
„Mit ,wirʼ sind wohl wir beide gemeint“, sagte Mathilda. „Geht in Ordnung, Joe. Der perfekte Gast: Das bin ich. Wo ist Cousine Maud?“
Man entdeckte Maud alsbald im Frühstückszimmer. Es war nicht ersichtlich, ob der Besuch Mathildas sie erfreute, aber sie hielt ihre Wange zum Kuss hin und bemerkte etwas zerstreut: „Der arme Joseph ist so darauf aus, ein Weihnachtsfest so richtig nach altem Brauch zu arrangieren!“
„Gut, ich will ihm gerne dabei helfen“, sagte Mathilda. „Soll ich Papierketten machen oder sonst etwas? Wer kommt denn überhaupt alles?“
„Stephen und Paula, dann Stephens Braut und Mr. Mottisfont natürlich.“
„Hört sich an wie ein schlechter Scherz. Stephen würde jede Gesellschaft glatt schmeißen.“
„Nathaniel mag Stephens Braut nicht“, konstatierte Maud.
„Was du nicht sagst“, erwiderte Miss Clare.
„Sie ist sehr hübsch“, sagte Maud.
Mathilda lächelte breit. „Das ist sie“, gab sie zu.
Mathilda selbst war nicht hübsch. Sie hatte gut geformte Augen und herrliches Haar, aber nicht einmal in ihrer taufrischen Jugend hatte sie sich mit dem Gedanken zu täuschen versucht, dass sie gut aussähe. So fand sie sich vernünftigerweise damit ab, dass ihrer Figur frauliche Reize fehlten, und wendete daher ihr ganzes Geld für gute Kleider auf. Sie war Ende Dreißig, verfügte über ein eigenes Vermögen und lebte in einem Städtchen, nicht allzu weit von London entfernt. Ihr Einkommen ergänzte sie durch gelegentliche journalistische Arbeiten und die Aufzucht von Terriern. Stephens Braut, Valerie Dean, konnte ihr kaum gefährlich werden. Mathilda verstand sich so gut anzuziehen, dass sie damit jeden Mangel ausglich und einen großen Teil der Aufmerksamkeit bei Gesellschaften auf sich zog.
„Natürlich, Liebling, es handelt sich nicht darum, dass ich deine Cousine nicht mag“, sagte Valerie zu Stephen, „aber es ist so unsinnig, sie reizend zu nennen. Weil sie einfach scheußlich ist.“
„Ich habe sie gern. Und momentan wäre mir lieber, du würdest deine reizende, kleine Klappe halten. Ich kann es nicht leiden, beim Fahren angebellt zu werden.“
„Du bist ein gemeiner Hund, Stephen. Liebst du mich?“
„Ja, verdammt noch mal.“
„Nun, es klingt nicht gerade so, als ob du es wirklich tätest. Ich bin hübsch, nicht wahr?“
„Ja, mein kleiner Holzkopf. Du bist reizend — und jetzt hör mit deiner Faselei auf.“
„Oh, ich verstehe nicht, wieso ich mich überhaupt in dich verliebt habe, Liebling. Ich glaube, du bist ein Narr“, sagte sie gurrend.
Er ließ sich zu keiner weiteren Antwort herab, und sie erkannte, dass er schlechte Laune hatte. So vergrub sie das Kinn in den Kragen ihres Pelzmantels und versank in Schweigen.
In Lexham kamen sie zugleich mit Edgar Mottisfont an. Joseph, der zur Vorhalle hinausgetrottet war, begrüßte sie alle drei freudestrahlend, und das Privileg des Mannes von Welt beanspruchend umarmte er Valerie. Miss Dean, die tatsächlich reizend aussah, dünkte sich nicht zu erhaben, auf die Scherze alter Herren einzugehen. Sie richtete ihre großen, blauen Augen auf Joseph und sagte, sie habe erfahren, dass er schrecklich verrucht sei, worüber Joseph sich freute.
„Tag, Stephen“, grüßte Edgar Mottisfont und stieg aus dem Wagen, der ihn vom Bahnhof nach Lexham Manor gebracht hatte.
„Tag“, entgegnete Stephen gleichgültig.
„Das ist ein unerwartetes Vergnügen“, bemerkte Mottisfont.
„Warum?“, fragte Stephen.
„Aber, aber“, schalt Joseph, der dieses Geplänkel mit angehört hatte. „Mein lieber Edgar, kommen Sie herein, kommen Sie doch. Sie müssen ja ganz durchgefroren sein, das heißt, ihr alle! Seht euch den Himmel an! Wir werden weiße Weihnachten haben. Es sollte mich nicht wundern, wenn wir in ein oder zwei Tagen rodeln.“
„Mich bestimmt“, fügte Stephen hinzu und folgte den anderen ins Haus. „Hallo, Mathilda!“
„Ich habe deine angenehme Stimme bereits vernommen“, sagte Mathilda. „Du lässt deine Gunst wieder mal überströmen, mein Lieber!“
Bei dieser Begrüßung machte der harte Zug um Stephens Mund einem Lächeln Platz. Aber als in diesem Augenblick Nathaniel die Halle betrat und ihn nur mit einem Kopfnicken und einem kurzen „Freut mich, dich zu sehen, Stephen“ begrüßte, kehrte der verdrießliche Ausdruck in sein Gesicht zurück.
Nathaniel reichte Miss Dean nur flüchtig die Hand und zog sich danach unverzüglich mit Edgar Mottisfont in sein Arbeitszimmer zurück.
„Erinnern Sie mich gelegentlich daran, dass ich Ihnen einige Hinweise gebe, wie Sie sich mit Onkel Nat gutstellen können“, sagte Mathilda zu Miss Dean.
„Verflucht, halt doch den Mund“, fuhr Stephen sie an. „Mein Gott, ich frage mich, warum bin ich nur gekommen!“
„Wahrscheinlich weil du nicht wusstest, wo du sonst hingehen könntest“, erwiderte Mathilda, und als sie Josephs dümmlich-entsetzten Gesichtsausdruck sah, fügte sie hinzu: „Wenn schon, nun bist du hier, also benimm dich! Wollen Sie jetzt auf Ihr Zimmer gehen, Valerie, oder möchten Sie den Tee?“
Miss Dean, deren Hauptsorge im Leben es war, dass sie schlecht frisiert oder ihr Make-up nicht in Ordnung sein könnte, entschloss sich, ihr Zimmer aufzusuchen. Bei diesem Gespräch entsann sich Joseph plötzlich seiner Frau, aber während er zu ihr ins Wohnzimmer eilte, wurde Valerie schon von Mathilda nach oben gebracht.
Maud erwiderte auf Josephs vorwurfsvolle Frage, warum sie nicht herausgekommen wäre, die Gäste zu begrüßen: „Ich habe hier ein sehr interessantes Buch. Es handelt von der armen Kaiserin von Österreich. Sieh mal, Joseph! Die ist tatsächlich in einem Zirkus geritten.“
Es bestand wenig Hoffnung, dass Maud sich von den Absonderlichkeiten der Kaiserin losreißen würde. Deshalb gab ihr Joseph einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und trippelte wieder geschäftig hinweg, um zunächst die Dienerschaft anzutreiben, sie möge den Tee anrichten. Dann eilte er hinauf zu Valeries Zimmer, klopfte an die Türe und fragte, ob sie einen Wunsch habe.
Der Tee wurde im Salon gereicht. Maud legte „Das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich“ zur Seite und goss ein. Sie saß auf dem Sofa wie die verkörperte schlechte Laune und reichte jedem der Gäste mit dem gleichen mechanischen Lächeln und der gleichen farblosen Begrüßungsformel ihre kleine, plumpe Hand.
Mathilda saß neben ihr und lachte, als sie Mauds Buch sah. „Das letzte Mal, als ich hier war, sind es ,Die Memoiren einer Hofdameʼ gewesen“, neckte sie.
Als Nathaniel mit Edgar Mottisfont eintrat, hob sich Stephen aus einem tiefen Armsessel und sagte ungnädig: „Hier, wenn du dich setzen willst, Onkel!“
Nathaniel erwiderte: „Lass dich nicht stören, mein Junge. Wie ist es dir ergangen?“
„Gut“, antwortete Stephen. Er versuchte höflich zu erscheinen und fügte hinzu: „Du scheinst wohlauf zu sein?“
„Wenn man von diesem verdammten Hexenschuss absieht“, sagte Nathaniel. „Außerdem hatte ich gestern auch einen Ischiasanfall.“
„Mit der Zeit sind solche Dinge unausbleiblich“, bemerkte Mottisfont.
„Unsinn“, warf Joseph ein. „Seht mich an! Wenn ihr beide meinen Rat annehmen wolltet und jeden Morgen vor dem Frühstück regelmäßig ein Dutzend Übungen machtet, würdet ihr euch um zwanzig Jahre jünger fühlen. Kniebeugen — Zehen berühren — tief atmen vor dem offenen Fenster.“
„Sei kein Narr, Joe“, knurrte Nathaniel. „Du kannst für mich meine Zehen berühren.“
„Eine Dosis Salz jeden Morgen würde den meisten Menschen sehr gut tun“, sagte Maud, während sie Stephen eine Tasse Tee reichte.
Nathaniel warf seiner Schwägerin einen feindseligen Blick zu und wandte sich dann unvermittelt an Mottisfont. Mathilda lachte auf. Mauds farblose Augen richteten sich verständnislos auf Mathilda, und ohne das leiseste Anzeichen von Humor meinte sie: „Ich halte Salz wirklich für sehr wohltuend.“
Valerie Dean sah in ihrem Jerseykleid, das ganz genau mit dem Blau ihrer Augen harmonierte, wirklich allerliebst aus. Sie hatte eben Mathildas Tweedkostüm kritisch gemustert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass es Mathilda nicht stand. So wollte sie denn zu Mathilda freundlich sein, rückte ihren Sessel näher an das Sofa heran und begann mit ihr zu plaudern. Stephen, der sich anscheinend wirklich bemühte, nett zu sein, beteiligte sich an der Unterhaltung seines Onkels mit Mottisfont. Und Joseph blickte alle so strahlend an, dass ihm Mathilda wieder zuzwinkerte und sich antrug, ihm nach dem Tee beim Aufhängen der Papierketten zu helfen.
„Ich freue mich, dass du gekommen bist, Tilda“, beteuerte ihr Joseph, als sie behutsam die gebrechliche Stufenleiter hinaufstieg. „Es ist mir ein Herzensbedürfnis, dass bei der Party alles gut geht.“
„Du bist ein Allerweltsonkel, Joe“, sagte Mathilda. „Um Gottes willen, halte die Leiter fest! Warum wolltest du eigentlich dieses Familienfest?“
„Ach, du wirst mich auslachen, wenn ich dir das sage“, antwortete er kopfschüttelnd. „Ich glaube, wenn du das Ende der Kette genau über diesem Bild dort festmachst, wird sie gerade bis zum Luster reichen.“
„Zu Befehl, Herr Weihnachtsmann. Aber warum dieses Familienfest?“
„Nun, meine Liebe, ist jetzt nicht die Zeit, da alle guten Willens sind? Und entwickelt sich nicht alles so, wie man es nur hoffen kann?“
„Das hängt davon ab, was du hofftest“, sagte Mathilda, während sie eine Reißzwecke in die Mauer drückte. „Wenn du mich fragst, dann wird es wahrscheinlich noch einen Mord geben, ehe die Party zu Ende ist. Nats Geduld wird der kleinen Valerie nicht gewachsen sein.“
„Dummes Zeug, Tilda“, wies Joseph sie zurecht. „Dummes Zeug und Unsinn! Das Kind ist ohne Fehl und Tadel. Und fest steht jedenfalls das eine, dass sie zum Fressen hübsch ist.“
Mathilda kam die Leiter herunter. „Ich glaube nicht, dass Nat für Blondinen etwas übrig hat.“
„Das macht nichts! Es spielt keine Rolle, was er letztlich über die arme kleine Val denkt. Hauptsache ist, dass er mit Stephen keinen dummen Streit bekommt.“
„Warum soll er nicht mit Stephen zanken, wenn es ihm Spaß macht?“
„Weil er ihn in Wirklichkeit sehr gerne hat, und weil Stephen es sich nicht leisten kann, mit Nathaniel zu zanken.“
„Sorgen hast du! Oder willst du mir vielleicht sagen, dass sich Nat endlich überwunden hat, ein Testament zu machen? Ist Stephen der Erbe?“
„Du willst zu viel wissen“, wehrte Joseph ab und gab ihr einen freundschaftlichen Klaps.
„Natürlich will ich das wissen. Du tust ja sehr geheimnisvoll.“
„Nein, nein, auf mein Wort, ich tue gar nicht geheimnisvoll. Ich finde nur, dass es von Stephen sehr dumm wäre, weiterhin mit Nat auf schlechtem Fuß zu stehen. Sollen wir diese große Papierglocke unter den Luster hängen, oder glaubst du, ein Armvoll Mistelzweige würde sich besser machen?“
2
Paula Herriard traf im Herrenhaus erst nach sieben Uhr ein, als sich die anderen bereits für das Dinner umzogen. Ihre Ankunft konnte auch den Gästen in den entferntesten Schlafzimmern nicht verborgen bleiben, mit solch ungewöhnlichem Tumult ging sie vor sich. Nicht dass Paulas Auftritte reichlich überlegt gewesen wären: Es war einfach ihre Persönlichkeit, ihre stürmischen Bewegungen wie auch ihr lebhaftes, kleines Gesicht. Mathilda hatte einmal mit freundschaftlicher Bosheit gesagt, Paula scheine schon mit dem Echtheitsstempel der großen Tragödin auf die Welt gekommen zu sein.
Sie war einige Jahre jünger als ihr Bruder Stephen, mit dem sie fast gar keine Ähnlichkeit hatte. Sie war hübsch in einer Art, wie der Maler Burne-Jones sie zu Ende des 19. Jahrhunderts berühmt gemacht hatte: üppiges Haar, eine kurze, volle Oberlippe und dunkle Augen, über denen hochgezogene Brauen eine ständige Unzufriedenheit anzudeuten schienen. Die Rastlosigkeit, die ihr anhaftete, äußerte sich in fahrigen Bewegungen, in dem plötzlichen Aufglühen ihrer lebhaften Augen und dem dürstenden Zug um den Mund. Sie hatte eine wunderbare Stimme — weich und biegsam, ideal zur Gestaltung einer Shakespeare-Rolle. Zweifellos wusste sie diese Stimme entsprechend anzuwenden, dachte Mathilda, die Paula bis auf ihr Zimmer hinauf hörte.
Sie vernahm ihren eigenen Namen. „Im blauen Zimmer? Oh, ich gehe hinauf.“ Mathilda saß zurückgelehnt vor ihrem Ankleidespiegel und erwartete Paulas Eintritt. Eine oder zwei Minuten später hörte sie ein flüchtiges Klopfen an der Tür, und noch ehe sie „Herein“ sagen konnte, war Paula schon eingetreten.
„Mathilda, Liebling!“
„Vorsicht, mein Make-up“, rief Mathilda und entzog sich der Umarmung.
Paula kicherte. „Kindchen, ich freue mich so, dich zu sehen. Wer ist denn überhaupt alles hier? Stephen? Valerie? Oh, dieses Mädchen! Meine Liebe, wenn du das Gefühl kenntest, das ich hier drinnen für sie hege!“ Sie schlug sich bei diesen Worten auf die Brust; in ihren Augen funkelte es für einen Augenblick, aber dann blinzelte sie unter ihren dichten Wimpern, lachte und sagte: „Oh, das hat nichts zu sagen! Übrigens, ich habe Willoughby mitgebracht.“
„Wer ist Willoughby?“
„Willoughby Roydon, er hat ein Stück geschrieben ...“
Es war eigenartig, was diese vibrierende Stimme und diese flatternden Hände alles auszudrücken vermochten. Mathilda fragte: „Oh, ein unbekannter Dramatiker?“
„Bis jetzt. Aber dieses Stück! Die Produzenten sind ja solche Narren! Wir brauchen Unterstützung. Ist Onkel Nat in guter Stimmung? Hat Stephen ihn wieder geärgert? Du musst mir alles sagen, Mathilda, schnell.“
Mathilda legte den Augenbrauenstift beiseite. „Du hast doch deinen Stückeschreiber nicht in der Hoffnung mitgebracht, dass du Nats Herz erobern wirst, Paula, mein armes Mädchen?“
„Er muss es für mich tun“, sagte Paula und warf ungeduldig das Haar zurück. „Es handelt sich um Kunst, Mathilda ...“
„Kunst plus eine Rolle für Paula“, murmelte Mathilda.
„Ja. Eine Rolle. Solch eine Rolle! Sie wurde für mich geschrieben. Er sagt, ich hätte ihn dazu inspiriert.“
„Sonntagsvorstellung und ein Publikum von Intellektuellen. Ich weiß Bescheid.“
„Onkel Nat muss mich anhören! Ich muss die Rolle spielen. Ich muss, Mathilda, verstehst du?“
„Gewiss, Liebste, du musst sie spielen. Doch nur nebenbei — das Dinner wird in etwa zwanzig Minuten aufgetragen.“
„Ach, ich brauche keine zehn Minuten zum Umziehen“, erwiderte Paula ungeduldig.
Paula gab sich mit ihrer Kleidung keinerlei Mühe. Sie hängte sich die Dinge einfach um. Kleider waren nichts weiter als eine Hülle für Paulas dünnen Körper. „Ich finde dich schauderhaft, Paula!“, sagte Mathilda, die wusste, dass sie den Leuten überhaupt nur durch die exquisiten Schöpfungen, die sie trug, auffiel. „Geh weg, ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die so rasch fertig sind. Übrigens: Wo ist dein Stückeschreiber abgeblieben?“
„Was weiß ich. Dieses absurde Getue, als ob das Haus nicht groß genug wäre; Sturry sagte, er würde ihn unterbringen!“
„Schön, solange dein Stückeschreiber nicht weiche Hemden und eine Haarmähne trägt ...“
„Was hat das schon zu sagen?“
„Deinem Onkel Nat würde dies sehr schnell etwas sagen“, prophezeite Mathilda.
Tatsächlich war es auch so. Als man Nathaniel ohne Vorbereitung Willoughby Roydon vorstellte, starrte er ihn und Paula nur an und brachte nicht einmal einige konventionelle Begrüßungsworte über die Lippen. Es blieb Joseph vorbehalten, alles mit seiner überfließenden Freundlichkeit gutzumachen.
Schließlich rettete Sturry, der das Dinner ankündigte, die Situation. Man begab sich in das Speisezimmer. Willoughby Roydon saß zwischen Mathilda und Maud. Letztere interessierte ihn nicht, dafür jedoch Mathilda. Er unterhielt sich mit ihr über die Strömungen des modernen Dramas.
Er war ein kränklicher, junger Mann mit ziemlich unbestimmten Zügen. Mathilda folgte seinen Worten ein wenig unaufmerksam, während sie überlegte, dass er wohl aus Kreisen des Mittelstandes komme. Sicherlich stammte er von ehrenwerten Eltern, denen ihr gescheiter Sohn vielleicht unheimlich geworden war. Er war seiner selbst nicht sicher, feindselig gegenüber der Umwelt aus Mangel an innerem Gleichgewicht. Mathilda tat er leid.
Paula saß neben Nathaniel und erzählte ihm von Roydons Stück. Sie vergaß in ihrem Eifer ganz zu essen und verärgerte Nathaniel, weil sie darauf beharrte, dass er gegen seinen Willen zuhöre.
Valerie, die rechts neben Nathaniel saß, langweilte sich und gab sich gar keine Mühe, dies zu verbergen. Zuerst hatte sie vorgegeben, äußerst interessiert zu sein, und gesagt: „Meine Liebe, wie wunderbar, erzählen Sie mir doch über Ihre Rolle!“ Aber Paula tat sie mit einer geringschätzigen Gebärde ab und hatte dabei einen Ausdruck, wie Stephen ihn immer zeigte. So hatte denn Valerie beschlossen, Paula zu verachten, weil sie ein Kleid trug, das ihr nicht stand, und weil sie ihr Haar so lässig aus dem Gesicht strich.
Es sollte ein schlimmer Abend für Valerie werden. Sie hatte nach Lexham kommen wollen, weil sie wusste, dass Nathaniel sie nicht mochte. Sie hatte an ihrer Fähigkeit, ihn zu erobern, nicht gezweifelt. Aber nicht einmal das Chanel-Modell, das sie trug, vermochte ihm einen bewundernden Blick zu entlocken. Joseph hatte ihr zwar anerkennend zugezwinkert, aber das war für sie ohne Nutzen; schließlich war Joseph kein reicher Erbonkel.
Dass es einen männlichen Gast gab, mit dem sie nicht gerechnet hatte, war wohl aufregend gewesen, aber er schien im Gespräch mit Mathilda völlig aufgegangen zu sein. Valerie fragte sich, was die Männer in Mathilda wohl sahen, und warf ihr einen grollenden Blick zu. In diesem Moment sah Roydon auf, und ihre Augen trafen sich. Er machte den Eindruck, als sähe er sie zum ersten Mal und als sei er ganz überrascht. Er hielt mitten im Satz inne, errötete, nahm aber eilig den Faden seines Gesprächs wieder auf. Valerie begann sich gleich besser zu fühlen.
Joseph, dem Nathaniel heimlich vorwarf, er hätte von Anfang an mit Willoughbys Erscheinen zu viel Nachsicht gezeigt, sagte, er rieche wieder die Sägespäne. Diese Redewendung erweckte in Roydon offensichtlich den Eindruck, Joseph sei Zirkusartist gewesen. Joseph raubte ihm jedoch schnell die Illusion, indem er sagte: „Ich erinnere mich, als ich in Durban einmal den Hamlet spielte ...“
Aber Roydon interessierte sich für Josephs Hamlet nicht. Er tat Shakespeare mit einem Achselzucken ab. Er erklärte, dass er sich Strindberg verpflichtet fühle.
Joseph war deprimiert. Er hätte eine nette, kleine Anekdote über die Zeit, als er in Sidney den Benedick gespielt hatte, zu erzählen gewusst. Aber es sah nicht danach aus, als ob Roydon das schätzen würde. Ein eingebildeter junger Mann, dachte Joseph und aß entmutigt sein Dessert.
Als Maud sich vom Tisch erhob, war Paula gezwungen damit aufzuhören, Nathaniel mit Roydons Stück in den Ohren zu liegen. Sie errötete, weil sie unterbrochen wurde, ging aber mit den anderen Damen hinaus.
Maud ging voraus zum Salon. Es war ein großer, kalter Raum, den zwei Stehlampen in der Nähe des Kamins so schwach erhellten, dass die fernen Ecken des Zimmers im Dunkeln blieben. Paula fröstelte und drehte die Deckenbeleuchtung an. „Ich hasse dieses Haus“, sagte sie, „und es hasst auch uns, man kann es beinahe fühlen.“
„Wie meinen Sie das?“, fragte Valerie und blickte halb furchtsam, halb skeptisch von einer zur anderen.
„Weiß nicht. Ich glaube, irgendetwas ist hier einmal geschehen. Spüren Sie nicht, wie düster alles ist? Nein, ich glaube, Sie können das nicht fühlen.“
„Sie wollen damit doch nicht sagen, dass es hier geistert?“, erkundigte sich Valerie mit leicht bebender Stimme.
„Nein, das meine ich nicht“, erwiderte Paula, „aber es ist irgendetwas — es ist mir immer gegenwärtig. Eine Zigarette, Mathilda?“
Mathilda bediente sich. „Danke, meine Liebe. Sollen wir uns um das Feuer herumsetzen, Kinder, und Geistergeschichten erzählen?“
„Es ist ein Jammer, dass es hier keine Zentralheizung gibt“, bemerkte Maud und rückte ganz nahe ans Feuer.
Valerie begann sich vor dem Spiegel über dem Kamin zu pudern. Paula in ihrer Ruhelosigkeit schlenderte im Zimmer umher, rauchte eine Zigarette und ließ die Asche auf den Teppich fallen.
Mathilda, die sich Maud gegenübersetzte, sagte: „Paula, es wäre besser, wenn du dich bezähmen und Nat mit dem Stück deines jungen Freundes verschonen könntest; dann, glaube ich, würde die Party mit mehr Schwung ablaufen.“
„Das ist mir egal. Für mich ist es lebenswichtig, dass Willoughbys Stück aufgeführt wird.“
„Traum der Liebe?“, Mathilda hob fragend die Brauen.
„Mathilda! Kannst du nicht verstehen, dass Liebe damit nichts zu tun hat? Es geht um die Kunst!“
Maud hatte indessen wieder ihr Buch aufgeschlagen und sagte: „Stellt euch vor, die Kaiserin war erst sechzehn, als Franz Joseph sich in sie verliebte.“
„Welche Kaiserin?“, erkundigte sich Paula, blieb in der Mitte des Raumes stehen und sah Maud an.
„Die Kaiserin von Österreich, meine Liebe. Irgendwie kann man sich Franz Joseph gar nicht als jungen Mann vorstellen, nicht wahr? Aber es heißt hier, dass er sehr gut aussah und sie sich auf den ersten Blick in ihn verliebte.“
„Was in aller Welt hat das mit Willoughbys Stück zu tun?“, fragte Paula verständnislos.
„Nichts, meine Liebe; aber ich lese gerade ein sehr interessantes Buch.“
„Das aber mich nicht interessiert“, gab Paula zurück und nahm ihren Gang durch das Zimmer wieder auf.
„Mach dir nichts draus, Maud“, beschwichtigte Mathilda. „Paula betrachtet alles nur von ihrer Warte aus, und Manieren hat sie auch keine. Erzähl mir noch etwas über deine Kaiserin.“
„Ein armes Ding“, berichtete Maud. „Die Schwiegermutter scheint eine sehr unfreundliche Frau gewesen zu sein. Sie wollte ihren Sohn mit Helene verheiraten.“
„Wer war Helene?“
Maud konnte Mathilda gerade noch über Helene aufklären, da kamen die Herren in den Salon.
Es war offenkundig, dass Nathaniel nicht den passenden Gesellschafter gefunden hatte. Allem Anschein nach war er von Roydon mit Beschlag belegt worden, denn er warf mehrere wütende Blicke auf den Dramatiker und zog sich so weit er nur konnte aus dessen Bereich zurück. Mottisfont nahm neben Maud Platz, und Stephen, der mit seinem Onkel mitzufühlen schien, überraschte jedermann durch die Liebenswürdigkeit, mit der er ihn in die Unterhaltung zog.
„Ich bin sprachlos — Stephen entwickelt sich zum Kavalier“, murmelte Mathilda.
Joseph legte beschwörend einen Finger auf die Lippen. Als er sah, dass Nathaniel ihn dabei beobachtet hatte, beeilte er sich, etwas überlaut zu sagen: „Nun, wer spielt Rommé“
Niemand reagierte. Einige, besonders Nathaniel, sahen empört auf; und nach einer Pause fragte Joseph ein wenig entmutigt: „Also, was soll es sein?“
„Mathilda“, Nathaniel fixierte sie, „spiele mit uns als vierte Bridge.“
„Mach ich“, stimmte Mathilda zu. „Wer spielt noch mit?“
„Stephen und Mottisfont. Wir werden in der Bibliothek einen Tisch aufstellen, und die anderen können tun, was ihnen Spaß macht.“
Joseph sagte: „Niemand wird euch ernste Leute stören. Und wir Leichtfertigen können närrisch sein, so viel wir wollen.“
„Mit mir können Sie nicht rechnen“, verkündete Roydon, „ich kann eine Karte von der anderen nicht unterscheiden.“
„Oh, Sie werden es bald begreifen“, versicherte ihm Joseph. „Maud, meine Liebe, ich nehme an, dich können wir zu einem Spiel nicht verlocken?“
„Nein, Joseph, ich möchte eine Patience legen“, erwiderte Maud.
Valerie war keineswegs erfreut zu hören, dass ihr Bräutigam den Abend damit verbringen sollte, Bridge zu spielen. Sie schenkte Roydon ein betörendes Lächeln und sagte: „Ich kann es einfach nicht erwarten, Sie über Ihr Stück auszufragen. Kommen Sie, und erzählen Sie mir alles darüber.“
Da Willoughby sich durch Nathaniels mangelnde Anerkennung verletzt fühlte, gesellte er sich sogleich zu ihr. So blieb für Josephs Gesellschaftsspiel nur Paula übrig. Er schien nun die Unmöglichkeit, unter solchen Umständen etwas Vernünftiges erfolgreich zu organisieren, einzusehen und setzte sich, um seiner Frau beim Patiencelegen zuzusehen.
Nachdem Paula einige Zeit im Zimmer herumgegangen war und sich gelegentlich in Roydons Unterhaltung mit Valerie eingemischt hatte, warf sie sich auf ein Sofa und begann eine Illustrierte durchzublättern. Joseph rückte bald zu ihr und sagte in vertraulichem Ton: „Erzähl doch deinem alten Onkel: Was ist es für ein Stück? Eine Komödie, eine Tragödie?“
„Es lässt sich nicht so abstempeln. Es ist eine äußerst subtile Charakterstudie. Es gibt keine andere Rolle auf der Welt, die ich lieber spielen würde. Sie ist für mich geschrieben. Die Rolle bin ich.“
„Ich weiß genau, was du meinst“, sagte Joseph mitfühlend. „Ach, wie oft hat man solches erlebt. Sicherlich findest du es komisch, dir deinen alten Onkel auf den Brettern vorzustellen, aber als ich ein junger Mensch war, schockierte ich meine ganze Verwandtschaft damit, dass ich den ehrenwerten Beruf eines Anwalts an den Nagel hängte und mich einer Wanderbühne anschloss. Aber ich habe es niemals bereut. Niemals.“
„Ich wollte, du könntest Onkel Nat veranlassen, mir vernünftig zuzuhören“, sagte Paula unzufrieden.
„Ich werde es versuchen, meine Liebe. Aber du weißt, wie Nat ist. Ein lieber, alter Querkopf. Er ist der beste Mensch, den man sich vorstellen kann, aber er hat seine Vorurteile.“
„Zweitausend Pfund würden für ihn gar nichts bedeuten. Ich sehe nicht ein, warum ich das Geld nicht jetzt haben kann, wenn ich es brauche, anstatt warten zu müssen, bis er stirbt.“
„Schlimmes Mädchen! Du rechnest mit deinen Küken, bevor sie ausgeschlüpft sind.“
„Nein. Er sagte mir, er würde mir Geld vermachen. Abgesehen davon, er muss es: Ich bin seine einzige Nichte.“
Maud hatte ihre Diplomaten-Patience zu einem großartigen Abschluss gebracht und kam auf die Idee, plötzlich vorzuschlagen, dass Paula etwas rezitieren möge. „Ich liebe gute Rezitationen“, sagte sie.
Paula erklärte, sie wolle nichts vortragen, aber wenn Onkel Nat sich nicht dazu entschlossen hätte, Bridge zu spielen, würde sie Willoughby gebeten haben, sein Stück vorzulesen.
„Das wäre sehr nett gewesen“, sagte Maud.
Es gehörte nicht zu Nathaniels Gewohnheiten, bis spät in die Nacht hinein aufzubleiben. Um elf Uhr kamen die Bridgespieler wieder in den Salon, wo für sie Getränke aufgetragen worden waren. Nathaniel sagte jedoch, er für seinen Teil begebe sich zu Bett.
Edgar Mottisfont wagte vorzubringen: „Ich hatte gehofft, mit dir noch allein sprechen zu können, Nat.“
„Zu so vorgerückter Stunde pflege ich keine geschäftlichen Besprechungen abzuhalten!“
„Ich hätte dich auch gern noch gesprochen“, sagte Paula.
„Ach, wirklich?“, erwiderte Nathaniel mit einem kurzen Auflachen.
Maud legte ihre Karten zusammen. „Du lieber Gott, schon elf Uhr? Ich glaube, ich werde auch hinaufgehen.“
Valerie war bestürzt über die Aussicht, sich zu einer so ungewöhnlichen Stunde schon zurückziehen zu müssen, hörte aber zu ihrer Erleichterung Joseph sagen: „Nun, ich hoffe, jetzt wird niemand mehr davonlaufen. Die Nacht ist noch zu jung. Stimmt's, Valerie? Wie wär's, wenn wir ins Billardzimmer gingen und dort das Radio andrehten?“
„Du wärst im Bett viel besser aufgehoben“, sagte Nathaniel, der Josephs Unternehmungslust gereizt zur Kenntnis nahm.
„Nein“, erklärte Joseph. „Und dir sage ich, Nat, auch du würdest dich mit uns viel besser unterhalten.“
Sein böser Geist hieß ihn, dem Bruder bei diesen Worten auf die Schulter zu klopfen. Jedermann konnte sehen, dass der leichte Klaps zwischen Nats Schultern gegangen war, aber Nathaniel, der es hasste, berührt zu werden, stöhnte plötzlich auf und stieß hervor: „Mein Hexenschuss!“
Wie ein Krüppel verließ er den Raum und hielt die Hand auf das Kreuz – in einer Geste, die seine Verwandten gut kannten, die aber Valerie veranlasste, ihre lieblichen Augen weit aufzureißen und zu sagen: „Ich hatte keine Ahnung, dass ein Hexenschuss so schlimm ist.“
„Das ist er auch nicht, das ist bloß mein lieber Onkel Nat, der übertreibt“, sagte Stephen, während er Mathilda einen Whisky-Soda reichte.
„Nein, nein, das ist nicht nett“, protestierte Joseph. „Ich frage mich, ob ich ihm nicht nachgehen soll.“
„Nein, Joe“, beschwichtigte ihn Mathilda freundlich. „Du meinst es gut, aber du wirst ihn nur verärgern. Warum blickt unsere kleine Paula wie die tragische Muse?“
„Dieses schreckliche Haus“, stieß Paula hervor. „Wie könnt ihr auch nur eine Stunde darin verbringen und nicht die Atmosphäre fühlen ...“
„Bete um die ewige Ruhe für Mrs. Siddons“, sagte Stephen.
„Ach, du kannst leicht spotten“, fuhr sie auf ihn los, „aber sogar du musst doch die Spannung fühlen.“
„Ich halte nichts von Spiritismus und ähnlichem, aber ich verstehe, was Paula meint“, sagte Valerie an Stephen gewandt. „Es ist so eine Art Atmosphäre. Sie könnten ein herrliches Stück darüber schreiben, Mr. Roydon.“
„Ich weiß nicht, ob das auf meiner Linie liegt“, erwiderte er.
„Oh, ich bin fest davon überzeugt, dass Sie ein Mensch sind, der auch über das Simpelste ein herrliches Stück schreiben kann“, beteuerte Valerie.
„Auch über Meerschweinchen?“, fragte Stephen und brachte damit einen Misston ins Gespräch.
Der Dramatiker errötete. „Sehr lustig.“
Mathilda bemerkte, dass Mr. Roydon nicht gewohnt war, ausgelacht zu werden. „Am besten beachten Sie meinen Cousin Stephen nicht.“
Stephen kümmerte sich niemals darum, was Mathilda sagte; er grinste nur. Aber Joseph brachte den hämischen Ausdruck wieder in Stephens Züge zurück, als er sagte: „Och, wir alle wissen, was unser alter Bär Stephen gern vorgibt zu sein.“
„Mein Gott!“, sagte Stephen mit Nachdruck.
Paula sprang auf und warf mit einer hastigen Geste das Haar aus der Stirn. „Das ist es, was ich meine. Ihr benehmt euch alle so, weil euch dieses Haus befangen macht. Es ist die Spannung: Etwas dehnt sich und dehnt sich, bis es reißt. Mit Stephen ist es immer viel schlimmer, wenn er sich hier aufhält; ich bin am Rande; Valerie flirtet mit Willoughby, um Stephen eifersüchtig zu machen; Onkel Joe ist nervös und sagt immer das Verkehrte.“
„Ja, wahrhaftig“, rief Valerie aus, „es ist wirklich so.“
Roydon sagte gedankenvoll: „Ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ich persönlich glaube sehr an den Einfluss der Umgebung.“ Joseph schlug die Hände zusammen. „Nun ist es aber wirklich genug. Was gibt es im Radio?“
„Ja, fein, drehen Sie es an“, bat Valerie. „Jetzt wird gerade Tanzmusik sein. Mr. Roydon, ich bin überzeugt, Sie tanzen gerne.“
Willoughby widersprach, ließ sich aber wegziehen. Valeries Schönheit blendete ihn ein wenig, und obgleich eine vernünftige innere Stimme ihm sagte, dass ihre Schmeichelei leer war, empfand er sie als nicht unangenehm. Er ging also mit Valerie und Joseph.
„Ich muss sagen, ich verurteile Onkel Nat nicht, wenn er deine Braut ignoriert, Stephen“, sagte Paula unverblümt.
Stephen schien sich an dieser offenen Äußerung über seinen Geschmack nicht zu stoßen. Er schlenderte zum Kamin und versenkte seine langen Glieder in einem Armsessel. „Ich halte deine neueste Eroberung auch nicht gerade für weltbewegend“, sagte er.
„Willoughby?“, fragte sie. „Oh, ich weiß, aber er ist genial. Ich kümmere mich um sonst nichts. Nebenbei, ich bin nicht in ihn verliebt. Aber was du in dieser hirnlosen Pute siehst, ist mir unbegreiflich.“
„Mein liebes Kind, was ich in ihr sehe, muss jedem vollauf klar sein“, entgegnete Stephen. „Diese stückeschreibende Talggeschwulst hat es auch bereits erkannt. Nicht zu vergessen Joe, dem ja förmlich das Maul wässert.“
„Lass die Herriards aus dem Spiel“, wies ihn Mathilda zurecht und lehnte sich in ihrem Sessel zurück, während sie träge die beiden Geschwister betrachtete. „Ihr seid beide gemeine Menschen.“
„Wirklich? Ich glaube, ich bin nur aufrichtig“, sagte Paula. „Du bist ein Narr, Stephen. Sie würde sich mit dir nie verlobt haben, wenn sie nicht annähme, dass du einmal den ganzen Besitz Onkel Nats erben wirst.“
„Ich weiß“, gestand Stephen freimütig.
„Und wenn du mich fragst, dann sage ich dir: Sie ist nur mit dir hierhergekommen, um Onkel Nat schwach zu machen.“
„Ich weiß“, sagte Stephen wieder.
Ihre Blicke trafen sich. Stephens Lippen kräuselten sich plötzlich, und während Mathilda zurückgelehnt dasaß und sie beobachtete, begannen er und Paula mit einem Mal heftig zu lachen.
„Du und dein Willoughby, und ich und meine Val“, keuchte Stephen. „Oh, du meine Güte.“
„Ja, ich weiß, es ist komisch“, sagte Paula, „aber ich meine es ernst mit dieser Sache, weil er ein wirklich großartiges Stück geschrieben hat. Und ich werde die Hauptrolle darin spielen. Ich werde ihn dazu überreden, es morgen allen vorzulesen.“
„Und du glaubst wirklich, du armes, törichtes Frauenzimmer, dass dieser intellektuelle Ohrenschmaus das Herz deines Onkels Nat betören wird?“, fragte Mathilda. „Jetzt bin ich an der Reihe zu lachen.“
„Er muss das Stück finanzieren“, sagte Paula. „Es ist das einzige, das ich jemals verlangt habe, und es wäre grausam, wenn er es nicht für mich täte. Außerdem habe ich Onkel Joe dazu gebracht, ein Wort für mich einzulegen.“
„Das wird wahnsinnig viel helfen“, spottete Stephen. „Sieh mal einer an!“
„Lass Joe aus dem Spiel“, befahl Mathilda. „Er mag ein Esel vor dem Herrn sein, aber er ist das einzige anständige Mitglied deiner Familie, dem zu begegnen ich je das Vergnügen hatte. Außerdem mag er dich.“
„Aber ich mag nicht, dass er mich mag“, sagte Stephen.
3
Am vierundzwanzigsten Dezember bedeckte eine dünne Schneeschicht die Landschaft. Mathilda nahm ihren Frühstückstee im Bett ein. Sie musste lächeln, weil sie fest überzeugt war, dass Joseph den ganzen Tag von weißen Weihnachten sprechen und vielleicht sogar ein Paar Schlittschuhe suchen würde.
Langsam verzehrte sie die dünnen Butterschnitten, die mit dem Tee serviert worden waren. Was in aller Welt hatte Stephen nur veranlasst, nach Lexham zu kommen? Gewöhnlich kam er, wenn er etwas wollte: Geld natürlich, das ihm Nathaniel fast immer gab. Dieses Mal aber war es Paula, die Geld wollte, und Stephen ganz offensichtlich nicht. Soweit sie wusste, hatte Stephen vor gar nicht allzu langer Zeit einen ziemlich ernsthaften Streit mit Nathaniel gehabt. Natürlich war es nicht ihr erster Streit gewesen. Sie stritten ja immer miteinander, aber der Grund des letzten Streites — Valerie — existierte noch. Seltsam, dass es Joseph doch gelungen sein sollte, Nathaniel dazu zu überreden, Valerie zu empfangen. Oder glaubte Nathaniel etwa, Stephens Vernarrtheit würde sich von selbst legen? Sie rief sich sein Gehabe am gestrigen Abend ins Gedächtnis zurück und musste sich eingestehen, dass dies sehr wahrscheinlich eintreten würde, wenn es nicht schon soweit war.
Valerie selbst sah sich natürlich bereits als Herrin von Lexham; schreckliche Aussichten! Allein den Gedanken fand Mathilda kurios. Seltsam auch, dass Stephen es riskiert hatte, Valerie zu Nathaniel zu bringen. Genug, um alle seine Chancen, Nathaniels Vermögen einmal zu erben, zu zerstören, sollte man annehmen. Und Stephen betrachtete sich als Nathaniels Erben. Manchmal fragte sich Mathilda, ob Nat sein Testament überhaupt gemacht hatte, denn sie kannte seine unverständliche Abscheu, den Namen seines Nachfolgers zu nennen.
Und Paula: Was bedeutete all der Unsinn über die unheimliche Atmosphäre im Haus? Meinte sie das ehrlich, oder wollte sie damit in dem Hühnerverstand Valeries einen Widerwillen gegen diesen Besitz erwecken? Wenn etwas nicht stimmte, dann lag das nicht an dem Haus, sondern an den Menschen darin. Gut, es war hier unbehaglich, aber was berechtigte Paula, es noch schlimmer zu machen? Wunderliches, flammengleiches Geschöpf. Sie lebte unter einem starken Druck, wünschte sich manche Dinge so leidenschaftlich und konnte ihre ungebärdigen Gefühle doch so beherrschen, dass man nie recht wusste, wann man die wahre Paula vor sich hatte und wann die unbewusste Schauspielerin.
Der Dramatiker: Mathilda, die an sich nicht sentimental war, hatte Mitleid mit ihm. Vielleicht war ihm niemals eine richtige Chance gegeben worden. Es schien ihm nicht besonders gut zu gehen: Das Sakko seines Abendanzuges war schlecht geschnitten und hatte starke Glanzstellen. Armer Teufel! Es lag etwas Verschrecktes hinter dem kriegerischen Aufleuchten in seinen Augen, so als sähe er eine freudlose Zukunft vor sich liegen. Er hatte versucht Nathaniel zu interessieren, war dabei teils in Furcht gewesen, unterwürfig zu erscheinen, und teils von der verzweifelten Notwendigkeit getrieben worden, Unterstützung zu gewinnen. Er würde aus Nathaniel natürlich nicht einen Penny herausholen!
Stephen: Mathilda rührte energisch in ihrer Teeschale, während ihre Gedanken auf Stephen übergingen. Ein Querkopf wie sein Onkel Nathaniel. Ja, aber er war kein Narr, und doch hatte er sich mit einer schönen Gans verlobt. Man konnte all die Schrullen Stephens nicht allein der argen Enttäuschung in seiner Kindheit zuschreiben. Oder doch? Stephen hatte als Kind auch eine unbeständige Person angebetet, nämlich seine Mutter, der Paula so unähnlich war, die sich über „Kätzchen“ nie Illusionen hingegeben hatte.
„Kätzchen.“ Sogar ihre Kinder hatten sie so genannt. Armes kleines Kätzchen, in der Witwentracht, die ihr so gut gestanden hatte. Liebliches kleines Kätzchen, das man vor den Stößen dieser grausamen Welt schützen musste. Gescheites kleines Kätzchen, das nicht nur einmal, sondern dreimal geheiratet hatte, und das nun eine Mrs. Cyrus P. Thanet war und ihre Nerven und Neigungen in Chicago pflegte! Ja, vielleicht war Stephen, der sie so widerstrebend durchschaut hatte und dem es sehr nahe gegangen war, durch diese Entdeckung verbittert.
Und Valerie? Mathilda unterdrückte entschieden einen Impuls, sie als eine zu bezeichnen, die nur auf Geld aus war. Vielleicht war sie gerade von Eigenheiten Stephens angezogen worden, die sie sehr bald anwidern würden: seine rücksichtslose Rohheit, seine Grobheit, sein gleichgültiger, hämischer Blick in den tiefliegenden, grauen Augen.
Mathilda fragte sich, was Maud über all das denken mochte, wenn sie überhaupt etwas dachte; eine Frage, die bis jetzt noch nicht entschieden war. Mathilda hatte das Gefühl, dass es für Maud mehr geben musste, als sie zu erkennen gab. Kein Geist konnte so gänzlich indifferent sein. Sie selbst hatte manchmal geglaubt, Maud maskiere mit ihrer Gleichgültigkeit sehr viel Intelligenz. Aber sobald sie Maud aus müßiger Neugierde auf die Probe stellte und sie aus ihrer Reserve locken wollte, verschanzte sich Maud hinter ihrer Nichtigkeit, in die sie sich so geschickt einschachtelte. Es sah aus, als hätte sie sich damit abgefunden, ein geduldeter Gast im Hause ihres Schwagers zu sein.