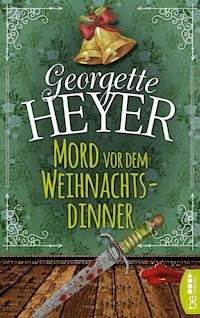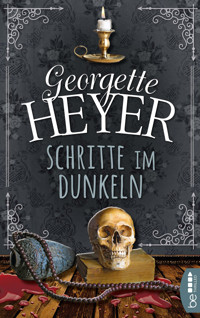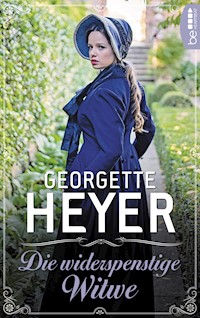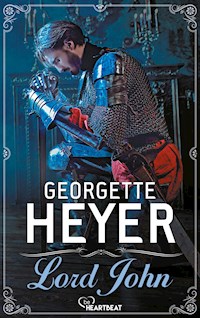6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgette-Heyer-Krimis
- Sprache: Deutsch
England, 1938: Der wohlhabende Ernest Fletcher wird erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Wer könnte einen Grund haben, den allseits beliebten Gentleman auf so brutale Art und Weise zu töten? Superintendent Hannasyde von Scotland Yard beginnt zu ermitteln und entdeckt schon bald, dass sich hinter der respektablen Fassade des Ermordeten tiefe moralische Abgründe auftun. Als ein zweites Opfer gefunden wird, muss sich Hannasyde fragen, ob es zwischen den Morden eine Verbindung gibt, denn die Ähnlichkeiten in beiden Fällen sind überwältigend ...
Georgette Heyer auf den Spuren Agatha Christies - jetzt als eBook bei beTHRILLED.
"Scharfsinnig, elegant und amüsant." New Yorker
"An Heyers Figuren und Dialogen habe ich immer wieder meine helle Freude." Dorothy L. Sayers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Über dieses Buch
Superintendent Hannasyde muss einen Doppelmord aufklären: Beide Opfer wurden mit einem stumpfen Gegenstand getötet, doch während der eine Tote aus wohlhabenden Verhältnissen stammt, handelt es sich bei dem anderen um einen kleinen Ganoven. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt waren. Hannasyde, der große Psychologe, muss zu höchst eigenwilligen Methoden greifen …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Ein Mord mit stumpfer Waffe
Aus dem Englischen von Ulla Hengst
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der Originalausgabe: A Blunt Instrument
© 1938 by Georgette Heyer, Copyright © renewed 1966
by Georgette Rougier
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© 1973 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © istockpoto.com: sqback | cobalt | CyberKristiyan
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4324-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Ein leichter Wind, kaum mehr als ein Hauch, bewegte die Vorhänge zu beiden Seiten der Fenstertür und wehte den Duft der Wistarien herein, die sich an der Hausmauer emporrankten. Der Polizist wandte den Kopf, als er das schwache Rascheln des Stoffes hörte, und in seine glasigen blauen Augen trat ein finsterer, argwöhnischer Ausdruck. Er richtete sich auf – bisher hatte er in gebeugter Haltung neben einem Mann gestanden, der mitten im Zimmer an einem geschnitzten Schreibtisch saß –, ging zum Fenster und spähte in den dämmerigen Garten hinaus. Seine Stablampe erforschte die Schatten zweier blühender Sträucher, ohne jedoch mehr zu enthüllen als eine Katze, deren Augen den Lichtstrahl eine Sekunde lang auffingen und reflektierten, bevor das Tier im Gebüsch verschwand. Sonst rührte sich nichts im Garten, und nach einem langen, prüfenden Blick kehrte der Polizist zum Schreibtisch zurück. Der Mann, der dort saß, nahm keine Notiz von ihm, denn er war tot, wie der Polizist bereits festgestellt hatte. Sein Kopf lag auf der offenen Schreibmappe, und in dem glatten, pomadisierten Haar klebte geronnenes Blut.
Der Polizist holte tief Luft. Er war sehr blass, und die Hand, die er jetzt nach dem Telefon ausstreckte, zitterte ein wenig. Mr. Ernest Fletchers Schädel war seltsam verformt; unter den Blutgerinnseln war eine Einbuchtung zu erkennen.
Die Hand des Polizisten machte auf halbem Weg plötzlich halt. Der Mann zog sie hastig zurück, tastete nach seinem Taschentuch, wischte sich damit einen Blutfleck vom Handrücken und nahm dann erst den Telefonhörer ab.
In diesem Moment näherten sich Schritte dem Zimmer. Der Polizist, noch immer mit dem Hörer in der Hand, blickte zur Tür. Sie öffnete sich, und ein Butler, ein Mann in mittleren Jahren, kam herein. Er trug ein Tablett, auf dem ein Siphon, eine Karaffe mit Whiskey und ein paar Gläser standen. Beim Anblick des Polizisten zuckte der Mann erschrocken zusammen. Dann entdeckte er die zusammengesunkene Gestalt seines Herrn. Ein Becherglas rutschte klirrend gegen die Karaffe, aber Simmons ließ das Tablett nicht fallen. Er hielt es mechanisch fest, während er auf Ernest Fletchers Rücken starrte.
Polizist Glass nannte die Nummer des Polizeireviers. Seine monotone, gleichmütige Stimme lenkte Simmons’ Augen wieder auf sein Gesicht. »Mein Gott, ist er tot?«, fragte er im Flüsterton.
Ein strenger Blick traf ihn. »Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen«, sagte Glass feierlich.
Simmons gehörte derselben Sekte an wie Polizist Glass und begriff daher diese Ermahnung besser als der Beamte in der Vermittlung, der ziemlich gereizt reagierte. Während das Missverständnis aufgeklärt und die Nummer des Reviers wiederholt wurde, setzte Simmons das Tablett ab und näherte sich zaghaft dem Leichnam seines Herrn. Als er den zerschmetterten Schädel sah, wich er entsetzt zurück und wurde kreidebleich. »Wer war es?«, fragte er mit zitternder Stimme.
»Das werden andere herausfinden müssen«, erwiderte Glass. »Darf ich Sie bitten, Mr. Simmons, die Tür zu schließen?«
»Wenn’s Ihnen recht ist, Mr. Glass, möchte ich sie von draußen schließen«, sagte der Butler. »Es ... es war ein furchtbarer Schock für mich, und ich fühle mich hundsmiserabel.«
»Sie bleiben hier, bis ich Ihnen pflichtgemäß einige Fragen gestellt habe«, ordnete Glass an.
»Aber ich kann Ihnen nichts, gar nichts sagen! Ich habe doch keine Ahnung, was hier passiert ist.«
Glass hörte nicht auf ihn, denn inzwischen hatte sich das Polizeirevier gemeldet. Simmons schluckte, ging zur Tür, schloss sie und blieb neben ihr stehen, so dass nur noch Ernest Fletchers Schultern für ihn sichtbar waren.
Nachdem Polizist Glass seinen Namen und Aufenthaltsort genannt hatte, teilte er dem Sergeant mit, er habe einen Mord zu melden.
Diese Polizisten, dachte Simmons, empört über die Gelassenheit, mit der Glass sprach. Der Kerl tat ja, als wären Leichen mit zertrümmertem Schädel so alltäglich wie Gänseblümchen. Wie konnte ein Mensch es fertig bringen, seelenruhig neben einem Toten zu stehen, praktisch auf Tuchfühlung mit ihm, und so sachlich wie ein Zeuge vor Gericht von dem grässlichen Fund berichten, während er den Ermordeten ohne eine Spur von Anteilnahme betrachtete? Jedem normal empfindenden Menschen musste sich doch bei diesem Anblick der Magen umkehren.
Glass legte den Hörer auf und steckte das Taschentuch ein. »Siehe, dies ist der Mann, der seines Lebens Kraft nicht in dem Herrn sah, sondern auf seinen Reichtum baute«, verkündete er düster.
Simmons, aus seinen Gedanken gerissen, ließ ein zustimmendes Grunzen hören. »Da haben Sie recht, Mr. Glass. Weh der Krone des Stolzes! Aber wie ist es eigentlich geschehen? Wieso sind Sie hier? Ach, du lieber Himmel, nie hätte ich geglaubt, dass ich einmal in etwas so Schreckliches verwickelt werden würde.«
»Ich bin durch den Garten gekommen«, sagte Glass mit einer Kopfbewegung zur Fenstertür hin. Er zog ein Notizbuch und einen Bleistiftstummel aus der Tasche und setzte eine dienstliche Miene auf. »Also bitte, Mr. Simmons.«
»Es ist zwecklos, mich zu fragen. Ich sage Ihnen doch, dass ich nichts über die Sache weiß.«
Die offensichtliche Erregung des Butlers ließ Glass kalt. »Sie wissen zumindest, wann Sie Mr. Fletcher das letzte Mal lebend gesehen haben.«
»Das war wohl, als ich Mr. Budd zu ihm hineinführte«, antwortete Simmons nach kurzem Zögern.
»Um welche Zeit?«
»Ich weiß nicht – nicht auf die Minute genau, meine ich. Etwa vor einer Stunde.« Er dachte angestrengt nach und fügte hinzu: »So gegen neun. Ich war gerade dabei, den Tisch im Speisezimmer abzuräumen, also kann es nicht viel später gewesen sein.«
Ohne von seinem Notizbuch aufzusehen, fragte Glass: »Dieser Mr. Budd – kennen Sie ihn?«
»Nein. Meines Wissens habe ich ihn nie zuvor gesehen.«
»Aha. Wann ging er fort?«
»Keine Ahnung. Bis eben wusste ich überhaupt nicht, dass er schon fort war. Er muss durch den Garten gegangen sein, genauso wie Sie hereingekommen sind, Mr. Glass.«
»War das üblich?«
»Teils ja, teils nein, wenn Sie wissen, was ich meine«, erwiderte Simmons.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte Glass unnachgiebig.
Simmons stieß einen Seufzer aus. »Manche Besucher betraten Greystones auf diesem Weg. Frauen, Mr. Glass.«
»Die verlassen die geraden Pfade, um auf dunklen Wegen zu gehen«, zitierte Glass und sah sich missbilligend in dem gut eingerichteten Zimmer um.
»So ist es, Mr. Glass. Wie oft habe ich im Gebet gerungen ...« Er verstummte, als die Tür sich plötzlich öffnete. Weder er noch Glass hatten Schritte gehört, und so konnten sie nicht verhindern, dass ein schlanker junger Mann hereinkam. Er trug einen schlecht sitzenden Smoking. Beim Anblick des Polizisten blieb er stehen. Seine Augenlider mit den langen Wimpern zuckten; dann lächelte er entschuldigend.
»O Pardon«, sagte er. »Merkwürdig, Sie hier zu treffen.«
Seine Stimme war tief; er sprach leise und sehr schnell, so dass es nicht leicht war, ihn zu verstehen. Eine dunkle Haarsträhne hing ihm in die Stirn. Er trug ein plissiertes Hemd mit einer liederlich gebundenen Smokingschleife und sah für den Polizisten Glass wie ein Dichter aus.
Die gemurmelte Bemerkung des jungen Mannes ließ Glass stutzig werden. »Merkwürdig, mich hier zu treffen?« wiederholte er fragend. »Dann kennen Sie mich also, Sir?«
»O nein«, sagte der andere. Sein unruhig im Zimmer umherschweifender Blick fiel auf Ernest Fletchers reglose Gestalt. Er ließ den Türknopf los, ging auf den Schreibtisch zu und wurde blass. »Es wäre höchst unmännlich, wenn mir jetzt übel würde, nicht wahr? Was tut man nur in solchen Fällen?« Er sah zuerst Glass, dann Simmons auskunftheischend an, begegnete jedoch verschlossenen Mienen. Auf einmal entdeckte er das Tablett, das Simmons auf ein Tischchen gestellt hatte. »Ja, das ist es, was man tut«, sagte er und schenkte sich viel Whiskey mit wenig Soda ein.
»Der Neffe meines Herrn – Mr. Neville Fletcher«, beantwortete Simmons die stumme Frage, die er in den Augen des Polizisten las.
»Sie wohnen hier im Haus, Sir?«
»Ja, aber ich mag keine Morde. So unkünstlerisch, finden Sie nicht auch? Außerdem passiert so etwas nicht.«
»Dieser Mord ist passiert, Sir«, sagte Glass leicht verwundert.
»Das regt mich ja gerade so auf. Morde kommen nur bei anderen Leuten vor, nicht in der eigenen Familie. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Nein, wahrscheinlich nicht. Da hält man sich für wer weiß wie erfahren, aber niemand und nichts hat einen je gelehrt, mit einer so bizarren Situation fertig zu werden.«
Das Lachen, mit dem er seine Rede beschloss, klang unsicher; zweifellos war er erschüttert, so unbekümmert er sich auch gebärdete. Der Butler betrachtete ihn erstaunt und wandte sich dann Glass zu, der ebenfalls den jungen Mann angestarrt hatte, nun aber die Spitze seines Bleistifts mit der Zunge anfeuchtete und fragte: »Bitte, Sir, wann haben Sie Mr. Fletcher zuletzt gesehen?«
»Beim Dinner. Im Speisezimmer, meine ich. Nein, genau genommen nicht im Speisezimmer, sondern in der Diele.«
»Entscheiden Sie sich, Sir«, empfahl der unerschütterliche Glass.
»Ja, so war es. Nach dem Dinner wollte er in sein Arbeitszimmer gehen, also hier hinein, und mich zog es ins Billardzimmer. Wir trennten uns in der Diele.«
»Wann war das, Sir?«
Neville zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Nach dem Dinner. Wissen Sie es, Simmons?«
»Mit Sicherheit kann ich es auch nicht sagen, Sir. Der Herr verließ das Speisezimmer im Allgemeinen um zehn Minuten vor neun.«
»Und danach haben Sie Mr. Fletcher nicht mehr gesehen?«
»Nein«, antwortete Neville. »Nicht, bis ich hier hereinkam. Haben Sie noch Fragen, oder darf ich mich jetzt zurückziehen?«
»Wir würden Zeit sparen, Sir, wenn Sie mir sagen könnten, was Sie zwischen ungefähr acht Uhr fünfzig, als Sie mit dem Verstorbenen das Speisezimmer verließen, und zehn Uhr fünf getan haben.«
»Ich war im Billardzimmer und habe ein bisschen gespielt.«
»Allein, Sir?«
»Ja, bis meine Tante kam, um mich zu holen.«
»Ihre Tante?«
»Miss Fletcher«, warf der Butler ein. »Die Schwester meines Herrn, Mr. Glass.«
»Sie verließen das Billardzimmer in Begleitung Ihrer Tante, Sir? Blieben Sie danach mit ihr zusammen?«
»Nein. Da können Sie wieder mal sehen, dass Höflichkeit sich immer auszahlt. Ich habe mich still und heimlich verdrückt, und das tut mir jetzt sehr leid. Wäre ich nämlich bei ihr im Wohnzimmer geblieben, dann hätte ich ein hieb- und stichfestes Alibi. Aber ich war oben in meinem Zimmer und las. Vielleicht bin ich über dem Buch eingeschlafen, und dies alles ist nur ein Traum?« Er blickte zweifelnd auf den Stuhl seines Onkels, und ein Schauer überlief ihn. »O Gott, so etwas kann man unmöglich träumen. Viel zu phantastisch.«
»Entschuldigen Sie, Mr. Glass«, unterbrach Simmons die Befragung, »ich glaube, es hat an der Haustür geläutet.«
Er verließ das Zimmer, und wenig später erschien ein Sergeant der Polizei mit mehreren Untergebenen, während Miss Fletcher in der Diele laut und erregt zu wissen verlangte, was diese Invasion bedeuten solle. Neville eilte zu seiner Tante hinaus und nahm sie am Arm. »Komm ins Wohnzimmer, dann erkläre ich’s dir.«
»Was sind das für Männer?«, rief Miss Fletcher. »Sie sehen alle wie Polizisten aus!«
»Genau das sind sie auch«, erwiderte Neville. »Die meisten jedenfalls. Es ist so, Tante Lucy ...«
»Man hat bei uns eingebrochen!«
»Nein ...« Er hielt inne. »Ich weiß nicht. Ja, vielleicht war es ein Einbrecher. Leider ist etwas noch Schlimmeres passiert, Tante. Ernie ist ... Ernie hat einen Unfall gehabt.«
Er brachte diese Worte sehr leise, sehr zögernd hervor und blickte seine Tante besorgt an.
»Bitte, lieber Neville, versuch doch, deutlicher zu sprechen. Was hast du gesagt?«
»Ein Unfall, sagte ich, aber es war gar keiner. Ernie ist tot.«
»Tot? Ernie?«, stammelte Miss Fletcher. »O nein! Das ist doch nicht wahr. Wie kann er denn tot sein? Neville, du weißt, dass ich solche Scherze hasse. Ich finde es gar nicht nett, so zu reden, mein Junge, ganz zu schweigen davon, dass es äußerst geschmacklos ist.«
»Es ist kein Scherz.«
Sie unterdrückte einen Aufschrei. »Kein Scherz? O Neville, ich muss sofort zu ihm!«
»Hat gar keinen Sinn. Außerdem darfst du nicht hinein. Tut mir schrecklich leid, aber so ist es nun mal. Mich hat’s auch ganz schön mitgenommen.«
»Neville, du verschweigst mir etwas.«
»Ja. Er ist ermordet worden.«
Miss Fletchers blassblaue, ziemlich vorstehende Augen starrten ihn entsetzt an. Sie öffnete den Mund, brachte aber kein Wort heraus. Neville, der sich überaus unbehaglich fühlte, machte eine vage Handbewegung. »Kann ich irgendwas für dich tun, Tante? Ich würde dir so gern helfen, nur weiß ich nicht, wie. Ist dir nicht gut? Ja, ich weiß, dass ich mich wie ein Trottel benehme, aber was hier passiert ist, übertrifft einfach alles. Ich bin völlig durcheinander.«
»Ernie ermordet?«, stieß sie hervor. »Das glaube ich nicht.«
»Sei nicht albern«, sagte er in einem Ton, der verriet, dass seine Nerven bis zum Zerreißen angespannt waren. »Niemand schlägt sich selbst den Schädel ein.«
Ein Wimmern drang aus ihrer Kehle. Sie wankte zu einem Sessel und ließ sich hineinsinken. Neville zündete mit zitternder Hand eine Zigarette an und sagte: »Tut mir leid, aber irgendwann musstest du es ja doch erfahren.«
Sie war sichtlich bemüht, die Fassung wiederzuerlangen. Nach einer Weile rief sie aus: »Aber wer hat denn den lieben Ernie so gehasst, dass er ihn umbringen wollte?«
»Ja, wenn ich das wüsste ...«
»Das muss irgendein furchtbarer Irrtum sein. Ach, Ernie, Ernie!«
Sie brach in Tränen aus. Neville unternahm keinen Versuch, sie zu trösten; er setzte sich ihr gegenüber in einen großen Lehnstuhl und rauchte.
Inzwischen berichtete Polizist Glass seinem Chef in allen Einzelheiten, wie er den Mord entdeckt hatte. Der Arzt war bereits fortgegangen, die Fotografen hatten ihre Aufnahmen gemacht, und der Leichnam von Ernest Fletcher war abtransportiert worden, so dass sich nur noch der Sergeant und Glass im Arbeitszimmer aufhielten.
»Ich machte gerade meine Runde, Sergeant, und befand mich um zehn Uhr zwei in der Vale Avenue. Als ich zur Maple Grove kam – Sie wissen ja, das ist die Gasse, die hinter diesem Haus die Vale Avenue mit der Arden Road verbindet –, fiel mir ein Mann auf. Er schlüpfte aus der Gartentür von Mr. Fletchers Haus, und zwar auf eine Art, die mir verdächtig erschien. Dann entfernte er sich sehr schnell in Richtung der Arden Road.«
»Würden Sie ihn wieder erkennen?«
»Nein, Sergeant. Es war schon ziemlich dunkel, und ich habe ihn auch gar nicht von vorn gesehen. Er war schon an der Arden Road, bevor ich mehr tun konnte, als mich zu wundern, was er hier suchte.« Glass zog nachdenklich die Stirn kraus. »Ich konnte nur feststellen, dass er mittelgroß war und einen hellen Hut trug. Was mich auf die Idee brachte, dass irgendwas faul sei, kann ich nicht sagen. Vielleicht lag es an der Eile, in der er offensichtlich war. Der Herr lenkte meine Schritte.«
»Gut, gut, lassen wir das«, sagte der Sergeant hastig. »Was haben Sie dann getan?«
»Ich rief ihm nach, er solle stehen bleiben, aber er kümmerte sich nicht darum, und im nächsten Augenblick war er auch schon in die Arden Road eingebogen. Nun beschloss ich, mir dieses Haus hier etwas genauer anzusehen. Die Pforte stand offen, und ich ging durch den Garten auf das erleuchtete Fenster zu, um herauszufinden, ob da vielleicht etwas passiert wäre. Und dann sah ich den Toten am Schreibtisch sitzen, genauso wie Sie ihn vorgefunden haben, Sergeant. Sowohl meine Uhr als auch die Wanduhr dort drüben zeigten zu diesem Zeitpunkt fünf Minuten nach zehn an. Als erstes vergewisserte ich mich, ob Mr. Fletcher noch zu helfen sei. Das war nicht der Fall, und so machte ich mich daran, das Zimmer und auch den Garten zu durchsuchen. Dann – es war genau zehn Uhr zehn – rief ich das Revier an. Während ich noch auf die Verbindung wartete, betrat Joseph Simmons, der Butler, das Zimmer. Er brachte das Tablett, das dort auf dem Tischchen steht. Ich hieß ihn warten und befragte ihn, nachdem ich das Telefongespräch beendet hatte. Seinen Angaben zufolge hat er gegen neun Uhr einem gewissen Abraham Budd, der den Verstorbenen besuchen wollte, die Tür geöffnet und ihn in dieses Zimmer geführt. Es entzieht sich seiner Kenntnis, wann besagter Abraham Budd fortging.«
»Beschreibung?«
»Soweit bin ich nicht gekommen, Sir, denn in diesem Augenblick erschien Mr. Neville Fletcher. Wie er erklärte, hat er den Verstorbenen zuletzt gegen acht Uhr fünfzig gesehen, als er mit ihm zusammen das Speisezimmer verließ.«
»Gut, wir werden uns gleich mit ihm unterhalten. Sonst noch etwas?«
»Nichts, was ich mit eigenen Augen gesehen habe«, erwiderte Glass, nachdem er sein Gedächtnis durchforscht hatte.
»Wir werden uns gründlich umsehen. Scheint ein ganz klarer Fall zu sein, wie? Freund Abraham Budd kommt zu Besuch, und Sie ertappen ihn dabei, dass er fluchtartig das Weite sucht.«
»Meiner Ansicht nach ist Budd nicht der Täter«, sagte Glass.
Der Sergeant maß ihn mit einem strengen Blick. »Sieh mal einer an. Da hat Sie wohl wieder der Herr erleuchtet?«
In den kalten Augen des Polizisten blitzte Zorn auf. »Der Spötter ist ein Gräuel vor den Leuten«, bemerkte er.
»Das genügt«, sagte der Sergeant. »Vergessen Sie gefälligst nicht, dass Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
»Der Spötter«, fuhr Glass unbeirrt fort, »liebt nicht, dass man ihn rügt; zu Weisen mag er nicht gehen. Dieser Budd machte weder aus seinem Besuch noch aus seinem Namen ein Hehl.«
Der Sergeant ließ ein Knurren hören. »Darin muss ich Ihnen recht geben. Vielleicht war’s also doch kein vorsätzlicher Mord. Holen Sie mir mal den Butler.«
»Ich kenne Joseph Simmons als einen gottesfürchtigen Mann«, sagte Glass, während er zur Tür ging.
»Schon gut, schon gut. Holen Sie ihn.«
Glass fand den Butler in der Diele. Als Simmons, der noch immer sehr blass war, das Arbeitszimmer betrat, blickte er ängstlich zum Schreibtisch hinüber und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als er den leeren Stuhl sah.
»Ihr Name?«, fragte der Sergeant in scharfem Ton.
»Joseph Simmons, Sergeant.«
»Beruf?«
»Ich bin ... ich war Mr. Fletchers Butler.«
»Wie lange sind Sie für ihn tätig gewesen?«
»Sechseinhalb Jahre, Sergeant.«
»Und Sie haben –«, der Sergeant suchte in Glass’ Notizen, »Sie haben Ihren Herrn zuletzt lebend gesehen, als Sie gegen neun Uhr einen gewissen Abraham Budd in dieses Zimmer führten. Ist das richtig?«
»Ja, Sergeant. Hier ist seine Visitenkarte.«
Der Sergeant nahm die Karte und las vor: »Mr. Abraham Budd, 333 c Bishopsgate, London E. C. Nun, jetzt wissen wir wenigstens, wo er wohnt, das ist schon etwas wert. Wie ich sehe, haben Sie erklärt, er sei Ihnen nicht bekannt.«
»Er ist mir nie zuvor begegnet, Sergeant. Leute wie er pflegen in diesem Haus nicht zu verkehren«, erwiderte Simmons hochmütig.
Auf diese pharisäerhafte Bemerkung reagierte Glass mit einem vernichtenden Ausspruch. »Der Herr ist hoch und sieht dennoch auf das Niedrige, aber die Stolzen kennt er nur von ferne«, sagte er in drohendem Ton.
»Meine Seele ist von Reue erfüllt«, beteuerte Simmons schuldbewusst.
»Kümmern Sie sich nicht um Ihre Seele«, rief der Sergeant ungeduldig. »Und nehmen Sie keine Notiz von Glass. Beantworten Sie nur meine Fragen. Können Sie diesen Budd beschreiben?«
»O ja, Sergeant. Ein kleiner, dicker Mann in einem Anzug, dessen Farbe für meinen Geschmack zu grell war. Er trug einen steifen Hut und ist, wie mir schien, südländischer Abstammung.«
»Klein und dick«, sagte der Sergeant enttäuscht. »Könnte ein Vertreter gewesen sein. Erwartete Mr. Fletcher seinen Besuch?«
»Das glaube ich nicht. Mr. Budd behauptete, er käme in dringenden Geschäften, so dass ich gezwungen war, meinem Herrn die Visitenkarte zu überbringen. Mir schien, dass Mr. Fletcher sehr ärgerlich war.«
»Ärgerlich oder ängstlich?«
»Ängstlich? O nein, Sergeant. Mr. Fletcher murmelte etwas von verdammter Frechheit, sagte dann aber, ich solle Mr. Budd hereinführen, was ich auch tat.«
»Und das war so gegen neun Uhr? Haben Sie gehört, ob es zu Auseinandersetzungen kam?«
Der Butler zögerte. »Als Auseinandersetzung würde ich es nicht bezeichnen. Mein Herr sprach ein- oder zweimal mit erhobener Stimme, aber ich konnte nichts verstehen, weil ich zuerst im Speisezimmer beschäftigt war, also auf der anderen Seite der Diele, und mich dann in den Anrichteraum zurückzog.«
»Sie würden nicht sagen, dass die beiden miteinander gestritten haben?«
»Nein, Sergeant. Mr. Budd machte auf mich nicht den Eindruck eines streitsüchtigen Menschen. Im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, dass er sich vor meinem Herrn fürchtete.«
»So, so, er fürchtete sich. Neigte Mr. Fletcher zu Wutausbrüchen?«
»Du lieber Himmel, nein. Im Allgemeinen war er sehr freundlich, sehr liebenswürdig. Es geschah höchst selten, dass er die Fassung verlor.«
»Aber heute Abend verlor er sie? Wegen Mr. Budds Besuch?«
Der Butler überlegte. »Ich glaube, an seiner Nervosität war etwas anderes schuld, Sergeant. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte Mr. Fletcher kurz vor dem Dinner eine ... eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Mr. Neville.«
»Mr. Neville? Das ist der Neffe, nicht wahr? Wohnt er hier?«
»Nein. Mr. Neville traf heute Nachmittag ein und wollte, soviel ich weiß, ein paar Tage bei seinem Onkel verbringen.«
»Wurde er erwartet?«
»Wenn das der Fall war, ist mir jedenfalls nichts davon bekannt. Um der Fairness willen möchte ich bemerken, dass Mr. Neville ein – wenn ich so sagen darf – recht exzentrischer junger Herr ist. Es war durchaus nicht das erste Mal, dass er hier unangemeldet erschien.«
»Und diese Meinungsverschiedenheit mit seinem Onkel – war so etwas auch üblich?«
»Ich möchte nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen, Sergeant. Verstehen Sie mich recht: Von einem Streit im eigentlichen Sinn kann keine Rede sein. Es ist nur so, dass ich vor dem Dinner, als ich Sherry und Cocktails im Wohnzimmer servierte, den Eindruck hatte, einen Wortwechsel unterbrochen zu haben. Mein Herr wirkte ausgesprochen verärgert, was bei ihm selten vorkam, und als ich das Zimmer betrat, hörte ich ihn sagen, er wünsche nichts mehr darüber zu hören und Mr. Neville solle sich zum Teufel scheren.«
»Oh. Und wie verhielt sich Mr. Neville? War er wütend?«
»Das kann ich nicht beurteilen, Sergeant. Mr. Neville ist ein eigenartiger Mensch. Er neigt nicht dazu, seine Gefühle zu offenbaren – falls er überhaupt welche hat, was ich manchmal bezweifle.«
»Natürlich habe ich welche, sogar eine ganze Menge«, warf Neville ein, der unbemerkt hereingekommen war.
Der Sergeant wusste nicht, dass der junge Mr. Fletcher die Angewohnheit hatte, Zimmer geräuschlos zu betreten, und so verschlug es ihm im ersten Augenblick die Sprache. Neville lächelte entschuldigend und sagte: »Guten Abend. Ist es nicht furchtbar? Hoffentlich haben Sie schon irgendetwas herausgefunden. Meine Tante würde Sie gern noch sprechen, bevor Sie gehen. Wissen Sie, wer meinen Onkel getötet hat?«
»Es ist noch ein bisschen früh, mich das zu fragen, Sir«, antwortete der Sergeant vorsichtig.
»Ihre Worte deuten auf eine längere Periode der Ungewissheit hin, und das finde ich überaus deprimierend.«
»Ja, Sir, es ist recht unangenehm für alle Beteiligten«, stimmte der Sergeant zu. Dann sagte er, zu Simmons gewandt: »Für den Augenblick ist das alles.«
Simmons zog sich zurück, und der Sergeant, der Neville mit verstohlener Neugier gemustert hatte, forderte den jungen Mann auf, sich zu setzen. Neville kam dieser Bitte bereitwillig nach und ließ sich in einen tiefen Lehnstuhl vor dem Kamin fallen. Der Sergeant sagte höflich: »Ich wäre froh, wenn Sie mir helfen könnten, Sir. Vermutlich standen Sie dem Verstorbenen sehr nahe.«
»O nein«, erwiderte Neville schockiert. »Das war ganz und gar nicht der Fall.«
»Nein? Wollen Sie damit andeuten, Sir, dass Sie mit Mr. Fletcher nicht gut auskamen?«
»Keineswegs. Ich komme mit allen Leuten gut aus. Nur was das Nahestehen betrifft ...«
»Bitte, Sir, ich meine doch ...«
»Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie wollen wissen, ob ich die Geheimnisse im Leben meines Onkels kenne. Nein, Sergeant, ich hasse Geheimnisse und kümmere mich prinzipiell nicht um die Probleme anderer Leute.«
Seine Miene drückte leutselige Freundlichkeit aus. Der Sergeant war ein wenig verblüfft, fasste sich aber rasch und sagte: »Nun, jedenfalls kannten Sie ihn recht gut, nicht wahr, Sir?«
»Wenn Sie wollen, können Sie es so formulieren«, murmelte Neville.
»Wissen Sie, ob er Feinde hatte?«
»Nach dem, was vorgefallen ist, sollte man es annehmen.«
»Allerdings, Sir, aber ich muss versuchen, Klarheit zu gewinnen und ...«
»Ich weiß, ich weiß. Leider bin ich, was das betrifft, ebenso wenig informiert wie Sie. Haben Sie meinen Onkel gekannt?«
»Nein, Sir, persönlich nicht.«
Neville blies einen Rauchring durch einen zweiten und betrachtete träumerisch dieses Gebilde. »Alle nannten ihn Ernie«, sagte er mit einem Seufzer. »Oder lieber Ernie – je nach Geschlecht. Verstehen Sie?«
Der Sergeant sah vor sich hin und antwortete dann langsam: »Ja, Sir, ich verstehe. Ich habe auch immer nur Gutes von ihm gehört. Sie kennen also niemanden, der einen Groll gegen ihn hegte?«
Neville schüttelte den Kopf. Hemingway blickte ihn missmutig an und zog dann Glass’ Notizbuch zu Rate. »Wie ich sehe, haben Sie erklärt, Sie seien vom Speisezimmer ins Billardzimmer gegangen, wo Sie sich aufhielten, bis Miss Fletcher kam, um Sie ins Wohnzimmer zu holen. Wann könnte das gewesen sein?«
Neville zuckte die Achseln. Sein Lächeln schien um Entschuldigung zu bitten.
»Sie wissen es nicht, Sir? Auch nicht annähernd? Bitte, versuchen Sie sich zu erinnern.«
»O weh, die Zeit hat in meinem Leben bisher noch nie eine Rolle gespielt. Hilft es Ihnen vielleicht weiter, wenn ich sage, dass meine Tante einen recht eigenartig aussehenden Mann erwähnte, der bei meinem Onkel zu Besuch sei? Ein kleiner, dicker Mann, der seinen Hut in der Hand trug. Sie war ihm in der Diele begegnet.«
»Haben Sie diesen Mann ebenfalls gesehen?«, fragte der Sergeant hastig.
»Nein.«
»Und Sie wissen auch nicht, ob er noch bei Ihrem Onkel war, als Sie die Treppe hinauf- und in Ihr Zimmer gingen?«
»Ich bitte Sie, Sergeant, glauben Sie etwa, dass ich an Türen lausche und durch Schlüssellöcher spähe?«
»Natürlich nicht, Sir, aber ...«
»Jedenfalls tue ich’s nicht, wenn ich kein bisschen neugierig bin«, fügte Neville überflüssigerweise hinzu.
»Gut, Sir. Sie gingen also irgendwann zwischen neun und zehn Uhr in Ihr Zimmer hinauf.«
»Um halb zehn«, präzisierte Neville.
»Um ... Eben haben Sie doch gesagt, Sie hätten keine Ahnung, wie spät es war.«
»Hatte ich auch nicht, aber jetzt erinnere ich mich an einen Kuckucksruf.«
Der Sergeant blickte erschrocken zu Glass hinüber, der regungslos und mit missbilligender Miene an der Tür stand. War es möglich, dass dieser exzentrische junge Mann an Wahnvorstellungen litt? »Was meinen Sie damit, Sir?«
»Die Uhr auf dem Treppenabsatz«, antwortete Neville.
»Oh, eine Kuckucksuhr! Wirklich, Sir, im ersten Moment dachte ich ... Die Uhr schlug also die halbe Stunde?«
»Ja, aber verlassen kann man sich nicht auf sie.«
»Das werden wir gleich mal feststellen. Nach welcher Seite geht Ihr Zimmer hinaus, Sir?«
»Nach Norden.«
»Also zum Garten hin, nicht wahr? Könnten Sie hören, wenn jemand den Gartenweg entlangginge?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe niemanden gehört, aber vielleicht nur deswegen nicht, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war.«
»Richtig«, sagte der Sergeant. »Ja, das wär’s wohl fürs Erste, vielen Dank, Sir. Leider muss ich Sie bitten, dieses Haus in den nächsten Tagen nicht zu verlassen. Eine Routinemaßnahme, für die Sie gewiss Verständnis haben. Hoffentlich wird es uns in Kürze gelingen, den Fall restlos aufzuklären.«
»Ja, hoffentlich«, stimmte Neville zu. Sein Blick ruhte nachdenklich auf einem Gemälde, das gegenüber dem Kamin an der Wand hing. »Einbrecher können es wohl nicht gewesen sein?«
»Kaum, Sir. Vorerst lässt sich das natürlich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es ist doch recht unwahrscheinlich, dass sich jemand hier eingeschlichen haben sollte, als Mr. Fletcher und die übrigen Mitglieder des Haushalts noch wach waren.«
»Ja, ich dachte nur ... Hinter dem Bild dort befindet sich nämlich ein Safe.«
»Das hat mir der Butler bereits mitgeteilt, Sir. Wir haben auch schon nach Fingerabdrücken gesucht, und sobald Mr. Fletchers Anwalt eintrifft, werden wir den Safe öffnen lassen. Ja, Hepworth? Haben Sie was gefunden?«
Diese Frage galt einem Polizisten, der das Zimmer durch die Fenstertür betreten hatte.
»Nicht viel, Sergeant, aber ich möchte Sie bitten, sich da draußen etwas anzusehen.«
Der Sergeant ging sogleich hinaus. Neville faltete seine Beine auseinander, stand auf und steuerte ebenfalls dem Garten zu. »Macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich mitkomme?«, murmelte er, als der Sergeant den Kopf wandte.
»Ich wüsste nicht, was ich dagegen haben sollte, Sir. Es handelt sich darum, dass kurz nach zehn Uhr ein Mann gesehen wurde, der eilig aus der Gartenpforte schlüpfte, und ich würde mich nicht wundern, wenn das der Kerl war, den wir suchen.«
»Ein kleiner, dicker Mann?«
»Ach, das wäre wohl doch ein bisschen zu einfach, nicht wahr?«, meinte der Sergeant nachsichtig. »Nein, es war ein ganz unauffälliger Mann mit einem Filzhut. Na, Hepworth, was gibt’s denn?«
Der Polizist hatte die beiden hinter einen Johannisbeerstrauch geführt, der in einem Beet nahe dem Haus stand. Nun richtete der Mann den Strahl seiner Taschenlampe auf den Boden. In der weichen Erde waren deutlich die Abdrücke eines Paars hochhackiger Schuhe zu sehen.
»Ganz frisch, Sergeant«, sagte Hepworth. »Hinter diesem Strauch hatte sich jemand versteckt.«
»Also war eine Frau im Spiel!«, rief Neville. »Ist das nicht herrlich aufregend?«
Kapitel 2
Um halb elf befand sich nur noch ein Polizist im Haus, der als Wache zurückgeblieben war. Miss Fletcher, von dem Sergeant taktvoll befragt, hatte nichts zur Aufklärung des Verbrechens beisteuern können. Die Mitteilung, man habe Abdrücke von Damenschuhen entdeckt, schien sie weder zu schockieren noch zu überraschen. »Er war so ungewöhnlich attraktiv«, vertraute sie dem Sergeant an. »Das soll natürlich nicht heißen ... aber Männer sind nun einmal anders als wir Frauen, nicht wahr?«
Der Sergeant hatte sich eine lange Lobrede auf den verstorbenen Ernest Fletcher anhören müssen: wie bezaubernd er gewesen war und wie beliebt; was für vollendete Manieren er gehabt und mit welcher Güte er seine Schwester stets behandelt hatte. Ein fröhlicher, flotter, großzügiger Mensch ... Aus diesem Redestrom hatten sich einige Tatsachen herauskristallisiert. Neville, der Sohn von Ernies längst verstorbenem Bruder Ted, war zweifellos der Erbe seines Onkels. Ein lieber Junge, aber man wusste nie, was er als Nächstes anstellen würde, und – ja, der arme Ernie war mächtig verärgert gewesen, als Neville im Gefängnis irgendeines grässlichen Balkanstaates landete. O nein, nichts von Belang. Neville war nur so furchtbar unordentlich und hatte irgendwie, irgendwo seinen Pass verloren. Was die junge Russin betraf, die in Budapest eines Morgens (»noch vor dem Frühstück!«) mit all ihrem Gepäck in Nevilles Hotel aufgekreuzt war, weil er sie angeblich am Abend zuvor bei einer Party dazu aufgefordert hatte – nun, man konnte das natürlich nicht gerade gutheißen, aber junge Männer betranken sich eben dann und wann; außerdem taugte die Frau offensichtlich gar nichts, und im Grunde sah so etwas Neville nicht ähnlich. Andererseits konnte einem der arme Ernie leidtun, der Neville buchstäblich loskaufen musste. Trotzdem war es eine ausgesprochene Lüge, zu behaupten, Ernie möge Neville nicht leiden. Gewiss, Onkel und Neffe hatten nicht viel miteinander gemein, aber Blut war nun einmal dicker als Wasser, und Ernie zeigte doch immer so viel Verständnis ...
Nein, erklärte sie bei näherer Befragung, sie kenne niemanden, der auch nur den leisesten Groll gegen ihren Bruder hege. Ihrer Meinung nach müsse es sich bei dem Mörder um einen dieser grässlichen Geisteskranken handeln, von denen man so oft in den Zeitungen lese ...
Der Sergeant hatte einige Mühe, das Gespräch zu beenden. Als er gegangen war, setzten sich Tante und Neffe ins Wohnzimmer.
»Mir ist, als wäre das alles ein schrecklicher Albtraum«, stöhnte Miss Fletcher und presste die Hand auf die Stirn. »Draußen in der Diele steht ein Polizist, und das Zimmer des lieben Ernie ist versiegelt worden.«
»Macht dir das etwas aus?«, fragte Neville. »Waren da vielleicht irgendwelche Dinge, die du beseitigen wolltest?«
»O nein«, protestierte Miss Fletcher, »das wäre doch höchst unehrenhaft. Obgleich ich sicher bin, dass es Ernie lieber gewesen wäre als dieses Herumgeschnüffel von wildfremden Leuten in seinen Angelegenheiten. Natürlich würde ich nichts wirklich Wichtiges vernichten, und bestimmt gibt es so etwas auch gar nicht. Es ist nur ... ach, du weißt doch, wie Männer sind, selbst die allerbesten.«
»Nichts weiß ich. Erzähl mal.«
»Nun ja«, sagte Miss Fletcher, »es gibt gewisse Dinge im Leben eines Mannes, über die man nicht spricht, aber ich fürchte, Neville, dass er Frauengeschichten hatte. Und ich glaube – obgleich ich natürlich nichts Genaues weiß –, dass manche dieser Frauen keinen guten Ruf hatten.«
»Männer sind nun mal so«, tröstete Neville.
»Ja, mein Junge, und ich war auch sehr dankbar dafür, denn es gab einmal eine Zeit, da dachte ich, Ernie würde sich einfangen lassen.«
»Einfangen?«
»Als Ehemann«, erklärte Miss Fletcher. »Das wäre ein schwerer Schlag für mich gewesen. Nun, zum Glück neigte er nicht zur Beständigkeit.«
Neville blickte sie erstaunt an. Sie lächelte unglücklich und war sich offenbar gar nicht bewusst, etwas Verblüffendes gesagt zu haben. Wie die Verkörperung höchster Ehrbarkeit saß sie vor ihm: eine rundliche, welke Dame mit strähnigem grauem Haar, sanften, vom Weinen rotgeränderten Augen und einem altjüngferlichen kleinen Mund, der gewiss noch nie mit Lippenstift in Berührung gekommen war.
»Also das gibt mir den Rest«, sagte Neville. »Ich glaube, ich gehe am besten zu Bett.«
»Ach herrje, regt dich das auf, was ich dir erzählt habe?«, fragte sie betroffen. »Aber es kommt ja auf jeden Fall heraus, und früher oder später hättest du es sowieso erfahren.«
»Es ist nicht mein Onkel, sondern meine Tante«, murmelte Neville.
»Wie merkwürdig du redest, mein Junge. Du bist überanstrengt, und das ist ja auch kein Wunder. Meinst du, ich sollte dem Polizisten eine Erfrischung anbieten?«
Während sie ein Gespräch mit dem Wachtposten in der Diele begann, ging Neville nach oben. Bald darauf klopfte die Tante an seine Tür und erkundigte sich nach seinem Befinden. Er rief ihr zu, dass er sich sehr gut fühle, aber entsetzlich müde sei. Mit Gutenachtwünschen und dem Versprechen, ihn nicht mehr zu stören, begab sich Miss Fletcher in ihr Schlafzimmer, das im vorderen Teil des Hauses lag.
Nachdem Neville Fletcher seine Tür abgeschlossen hatte, kletterte er aus dem Fenster und gelangte mit Hilfe einer dicken Regenröhre und des Verandadaches wohlbehalten nach unten.
Der Garten lag in Mondlicht gebadet. Für den Fall, dass auch an der Pforte ein Wachtposten stand, schlich sich Neville zu der Mauer, die den Garten von der Arden Road trennte. Dort gab es ein Spalier, und so konnte er mit Leichtigkeit die Mauer erklimmen, sich dann von oben herablassen und sportsmännisch gewandt auf dem Boden landen. Er blieb einen Augenblick stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden, bevor er in westlicher Richtung die Arden Road entlangging. Nach etwa hundert Yards bog er in eine Seitenstraße ein, die parallel zur Maple Grove verlief, und schlüpfte in den ersten Torweg, zu dem er kam. Im Mondschein zeichneten sich deutlich die Umrisse eines großen, viereckigen Hauses ab, in dem noch mehrere Fenster erleuchtet waren. Bei allen fiel das Licht durch zugezogene Vorhänge; eines davon, im Erdgeschoß, links von der Haustür, stand offen. Neville ging darauf zu, schob die Vorhänge ein wenig beiseite und spähte in das Zimmer.
Eine Frau saß an einem Sekretär und schrieb. Das Licht der Leselampe verlieh ihrem goldblonden Haar einen feurigen Schimmer. Sie trug ein Abendkleid, und über der Lehne ihres Stuhls hing ein Brokatmantel. Neville betrachtete sie eine Weile, bevor er über die Fensterbrüstung stieg.
Sie hob rasch den Kopf und stieß einen unterdrückten Schreckensschrei aus. Im nächsten Moment wich die Angst in ihren Augen einem Ausdruck der Erleichterung. Ihr liebliches Gesicht rötete sich; sie presste die Hand auf die Brust und sagte mit schwacher Stimme: »Neville! Mein Gott, wie du mich erschreckt hast.«
»Das ist noch gar nichts gegen das, was ich heute Abend durchgemacht habe«, erwiderte Neville. »Du kannst dir nicht vorstellen, Schätzchen, was sich bei uns in Greystones getan hat.«
Sie klappte die Schreibmappe mit dem angefangenen Brief zu. »Du meinst, du hast sie nicht bekommen?«, fragte sie erregt, in ungläubigem Ton.
»Alles, was ich bekommen habe, ist das große Zittern«, erwiderte Neville. Er schlenderte auf sie zu und ließ sich zu ihrem Erstaunen auf ein Knie nieder.
»Neville, was um Himmels willen ...«
Seine Hand umfasste ihren Knöchel. »Komm, zeig mir mal deinen Fuß, Süße.« Er betrachtete den Schuh aus silbernem Leder. »O mein prophetisches Gemüt! Jetzt sitzen wir drin, genau wie deine hübschen Schuhchen in dem weichen Boden.« Er ließ ihren Fuß los und stand auf.
Ihre Augen weiteten sich vor Angst. Sie blickte auf die silbernen Schuhe und verbarg sie hastig unter dem weitfallenden Rock. »Was soll das heißen?«
»Tu nicht so, Schätzchen. Du warst heute Abend bei Ernie und hast dich hinter einem Busch in der Nähe seines Zimmers versteckt.«
»Woher weißt du das?«, fragte sie rasch.
»Intuition. Du hättest es wirklich mir überlassen können. Was hatte das für einen Sinn, mich in die Sache hineinzuziehen, wenn du sowieso eingreifen wolltest? Mir war das alles weiß Gott sehr zuwider.«
»Das ist es ja gerade. Ich war ziemlich sicher, dass du nichts ausrichten würdest. Du bist so unzuverlässig, und ich wusste, wie ungern du es tatest.«
»Stimmt, ich hab’s ungern getan, unzuverlässig bin ich auch, und ausgerichtet habe ich gar nichts, aber trotzdem war es verdammt blöde von dir, das Ende meiner Bemühungen nicht abzuwarten. Hast du sie wenigstens bekommen?«
»Nein. Er hat nur gelacht und ... ach, du weißt schon.«
»Wie reizend«, sagte Neville. »Und warst du es, die ihm den Schädel eingeschlagen hat?«
»Lass die Albernheiten«, fuhr sie ihn an.
Neville musterte sie kritisch. »Falls du mir was vormachst, kann ich das nur als reife Einzelleistung bezeichnen. Hast du gesehen, wer es war?«
Sie zog die Stirn kraus. »Wen, bitte, soll ich gesehen haben?«
»Denjenigen, der Ernie den Schädel einschlug. Mein süßer kleiner Dummkopf, Ernie ist ermordet worden.«
Ein wimmernder Aufschrei entrang sich ihrer Kehle. »Neville! Nein, nein! Neville, das ist doch nicht wahr!«
Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. »Hast du es nicht gewusst?«
Ihr Blick suchte den seinen, während die Farbe langsam aus ihrem Gesicht wich. »Ich habe es nicht getan«, stieß sie hervor.
Er nickte. »Vermutlich hättest du auch gar nicht die nötige Kraft aufbringen können.«
Hier wurden sie unterbrochen. Die Zimmertür öffnete sich, und eine schlanke junge Frau mit einer Fülle brauner Locken, ein Monokel ins linke Auge geklemmt, kam herein. »Hast du gerufen, Helen?«, fragte sie ruhig. Dann richtete sie ihren Blick auf Neville und sagte mit unverhohlenem Abscheu: »Ach, du bist hier?«
»Ja, aber wenn ich diese Begegnung vorausgesehen hätte, wäre ich bestimmt nicht gekommen, du Teufelsbraten«, erwiderte Neville freundlich.
Miss Drew gab ein verächtliches Schnaufen von sich und schaute ihre Schwester prüfend an. »Du siehst ja aus wie das Leiden Christi«, stellte sie fest. »Ist irgendwas passiert?«
Helen Norths Hände krampften sich nervös ineinander. »Ernie Fletcher ist ermordet worden.«
»Gut«, sagte Miss Drew ungerührt. »Ist Neville gekommen, um dir das zu erzählen?«
»O bitte nicht!«, rief Helen schaudernd. »Es ist so furchtbar!«
»Was mich betrifft –«, Miss Drew nahm eine Zigarette aus dem Kästchen auf dem Tisch und steckte sie in eine lange Spitze –, »so betrachte ich es als ein höchst denkwürdiges Ereignis. Ich hasse Männer, die sich als Superkavaliere aufspielen und immerzu bezaubernd lächeln. Wer hat ihn denn umgebracht?«
»Ich weiß es nicht!«, rief Helen verzweifelt. »Sally! Neville! Ihr glaubt doch nicht etwa, ich wüsste es? O mein Gott!« Sie blickte wild von einem zum anderen, ließ sich dann auf ein Sofa fallen und schlug die Hände vors Gesicht.
»Wenn das eine Probe deines mimischen Könnens sein soll, finde ich’s großartig«, sagte Neville. »Anderenfalls ist es reine Zeitverschwendung. Hör schon auf, Helen, du bringst mich in Verlegenheit.«
Sally betrachtete ihn missbilligend. »Sehr tief scheint es dich nicht getroffen zu haben«, meinte sie.
»Oh, du hättest mich vor einer Stunde sehen sollen«, erwiderte Neville. »Da hatte ich völlig die Fassung verloren.«
Sie lachte verächtlich auf, sagte aber nur: »Wie wär’s, wenn du mir die ganze Geschichte erzähltest? Vielleicht lässt sich der Stoff literarisch verwerten.«
»Eine fabelhafte Idee«, lobte Neville. »Dann ist Ernie wenigstens nicht umsonst gestorben.«
»Ich wollte schon immer mal einen richtigen Mordfall miterleben. Was war die Todesursache?«
»Zertrümmerter Schädel«, antwortete Neville.
Helen stöhnte dumpf, während ihre Schwester mit Kennermiene nickte. »Aha«, sagte Sally, »also ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Hast du eine Ahnung, wer es getan hat?«
»Nein, aber vielleicht weiß Helen etwas.«
Helen hob den Kopf. »Glaub mir doch, ich war nicht dabei!«
»Deine Schuhe strafen dich Lügen, Süße.«
»Ja, ich war dort, aber nicht, als er umgebracht wurde! Bestimmt nicht, ich schwör’s dir!«
Das Monokel fiel aus Miss Drews Auge. Sie klemmte es wieder ein und blickte ihre Schwester forschend an. »Was soll das heißen – ›ja, aber nicht, als er umgebracht wurde‹? Bist du heute Abend in Greystones gewesen?«
Helen schien nicht zu wissen, was sie antworten sollte. Nach einigem Zögern sagte sie: »Ja. Ja, ich war drüben bei Ernie. Erstens, weil ... weil mir das Geklapper deiner Schreibmaschine auf die Nerven ging, und zweitens, weil ich ... etwas mit ihm zu besprechen hatte.«
»Hör mal«, erwiderte Sally streng, »wenn schon, dann erzähl auch gleich alles. Was ist zwischen dir und Ernie Fletcher?«
»Als Purist«, warf Neville ein, »muss ich gegen den Gebrauch des Präsens protestieren.«
Sally wandte sich ihm zu. »Ich nehme an, du bist über alles informiert, wie? Dann solltest du mich aufklären, verdammt noch mal.«
»Es ist nicht das, was du denkst«, beteuerte Helen hastig. »Wirklich nicht, Sally. Ja, ich gebe zu, ich hatte ihn gern, aber nicht so gern, dass ich ...«
»Wenn du Neville die Wahrheit sagen konntest, dann kannst du sie mir auch sagen«, beharrte Sally. »Und rede dich nicht mit meiner klappernden Schreibmaschine heraus, denn so was zieht bei mir nicht.«
»Erzähl ihr alles«, riet Neville. »Sie ist ganz wild auf schmutzige Geschichten.«
Helen wurde rot. »Musst du es so bezeichnen?«
Er seufzte. »Schätzchen, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich die Sache über die Maßen banal und schmutzig finde. Warum wirfst du mir das jetzt auf einmal vor?«
»Du begreifst nicht, was es heißt, verzweifelt zu sein«, erwiderte sie bitter.
»Stimmt. Weil ich wie ein Gott über allem schwebe.«
»Nun, ich kann nur hoffen, dass du als Mörder angeklagt wirst«, bemerkte Sally. »Was würde dir dann dein göttliches Über-allem-Schweben helfen?«
Er sah sie nachdenklich an. »Das wäre furchtbar interessant«, meinte er. »Natürlich würde ich äußerlich ruhig und gelassen bleiben, aber vielleicht wäre ich insgeheim verzagt. Hoffentlich nicht, weil ich dann nicht mehr ich selbst wäre. Und das würde mir nicht behagen.«
Helen schlug mit der Faust auf die Sofalehne. »Geschwätz, nichts als Geschwätz! Was kann das schon nützen?«
»Der Nützlichkeitskult ist das Scheußlichste, was es gibt«, sagte Neville. »Du bist eine prosaische Natur, liebes Kind.«
»Ach, sei doch still«, bat Sally. Sie ging zum Sofa und setzte sich neben Helen. »Komm, altes Mädchen, erzähl mir die ganze Geschichte von A bis Z. Wenn du in der Klemme sitzt, werde ich alles Menschenmögliche versuchen, dir herauszuhelfen.«
»Das kannst du nicht«, sagte Helen mutlos. »Ernie hat Schuldscheine von mir, und wenn die Polizei sie findet, gibt es einen schrecklichen Skandal.«
Sally runzelte die Stirn. »Schuldscheine? Wieso? Ich meine, wie ist er zu denen gekommen? Und um was für Schulden handelt es sich überhaupt?«
»Um Spielschulden. Neville nimmt an, dass Ernie die Scheine aufgekauft hat.«
»Ja, aber weshalb sollte er das getan haben?«, fragte Sally, und wieder sprang ihr das Monokel aus dem Auge.
Neville blickte sie bewundernd an. »Dieses Mädchen ist die verkörperte Tugend. Lilienweiß und engelsrein. Geradezu überirdisch.«
»Nichts dergleichen bin ich«, rief Sally hitzig. »Aber solche Begriffe wie ›Lohn der Schande‹ sind doch völlig antiquiert. Du meine Güte, nie würde ich so was in einem meiner Bücher verwerten.«
»Flüchtest du vor der Wirklichkeit?«, fragte Neville teilnahmsvoll. »Ist das der Grund, aus dem deine Romane immer eine so unwahrscheinliche Handlung haben? Empfindest du die Banalität des Alltagslebens als unerträglich?«
»Meine Romane sind nicht unwahrscheinlich! Vielleicht interessiert es dich zu hören, dass die Kritiker mich zu den sechs bedeutendsten Kriminalschriftstellern zählen.«
»Wenn du ihnen das glaubst, bist du ein schlechter Menschenkenner«, versetzte Neville.
Helen konnte einen Wutschrei nicht unterdrücken. »Hört auf, hört auf! Als ob das im Augenblick eine Rolle spielte! Sagt mir lieber was ich tun soll.«
Sally wandte sich von Neville ab. »Gut, beschäftigen wir uns erst mal mit dieser Sache. Dazu brauche ich aber noch ein paar Angaben. Seit wann warst du in Ernie Fletcher verliebt?«
»Verliebt war ich niemals in ihn. Ich fand ihn nur sehr attraktiv, und ... und er hatte so viel mitfühlendes Verständnis. In seiner Art war er fast ein bisschen feminin – nein, das ist nicht richtig ausgedrückt. Ich kann’s einfach nicht erklären. Ernie gab einem das Gefühl, man sei aus kostbarem, sehr zerbrechlichem Porzellan.«
»Das muss sich recht anregend auf dein Leben ausgewirkt haben«, meinte Neville.
»Sei doch still! Sprich weiter, Helen. Wann hat das alles angefangen?«
»Ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich in dem Augenblick, als ich ihn kennenlernte – richtig kennenlernte, meine ich. Glaube bitte nicht, dass er ... dass er mich zu verführen suchte. Er hielt sich immer zurück. Erst vor kurzem wurde mir auf einmal klar, was er wollte. Ich dachte ... ach, ich weiß nicht, was ich dachte.«
»Du hast gar nichts gedacht«, erklärte Neville freundlich. »Du bist einfach in einem goldfarbenen Sirupmeer dahingetrieben.«
»So wird’s gewesen sein«, meinte auch Sally. »Du warst offenbar in einer Art Ätherrausch. Übrigens, wie hat John darauf reagiert – wenn überhaupt?«
Ihre Schwester wurde rot und blickte zur Seite. »Ich weiß nicht. Zwischen John und mir waren die Brücken schon abgebrochen, bevor ... bevor Ernie in mein Leben trat.«
Scheinbar überwältigt, sank Neville in einen Sessel und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. »O Gott, o Gott«, stöhnte er. »Jetzt werde ich auch noch in diesen ekelhaften Sirup gezerrt. Bitte, Helen, lass mich die Brücken zwischen uns abbrechen und aus deinem Leben verschwinden, bevor ich ebenfalls anfange, Phrasen zu dreschen. So etwas ist enorm ansteckend.«
»Ich muss zugeben«, sagte Sally um der Gerechtigkeit willen, »dass auch ich gegen Ausdrücke wie ›die Brücken abbrechen‹ und ›in mein Leben treten‹ allergisch bin. Helen, versuch doch bitte, dich nicht in Sentimentalitäten hineinzusteigern. Die Sache scheint mir verdammt ernst zu sein. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass ihr beide, John und du, nicht besonders gut miteinander auskämt. Manche Frauen merken es eben nicht, wenn sie auf Gold gestoßen sind. Was hattet ihr denn gegeneinander? Ich dachte immer, John wäre die Antwort auf jeder Jungfrau Gebet.«