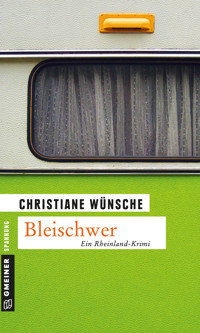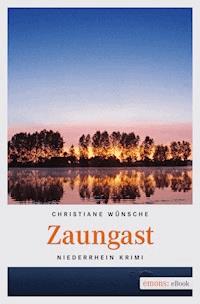9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christiane Wünsche, Autorin des Bestsellers »Aber Töchter sind wir für immer«, erzählt in ihrem neuen Roman »Heldinnen werden wir dennoch sein«, was Freundschaft für uns bedeutet und davon, wie einmal getroffenen Entscheidungen unser ganzes Leben beeinflussen. »Mein Zuhause – das seid ihr.« Susanne, Helma, Ellie, Ute, Marie: fünf Freundinnen, die seit ihrer Jugend eng verbunden sind – und ein Freund von damals, dessen plötzlicher Tod sie dazu bringt, nachzudenken: Über ihr Leben, ihre Entscheidungen, über Loyalität und ihre Erinnerungen, die ihre ganz eigenen Geschichten schreiben. Lange haben die Frauen nicht an Frankie gedacht und an den einen Abend, an dem er damals plötzlich verschwand. Doch jetzt ist es an der Zeit sich der Vergangenheit zu stellen. »Die Träume unserer Jugend geistern auch dann noch durch unsere Köpfe, wenn wir längst erwachsen sind – genauso wie die Entscheidungen, die wir einst getroffen und die Wege, die wir damals eingeschlagen haben, uns ein Leben lang begleiten …«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christiane Wünsche
Heldinnen werden wir dennoch sein
Roman
Roman
Über dieses Buch
Christiane Wünsche, Autorin des Bestsellers Aber Töchter sind wir für immer, erzählt in ihrem neuen Roman, was Freundschaft für uns bedeutet und davon, wie einmal getroffenen Entscheidungen unser ganzes Leben beeinflussen.
Mein Zuhause – das seid ihr. Susanne, Helma, Ellie, Ute, Marie: fünf Freundinnen, die seit ihrer Jugend eng verbunden sind- und ein Freund von damals, dessen plötzlicher Tod sie dazu bringt, nachzudenken: Über ihr Leben, ihre Entscheidungen, über Loyalität und ihre Erinnerungen, die ihre ganz eigenen Geschichten schreiben. Lange haben die Frauen nicht an Frankie gedacht und an den einen Abend, an dem er damals plötzlich verschwand. Doch jetzt ist es an der Zeit sich der Vergangenheit zu stellen.
Die Träume unserer Jugend geistern auch dann noch durch unsere Köpfe, wenn wir längst erwachsen sind- genauso wie die Entscheidungen, die wir einst getroffen und die Wege, die wir damals eingeschlagen haben, uns ein Leben lang begleiten
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christiane Wünsche wurde 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, aber schon kurze Zeit später zog die Familie nach Kaarst am Niederrhein. Mit 20 begann Christiane Wünsche ihr Studium in der Großstadt, dennoch blieb sie der Heimat eng verbunden. Seit 1991 wohnt sie wieder in Kaarst, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Sie hat eine erwachsene Tochter, der Familie genauso wichtig ist wie ihr. Mit ihrem Debüt-Roman »Aber Töcher sind wir für immer« gelang Christiane Wünsche auf Anhieb der Einstieg auf die Bestseller-Liste, »Heldinnen werden wir dennoch sein« ist ihr zweiter Roman, der ebenfalls am Niederrhein spielt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Hinweis: Dieses Buch ist ein Roman. Etwaige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig.
Den Kaarsterinnen und Kaarstern
Die auf der Karte eingezeichneten Geschäfte, das Hexenhaus und der Küllenhof sind frei erfunden.
Prolog
Wer bin ich? Das habe ich mich zeit meines Lebens gefragt. Und: Wer will ich sein?
Bin ich der eher oberflächliche Sohn eines sanften, freundlichen Buchhändlers, welcher den Kopf voller Zitate von berühmten deutschen Schriftstellern und Philosophen hatte, in dem sich aber auch über die Jahrzehnte der Staub angesammelt hatte von all den alten Schinken? Schichten aus Staub, die seinen Schmerz verdeckten, eine jüdische Mutter gehabt zu haben, die sich ein Jahr nach der Machtergreifung Hitlers das Leben nahm? Bin ich der laute Sohn einer eher stillen, zurückhaltenden Mutter, die als kaufmännische Angestellte den Buchladen immer wieder gekonnt auf Vordermann gebracht und gleichzeitig ihre Kinder mit ihrer verschwenderischen Liebe umsorgt hat? Der der Krieg auch nach fünfundsiebzig Jahren noch in den Knochen steckt, weil er ihr bei einem Bombenangriff alle drei Geschwister und die Großmutter nahm?
Bin ich der alberne kleine Bruder eines Draufgängers und Erfolgsmenschen, der seine Manneskraft zweifellos durch seine Karriere und die Zeugung von drei Kindern unter Beweis gestellt hat?
Bin ich ein Frauenversteher, wie alle immer sagen?
Als Kind habe ich es mir großartig vorgestellt, ein Mädchen zu sein. Nicht wie ein Transgender, der das Gefühl hat, im falschen Körper zu stecken. Nein, das war es nicht. Aber ich fand, dass es Mädchen leichter haben, zu sich zu finden. Einfach die zu sein, die sie sind. Von einem Mädchen wird nicht erwartet, dass es kämpferisch, erfolgreich oder rücksichtslos ist. So dachte ich in meiner Naivität.
Dann lernte ich Helma kennen, das tapferste Mädchen, das man sich vorstellen kann, und Susi, die pausenlos auf der Suche nach der ganz großen Liebe war und alles dafür getan hätte. Und Ellie, die für ihren Bruder zur Löwin wurde, Ute, die mit ihrem Intellekt sämtliche Jungs in die Tasche gesteckt hat, und Marie, die stärker und selbstloser war, als alle anderen ahnten.
Und rücksichtslos können sie alle sein. Das musste ich bitter erfahren. Ich weiß nicht, ob ich es ihnen verübeln kann, denn ihr Kampf im Leben ist ein anderer als der von uns Männern.
Nein, es ist nicht leichter, ein Mädchen zu sein. Ganz im Gegenteil.
Bin ich ein Weichei? Auch das habe ich mich wieder und wieder gefragt.
Wir Babyboomer sind eine Weicheigeneration, das ist unumstritten. Unsere Eltern und Großeltern haben das Land, als es in Schutt und Asche lag, mit bloßen Händen wiederaufgebaut und eine schöne neue Welt erschaffen. Für uns, ihre Nachkommen.
Wir sind ohne Krieg und Hunger aufgewachsen, ohne Revolution und ohne Studentenbewegung. Okay, wir haben die Bedrohung des Kalten Krieges ertragen müssen, sahen in den Nachrichten brutale Bilder von RAF-Attentaten, wurden mit der Katastrophe von Tschernobyl, dem Waldsterben, Aids und dem Ozonloch konfrontiert. Doch was haben wir getan? Einige von uns haben sich immerhin aufgerafft, sind zu Friedensdemos gegangen oder zum Kirchentag gefahren, ein paar engagierten sich bei Greenpeace oder Amnesty International. Aber die allermeisten haben Karottenjeans, Netzhemden und Schulterpolster getragen, Neue Deutsche Welle gehört, sich auf die Sonnenbank gelegt, einen Walkman gekauft, mit achtzehn den Führerschein gemacht und geglaubt, Glück sei ein Grundrecht. Wir sind die Generation, die einen VW Golf fuhr und das immens wichtig fand. Belangloser geht es doch gar nicht.
Wer bin ich? Das habe ich mich gefragt, und allein, dass ich mir diese Frage stellen durfte, ist ein Luxus. Es bedeutet, dass ich die Muße dazu hatte.
Es gab viele Leute, meistens männlichen Geschlechts, die mich wegen meiner Homosexualität verhöhnt haben. Als Teenager hat mich das besonders fertiggemacht, denn ich wusste eben nicht, wer und was ich bin. Ich war schlichtweg ratlos und völlig durcheinander.
Wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, hätte ich mir die Frage vielleicht nie stellen müssen. Die Frauen halten die Welt zusammen und die Zügel in der Hand. Sie sorgen dafür, dass es weitergeht, dass es immer weitergeht.
Und wir Männer? Keine Ahnung! Ich wollte stets ein Künstler sein, und das ist mir irgendwie auch gelungen. Es ist wohl das Einzige, was ich im Leben als Erfolg verbuchen kann. Aber es ist zu wenig, leider viel zu wenig, denn ich habe einen Fehler begangen, den ich damit nicht ausbügeln kann, einen verhängnisvollen Fehler auf der Suche nach mir selbst.
Gemeinsame Zeit
Susi
Das Café war erfüllt von Stimmengewirr und dem Klappern von Besteck auf Geschirr, warme Heizungsluft mischte sich mit den Ausdünstungen der Gäste zu wahrhaft tropischer Hitze, und es kam Susanne Wienand, von allen Susi genannt, so vor, als ließen die Topfpflanzen auf den Fenstersimsen vor lauter Ermattung die Blätter hängen. Sie lechzte nach frischer Winterluft und fragte sich gleichzeitig, ob vielleicht nur sie die Temperaturen als unangenehm empfand, weil ihr die Wechseljahre wieder einmal einen Streich spielten.
Doch was es auch war, inzwischen schwitzte sie mächtig und hoffte inständig, dass ihr Deo nicht versagte. Zudem fühlte sie sich in dem figurbetonten Wollkleid, das sie sich für diesen Anlass gekauft hatte und dessen blassrosa Farbe nach Aussage der Verkäuferin mit ihrem Hauttyp harmonierte, von Minute zu Minute unwohler, da es nach dem üppigen Frühstück am Bauch und unter der Brust zwickte. Sie fächerte sich mit der Frühstückskarte Luft zu und schwor sich im Stillen, bis Ostern mindestens fünf Kilo abzunehmen.
Es war nicht der erste Vorsatz seiner Art, und Susi schalt sich eine alberne Gans, weil sie doch genau wusste, dass sie es wieder nicht schaffen würde. Sie aß einfach viel zu gern, und Essen war Balsam für die Seele.
Nun freute sie sich über die kühle Brise, die der behelfsmäßige Fächer erzeugte. Währenddessen plauderte sie mit ihren Gästen, lächelte mal hierhin, mal dorthin und nippte abwechselnd an ihrem Sekt und dem Latte macchiato.
Es war Susi Wienands vierundfünfzigster Geburtstag, und sie hatte an diesem Sonntag im Januar ihre Mutter, ihre Schwester Melanie, ihre einundzwanzigjährige Tochter Sarah und ihre drei Freundinnen Ute, Helma und Ellie ins derzeit in Kaarst sehr beliebte Café Apfelblüte zum Frühstück eingeladen. Lisa Mancini, die knapp dreißigjährige Tochter ihrer verstorbenen Freundin Marie, hatte für heute leider absagen müssen. Als Museumspädagogin musste sie manchmal am Wochenende arbeiten.
Seit langem feierte Susi ihre Geburtstage im Kreis der Frauen, die ihr nahestanden. Männer wurden bei diesen Feiern außen vorgelassen. Begonnen hatte sie damit an ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag aus einer Laune heraus, damals in Form eines Tequilabesäufnisses, nur mit den Freundinnen. Als sich die ausgesaugten Zitronenscheiben in der Mitte des Tisches häuften, auf dem überall Salzkristalle glitzerten, weil die Freundinnen es nicht mehr hinkriegten, mit dem Streuer auf ihre angefeuchteten Handrücken zu zielen, und alle mehr oder minder hinüber waren, hatte Susi geschworen, sie alle jedes Jahr einzuladen.
»Nur euch Mädels«, hatte sie getönt, die Gläschen neu gefüllt, und alle waren begeistert gewesen. »Auf uns!«
Inzwischen war aus der spleenigen Idee von damals eine mehr oder minder lästige Tradition geworden.
Eigentlich hatte Susi in diesem Jahr der Sinn überhaupt nicht nach Feiern gestanden. Viel lieber wäre sie mit Martin und Sarah am Abend zum Griechen um die Ecke gegangen, hätte einen gut gewürzten Grillteller verspeist – und gut. Ihr Mann musste in letzter Zeit viel und lange arbeiten, die gemeinsame Zeit mit ihm war rarer und kostbarer geworden. Und Sarah studierte seit eineinhalb Jahren in Münster Jura. Sie wohnte dort mit zwei Kommilitoninnen in einer WG und kam nur selten nach Hause an den Niederrhein, um in ihrem alten Kinderzimmer zu übernachten.
Susi genoss es, wenn sie ihr einziges Kind um sich hatte, und vermisste Sarah schmerzlich, sobald sie wieder abgereist war. Seit ihrem Auszug fühlte Susi sich ihrer Mutterrolle beraubt, obwohl sie doch wusste, wie albern das war. Hatte sie sich nicht eher stolz und glücklich zu fühlen, eine dermaßen selbstbewusste und starke Tochter großgezogen zu haben, die unbeirrt ihren Weg ging? Und es war schließlich völlig normal und richtig, wenn die Kinder flügge wurden. Dass sie auf ewig zu Hause hocken blieben und sich von Mama bedienen ließen, war sicher keine Alternative.
Dennoch: Sarah zu umsorgen, zu unterstützen und zu verwöhnen und später, als sie volljährig wurde, immerhin noch als Beobachterin und Ratgeberin an ihrem Leben teilzuhaben hatte Susi Bedeutung und Stabilität verliehen. Was und wer war sie ohne all das? Noch immer hatte Susi die Lücke nicht mit anderen sinnvollen Beschäftigungen füllen können, was in erster Linie Martin zu spüren bekam, den sie deutlich mehr beanspruchte als zuvor.
Martin Wienand war als Anwalt in einer der führenden Großkanzleien Deutschlands ein vielbeschäftigter und -gefragter Mann, der fast rund um die Uhr arbeitete. Demzufolge reagierte er eher genervt als erfreut auf Susis verstärkten Wunsch nach Zweisamkeit und gemeinsamen Unternehmungen, so dass Susi sich noch mehr in Frage stellte.
Sie beschloss, sich an ihrem Geburtstag nicht weiter in Selbstmitleid zu ergehen, ordnete mit den Fingern ihren gestuften blondierten Bob, der den Ansatz ihres Doppelkinns verbergen sollte, kippte ihren Sekt herunter und widmete sich wieder Ute zu ihrer Linken.
Immerhin hatte sie noch ihre Freundinnen, und das seit ihrer gemeinsamen Jugend. Die Freundschaft zu ihnen stellte für Susi einen Schatz dar, der nach Kräften zu hüten war.
»Ich begreife einfach nicht, warum Tim sein Studium unbedingt abbrechen will«, meinte Ute gerade stirnrunzelnd, während sie an ihrer Papierserviette herumfingerte. »Er war schon immer ein Sprachengenie und mehr der intellektuelle Typ, aber plötzlich will er nichts mehr davon wissen und Schreiner werden. Schreiner! Das stelle man sich mal vor!«
Susi nickte geistesabwesend und kam nicht umhin festzustellen, wie sehr ihre Jugendfreundin in den letzten Jahren gealtert war. Zwar war ihre Figur immer noch top in Form, aber ihre Haut wirkte bleich und zerknittert, und das teils ergraute Haar hätte dringend einen neuen Schnitt nötig gehabt. Letzteres passte überhaupt nicht zu ihr. Normalerweise war Ute stets pingelig um ihr Äußeres bemüht und pflegte sich akribisch. War bei ihr etwa noch etwas im Argen, außer dass sie sich um Tims Zukunft sorgte? Susi erwog, die Freundin darauf anzusprechen. Andererseits war Ute ein sehr verschlossener Mensch. Man musste behutsam vorgehen, damit sie sich öffnete, sonst kriegte man lediglich eine abwehrende Antwort …
»Deine Sarah ist sehr zielstrebig, nicht wahr? Du hast echt Glück!«, unterbrach Ute Susis Gedanken.
»Stimmt.« Susi nickte und strahlte, wie sie es stets automatisch tat, wenn es um ihr heißgeliebtes Kind ging. Ihr Blick flog zu Sarah hinüber, die rechter Hand am anderen Ende des Tisches saß und sich angeregt mit Susis Mutter unterhielt. Großmutter und Enkeltochter waren sich immer nahe gewesen, wohl auch, weil Sarah in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Großeltern aufgewachsen war, und Susi von jeher ein enges Verhältnis zu ihren Eltern gehabt hatte. Sie schneite gern auf einen Kaffee bei ihnen herein. In den letzten Monaten hatte sich die Frequenz aufgrund der sich verschlimmernden Demenz ihres Vaters sogar noch erhöht, so dass sie die beiden inzwischen fast täglich besuchte.
Susi empfand es als ein großes Glück, dass sie Martin vor zwanzig Jahren dazu hatte überreden können, im Kaarster Stadtteil Büttgen das brachliegende Grundstück neben ihrem Elternhaus zu erstehen, um dort ihr Eigenheim zu bauen. Seitdem lebten die Wienands in dem freistehenden Haus, und Susi liebte nicht nur die lichtdurchfluteten Räume mit dem warmen Parkettboden und die offene, moderne Wohnküche, sondern auch den großen Garten mit seiner weitläufigen Rasenfläche und den Beeten, die mit allerlei heimischen Sträuchern und Blumen bepflanzt waren. Für die Gartengestaltung war sie zuständig. Sie besaß einen dieser kleinen Mähroboter und sorgte dafür, dass die Gehölze regelmäßig von einem Gärtner gestutzt wurden. Um ihre Rosen und die anderen Blumen, die dem Garten je nach Jahreszeit ein anderes Farbspiel verliehen, kümmerte sie sich liebevoll selbst und fragte ab und an Helma, die Floristin unter ihren Freundinnen, um Rat.
Susi dachte daran zurück, dass vor dem Hausbau inmitten von Brombeerranken, Brennnesseln und hüfthohem Unkraut ein verfallenes Backsteinhaus gestanden hatte, in dem sie sich in den Achtzigern mit der Clique trafen.
Wer sagte eigentlich heute noch Clique zu seinem Freundeskreis, überlegte sie. Sarah jedenfalls nicht. Verblüfft ging ihr auf, dass die Bezeichnung unversehens zu einem Jugendwort ihrer Generation geworden war und heute altmodisch anmutete. Und wie häufig Susi sich dabei ertappte, von »früher« zu sprechen! Untrügliche Anzeichen des Alterns, dachte sie, schluckte und zwang sich dazu, sich auf Sarahs erfreulichen Anblick und damit auf die Gegenwart von 2020 zu konzentrieren.
Ihre Tochter saß kerzengerade auf ihrem Bistrostuhl, die schmalen Schultern durchgedrückt, den Schwanenhals, der von langen lässigen Beach Waves umspielt wurde, graziös gereckt. Sie lächelte ihrer Großmutter zu. Ihre Lippen glänzten, die blauen Augen unter zu perfekten Bögen gezupften Augenbrauen strahlten. Sarah war so wunderhübsch, dass Susi darüber nur staunen konnte und es sie ganz unvernünftig stolz machte. Ihr Herz quoll über vor Mutterliebe. Außerdem fand sie es wieder einmal unglaublich, dass sie dieses makellose Geschöpf geboren haben sollte, sie, die ewig mollige Susi, deren Figur mit zunehmendem Alter immer mehr aus dem Leim ging.
Mit halbem Ohr hörte sie Ute zu, die weiter über ihren wankelmütigen Sohn herzog, als sei er ein ungeliebtes Kuckuckskind. Dabei war Tim ihr Augenstern, anders als ihre vier Jahre jüngere Tochter Lea, zu der Ute wenig Draht zu haben schien. Lea war extrem selbständig und tough, und Ute hätte allen Grund gehabt, sich im Glanz ihrer Leistungen zu sonnen. Vor zweieinhalb Jahren hatte sie an der internationalen Schule in Neuss ein tadelloses Abitur abgelegt, um anschließend in England International Business zu studieren.
Bald war Susi es überdrüssig, Utes Beschwerden zu lauschen und ab und an ein paar passende Kommentare einzustreuen. Klammheimlich fand sie es sympathisch, dass Tim sein Studium hinschmeißen wollte, um ein Handwerk zu erlernen. Junge Menschen mussten ihren Weg manchmal über Umwege finden, glaubte sie, und Tim war nach ihrem Dafürhalten schon immer eher handfest als hochgeistig gewesen. Er kam in der Hinsicht ganz nach seinem Vater. Dass er studieren sollte, hatte Ute ihm eingeredet, und er hatte sich ihrem Wunsch anfangs wohl nur gebeugt, weil es bequemer war, als sich über eigene Wünsche und Ziele den Kopf zu zerbrechen und selbständig Entscheidungen zu treffen.
Sarah indes hatte schon mit vierzehn Jahren gewusst, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten wollte. Sie studierte mit einem so zielstrebigen Ehrgeiz Jura, dass es Susi als Mutter geradezu unheimlich war. Für die große Liebe oder einen Freund an ihrer Seite schien sie überhaupt keine Zeit zu haben. Oder zumindest erwähnte sie nie einen jungen Mann, der ihr gefiel oder mit dem sie sich traf. Susi bekam auf ihr Nachbohren lediglich knappe, abwiegelnde Antworten. Auch konnte Susi sich nicht erinnern, dass sich ihre Tochter, als sie noch zu Hause gewohnt hatte, je vor Sehnsucht nach einem Jungen verzehrt hätte oder von Liebeskummer gebeutelt wurde.
Susis Jugend war dagegen ein einziges Wechselbad der Gefühle gewesen. Sich zu verlieben und den Richtigen zu finden hatte auf ihrer Prioritätenliste ganz oben gestanden. Eine Zeitlang waren die Jungs verrückt nach ihr gewesen, denn mit ihrem üppigen Busen, den weiblichen Kurven und dem blonden Wallehaar hatte sie sich zunächst ziemlich von den meisten Mädchen ihres Alters unterschieden, deren körperliche Entwicklung langsamer voranschritt und die mit ihren knospenden Brüsten und den dünnen, langen Gliedmaßen eher jungen Trieben und nicht wie Susi einer voll erblühten Blume glichen.
Susi seufzte, denn den Vorsprung hatte sie nicht lange halten können, sondern war bald hinter den schlanken, grazilen Schönheiten zurückgeblieben. Ihre Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit war jedoch nicht gewichen. Sie erschauderte, als sie daran dachte, dass sie sogar einmal all ihre Hoffnungen in Jürgen gesetzt hatte, diesen Macho und Großkotz, der Teil ihrer Clique gewesen war und jetzt ein Autohaus in Neuss besaß. Aus dem coolen, muskulösen und blendend aussehenden Jürgen mit der Affinität zu motorisierten Fahrzeugen aller Art war über die Jahrzehnte ein behäbiger, fetter Spießer geworden, der sich neben seiner Firma und seinen Luxuskarossen nur für Borussia Mönchengladbach interessierte. Wie gut, dass er letzten Endes nichts von ihr hatte wissen wollen!
Soweit sie sich erinnern konnte, war es auch bei den anderen Mädchen ständig darum gegangen, wer mit wem ging, welcher Junge toll und cool und welcher es nicht wert war, auch nur einen Gedanken an ihn zu verschwenden.
Sarah schien ihr in der Hinsicht eher kühl und abgeklärt. Energie und Leidenschaft steckte ihre schöne Tochter allein in ihre berufliche Karriere, ähnlich wie Utes Tochter Lea. War dieses Verhalten eventuell typisch für deren Generation und den immer neuen Anforderungen in einer sich rasant wandelnden Gesellschaft geschuldet?
Ute plapperte weiter, und Susi langweilte sich.
Wie froh war sie, als der Kellner kam, um die leeren Käse- und Aufschnittplatten sowie Teller und Gläser abzuräumen, und sich ihr damit die Chance bot, sich ihrer Freundin zur Rechten zuzuwenden.
Sie kannte Helma exakt so lange wie Ute, nämlich seit dreiundvierzig Jahren, nur war Helma ein völlig anderer Typ. Groß, hager, mit raspelkurzem graumeliertem Haar, runder Metallbrille auf langer Höckernase, schwarzer hautenger Jeans zu klobigen Boots, knallrotem Oversizepulli und dicken Silberringen an den dürren Fingern wirkte sie wie eine Exzentrikerin inmitten dieser doch eher konservativen Runde. Dabei kam Helma Küllen vom Bauernhof und betrieb in Vorst einen Blumenladen. Sie war so bodenständig, wie man nur sein konnte, und gleichzeitig der toleranteste und weltoffenste Mensch, der Susi je untergekommen war. Helma hatte keine Kinder, lebte allein, und es hatte auch nie einen Mann an ihrer Seite gegeben, soweit Susi wusste. Als junge Frau hatte sie dieser Umstand traurig gemacht, heute war sie damit wohl im Reinen.
»Ich bin ein Topf, auf den kein Deckel passt«, pflegte Helma achselzuckend zu sagen, wenn man sie auf ihr Singledasein ansprach. »Vielleicht bin ich ein Milchtopf. Der kommt ohne Deckel aus.«
Susi mochte Helma sehr. In ihrer Gegenwart fühlte sie sich stets geborgen, und trotz Helmas dünner Statur kam sie sich neben ihr nie fett oder gar unförmig vor, anders als bei Ellie Meyerhoff, der dritten Freundin, die mit am Tisch saß und die mit ihren knapp ein Meter sechzig irritierenderweise immer noch Größe vierunddreißig trug.
Jetzt legte Susi Helma eine Hand auf die knochige Schulter. »Sag mal, gibt es bei dir im Laden eigentlich schon Traubenhyazinthen, oder ist es zu früh dafür? Ich bräuchte ein paar für meine Beete.«
»Na, warte noch ein bisschen, dann kann ich dir eine Palette vom Großmarkt mitbringen. Anfang Februar dürfte es so weit sein. Der Winter war ja bislang extrem mild. Es geht alles etwas schneller als sonst.«
Susi nickte zufrieden. Sie liebte Perlblümchen. Für sie symbolisierten sie wie nichts anderes das beginnende Frühjahr. Was für andere Menschen wahrscheinlich Narzissen oder Primeln darstellten, waren für Susi die zarten Pflanzen mit den blauen kerzenförmigen Blütenständen. Aber noch war natürlich tiefster Winter. Das Jahr war jung, das Wetter trüb, regnerisch und grau.
Susi machte eine Bewegung neben Sarah aus. Mama war aufgestanden, drückte Sarah ein Küsschen auf die Wange und schulterte ihre Handtasche. Susi fand, dass ihre Mutter mit dem adretten Kurzhaarschnitt und der drahtigen Figur immer noch sehr gut aussah. Sie wirkte, obschon längst ergraut, deutlich jünger als zweiundachtzig Jahre.
»Kind, nimm es mir nicht übel, ich habe keine Ruhe und fahre nach Hause. Ich mag Franz nicht so lange allein lassen«, sagte sie bedauernd.
Susi erhob sich mit einem Kloß im Hals von dem Stuhl mit den viel zu eng beieinanderstehenden Armlehnen und verabschiedete sich mit einer festen Umarmung von ihrer Mutter.
Sie konnte verstehen, dass Mama unruhig war und nach Hause wollte. Papa wusste manchmal nicht mehr, in welcher Zeit sie sich befanden. Dann wähnte er sich beispielsweise in Pommern, wo er seine Kindheit verbracht hatte, und fragte nach seinen Eltern, die seit über zwanzig Jahren unter der Erde lagen, oder er glaubte, mit Susis Mutter frisch verheiratet in ihrer kleinen Dachwohnung in Essen zu wohnen. Keiner konnte absehen, auf welche Ideen Papa in solchen Phasen der Desorientierung kam. Es tat Susi weh, ihren einstmals vitalen und geistig regen Vater so zu erleben. Es kam ihr vor, als sei seine markante Persönlichkeit in Auflösung begriffen. Außerdem tat ihr ihre Mutter unendlich leid. Aus ihrem Ehemann und Partner, auf den sie sich immer hatte stützen können, wurde schleichend eine Art unvernünftiges Kind. Nicht auszudenken, dass Martin einmal so enden könnte. Oder gar sie selbst.
»Danke, Mama, dass du gekommen bist. Ich besuche euch morgen, ja? Richtest du Papa meine Grüße aus?«
»Von mir bitte auch.« Das kam von Melanie.
Susi fragte sich, warum ihre drei Jahre jüngere Schwester nicht angeboten hatte, zwischendurch nach Papa zu schauen, damit Mama etwas länger beim Geburtstag ihrer Ältesten bleiben konnte. Sie hätte damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können und nach Monaten endlich einmal ihren hinfälligen Vater wiedergesehen. Andererseits war es typisch für Melanie, dass ihr der Gedanke überhaupt nicht gekommen war. Sie war kein Familienmensch, lebte völlig ungebunden in Düsseldorf, wo sie als Geschäftsführerin in einer Marketingagentur arbeitete, besuchte nach Feierabend ein Fitnessstudio, um ihren ohnehin gertenschlanken Körper zu stählen, und liebte ihre Fernreisen mit ständig wechselnden Männern. Mit Kindern hatte sie sich nie belastet; und bei ihren Eltern oder Susi kam sie nur alle paar Monate auf eine Stippvisite vorbei.
Obwohl Susi all das seit langem bekannt war, ärgerte sie sich darüber. Das Leben war kein Ponyhof, und jeder hatte Verantwortung für seine Lieben zu tragen.
»Richte ich ihm aus.« Mama lächelte tapfer und friemelte den Autoschlüssel aus der Tasche ihrer Winterjacke.
»Und danke für dein tolles Geschenk!«, beeilte Susi sich noch zu sagen. Mama hatte für sie ein Album mit Bildern aus Susis Kindheit und Jugend gestaltet, keins dieser Fotobücher, die man online hochlud, sondern ein dickes mit Stoffeinband, das eigenhändig mit Fotoecken fixierte Abzüge auf steifen Pappseiten enthielt, zwischen denen Transparentpapier knisterte.
Susi hatte keine Ahnung, wo Mama manche der Aufnahmen aufgetrieben hatte, denn beim schnellen Durchblättern war ihr aufgefallen, dass es auch welche enthielt, die sie mit ihrer alten Clique zeigten, damals, zu Beginn der achtziger Jahre, auf dem Küllenhof, drinnen im Kickerraum oder draußen auf den Stoppelfeldern, wo sie ein Feuerchen gemacht und in der Glut Kartoffeln gegart hatten.
Mama lächelte verschmitzt. »Dafür darfst du dich auch bei deinen Freundinnen bedanken«, beantwortete sie Susis unausgesprochene Frage. »Sie haben etliches dazu beigetragen.«
Helma und Ute grinsten verschwörerisch, und Ellie schmunzelte vom anderen Ende des Tisches ebenfalls in Susis Richtung.
Plötzlich wurde Susi ganz warm ums Herz. Wie glücklich sie sich schätzen konnte, solche Freundinnen zu haben. Natürlich hatte jede von ihnen ihre Macke, genauso wie sie, aber letztlich zählte, dass die gemeinsame Jugend sie zusammengeschweißt hatte und sie über Jahrzehnte zueinander hielten.
»Danke, euch allen«, hauchte sie mit Tränen der Rührung in den Augen.
»Einige Bilder hat mir mein Mann überlassen«, sagte Ute. »Die Qualität ist nicht gerade überragend, aber das finde ich nicht weiter tragisch. Stell dir vor, der Film steckte noch in seinem albernen kleinen Fotoapparat ohne Blitz, den er damals immer mit sich rumgetragen und uns mit der Knipserei genervt hat. Es war kein Problem, die uralten Fotos zu entwickeln. Irre, oder?«
Susi nickte begeistert. »Allerdings, klasse!« Sie freute sich darauf, das Album später zu Hause in Ruhe anzusehen.
»Jetzt muss ich aber wirklich los.« Mama klopfte zum Abschied auf den Tisch. »Euch noch viel Spaß!« Sie eilte aus dem Café, und Susi blickte ihr besorgt nach.
»Hoffentlich ist mit Papa alles gut«, überlegte sie laut. »Die Reinigungskraft guckt zwar nach ihm, aber er ist furchtbar störrisch geworden. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wird Yolanda ihn nicht davon abhalten können.«
»Es wird schon nichts passiert sein«, sagte Melanie gelassen. »Entspann dich.«
Susi kniff die Augen zusammen. Melanie machte es sich einfach zu leicht. Gerade wollte sie zu einer schnippischen Erwiderung ansetzen, als Helma sie beruhigte: »Deine Mutter ist ja in ein paar Minuten bei ihm. Heute ist dein Geburtstag. Genieße ihn. Und bis dato hat dein Vater doch noch nie etwas Schlimmes angestellt, oder?«
Susi schüttelte den Kopf. Dann lächelte sie. »Nein, bis auf das superteure Zeitschriftenabo, das er an der Haustür abgeschlossen hat, als Mama einkaufen war. Hoch im Sattel und fest im Glauben heißt das Hochglanzmagazin. Dabei ist keiner von beiden je geritten, und besonders gläubig sind sie auch nicht!« Sie zog einen übertriebenen Flunsch, und alle lachten.
»Und wie ging es weiter?«, wollte Ute wissen. »Diese Haustürgeschäfte sind doch total unseriös.«
Susi nickte. »Na, Martin hat die Sache übernommen, rechtliche Schritte gegen die Firma eingeleitet, und danach war wieder alles in Butter.«
Sie fing an, sich zu entspannen, bestellte eine weitere Runde Sekt, prostete allen zu und setzte sich dann neben Sarah auf den frei gewordenen Platz. Gerade überlegte sie, den Frauen anzubieten, zum Kuchen überzugehen, denn sie hatte inzwischen richtig Appetit auf etwas Süßes, als Ellie wie aus heiterem Himmel herausplatzte: »Sagt mal, habt ihr eigentlich schon gehört, dass Frankie tot ist?«
Susi, Helma und Ute schauten einander zutiefst erschrocken an, und Helma wurde sogar leichenbass. Dann hefteten sich ihrer aller Blicke auf Ellie. Sarah machte ein fragendes Gesicht.
»Aber ich weiß ja nicht, ob das hierhergehört«, murmelte Ellie in zweifelndem Tonfall, was so typisch für sie war, dass Susi sie am liebsten geschüttelt hätte. Immer diese Andeutungen und die Geheimniskrämerei! Schon als Teenager war sie so gewesen. Es hatte ihr unglaublichen Spaß bereitet, sich in Szene zu setzen und mit ihrem puppenhaften Aussehen und irgendwelchen Neuigkeiten aus dem Dorf und der Schule, die sie wer weiß wo aufgeschnappt hatte, zu glänzen.
»Meinst du etwa Frank Sonnenberg?«, fragte Melanie. »Ist der nicht vor Ewigkeiten nach Berlin gezogen?« Sie hatte aufgrund des Altersunterschieds andere Freunde als Susi gehabt.
»Ja.« Ellie nickte. »Keiner von uns hat ihn seit Ende der Achtziger mehr gesehen.«
Melanie zuckte gleichmütig mit den Achseln. Frankies Schicksal schien sie nicht weiter zu kümmern. »Seine Eltern hatten früher diesen Buchladen in der Stadtmitte, oder? Als ich im Herbst das letzte Mal in Kaarst war, ist mir aufgefallen, dass der dichtgemacht hat.«
»Ja, Frankies Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, und seiner Mutter war es auf Dauer zu viel, sich allein um das Geschäft zu kümmern«, erklärte Ute ihr.
»Ach so. Jetzt ist da ein Schuhladen drin, der tatsächlich keine schlechte Auswahl hat«, fuhr Melanie fort. »Ich habe mir dort ein Paar schwarze Wildlederstiefeletten gekauft. Runtergesetzt. Ein echtes Schnäppchen!«
Susi spürte, dass sie einen roten Kopf bekam, so sehr ärgerte sie sich über ihre unsensible Schwester. Frankie war immerhin einmal einer ihrer besten Freunde gewesen, und Melanie ging über die schreckliche Nachricht seines Todes hinweg, als sei die nicht der Rede wert.
Frankie hatte wie Helma, Ellie und Ute zu ihrer Clique gehört und sogar lange Zeit deren quirligen Mittelpunkt gebildet. Melanie wusste das. Ein Quäntchen Einfühlungsvermögen hätte Susi schon von ihr erwartet!
Nachdem sie ihrer Schwester einen vernichtenden Seitenblick zugeworfen hatte, wandte sie sich erklärend an Sarah. »Frankie war ein sehr guter Freund. Er ging mit mir auf dem Gymnasium in dieselbe Klasse.«
Und Helma ergänzte: »So wie Ute, Ellie und ich auch. Und später Marie, die leider vor bald zehn Jahren nach einem Autounfall verstorben ist. Wir sechs waren unzertrennlich, die allerbesten Freunde, noch bevor Jürgen und mein Bruder Norbert dazukamen. Die zwei besuchten ja die Hauptschule in Büttgen und sind etwas älter. Wir alle haben früher oft bei uns auf dem Hof oder draußen auf dem Acker gespielt. Später wurde ein verfallenes Häuschen zum Treffpunkt, das mal an der Stelle stand, wo deine Eltern wohnen, Sarah. War echt eine tolle Zeit und Frankie der Lustigste von uns. Er ist zum Studieren nach Westberlin gezogen und nach der Wende dortgeblieben.« Sie schluckte und sprach mit belegter Stimme weiter: »Ellie, bist du dir sicher, dass er tot ist? Woher willst du das überhaupt wissen?«
Ellie wand sich. Auf einmal schien sie unsicher zu sein, ob sie ihr Wissen preisgeben sollte. »Sein Bruder hat mir vor ein paar Tagen die Todesanzeige geschickt«, stotterte sie schließlich. »Ihr wisst doch, Dirk und ich hatten mal was miteinander, und wir sind in Kontakt geblieben. Sporadisch, versteht ihr?«
»Klar.« Ute grinste spöttisch. »Sporadisch. Ist Dirk nicht verheiratet und hat einen ganzen Stall voller Kinder? Na ja, das geht mich nichts an, aber …«
»Allerdings nicht!« Ellie wurde puterrot im Gesicht, straffte sich und strich sich mit gespreizten Fingern durch ihre dicke, weißblond gefärbte Mähne. »Ich bin schließlich geschieden und kann tun und lassen, was ich will.«
»Komm zum Punkt, Ellie!«, unterbrach Susi sie. »Woran ist Frankie überhaupt gestorben? War er krank?«
In den letzten Jahren waren einige Gleichaltrige in ihrem weitläufigen Bekanntenkreis an Krebs, den Folgen eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarkts gestorben. Es war eine schmerzliche Erfahrung, einsehen zu müssen, dass man nicht automatisch achtzig oder älter wurde, doch man gewöhnte sich langsam an derartige Hiobsbotschaften. Bei einem ehemals sehr engen Freund war das natürlich etwas komplett anderes. Der Tod rückte näher.
»Nee, er hat sich umgebracht.« Ellies Antwort kam schnell und patzig. Sie hob ihre mageren Schultern. »Mit Tabletten und Alkohol. Mindestens fünf Tage lang lag er tot in seiner Wohnung in Kreuzberg, hat Dirk am Telefon gesagt, als ich ihn angerufen habe, um Näheres zu erfahren. Er hat mir auch erzählt, dass die Familie sich schon lange Sorgen um Frankie gemacht hat. Er ist wohl in den letzten Jahren ziemlich abgedriftet. Die Beerdigung findet am Donnerstag auf dem Kaarster Friedhof statt. Seine Mutter will Frankie neben seinem Vater begraben lassen.« Nun ließ sie ihren Blick in die Runde schweifen und sah Susi, Ute und Helma nacheinander an. »Wir könnten ja alle zusammen hingehen.«
Zeit zum Innehalten
Die Träume unserer Kindheit geistern auch noch durch unsere Köpfe, wenn wir längst erwachsen sind. Im besten Fall begleiten sie uns als niedliche kleine Gespenster, die ab und an »Buh« rufen und dann kichernd verschwinden, im schlimmsten Fall werden sie zu Monstern in Albträumen. Ich träumte als Junge davon, später einmal Kunst zu machen und Farbe in die Welt zu pinseln. Ich glaubte an Gerechtigkeit, Freundschaft und Treue. An die Liebe glaubte ich nicht. Allein, wenn ich an Liebe dachte, erfüllte mich das mit Unsicherheit. Und Freundschaft war außerdem viel schöner und erreichbarer! In Helma Küllen hatte ich meine liebste Freundin, für ihren Bruder Norbert schwärmte ich. Ich hoffe sehr, dass er es nie bemerkt hat.
Später in meiner wilden Zeit in Westberlin habe ich keine Freundschaften, sondern nur Zerstreuung gesucht. Es waren die Jahre vor dem Mauerfall, ein lautes Leben auf der Insel. Ich war in der Hausbesetzerszene in Kreuzberg, in den Studentenkneipen und den Clubs mehr zu Hause als an der Uni oder in meinem WG-Zimmer. Ich habe mich halb tot gesoffen, gekifft und gekokst, habe David Bowie verehrt und mit Typen geschlafen, die ihm ähnlich sahen. Ich bin wie ein bunter Schmetterling von Blüte zu Blüte geflattert.
Wenn ich annähernd nüchtern war, habe ich wie im Wahn fotografiert, gemalt und gezeichnet oder mich für Schwulen- und Lesbenrechte eingesetzt.
An meine erniedrigende Zeit bei der Bundeswehr wollte ich nicht mehr denken und mit meinem alten Leben in Kaarst so wenig wie möglich zu tun haben. Ich weiß, dass ich meinen Eltern damit sehr weh getan habe. Ich habe sie viel zu selten besucht. Aber es fiel mir schwer, ihnen oder Dirk, der die Zeit beim Bund mit Bravour gemeistert hat, unter die Augen zu treten, von meinem Freundeskreis von damals ganz zu schweigen.
Nur Marie blieb mir von meinen fünf Freundinnen, bis sie viel zu jung verunglückte, aber auch ihr habe ich mich letztlich nicht völlig geöffnet. Sie hatte ihre ganz eigene Sicht auf das, was damals geschah, eine Sicht, die ich nicht teile. Ich bin nicht gläubig, wie sie es war. Mit ihrer Vorstellung von einer »Strafe Gottes« kann ich wenig anfangen. Ich war jedoch für Marie und das Kind da, wie ich es ihr versprochen hatte.
Ganz selten habe ich in diesen vom Rausch vernebelten Jahren an die Jugendzeit auf dem Küllenhof gedacht, und wenn, dann mit einer Mischung aus Schuldgefühlen und Bitterkeit.
Helma
Helma Küllen tuckerte wie betäubt in ihrer türkisen dreirädrigen Ape mit dem gelben Werbeaufdruck Ein Mehr aus Blumen nach Hause. Ihr Haus lag ein gutes Stück hinter dem Vierkanthof der Familie auf dem Feld, etwas abseits von der Stelle, an der sich früher die Güllegrube des Nachbarhofes befand.
Ihr verwitweter Vater hatte den Bungalow einst als sein Altenteil bauen lassen. Nach seinem Tod hatte Helma ihn übernommen und von Grund auf renoviert, bis er zu dem behaglichen Zuhause geworden war, das sie für ihr Seelenleben brauchte.
Sie war froh, als sie ihr Miniauto auf den Betonplatten abgestellt, die langen Beine aus dem engen Wagen gestreckt und ihr Refugium betreten hatte. Sobald sie im Wohnzimmer war, heizte sie den Kaminofen in der Ecke an und holte, nachdem das Feuer ordentlich brannte, den Kirschaufgesetzten aus dem Büfettschrank. Nach dem Schock von eben brauchte sie etwas Hochprozentiges. Beim zweiten Gläschen flossen endlich die Tränen.
Frankie lebte nicht mehr. Sie hatte nie verstanden, warum er sich nach dem Tod ihrer Mutter plötzlich von ihr abgewandt hatte. Er war die einzige Liebe ihres Lebens gewesen, wenn man das so sagen konnte.
Früher
In der fünften Klasse des Vorster Gymnasiums hatte der pummelige Frank Sonnenberg unter den achtunddreißig Mitschülern allerdings zunächst einfach nur die Rolle des Klassenkaspers innegehabt. Seine albernen Witze, die er mitten im Unterricht zur Verzweiflung der Lehrer zum Besten gab, nervten Helma kolossal.
»Hattu Möhrchen?«, kreischte er zum Beispiel in einer Biologiestunde, als es um die Nährstoffe in den verschiedenen heimischen Gemüsesorten ging und Helma gerade einen Korb mit Kartoffeln, Karotten, Lauch, Zwiebeln und Kohlrabi auf dem Lehrerpult abgestellt hatte. Weil sie die Tochter eines Driescher Landwirts war, hatte sie auf Geheiß der jungen, schüchternen Lehrerin die Lebensmittel aus dem Hofladen als Anschauungsobjekte mitgebracht.
Häschenwitze waren zu der Zeit, 1976, schwer in Mode, aber Helma konnte sie inzwischen nicht mehr hören.
»Hattu Möhrchen?« Frank wollte sich vor Lachen ausschütten, und natürlich steckte er mit seinem Gegacker die anderen an, bis sich schließlich alle die Bäuche hielten und die Lehrerin vergebens versuchte, für Ruhe zu sorgen.
Irgendwann reichte es Helma, die immer noch mit nunmehr glühenden Ohren am Pult stand und nicht wusste, wohin mit sich. Sie hielt es nicht mehr aus, griff in den Korb, schnappte sich, was sie brauchte, stiefelte zu Franks Tisch und knallte es ihm direkt auf sein Bioheft. »Hier hast du deine Möhrchen«, rief sie gegen den Lärm an. »Sind gesund und machen schlank. Probier’s mal aus! Vielleicht hilft’s.«
Frank klappte augenblicklich den Mund zu, dann starrte er Helma an, während die Klasse den Atem anhielt und darauf wartete, dass Frank sich die Beleidigung nicht gefallen ließ und zurückschoss.
Aber er schien kein bisschen gekränkt zu sein. »Sehen lecker aus«, sagte er stattdessen, schlagartig ernst geworden, »und die anderen Sachen, die du mitgebracht hast, auch.« Er wies mit dem Kinn in Richtung ihres Korbes. »Ich halte ab sofort meine Klappe. Entschuldige bitte, Helma. Ich bin manchmal echt ein Idiot.«
In dem Moment schloss sie ihn ins Herz.
Susi, Ute und Ellie waren zwar weiterhin ihre Freundinnen, aber Frankie wurde bald ihr bester Freund, den sie gern und oft zu sich auf den Küllenhof einlud. Ihr Leben auf dem Bauernhof unterschied sich sehr von dem anderer Familien in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre. Vielleicht besuchten Frank und die Mädchen sie auch deshalb so gern.
Helma fand es natürlich völlig normal, zwischen Gemüsekisten, Traktoren, Pflügen und Grubbern aufzuwachsen und selbst kleine Aufgaben auf dem Hof zu übernehmen. Die Landwirtschaft der Küllens war ein Familienbetrieb, und jeder hatte seinen Teil beizutragen.
Helma palte beispielsweise Erbsen oder erntete Möhren, und Norbert durfte sogar den Traktor fahren, wenn Papa in der Nähe war. Darauf war ihr großer Bruder ungemein stolz. Die Küllens bauten Weizen, Kartoffeln und Futterrüben an sowie auf einem kleinen Feld neben dem Vierkanthof verschiedene Gemüsesorten. Eine Hilfe in der Landwirtschaft war Papas verrückter Cousin Jupp, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, der erst Mitte der fünfziger Jahre aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war und seitdem in einer Kammer im Nebengebäude des Hofes hauste. Obwohl ihm in der sibirischen Kälte drei Finger der rechten Hand und mehrere Zehen an den Füßen abgefroren waren, so dass er sich nur humpelnd fortbewegen konnte, arbeitete er wie ein Tier.
Es kam Helma so vor, als verfügte ihr Onkel über Bärenkräfte. Große Holzkisten, die ganz mit Kappes oder Kartoffeln gefüllt waren, trug er wie Schuhkartons.
1978, als die zwölfjährige Helma die siebte Klasse des Gymnasiums besuchte und ihr zwei Jahre älterer Bruder in die neunte Klasse der Hauptschule ging, war Jupp Küllen siebenundsechzig Jahre alt und neigte dazu, zu viel zu trinken. Frühstückskorn war inzwischen sein bevorzugtes Getränk zu jeder Tageszeit geworden, außerdem schluckte er haufenweise Tabletten gegen seine Schmerzen in den verkrüppelten Füßen. All das machte ihn unberechenbar, und Helma ging ihm, soweit es möglich war, aus dem Weg.
Heute, an einem windigen, verregneten Morgen im Oktober, saß die Familie am Frühstückstisch – wie immer ohne Onkel Jupp, der sich in seiner Kammer mit Frühstück und Abendbrot selbst versorgte. Nur das Mittagessen kochte Helmas Mutter für ihn.
Mama trieb die Kinder zur Eile. Sie sah angeschlagen aus, fand Helma. Ihr gutmütiges rundes Gesicht war bleich, unter ihren Augen schimmerten blaue Ringe, und ihr braunes Haar wirkte stumpf. Mama war eigentlich eine stattliche Frau, deren einfache Kittelkleider normalerweise an Brust und Po spannten. Jetzt schien das alte Kleid mit dem verblichenen Blümchenmuster eine Nummer zu groß zu sein, bemerkte Helma verwundert.
»Kommt schon, es ist gleich halb acht. Ihr müsst los.« Mama schob Helma und Norbert je eine Brotdose hin, die sie soeben mit belegten Schnitten und Kohlrabistücken gefüllt hatte, und warf dann einen Blick auf die Wanduhr über der Anrichte. »Helma, dein Schulbus kommt in sieben Minuten.«
Nun schaltete sich Helmas Vater ein: »Norbert, du hast mir versprochen, Onkel Jupp zu helfen, den Rübenhänger an den Traktor zu kriegen, bevor du zur Schule radelst.«
Seine sehnigen Schaufelhände mit den Schwielen an den Fingern hielten den Henkelbecher, als sei er Puppengeschirr. Er leerte seinen Kaffee in einem Zug. Dann richtete er sich mit knackenden Knien zu seiner vollen Größe von 1,90 m auf, versenkte die Pfeife in der Tasche seiner dunkelgrünen Drillichlatzhose und stieg an der Küchentür in seine Gummistiefel. »Ich muss dringend raus aufs Feld.«
»Ich hab’ Jupp heute Morgen noch gar nicht an seinem Fenster rauchen sehen, Papa«, gab Norbert zu bedenken. »Vielleicht schläft er noch.«
Mama entfuhr ein Stoßseufzer. »Er hat gestern wieder ordentlich zugelangt. Konrad, bitte rede noch mal mit ihm. So geht das nicht weiter. Er säuft sich noch zu Tode.«
Papa schnalzte ärgerlich mit der Zunge. »Ich habe mir deshalb schon den Mund fusselig geredet. Du weißt, es nützt nichts, und manchmal würde ich ihn am liebsten in die Wüste schicken, aber wir brauchen nun mal seine Arbeitskraft. Die beiden Hilfsarbeiter, die ich im Sommer eingestellt habe, tun zwar genau das, was ich ihnen auftrage, doch keinen Schlag mehr. Und über Jupp kann man sagen, was man will, aber der denkt wenigstens mit.«
»Ich fürchte mich manchmal vor Onkel Jupp«, gestand Helma leise. »Ich weiß, das ist blöd, aber …« Sie biss sich auf die Unterlippe.
»Angsthase!«, flachste Norbert und bedachte sie mit einem liebevollen Seitenblick. Helma streckte ihm die Zunge raus und registrierte zum ersten Mal, wie sehr ihr Bruder in letzter Zeit in die Höhe geschossen war. Mit krummem Rücken saß er am Tisch und schlürfte seinen geliebten Caro-Kaffee. In seinen hautengen Jingler-Jeans mit Schlag und dem engen Rollkragenpullover wirkte er sehr schlaksig, obschon seine kantigen Schultern und der gewölbte Bizeps davon zeugten, dass er langsam vom Jungen zum Mann wurde.
»Bin ich gar nicht! Aber wenn er getrunken hat, flucht er echt schlimm vor sich hin, und manchmal erkennt er mich dann nicht mal. Vorgestern hat er meinen Freund Frank Sonnenberg einen Judenbengel genannt. Ich weiß auch nicht, wieso. Und außerdem darf man das doch nicht sagen!«
Ihre Mutter war zusammengezuckt. »Natürlich nicht«, bestätigte sie mit schmalen Lippen. »Konni, sorg bitte dafür, dass er sowas unterlässt! Die Käthe von nebenan hat sich gestern auch schon bei mir über ihn beschwert. Vor ein paar Tagen ist er wohl mitten in der Nacht sternhagelvoll in ihren Kuhstall gestolpert, hat eine Mistgabel geschwungen und was von der Roten Armee gefaselt, die ihn diesmal nicht kriegen würde. Als Dieter ihn aus dem Stall bugsieren wollte, weil die Kühe so aufgeregt gemuht haben, hat er nach ihm gestochen und ihn dabei an der Schulter erwischt, bevor er zur Besinnung gekommen ist. Manchmal denke ich, wir müssten Jupp zum Irrenarzt schicken.«
»Mama, das heißt Psychiater«, korrigierte Helma sie automatisch.
»Klugscheißerin!« Norbert zwinkerte ihr zu. »Das kommt davon, wenn man aufs Gymmi geht.«
Helma nahm ihm den Spruch nicht übel, wusste sie doch ganz genau, dass er eigentlich ungemein stolz auf seine kleine Schwester war, die später einmal studieren wollte. Norbert kannte keinen Neid, sondern gönnte es seiner Schwester. Und umgekehrt hielt sie es genauso. Daher war es völlig in Ordnung für sie, dass er einmal als Bauer den Hof erben würde.
»Oh, Gymnasium. Da sagst du was. Ich muss los!« Helma sprang auf, schnappte sich ihre Butterbrotdose und stürmte an ihrem Vater vorbei zur Haustür, wo ihr gepackter Tornister auf sie wartete. In Windeseile streifte sie ihren Parka über, warf sich die Schultasche über die Schulter und rannte über den von Traktorspuren verdreckten, mit Pfützen übersäten Vorplatz des Bauernhofes zur Bushaltestelle.
Währenddessen fragte sie sich, warum sie ihrer Familie nicht die ganze Geschichte über Onkel Jupp erzählt hatte. Als vorgestern Nachmittag Frank zu Besuch gekommen war, hatte Onkel Jupp ihn erst beschimpft und dann verächtlich auf den plattierten Hof gespuckt.
»Ich bin nicht jüdisch«, hatte Frank völlig perplex geantwortet, und sein rundes, freundliches Gesicht wirkte plötzlich käsig blass. »Ich bin evangelisch.«
Helma war verwundert, dass er keine schlagfertigere Antwort parat hatte.
»Schlimm genug, aber ich weiß doch, was die Leut reden«, höhnte Onkel Jupp noch, bevor Helma Frank am Arm zog.
»Lass uns in mein Zimmer gehen«, forderte sie ihn eilig auf und bugsierte ihn zum Wohnhaus.
Helma verdrängte die unguten Gedanken an die Szene, weil der Schulbus nahte und sich die Vordertür öffnete, um sie und ein paar andere Driescher Schüler einsteigen zu lassen.
Das Innere war rappelvoll, und Helma befürchtete schon, während der Fahrt bis zur Schule in Vorst im Gang stehen zu müssen. Dann sah sie, wie Susi ihr von weiter hinten zuwinkte. »Helma, ich hab’ dir einen Platz freigehalten«, rief sie, und schon drängte sich Helma an den Schülern vorbei, die nicht dasselbe Glück wie sie hatten.
»Uff«, machte sie, als sie Susi erreichte und sich neben ihr auf die Bank plumpsen ließ. »Danke!«
»Wie findest du meine neue Föhnfrisur?« Die Freundin schüttelte ihr dickes blondes Haar, das nun, statt lang und wellig bis auf den Rücken zu hängen, stufig geschnitten ihr gutmütiges Gesicht umspielte, die schulterlangen Spitzen zu einer Art Regenrinne geformt.
»Sieht super aus!« Helma nickte anerkennend. »Ist aber sicher viel Arbeit, das hinzukriegen, oder?« Sie selbst hatte ihr dunkles, störrisches Haar heute früh lediglich fix zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, damit es ihr beim Frühstück nicht in die Cornflakes hing. Helma interessierte sich kaum für ihr Äußeres, stellte aber fest, dass sich die Mädchen in ihrer Klasse inzwischen mehr herausputzten als früher und ihre Nasen in die Bravo steckten, weil sie weibliche Stars wie Agnetha und Anni-Frid von ABBA oder Olivia Newton-John toll fanden und wie sie aussehen wollten.
»Keine Ahnung. Wird sich nach dem ersten Waschen herausstellen. Zumindest habe ich mir schon mal eine Rundbürste und einen Lockenstab gekauft.« Susi zog die Schultern hoch. »Schau mal, da steigt die Neue aus unserer Klasse ein.« Der Bus hatte unterdessen an der Hauptstraße in Vorst gehalten, und zwischen den Köpfen der Schüler, die sich in den Bus drängten, stachen Maria Mancinis geflochtene schwarze Zöpfe hervor. »Die scheint echt nett zu sein. Hat vorher mit ihrer Familie bei Köln gewohnt. Ellie hat erzählt, dass die Mancinis ursprünglich aus Norditalien stammen und Anfang der Sechziger als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind.«
»Was Ellie wieder alles weiß!« Helma zog bedeutungsvoll eine Augenbraue hoch. »Aber Maria ist in Deutschland geboren, oder? Sie spricht jedenfalls akzentfrei Deutsch.«
»Ja klar, und ihr kleiner Bruder Manuel natürlich auch.« Susi nickte. »Boah, ich hätte gern solche tollen schwarzen Haare wie Maria! Die schimmern astrein, wenn die Sonne drauffällt …«
»Psst, sie kommt!« Helma beobachtete, wie sich die neue Klassenkameradin durch die Menge drängelte, bis sie schließlich neben ihr und Susi zu stehen kam.
»Hallo, ihr zwei«, sagte sie schüchtern.
»Hallo, Maria!« Helma lächelte ihr aufmunternd zu. »Komm Susi, wir rücken zusammen. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht zu dritt auf die olle Bank passen würden!«
Frank Sonnenberg fuhr immer mit dem Fahrrad zur Schule. Er hatte es von Holzbüttgen nicht weit. Helma wartete auf dem Schulhof auf ihn und sah zu, wie er sein Bonanzarad, an dessen Rückenlehne der unvermeidliche Fuchsschwanz baumelte, abschloss, während Susi und Maria in das moderne doppelstöckige Schulgebäude gingen.
»Ganz schön stürmisch heute«, sagte er. »Und ich hatte Gegenwind. Nach der Höllentour hab’ ich schon wieder Hunger. Könnte glatt ein bis zwei Fortunabrötchen futtern.«
Helma musste grinsen, weil sein hellbraunes Haar zu Berge stand wie bei einem Monchichi. »Gut, dass das Schulbüdchen noch zu hat. Ich dachte, du wolltest abnehmen.«
Frank hielt sich theatralisch den Bauch, der sich über der engen Jeans wölbte. »Das Produkt harter Arbeit«, sagte er todernst mit der Stimme von Bud Spencer, die er inzwischen bis zur Perfektion nachahmen konnte. »Weißt du, wie mühsam das ist, sich jeden Abend eine Tafel Schokolade und ein paar Raider reinzuzwingen? Puh!« Er knuffte Helma in die Seite. Dann wurde er wieder ernst. »Hast ja recht. Die Plauze nervt. Und ich hab’ keine Lust, demnächst beim Völkerball als Ball mitzuspielen.«
Helma schüttelte grinsend den Kopf. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, beschwichtigte sie ihn. »Bestimmt kommt bald ein Wachstumsschub und …«
»Ja klar!« Er wollte sich ausschütten vor Lachen. »So groß kann ich gar nicht werden, dass sich die Speckrollen glattziehen. Oh, der Gong. Wir müssen rein.«
Sie hakten sich unter und strömten, zusammen mit Hunderten anderen Schülern, in die Schule. Im Treppenhaus sprach Helma Frank auf Jupps beleidigende Bemerkung an.
»Tut mir echt leid, wie sich mein Onkel vorgestern benommen hat«, hub sie an. »Mama sagt, er sei nicht ganz richtig im Kopf und müsste mal einen Arzt aufsuchen. Ich weiß gar nicht, wie er auf so etwas gekommen ist.«
Frank sah sie schräg von der Seite an. »Wirklich nicht?« Er nahm zwei Stufen auf einmal, und sie tat es ihm nach. »Meine Großmutter war Jüdin. Aber ist ja auch egal. Dein Onkel ist ein schrecklicher alter Nazi, aber dafür kannst du ja nichts.«
Wieder beschleunigte er seine Schritte, und diesmal schaffte es Helma nicht, ihn einzuholen, denn zwei Jungen aus der 8a schoben sich zwischen sie.
Nachdenklich ging sie in den Klassenraum, hängte ihren Parka an die Garderobenleiste und setzte sich zwischen Susi und Ute auf ihren Stuhl. Auf Susis anderer Seite nahm Ellie Platz, die in ihren grünen Schlaghosen und dem pinken Pulli wie eine kleine Barbiepuppe aussah. Ute hatte schon ihr Deutschbuch rausgeholt und legte gerade ihr Heft mit den Hausaufgaben und ihren Füller exakt parallel daneben auf den Tisch mit der hellen Kunststofffurnierplatte. Manchmal konnte die Freundin eine richtige Streberin sein.
In der großen Pause trafen Helma, Susi, Ute, Ellie und Frank sich auf dem Schulhof wie immer an der Litfaßsäule, an der etliche Plakate für die nächsten Schulveranstaltungen und Ankündigungen für Konzerte diverser Jugendrockbands klebten. Frank hatte sich inzwischen tatsächlich am Kiosk ein Fortunabrötchen gekauft, drückte die Brötchenhälften fest zusammen, so dass der Schokokuss dazwischen zerquetscht wurde, und biss herzhaft in die süße, klebrige Masse.
Dann deutete er mit vollem Mund auf eine Gruppe von Jugendlichen, die sich ein paar Meter weiter an den Fahrradständern aufhielten.
»Seht mal, ist das dahinten nicht unsere Neue? Was macht sie denn bei den Bekloppten aus der Neunten? Ach, und Stevie ist auch dabei! Typisch!«
Stefan Baumann war mit dem letzten Zeugnis sitzengeblieben und ging nun in dieselbe Klasse wie sie. Helma mochte ihn nicht. Sie fand ihn angeberisch und überheblich.
»Wusstet ihr, dass Stevies Mutter mit einem zehn Jahre jüngeren Typen abgehauen ist und ihn und seine kleinen Brüder einfach beim Vater zurückgelassen hat?«, fing Ellie an.
»Ah, unsere lebendige Boulevardpresse hat mal wieder Klatsch und Tratsch parat.« Frank knuffte sie in die Seite und fasste dann wieder die Gruppe um Maria Mancini ins Auge.
Ellie zog einen Flunsch. »Ich mein’ ja nur. Stevie war nämlich früher echt nett, das sagen alle …«
Helma stöhnte unwillkürlich auf und bemerkte, wie Ute neben ihr die Augen verdrehte. Ellie sprach immer kryptisch von »allen« und gab die Quelle ihrer Informationen selten preis.
»Egal, heute ist er ein Arschloch«, stellte Ute knallhart fest. »Und Maria sollte sich besser nicht mit ihm und den Spinnern aus der Neunten abgeben.«
»Finde ich auch, zumal sie gerade verschreckt wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange aus der Wäsche guckt. Ich schau mal nach, was da läuft.« Frank bewegte sich auf die Gruppe zu. Helma folgte ihm automatisch und sah, dass auch Susi mitging, während Ellie und Ute an der Litfaßsäule stehen blieben, um weiter an den Strohhalmen ihrer Tritop-Päckchen zu saugen.
»Hey, alles in Ordnung, Maria?«, fragte Frank.
Maria nickte zögerlich. Ihre Zöpfe schaukelten sacht. »Ja«, sagte sie, aber es klang nicht überzeugend.
Stevie brach in wieherndes Gelächter aus. »Ich hab’ sie bloß gefragt, ob sie Winnetous Schwester Nscho-tschi ist, bei der Frisur. Aber sie wollte es mir nicht verraten.« Die anderen Jungs um ihn herum feixten. Stevie wurde schlagartig ernst. »Auf jeden Fall ist sie ’ne Scheißausländerin. Was will so eine auf unserer deutschen Schule?«
Helma konnte es nicht fassen. Derartige Sprüche kannte sie nur von Onkel Jupp, der ja, wie Frank sagte, ein alter Nazi war und dem ihre Eltern verboten, so zu reden. Sie setzte gerade zu einer erbosten Erwiderung an, als Frank sich an den Jungen vorbeischob, Maria an der Hand nahm und sie resolut aus dem Kreis herausführte.
»Jungs, ihr habt wohl zu viel Karl May geguckt«, sagte er, wobei er Stevie völlig ignorierte. »Dann bin ich jetzt mal der Sheriff und nehme die junge Dame mit. Das hier sind übrigens meine Deputys.« Er wies mit dem Kopf auf Helma und Susi, die nun ihn und Maria flankierten. Gemeinsam gingen sie zurück zur Litfaßsäule. Die Jungen aus der Neunten starrten ihnen baff hinterher, schritten aber nicht ein.
Als die vier bei Ellie und Ute ankamen, schüttelte Maria Franks Hand ab und funkelte ihn mit blitzenden Augen an.
»Ich kann mir schon selbst helfen«, protestierte sie. »Ich bin kein Baby mehr!«
»Daran habe ich keinen Zweifel.« Frankie lächelte smart. »Aber Stevie und seine Lakaien sind hier die bad boys in town und miese Rassisten dazu.«
Marias Stirn glättete sich, sie atmete tief aus und nickte schließlich langsam. »Ich hatte gehofft, dass so was bei uns in der BRD langsam ausstirbt«, sagte sie leise.
Frank warf Helma einen vielsagenden Blick zu. »Das dachte ich auch mal, aber die Idioten sterben eben nie aus.«
Maria kramte in ihrer Jackentasche herum und förderte eine Packung Maoam zutage. Sie bot allen davon an. Bald kauten sie einträchtig auf den zähen, süßsauren Brocken herum. »Ich fände es übrigens schöner, wenn ihr mich Marie nennen würdet, so wie meine Freunde früher«, sagte Marie und lächelte unsicher. Dann wandte sie sich Susi zu. »Deine neue Frisur sieht echt stark aus, wollte ich schon vorhin im Bus gesagt haben. Ich möchte mir auch die Haare schneiden lassen und hoffe, dass meine Eltern es mir erlauben. Zu welchem Friseur gehst du denn?«
Bald gehörte auch Marie zu ihrem Freundeskreis in der Klasse. Frank störte es offenbar nicht, dass nun noch ein Mädchen hinzugekommen war und er weiterhin der Hahn im Korb blieb. Die Jungen in der Klasse schienen ihn sowieso kaum zu interessieren, es sei denn als Publikum für seine Gags im Unterricht.
»Ich kann mit denen einfach nichts anfangen«, gestand er Helma eines Sonntagnachmittags im Frühjahr 1979, als beide rücklings auf der Wiese hinter dem Hof zwischen Gänseblümchen, Löwenzahn und Hahnenfuß im Gras lagen und in die langsam ziehenden Wolken schauten. »Ich hasse Sport, und die hassen Kunst. Ist nix zu machen.« Er schnappte sich einen Grashalm, klemmte ihn zwischen die Daumen, legte beide Hände übereinander und blies kräftig in den schmalen Spalt zwischen den Daumengelenken, um den Halm zum Vibrieren zu bringen. Der jähe, schrille Ton scheuchte einige Krähen von dem Kabel zwischen den Telegraphenmasten auf, das weit über ihnen in der Luft hing und den Himmel zweiteilte. Krächzend flogen sie davon.
Helma blickte ihnen nach, bis sie sich in den Holunderbüschen niederließen, welche die Wiese vom frisch gepflügten Feld abgrenzten. »Ich begreife nicht, wie man Kunst doof finden kann. Es gibt doch nichts Schöneres als zu malen und zu zeichnen. Ich glaube, ich werde nach dem Abi Kunst studieren.«
»Und ich vielleicht Design. Finde ich klasse. Design ist Kunst in Gebrauch.«
»Kunst in Gebrauch …« Helma gefiel die Formulierung. »Das ist von dir, oder?« Sie drehte den Kopf zur Seite, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Grashalme kitzelten an ihrer Wange.
»Klar!« Er grinste, und es gefiel ihr, wie sich neben seinem Mund Grübchen bildeten.
»Du könntest auch Germanistik studieren«, überlegte sie. »Für deine Aufsätze in Deutsch kriegst du immer eine Eins, und deine Artikel für die Schülerzeitung kommen bei allen super an.«
Er zog die Stirn kraus. »Auf keinen Fall! Germanistik ist öde. Und ich trete doch nicht in die Fußstapfen von meinem Alten! Bücher, Bücher, Bücher … Kommt nicht in Frage. Niemals will ich so langweilig werden und so verstaubt wie er.«
»Also, ich finde deinen Vater supernett.«
Franks Eltern betrieben einen Buchladen im Kaarster Zentrum, und Helma liebte es, dort in den deckenhohen Regalen zu stöbern. Herr Sonnenberg beriet sie jedes Mal geduldig und freundlich, obwohl er genau wusste, dass sie kaum je etwas kaufte, weil ihr Taschengeld dafür nicht reichte. Meist lieh sie die Romane, die sie lesen wollte, in der öffentlichen katholischen Bücherei aus, deren Auswahl jedoch begrenzt und immer etwas veraltet war. Außerdem roch es in den dunklen, engen Räumen muffig. Im Buchladen Sonnenberg war es ungleich heller und die Atmosphäre heiter, was sich auch in der Miene des Besitzers widerspiegelte. Helma mochte ihn. Zudem hatte er dasselbe lustige Gesicht wie sein Sohn, spitzbübisch und gutmütig. Das machte ihn ihr noch sympathischer.
»Klar, ist er auch. Er ist der beste Papa überhaupt.« Franks Gesichtsausdruck wurde nachdenklich. »Aber ich will mal anders leben.«
Helma dachte, dass auch sie später nicht wie ihre Eltern werden wollte, die sich rund um die Uhr auf dem Hof abrackerten. Mama war in den letzten Monaten ständig erschöpft. Ihr selbst schwebte eine Zukunft vor, in der sie viel freier darüber bestimmen konnte, wie sie ihren Tagesablauf gestaltete, ohne sich unter die Knute von Wetter und Wachstumsphasen von Rüben, Kappes und anderem Gemüse zwingen zu lassen.
»Wie denn?«, fragte sie neugierig.
Er setzte sich auf und fuhr sich durch das ohnehin wuschelige Haar, so dass es noch mehr vom Kopf abstand. »Bunt«, sagte er. »So wie das Farbfernsehen, weißt du? Früher gab es nur Schwarzweiß, und alle fanden es normal. Keiner hat sich dran gestoßen. Bloß irgendein kreativer Kopf, der wollte sich nicht damit begnügen und hat das Farbfernsehen erfunden.« Er grinste schief auf sie herab. »Und der bin ich. Also im übertragenen Sinn. Und Papa guckt immer noch Schwarzweiß.«
»Aber das Farbfernsehen gibt’s doch schon lange. Und Kinofilme waren bereits vorher bunt.« Helma setzte sich auch auf. Ihre Schultern berührten sich. Es war ein angenehmes Gefühl.
»Ist ja nur ein Vergleich.« Frank stützte sich mit den Händen im Gras ab, legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Die Sonne war durch die Wolkendecke gebrochen und beschien sein Gesicht. Helma konnte es ungestört betrachten und sogar die Sommersprossen auf seiner Nase zählen. »Ich finde die Welt einfach manchmal zu grau und zu dunkel«, fuhr er versonnen fort. »Schwarzweiß, das ist die Vergangenheit, weißt du? Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Kalter Krieg, RAF