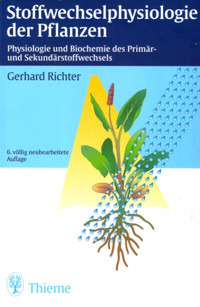Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernhard Freitag wird in den 1960-er Jahren als unscheinbares Kind einer Arbeiterfamilie unter ärmlichsten Verhältnissen in einer Kellerwohnung aufgezogen. Er gerät in den Sog grausamer Hänseleienseiner Schulkameraden. Ausgeschult, vermittelt ihm sein Klassenlehrer eine Stelle im Katasteramt. In den Kellerräumen muss er Akten sortieren und beschriften und wird dort fast vergessen. Erst als er auf dem Heimweg dabei entdeckt wird, wie er Hundekot vom Bürgersteig aufsammelt, wird er wahrgenommen. Eine unfassbare Lebenskraft breitet sich dadurch plötzlich in ihm aus. Mit Begeisterung richtet er in der Nähe eines Kinderspielplatzes eine Sammelstelle für Hundekot ein. Doch was folgt ist ein Fall ins Bodenlose.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Richter, Jahrgang 1943, wuchs in Edendorf-Itzehoe auf. Nach einer Ausbildung zum Augenoptiker zog er 24-jährig auf die Ostseeinsel Fehmarn, um dort als Quereinsteiger ein Eiscafé zu übernehmen. Das ermöglichte es ihm, während der saisonfreien Monate ausgedehnte Weltreisen aus der Rucksack-Perspektive zu unternehmen. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit 70 entschloss er sich, Geschichten aufzuschreiben, statt sie zu erzählen. So entstand nach drei Jahren sein erster großer Roman Herr Freitag - der Hundekotsammler. Sein Folgeroman Bauer Jakob und sein geiler Knecht Hans ist zurzeit mit umfangreichen Recherchen in Vorbereitung.
Für die direkte und indirekte Hilfe bei der Fertigstellung und Herausgabe dieses Buches danke ich meinem langjährigen Freund Detlef Blumentritt, meinem Sohn Moritz Richter und meiner Frau, die mir half, nicht aufzugeben.
Es musste so kommen. Freitag suchte etwas in der obersten Regalablage, benutzte die dafür vorgesehene Trittleiter bis zur letzten Stufe, die er auch noch, sich auf Zehenspitzen reckend, zu verlängern versuchte. Dabei verlor er das Gleichgewicht, ergriff reflexartig die Abschlussleiste des mit Akten gefüllten Holzregals und spürte sich – wie in Zeitlupe – kippen. Die schweren Ordner glitten als Erstes aus den Holzfächern, auf die Freitag stürzte. Die darauf fallende Holzkonstruktion deckte das entstandene Papp- und Papierchaos mitsamt seinem Körper schließlich fast vollständig und unverrückbar ab.
Der Hilfsarchivar hatte unglaubliches Glück, weil sein Kopf, zwischen zwei Aktenordnern verkeilt, so geschützt wurde, dass er unverletzt blieb. Andere Aktenbestände hatten sich am Boden ungeordnet verschachtelt. Lediglich eines seiner Schienbeine hatte Prellungen abbekommen. Freitag versuchte, sich vorsichtig zu bewegen. Er konnte jedoch nicht einmal den Kopf wenden. Ein weiterer Aktendeckel drückte auf seinen Kehlkopf, was ein lautes Hilferufen unmöglich machte. Er war fixiert. Bis auf das schmerzende Schienbein schien er sich nicht ernsthaft verletzt zu haben. Beruhigend! Aber wie sollte er sich bemerkbar machen oder gar befreien? Angst ergriff ihn. Was würden die „da Oben“ sagen? Also warten! Aber auf wen? Weil man ihn nicht vermisste, kam auch niemand grundlos, um ihn im Kelleraktenlager des Katasteramts aufzusuchen.
In dieses altehrwürdige Backsteingebäude mit dem großzügigen Portal führte eine schwere, mit kunstvollen Schnitzereien versehene Holztür, geziert mit tiefgrün glasierten Steinen über den hohen Fensterbögen. Hier sollte dem Besucher die Wichtigkeit der Ämter durch die darin wuchernde Bürokratie klargemacht werden. Zwei blank polierte Messingschilder mit hinweisenden Beschriftungen verstärkten blitzend deren Bedeutung; geteilt unter einem Dach lagen das Bau- und das Katasteramt.
Beim Betreten des Gebäudes, in dessen Innerem gedämpftes Licht durch Vielscheibenfenster fiel, wurde der Unkundige mittels des vergilbten Pfeilschilds Information aufgefordert, sich an den Pförtner zu wenden. Abgetrennt in einem kleinen, vorspringenden Glaskasten, versehen mit einem schiebbaren Sprechfenster, kauerte der ewig mit hochgehaltener Zeitung lesende Wachmann. Namentlich ausgewiesen mit einem kleinen verblichenen Pappschild: Sie sprechen mit Herrn Krause. Niemand kam ungesehen an ihm vorbei. Er hatte sich angewöhnt, die, die zögernd vorbeischlichen, um ihn nicht zu stören, unbemerkt unter der daraufhin leicht angehobenen Zeitung nach deren Schuhwerk zu beurteilen. Trugen sie schief abgetragene Treter, altmodische Stiefel oder billige Sandalen, legte er die Zeitung wichtig handglättend zur Seite, um mit hochgezogenen Augenbrauen zu fragen: „Wo soll’s denn hingehen? Haben Sie einen Termin?“
Die Antworten waren dann oft stammelnd fragend, stotternd verwirrend.
Der Pförtner Herr Krause fühlte sich überlegen und tat das offensichtlich kund: „Hier müssen Sie sich erst einmal entscheiden, Bauamt oder Katasteramt? Dann kann ich Ihnen Auskunft erteilen. Also, was denn – Katasteramt oder Bauamt?“
Die Hilflosen, eingeschüchtert, waren dankbar. Bis auf einen Griesgram, der sich wohl mit einem der Ämter angelegt hatte, den konnte Krause einfach nicht vergessen. Dieser wagte respektlos laut zu rebellieren: „Lies weiter deine Zeitung, ich find das schon!“
Der Wachmann war zutiefst beleidigt, lebte er doch auf seinem einsamen Posten von der Dankbarkeit der Unschlüssigen, der Hilfesuchenden.
Flure mit den sorgfältig beschilderten Amtsstuben, benannt nach Aufgabenbereichen, einschließlich Namensnennungen und respekteinflößenden Dienstgraden, irritierten so manchen Besucher. Eine unscheinbare Tür mit der Beschriftung Keller – Zutritt nur für Personal neben der Pförtnerloge führte in das Reich von Freitag. Er war „dort Unten“ als sogenannter Hilfsarchivar, ein besserer Bote, angestellt. Seine wenig anspruchsvolle Aufgabe bestand beispielsweise darin, abgeänderte Flurkarten in Ordner einzusortieren. Oder Unterlagen herauszusuchen, wenn einer seiner Vorgesetzten von „da Oben“ irgendwelche anforderte, um darin zu recherchieren. Nach Gebrauch waren diese später wieder einzuordnen oder neu zu beschriften. Doch das trat manchmal tagelang nicht ein. Über eine quäkende Gegensprechanlage wurden Aktenjahrgänge und Nummern knackend-rauschend durchgegeben, die Freitag auf einem kleinen Rollwagen, den er Lore nannte, lud und sie vor seinem Kellereingang abstellte.
In letzter Zeit schlich manchmal der neu eingestellte Hausmeister Grigoleit im selben Trakt herum, häufig in einer unangenehmen, freudlosen Laune, die er zu guter Letzt an Freitag ausließ. Grigoleit verfügte „hier Unten“ über eine kleine, räumlich abgetrennte Werkstatt mit eigenem Zugang über den Notausgang.
„Na, Freitach, du hängst hier den janzen Tach rum. Ich griebel immer wieder, warum man dich nich auf die Straße setzt. Wahrscheinlich wirst du auch noch besser bezahlt“, provozierte er den Hilfsarchivar immer, wenn er „nach Unten“ kam.
„Ich trage eben Verantwortung als Hilfsarchivar!“, kam jedes Mal hilflos Freitags Antwort.
Trotzdem verletzten ihn diese unverschämten Bemerkungen aufs Tiefste. Eines wusste Freitag mit Gewissheit: Der schlichte Hausmeister glaubte, seine Arbeit mit übernehmen, ihn ersetzen zu können. Aber ganz so einfach war das Archivieren auch wieder nicht. Sauber zu schreiben und die Rechtschreibung zu beherrschen waren Voraussetzung. Und im Übrigen war Freitag sehr bald aufgefallen: Grigoleit erledigte nur das Allernotwendigste: kleine Reparaturen im Hause, Straße fegen, Hecke schneiden, Botengänge. Seinen Arbeitstag verstand er mühelos zu gestalten, redete, wenn möglich, ausgiebig mit der Reinemachefrau. Auch Grigoleit war – wie Freitag – niemandem Rechenschaft über seine Zeit- und Arbeitseinteilung schuldig. Die „da Oben“ waren froh, wenn alles seinen gewohnten Gang ging.
Trotzdem beschlichen Freitag immer wieder Bedenken und sein Magen zog sich zusammen. War sein Arbeitsplatz sicher? Würden die „da Oben“ etwas verändern wollen, eines Tages? Zuzutrauen war es denen, den Unkündbaren, den Fachangestellten unterschiedlichster Qualifikationen.
Das Erscheinen Grigoleits wäre jetzt trotz aller Dissonanzen ein wahres Geschenk. Fieberhaft grübelte Freitag über einen Ausweg und dachte dabei unwillkürlich an Verunfallte, vom Hals abwärts querschnittgelähmte Menschen. Bei der Vorstellung, kein Glied bewegen zu können, setzte sein Verstand aus und ließ keinen klaren Gedanken mehr zu. Angsttränen begannen langsam aus den Augenwinkeln zu quellen.
Zu allem Übel war das Stromkabel seiner Schreibtischleuchte beim Regalsturz gerissen, was einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst hatte. Auch wenn die Kellerfeuchtigkeit einen möglichen Brand ausschloss, war im gesamten Trakt die Beleuchtung ausgefallen. Wenn ein dumpfes Halbdunkel muffig, schimmelfeucht, altverbraucht und leicht vermodert riechen konnte, dann traf das auf diesen Ort des Vergessenwerdens zu. Den einzigen Hinweis auf die Tageszeit gab das schwache Licht der beiden Kellerfensterschächte, die, jeweils mit einem einfach verglasten Fensterflügel ausgestattet, als Fluchtweg dienen sollten. Ein vergilbtes Metallschild warnte: Fluchtweg – nur im Notfall öffnen! Die massiven Holzfenster waren über Jahrzehnte nicht geöffnet worden und durch Feuchtigkeit derart zugequollen, dass man im Ernstfall die Scheiben einschlagen und dann auch noch, im Fensterschacht angelangt, die Eisengitterabdeckung nach oben drücken müsste. Nur möglich mit schwerem Handwerkszeug, Metallrahmen und Gitter waren in solchem Maße zusammengerostet, dass sie eine Einheit bildeten. Aus diesem kleinen Käfig gab es folglich kein Entkommen.
Warum verschwendete er nur Gedanken über Fluchtwege, die Türen der Räume waren doch nicht verschlossen! Dumpfe Angst. Allmählich musste Freitag begreifen, wie sinnlos seine sich immer wiederholenden Gedanken waren. Eigentlich war dieser Überall-und-nirgendwo-Hausmeister für solche Instandhaltungen zuständig. Normalerweise hätte er endlich mal eine gute Gelegenheit, eine Meldung zu machen, nach „Oben“. Diesmal war ihm jedoch nicht danach zumute, wartete er doch darauf, dass dieses ewig futternde Breitgesicht ihn befreite. Undenkbar, so eine Meldung. Grigoleit musste den Stromausfall bei seinem Erscheinen auf jeden Fall bemerken, denn der gesamte Kellertrakt war ja ohne Licht. Folglich war es doch nur eine Frage der Zeit, versuchte Freitag sich immer wieder zu beruhigen. Und wenn der Hausmeister zufällig krank geworden war? Oder einen Unfall hatte? Diese entmutigenden, fast ins Unerträglich gehenden Gedanken schlichen sich pulsierend in Freitags Hirn.
Aus den Augenwinkeln nahm er plötzlich wahr, wie sich die Kellerschachtfenster für einen kurzen Augenblick verdunkelten. Es musste jemand vorbeigegangen sein. Grigoleit? Rettung? Der Versuch seines kläglichen Hilferufs wurde abrupt durch eine entsetzliche Wahrnehmung erstickt. Schemenhaft zeichnete sich eine huschende Tiergestalt innen im matten Licht des Kellerfensterschachts ab. Zu klein für eine ausgewachsene Katze – und wie sollte die sich auch in den Kellerschacht hinein verirren? Ein Marder? Das Wesen krümmte sich in sprunghaften Bewegungen auf Freitags Körper zu, verharrte kurz, streckte sich geschmeidig, schlank – und der wehrlose Hilfsarchivar krächzte wie eine verletzte Krähe. Er spürte den Druck seiner hervorquellenden Augäpfel, als wollten sie seinen Schädel verlassen, um diese grausige Entdeckung nicht wahrnehmen zu müssen. Angstschweiß floss in seine Augenwinkel und trübte seinen Blick. Speichel rann vor Aufregung aus seinen Mundwinkeln. Japsend, gurgelnd wie ein Erstickender rollte er mit den Augen, um etwas visuell erfassen zu können. Zwischen den Akten hatte sich das unbekannte Wesen über Freitags Bein gezwängt. Und jetzt spürte er entsetzt und hilflos einen warmen, weichen, behaarten Körper auf seinem Schienbein. Das Hosenbein musste sich beim Sturz hochgeschoben haben und die Haut lag somit frei, vielleicht blau geschwollen, blutig, für jedes Untier ein gefundenes Fressen. Nur ein kurzer Augenblick, dann hörte er das leise Papierrascheln aufgeschlagener Seiten des Aktenordners neben seinem Kehlkopf. So nah konnten seine Augen nichts fokussieren. Unkontrolliert lief ihm der Angsturin aus seinem Unterleib, warme Nässe. Die Kleider sogen sich voll und kühlten sofort aus. Sein Körper fing an zu zittern. Wie ein Fisch auf dem Trockenen atmete er flach, den Mund weit aufgerissen, als würde er nicht genügend Luft bekommen. Vor seinem Gesicht bäumte sich das Teufelswesen auf, wie eine Schlange zog sich ein nackter Schwanz über seine Kehle. Er spürte lange, feine Barthaare, die zuckend an seinen Nasenflügeln kitzelten. Ein warmer, weichpelziger Körper schob sich über seine freie Gesichtshälfte. Freitag wagte nicht, den Mund zu schließen. Eine fette Ratte! Die schnupperte an seinen Lippen und trotz der panischen Angst fühlte er ihre winzig kleine Zunge, die seinen Speichel leckte, woraufhin das Tier seitlich aus seiner Zunge blitzschnell ein kleines Stück Fleisch herausfetzte. Ein Reflex ließ Freitags Zähne wie eine Sprungfalle zusammenschnappen, brach Halswirbel der Teufelsbrut, aus deren Maul und Nase langsam kleine Blutströpfchen quollen und sich mit Freitags Zungenblut vermischten. Zuckend wand sich der Rattenkörper, streckte sich im Überlebenskampf, versuchte sich mit seinen scharfen Krallen aus der Todesfalle zu befreien, stemmte sich noch einmal mit aller verbliebenen Kraft gegen Freitags Kinn, das wie von Rasierklingen angeritzt zu bluten begann, bevor er endgültig erschlaffte. Die Ratte war tot.
Freitags Zunge, Lippen, Kinn und Wangen brannten, als wäre er in Glasscherben gestürzt. Jetzt öffnete er weit seinen Mund und versuchte trotz verletzter Zunge, das Ekelmonster auszuspucken. Wie ein nasser Sack rutschte der Rattenkörper durch das frische Blut gleitend auf seinen Hals. Wärmend, aber tot. Das Biest stank nach Kot und süßlichem Blut. Diese Gerüche vermengten sich mit Freitags Urin und Proktospasmen – einer nervösen Darmreizung, die Gerüche nach Verfaultem zur Folge hatte – zu einem unerträglichen Gemisch aus Fäulnis und Moder. Gedanken durchzuckten ihn wie Wetterleuchten. Wenn es eine Hölle gab, dann war sie hier und jetzt. Er durfte sich nicht erbrechen, das konnte seinen Erstickungstod bedeuten. Würgend schluckte er immer wieder seinen hochkommenden schleimigen Mageninhalt, vermischt mit seinem Zungenblut und dem hochgespritzten Urin und Kot der Ratte. Rasend schnell spulte sich in seiner Erinnerung Gelesenes über Ratten ab.
~
Im Universallexikon und in diversen Realienbüchern, einem Geschenk seiner verwitweten Nachbarin Edeltraud Wertheim, las er als Jugendlicher mit Neugier und Faszination: Das Verhalten von Haus- und Wanderratten und deren Schädlichkeit. Ihn überkam Furcht und Ekel.
Indiens Riesenbaumratten, groß wie Katzen, Bandikutratten, die auf schwindelerregend hohen Kokospalmen kindskopfgroße Nüsse am tragenden Stiel annagten und mit dem letzten, trennenden, zielgerichteten Biss warteten, bis herumstreunende Hunde, andere kleine Tiere oder sogar Kinder unter der Palme spielten. Wie ein Geschoss flog dann die Kokosnuss aus höchster Höhe auf ihr Opfer und zerschmetterte einen Teil des darunter befindlichen Lebewesens, das zusammenbrach, bewegungslos. Wie auf ein wundersames Zeichen huschte eine Schar der Teufelsbrut dann auf das wehrlose, vor Schmerzen jammernde Wesen und fraß es an. Nach einem höchst bemerkenswerten Muster, welches einem Ritual gleichkam. Das größte und fetteste Ungeheuer fraß der Beute als Erstes die Augen aus, was äußerst intelligentes Verhalten vermuten ließ. Das Opfer war blind und konnte nicht mehr fliehen, falls es nicht ausreichend verletzt worden war. In einigen bekannt gewordenen Fällen wurden Kleinkindern in unbeobachteten Momenten nicht nur die Augen, sondern auch der Mund, die Lippen, die Zunge und die Geschlechtsteile angefressen. Hilfeschreie waren somit ausgeschlossen.
Unverständlich war es für Freitag, dass Ratten trotz dieser Kenntnis in einem Teil Indiens heilig waren. Sie wurden von den Gläubigen gefüttert und als Glücksbringer betrachtet, wenn sie ohne Scheu und Not über deren Füße liefen. Der im Hinduismus und Buddhismus verehrte Gott Karni Mata hält die überdimensionierte Rattenskulptur als Reittier in seinem Tempel, in Stein gemeißelt und verewigt.
~
Freitag hatte sofort begriffen, in welcher Gefahr er sich befand. Es gab zwar nicht mehr die Yersinia pestis übertragende Pestratte, aber seine offene Wunde musste schnellstens versorgt werden, vielleicht sogar genäht. Spezielle Antibiotika würden ihn vor einer unter Umständen todbringenden Infektion schützen – schließlich fraßen die Tiere alles! Lebendfleisch, Aas, sogar Seife und Pelz … einfach alles. Ein Arzt würde all das wissen und ihn retten.
Grigoleit, warum kam er denn nicht?! Er musste kommen! Freitag hatte das Zeitgefühl verloren. Lag er hier schon eine Stunde, zwei Stunden? Seine Erregung legte sich. Nach diesem psychischen Stress war er so erschöpft, dass ihn eine nicht ganz ungefährliche Müdigkeit überkam, gegen die er ankämpfen wollte, denn er schloss nicht aus, dass noch weitere Ratten hungernd über ihn herfallen könnten. Nicht endende Hilflosigkeit erweckte ungewollt Bilder. Demütigungen und Erniedrigungen im Katasteramt, auf der Polizeiwache und im Alltagsleben. Anfangs bruchstückhaft, dann als Ganzes. Zuerst durchlebte er wie im Wachtraum ein weiteres Mal seinen Unfall in einer Bahnsteigunterführung.
~
An einem Wochenende wollte er mit der Vorortbahn einen Stadtteil aufsuchen, in dem ein volksfestähnlicher Trödelmarkt stattfinden sollte. In seinem Wochenblatt hatte er gelesen, dass Privatleute dort kaufen und verkaufen konnten, was ihnen nützlich erschien und was sie gegen ein kleines Entgelt loswerden wollten. Vermerkt war weiterhin: Es darf gehandelt werden! Freitag war frohen Mutes, das eine oder andere erschwingliche Buch und, wenn auch ungewöhnlich, gebrauchte Fingerhüte zu finden.
Fingerhüte! Seine heimliche Leidenschaft bestand darin, dass er solche unterschiedlicher Größe und Materialien über seine Finger stülpte. Er trommelte damit auf seinen Holzschreibtisch, auf eine Glasplatte, in abwechselnden Abfolgen auf Pappkartons, leere Blechdosen, seitlich auf mit unterschiedlichen Wassermengen gefüllte Trink- und Einmachgläser. Alle Gegenstände mit wenigen Handgriffen sinnvoll auf seinem Arbeitsplatz arrangiert. Unglaublich, wie kunstvoll er die interessantesten Effekte, melodische Tonfolgen, Klänge nie gehörter Art erzeugen konnte: tickende Wanduhren, Pferdegalopp, Märsche in Perfektion. Diese Melodien begleitete er mit leisem Pfeifen. Wenn der Zuhörer die Augen schloss, glaubte er, einen Spielmannszug zu erleben. Sogar Hausmeister Grigoleit musste diese Kunst, wenn auch neidvoll, durch zustimmendes Brummen anerkennen.
Nur für die Daumen, die bekanntlich stärkere Ausmaße haben, fehlten ihm noch passende Fingerhüte, falls es diese überhaupt geben sollte. Er behalf sich mit einem Stück abisoliertem Kupferleitungsdraht, welches er geschickt um seine Daumen wickelte und somit alle zehn Finger zum Einsatz bringen konnte.
Stundenlang, wochenlang trommelte, melodierte er und erreichte eine faszinierende Fertigkeit, welche mit Sicherheit ein großes Publikum begeistern musste. Doch Freitag hatte eine viel bescheidenere Hoffnung. Falls er doch einmal zu einer Betriebsfeier seiner Kollegen eingeladen werden sollte, was bisher in den ganzen Jahren nie eingetreten war, würde er zur Unterhaltung beitragen. In Gedanken schwärmte er: Man würde applaudieren, ihn bewundern, ihn sogar für private Anlässe engagieren, vielleicht sogar ein wenig Geld für seine Kunstfertigkeiten anbieten. Das würde er aber ablehnen. Es würde sich ja um Kollegen handeln. Freunde, die er sich so sehr wünschte. Und denen konnte man doch kein Geld abnehmen. Freundschaft wäre für ihn unbezahlbar, nur bisher hatte er nicht einmal einen einzigen Freund.
Einmal traf das so sehr Erhoffte sogar ein und Freitag wurde durch Zufall, als er sich aus seinem Kellerarchiv kommend gerade im Treppenhaus befand, von einem ihm unbekannten Mitarbeiter angesprochen. Dieser lud ihn sektbeschwingt ein, an einer gerade stattfindenden Katasteramt-Betriebsfeier teilzunehmen. In Jubellaune verstaute er dankbar seine herumstehenden Trommelutensilien in seinem ständig bereitstehenden sperrigen Pappkarton, klemmte sich diesen unter den Arm und ging zögernd die Steinstufen „nach Oben“.
Die Tür zu den Büroräumen, aus denen munteres Stimmengewirr drang, war halb geöffnet. Als er den Raum betrat, beachtete ihn wie üblich niemand. Nur Fräulein Lange, die Bürokraft des Abteilungsleiters Herrn Bock, mit der er sich schon umständlich über seine kratzende und quäkende Gegensprechanlage verständigt hatte, sprach ihn an.
Sie war derart geschminkt, dass man sie nicht übersehen konnte. Die besten Jahre hatte sie bereits hinter sich, glaubte aber aufgrund ihres üppigen Busens, den sie stolz vor sich herschaukelte, noch immer an ihre Unwiderstehlichkeit. Sie wirkte wie eine Kartenabreißerin im Kino, die in den Pausen einen Bauchladen voller Süßigkeiten vor sich herwackelte und alles feilbot. Trotz Eau de Cologne dünsteten ihre Synthetikpullis immer etwas Gewöhnungsbedürftiges aus. Wie sehr Fräulein Lange auch bemüht war, sich Herrn Bock anzudienen, er ignorierte ihr Gehabe einfach und sah durch sie hindurch. Das ließ verständlicherweise Missmut bei ihr aufkommen, was sie den von „da Unten“ gern spüren ließ.
„Sie sind also der von ‚Unten‘. Was haben Sie denn da mitgebracht? Brauchen Sie dafür einen Tisch?“
Man hörte einen leicht verächtlichen Ton in ihrer Stimme – so sah der also aus, dieses Semmelgesicht – und sie schüttelte merklich missbilligend den Kopf. Ohne eine Antwort abzuwarten, schaute sie ihn gelangweilt an und zeigte mit gespreizten, billig beringten Fingern auf einen leeren Schreibtisch in einer verwaisten Ecke des Büroraums. Dort könne er sich breitmachen, erklärte sie in einer unangenehmen, hochnäsigen Art, sodass Freitag sich wie ein geduldeter Bittsteller vorkam. Aber die Überzeugung von dem, was er durch seine Fingerfertigkeit akustisch zu zaubern in der Lage war, machte ihm wieder Mut. Er hielt es für sehr wahrscheinlich, dass keiner von den anwesenden Personen auch nur annähernd etwas Derartiges zur Unterhaltung bieten könne.
Also packte er seine kleine Ausrüstung aus Flaschen, teils bereits unterschiedlich hoch befüllt mit Wasser, Blechdosen, Gläsern und noch einige Holzstäbe aus. Dann brachte er alles in spielbereite Position, stülpte seine Fingerhüte über und begann mit einem Marsch. Sein Pfeifen und Trommeln schaffte es, sich einen Augenblick gegenüber dem Stimmengewirr durchzusetzen. Es wurde sogar für einen Moment leiser und eine kurze Stille des Staunens machte sich breit, was Freitag ermutigte, seine Lautstärke zu steigern. Er wiegte sich glücklich wie ein leidenschaftlich klimpernder Pianospieler.
Dann geschah jedoch etwas, das nicht hätte geschehen dürfen: Ein kräftiger, junger Büroangestellter, jener, der ihn auf der Treppe zur Teilnahme eingeladen hatte, ging mit einer Flasche Bier in der Hand zu einer mitgebrachten Plattenspieleranlage, legte Heimatklänge auf und stellte eine alles übertönende Lautstärke ein.
„Es darf getanzt werden! Prost!“, brüllte er, sich demonstrativ um seine Achse drehend.
Freitag wurde blass und hielt inne. Einer seiner wertvollsten Fingerhüte aus Porzellan fiel ihm vor Schreck von der Hand auf den Linoleumboden.
Der junge Büroangestellte mit der Bierflasche ging, schon ein wenig alkoholschwankend, auf Freitag zu und kippte den Rest seines Getränks mit abgewinkeltem Arm in dessen Pappkarton. Gejohle! Dabei zertrat er versehentlich den Fingerhut, was jedoch niemand wahrnahm.
Frau Lange nutzte die Gelegenheit, schlich sich im Tangoschritt an den übermütigen Burschen, um ihn fest an sich zu drücken, und begann dickärschig zum Beifallsklatschen der Anwesenden mit ihm zu schunkeln.
Freitag schämte sich dieser Demütigung, packte hastig seine Sachen zusammen und verließ wie ein geprügelter Hund den Büroraum. Traurig, müde und leer im Kopf, suchte er seinen Kellerraum auf. „Hier Unten“ kam niemand, um ihn seine Unterlegenheit spüren zu lassen. Tiefer ging es nicht. Doch dieses vertraute Umfeld war seine Bleibe, sein Reich.
Für den Besuch des Trödelmarkts hatte er, trotz frühlingshafter Temperaturen, nach reiflichem Abwägen seinen schäbigen Wintermantel mit dem verschlissenen Kragen, den abgewetzten Ärmeln und einem fehlenden Knopf am Kragen ausgewählt. Er wollte seine gute Kleidung nicht beim Durchstöbern alter Schätze einschmutzen. Auf die Idee, dass er so ziemlich heruntergekommen wirken könnte, wie jemand, dem man erst gar keine Preise nennen musste, kam er nicht.
Am Bahnhof angekommen, löste er eine Fahrkarte am Schalter, der so eine kleine Ausgabe hatte, dass diese eher einer Schießscharte glich. Durch eine gegeneinanderlaufende Lade wurde vom Bahnbeamten Fahrkarte gegen Geld durchgeschoben. Beschwingt lief er die Steintreppe hinunter, dann durch einen kurzen Tunnel, um auf die gegenüberliegende Bahnsteigseite zu gelangen. Von den alten Tunnelwänden löste sich der Putz. Vergilbte Farbe blätterte durch Feuchtigkeit blasenartig ab. Hier unten roch es nach Urin. Blitzende Glasscherben geborstener Schnapsflaschen warteten auf ihre Entsorgung, breitgetretener Hundekot stank vor sich hin. Mit ekelgequältem Blick nahm Freitag all das wahr und erkannte: Nachts sollte er sich hier lieber nicht aufhalten.
Ihn überkam ein Gefühl der Zufriedenheit, der beruhigende Gedanke, dass er hier zu nächtlicher Stunde auch nichts zu suchen hatte. Er wusste um seine grenzenlose Naivität, die ungewollt immer wieder Schutz für sein Seelenheil bot. Diese schlichte Selbsterkenntnis, dieser Wohliges auslösende Gedanke durchdrang ihn zutiefst. Sein kleines Glück wollte er niemals gefährden. Ein zwar äußerst schlecht bezahlter, aber immerhin ein Arbeitsplatz, eine kleine Wohnung und jetzt ein vielversprechendes Wochenende.
Am hinteren Bahnhofsausgang verließ er das ihm vertraute Gebäude. Mit wenigen Schritten erreichte er ein kleines, mit Dachpappe belegtes, schuppenartiges Flachbauwerk, in dem sich wohl das Lager der Bahner für Werkzeug, Reinigungsgeräte, Ersatzteile und vieles mehr befinden musste. Ein verwittertes Holzfenster mit blinden Scheiben war im roten Backsteingemäuer eingebaut. Ausgewaschene Fugen und nicht zu übersehende Risse im Fenstersturz kündeten von der Unwichtigkeit dieses scheinbar vergessenen Nebengebäudes. Ein geborstenes Zinkfallrohr der Dachrinne ließ Regenwasser ungehindert ins Mauerwerk eindringen und seinen Verfall beschleunigen. Die Holzbalken der Traufe waren bereits weggerottet. Teilweise Bemoosung am nassen Ziegel stimmte Freitag traurig. Nachlässigkeit sowie fehlende Sorgfalt und Verantwortlichkeit mussten die Auslöser der Verwahrlosung sein. Doch neben dieser sich anbahnenden Bauruine ein Lichtblick: Eine kleine, schmutzig weiße Imbissbude lehnte an der Giebelseite des Werkzeugschuppens. Vereinzelte Brennnesselstauden und gelb blühender Löwenzahn hoben mit kräftigem Wurzelwuchs die verwitterten Gehwegplatten zu Stolperfallen an. Am ausgeklappten Dachüberstand der Fressbude waren zwei durch Fliegenkot verdreckte Leuchtstofflampen befestigt. Bei Dunkelheit gaben die nackten Röhren unangenehmes bläulichweißes Licht ab. Eine kleine vergraute Stofffahne kündigte Essen an. Ein dreckiger Sonnenschirm mit teils gebrochenen Metallspannern hing schief wie ein sterbendes Fabelwesen, in einen durch Geraderichten zerprügelten Betonfuß gesteckt. Trotz dieses wenig vertrauenerweckenden Erscheinungsbilds standen immer wieder Kunden an – Handwerker, ärmlich gekleidete Hausfrauen, alte Männer, Rentner –, um sich hier eine äußerst preiswerte, seltsame Spezialität zu gönnen: Strunzen! In Fett gesiedete Strunzen.
Einmal am Monatsende oder zu besonderen Anlässen fuhr er von diesem Bahnhof aus zu seiner Hauptsparkasse, um seinen kläglichen Lohn abzuheben und seine Wohnungsmiete einzuzahlen. Bescheiden und anspruchslos, wie er nun einmal sein musste, teilte er alle notwendigen Ausgaben ein. Er gönnte sich aber an diesem Imbissstand, der so versteckt neben dem dürftig instand gehaltenen Bahnhofsgebäude stand, jedes Mal nach Hin- und vor der Rückfahrt eine Spezialität dieser fetttriefenden Bretterbude. Gefaltete Strunzen zu einem unschlagbar niedrigen Preis, was auch ihn eigentlich hätte misstrauisch machen müssen. Freitag konnte gar nicht genug davon verzehren, musste sich in Acht nehmen, nicht zu viel davon in sich hineinzustopfen.
Als Kind, erinnerte er sich, war er einmal im angrenzenden Gebüsch seines Spielplatzes in eine Staude Brennnesseln gefallen. Diese Pflanzenart, Urtica dioica, die Große Brennnessel – wie er später dem Universallexikon entnahm –, löste seitdem unangenehme allergische Reaktionen bei ihm aus. Die in den Brennnesselhaaren enthaltenen Stoffe verursachten entzündliche Quaddeln auf seiner Haut. An seinen Lippen und um seinen Mundrand bildeten sich eitrige, nässende Bläschen und sein Gesicht wirkte dann wie das eines schlecht abgeschminkten Clowns. Dieselben Symptome wurden sonderbarerweise bei übermäßigem Verzehr von gefalteten Strunzen ausgelöst, was er sich nicht erklären konnte. Die in siedend heißem Schweineschmalz frittierten Köstlichkeiten bestanden aus geschroteter Kleie mit Kornhülsen, geknetet in gemahlenen Schweineschwarten.
Der Imbissbetreiber, den alle nur als Strunzenwilli kannten, hatte die Rezeptur, als er als Decksmann zur See fuhr, von einem philippinischen Hilfskoch erfahren. Und wer die Entstehungsgeschichte von Strunzenwillis Existenzgründung hören wollte, musste schon Zeit mitbringen, da dieser ausgesprochen gern weit ausholte bei seinen Erzählungen, wobei so manches Mal die in Arbeit befindlichen Strunzen verbrannten. Was er bei seinen ausgiebigen Geschichten nie preisgab, war der Inhalt einer mit Fett und Kleieresten bematschten großen, gelben Blechdose. Jedes Mal, wenn er die Strunzen faltete, griff er in diese unappetitliche Wunderdose und holte mit der Hand eine Prise graubraunen Pulvers heraus, welches er mit kreisender Handbewegung fast kultisch auf den ebenso graubraunen Fladen rieseln ließ. Man mochte noch so sehr herumrätseln, Farbe und Geschmack waren undefinierbar.
Aber es schmeckte – jedenfalls den meisten und insbesondere Freitag, der sich dazu, wenn es zeitlich möglich war, wieder und wieder Strunzenwillis Geschichten anhörte. Wie sehr wünschte er sich doch auch, einmal im gesellschaftlichen Mittelpunkt zu stehen. Er träumte von Menschen, die ihm zuhörten, ihn bewunderten, an seinen Lippen hingen, seine Geschichten von fernen Ländern hören wollten, wie er Geheimrezepturen heimbrachte, um alle Erfahrungen in einem eigenen Imbiss einzubringen, so wie Strunzenwilli.
Als am heutigen Tag keine Kundschaft anstand, fasste Freitag sich ein Herz.
„Eigentlich … Ich möchte manchmal so sein wie Sie, Ihre Erlebnisse aus aller Welt, Ihre Geschichten. Was muss ich in meinem Leben nur anders machen?“, fragte er zögerlich und mit leiser Stimme.
Und dann geschah das, womit Freitag nie gerechnet hätte. Strunzenwilli unterbrach sein Herumgewische auf der Arbeitsplatte mit einem unappetitlich graubraunen Lappen, neigte seinen Kopf ein wenig zur Seite, als müsste er überlegen, was er dieser unscheinbaren, naiven Kreatur antworten sollte, und musterte Freitag dann mit einem kurzen, aber mitleidigen Blick. „Du wirst nie so werden wie ich. Außerdem: Keine meiner Geschichten ist wahr, alles erfunden. Ich bin nie zur See gefahren und in meiner Wunderblechdose sind nur Salz, Pfeffer, Curry und Paprika. Mit dieser Bruchbude verdiene ich nicht viel, aber ich bin ein freier Mann, ich kann davon leben.“ Er wischte bereits wieder mit seinem Lappenlumpen, mit dem man wohl eher den Fußboden feudeln sollte. „Vor einigen Jahren war ich noch Hilfsarbeiter auf Baustellen. Wurde nur rumkommandiert. Musste jede Drecksarbeit machen, zu der die gelernten Handwerker keine Lust hatten. Einmal boten sie mir eine Flasche Bier an, in die einer reingepisst und sie geschickt wieder verschlossen hatte. Ein Schluck und das war’s, ich machte Schluss“, fuhr er fort.
Für Freitag brach eine Welt zusammen. Mit Entsetzen vernahm er diese wenigen Sätze. Sein Mund stand offen, was ihn ein wenig blöde aussehen ließ. Er suchte nach Worten, fand sie nicht. War denn jetzt die erste oder die zweite Geschichte erfunden? Wollte er ihn einfach zum Narren halten oder sich wichtig machen? Als er zu dem Schluss gekommen war, dass die Seefahrergeschichte eher gelogen sein musste, überkam ihn eine Müdigkeit, eine Freudlosigkeit. Wie konnte er sich nur so lächerlich machen, so einem Maulhelden seine innersten Wünsche anzuvertrauen. Er fühlte sich gedemütigt. Wie einfältig kam er sich vor! In seinem abgetragenen Mantel schlich er sich traurig, mit hängenden Schultern zurück ins Bahnhofsgebäude.
Wenn er nicht schon die Fahrkarte zur Weiterfahrt Richtung Flohmarkt gelöst hätte, wäre er umgekehrt und heimgefahren. Er hätte sich wie so oft in seiner kleinen Wohnung verkrochen, um in den alten Lexika und Realienbüchern, die er von seiner ehemaligen Nachbarin Edeltraud Wertheim schon zu Lebzeiten geschenkt bekommen hatte, rumzublättern. Er las sie immer aufs Neue. Vieles konnte man ihn abfragen, zumindest das, was er so einigermaßen verstand. Er kannte den Text auswendig und häufig sogar die entsprechenden Seiten des jeweiligen Buchs.
Um wieder auf die richtige Bahnsteigseite zu gelangen, musste er erneut die Treppenunterführung nutzen. Nur einen Augenblick der Unachtsamkeit beim Betreten der untersten Steinstufe und Freitag stolperte so unglücklich, dass es ihn folgenschwer und auf übelste Weise zu Fall brachte. Seine Beine verkeilten sich dabei derart am Pfosten und den Streben des Handlaufs, dass er seinen Sturz nicht abfangen konnte und sein Hinterkopf in einem schleimigen, unverdauten Haufen erbrochenen Mageninhalts landete.
Der Schreck und die verdrehte Lage seines Körpers ließen ihn so hilflos aussehen, dass schon kurz darauf eine besorgte Passantin die Polizei rief, die auch wenig später erschien.
Aufgrund des erbärmlichen Bilds, das sich den beiden Ordnungshütern bot, gingen die davon aus, es mit einem Volltrunkenen zu tun zu haben.
Freitag lag immer noch wie gelähmt auf der vollgekotzten Treppenstufe, fühlte aber trotzdem, dass er sich weder etwas verstaucht noch gebrochen hatte, alles dank seines alten Wintermantels, der ihn wie ein schützender Kokon umhüllte. Trotz aller Unbill erfüllte ihn die unerwartet entgegengebrachte Aufmerksamkeit mit einem positiven Gefühl.
Der jüngere Polizist reichte ihm die Hand, um ihm in eine sitzende Position zu helfen, ohne seinen schützenden Lederhandschuh zu beschmutzen. „Wie kann man sich nachmittags schon so volllaufen lassen?“, murmelte er angeekelt.
„Hilflose Person in Bahnunterführung. Nordausgang Spechtstraße. Brauchen Bereitschaftswagen. Bitte besagte Person zur Ausnüchterung und Identifizierung auf die Wache abholen“, sprach der Ältere in sein Handsprechfunkgerät.
Freitag saß noch immer wie benommen vornübergebeugt da und starrte auf die blank gewichsten Stiefel seiner Helfer.
Wenig später erschienen zwei nicht weniger glänzende Polizistenstiefel. Breitbeinig stehend und vor Autorität strotzend, erkannten sie sofort diese für sie alltägliche Situation: ekelhafter Gestank, schleimige Kotze, häufig lallendes Rumgequatsche. Allerdings stank es diesmal so übel nach verfaultem Abfall, als wäre der betroffenen Person der Mastdarm geplatzt. Was sie nicht wissen konnten: Es war ein Anfall von Freitags Proktospasmen.
Einer der Polizisten legte eine Plastikdecke über die Schultern des vermeintlich Betrunkenen, um sich und den Bereitschaftswagen nicht einzusauen.
Beim Abführen stammelte Freitag immer wieder, wie ein Hampelmann wild mit den Armen um sich rudernd, er sei nicht betrunken.
Vorbeieilende Fahrgäste blickten verstohlen neugierig und doch angewidert auf die Szene.
Einer der älteren Polizisten versuchte, ihn zu beruhigen: „Ist ja gut, wir nehmen dich zur Ausnüchterung mit auf die Wache und dort wird vom Amtsarzt ein kleines Protokoll gemacht. Und jetzt mach keinen Aufstand!“ Dabei wurde er wütend über den Widerstand dieses vermeintlich volltrunkenen Stinkstiefels und trat ihm von hinten derart heftig in die Kniekehle, dass Freitag, wie von einer Axt getroffen, seitlich wegsackte.
Die anderen Kollegen fingen ihn routiniert auf, als hätten sie solche brutalen Aktionen schon häufiger durchgezogen, und schleppten ihn zum Auto, wobei Freitag einen Schuh verlor.
„Mein Schuh, wartet, mein Schuh! Ich will meinen Schuh wiederhaben!“, krächzte er verzweifelt. Dabei versuchte er sich aus der Umklammerung der Polizisten zu befreien, wendete bei diesem aussichtslosen Versuch seinen Kopf und sah, wie der ältere Ordnungshüter mit der Faust zum Schlag ausholte. Er hörte nur noch die höhnischen Worte „Ich sag doch, dieses Schwein ist stockbesoffen!“ – und verlor nach dem Fausthieb die Besinnung.
Auf einer plastikbezogenen Liege wachte er schließlich wieder auf. Grelles Licht blendete ihn. Er lag in einer weiß getünchten Ausnüchterungszelle. Die stählerne Tür stand offen, um ihn beobachten beziehungsweise ab und zu einen Blick auf ihn werfen zu können.
Jetzt trat der angeforderte Amtsarzt in die Zelle. Er war offensichtlich müde, beugte sich nach vorn und stellte seine Tasche auf dem Fußende der Liege ab. „Hören Sie mich? Ich bin der Amtsarzt. Verstehen Sie mich?“, fragte er grußlos.
Freitag richtete sich auf und nickte. „Ja, Herr Doktor!“ Dabei blickte er auf seine Füße und fuhr klagend fort: „Ich habe einen Schuh verloren, sehen Sie?“ Er deutete zitternd auf seinen Fuß.
„Ja, ja. Wie heißen Sie, können Sie mir das sagen? Und wo wohnen Sie, können Sie mir das auch sagen?“, fragte der Arzt. Und ohne eine Antwort abzuwarten, fragte er weiter: „Wissen Sie noch, wie viel und was Sie getrunken haben?“ Einem anscheinend Volltrunkenen diese Frage zu stellen, war einfach unsinnig, und das wusste der Doktor. Trotzdem hielt er sich an seinen Fragenkatalog.
Und erhielt tatsächlich eine verblüffende Antwort von diesem nach Erbrochenem und verfaultem Abfall stinkenden Menschen: „Ich heiße Freitag und habe nichts getrunken und habe einen Schuh verloren.“
„Ja, ja, das sagen sie alle.“ Übergangslos setzte der Doktor seine routinierte Arbeit fort. „Schauen Sie auf meinen Finger!“ Den bewegte er langsam vor Freitags Gesicht hin und her. „Jetzt gehen Sie mal auf einer Linie!“
Die existierte hier im Raum natürlich nicht wirklich, sondern nur in seinem medizinisch ausgestatteten Untersuchungsraum. Freitag tat dennoch, wie ihm geheißen, und humpelte einschuhig auf einer gedachten Linie durch die Ausnüchterungszelle, jedoch ohne zu torkeln.
Erstaunlicherweise erfüllte der scheinbare Trunkenbold alle Anforderungen ohne Auffälligkeiten, die auf hohen Alkoholgenuss hätten schließen lassen können. Der langsam sichtbar genervte Arzt notierte etwas auf einem Protokollblatt, verließ den Raum erneut grußlos und wandte sich an einen der diensthabenden Polizisten im Wachraum: „Hier brauche ich keine Blutprobe entnehmen, der ist stocknüchtern. Wieso habt ihr ihn denn überhaupt reingeholt? Der sucht doch nur seinen zweiten Schuh.“ Und eilig wandte er sich zum Gehen. „Auf Wiedersehen, meine Herren.“
Die schauten sich verdutzt an und ihnen dämmerte: Anscheinend war der vermeintlich Volltrunkene wirklich nur unglücklich gestürzt.
„Hoffentlich hat das kein Nachspiel“, murmelte der leitende Diensthabende.
Der ältere der beiden räusperte sich. „Ich regel das schon“, sagte er halblaut. Er trat in die Zelle zum verängstigten Freitag. „Jetzt hau ganz schnell ab, bevor wir uns das noch anders überlegen. Mit dir stimmt doch was nicht. Hast du vielleicht Drogen genommen?“
Freitag schaute ihn verwirrt an. „Drogen?! Wo ist mein Schuh?“ Und ohne ein weiteres Wort humpelte er einschuhig aus dem Revier, bevor ihm noch etwas angehängt werden konnte.
~
Diese schmerzliche Erinnerung an den Unfall und das furchtbare Erlebnis mit des Menschen „Freund und Helfer“ hatte ihn um so manche Nachtruhe gebracht. Damals war er ja immerhin aus der unseligen Geschichte rausgekommen, wenn auch mit einigen Blessuren.
Diesmal musste sein Unfall auch zu einem guten Ende führen! Er wusste, dass er an seiner augenblicklichen Situation eigentlich absolut unschuldig war. Oder doch nicht? Hätte er sich nicht so sehr an das Aktenregal hängen sollen? Was würden die „da Oben“ dazu sagen? Würden sie den Unfall sogar als grob fahrlässiges Handeln einstufen? Diese anfänglichen Bedenken lösten sich langsam in beginnender Sorglosigkeit auf. Irgendwann in absehbarer Zeit musste ihn ja jemand finden, sogar vermissen. Und man würde ihn vielleicht sogar feiern – als Helden, der trotz seiner aussichtslosen Lage eine angreifende Monsterratte mit seinen Zähnen getötet hatte. Der Rattenbiss in die Zunge war der unübersehbare Beweis. Vielleicht würde ein Reporter einen Bericht einschließlich Foto in das Wochenblatt bringen. Leserbriefe, Einladungen. Der Pastor würde „Gott hat ihn nicht vergessen, sich seiner erbarmt!“ von der Kanzel rufen. Gratulation des Ortsvorstehers, in der Tageszeitung zum mutigsten Mann des Monats gekürt. Unbeschreiblich, wie lange hatte er darauf warten müssen? Anerkennung, das wäre der gesellschaftliche und berufliche Durchbruch. Endlich würde man ihn, Freitag, wahrnehmen, ihn aus seiner Unsichtbarkeit erlösen.
Der Gedanke erregte ihn so sehr, dass sein kleines Glück zwischen den eingeklemmten Beinen steif wurde, ein unbeschreibliches Wonnegefühl auslöste, als würde ein warmer Föhn seinen Körper überspülen. Seine Gefühle berauschten ihn, ließen ihn abheben, schweben, ein nie gekanntes Hochgefühl überkam ihn. Sollte Hausmeister Grigoleit sich doch Zeit lassen. Je länger sein Martyrium andauerte, desto größer würde seine Anerkennung ausfallen, sein Mut begeistern. Wie ein süßes Gift durchdrang eine ungekannte Eitelkeit seinen Geist. Eine beängstigend intensive Euphorie ließ ihn auf Wolken tanzen, schwimmen, lachen, den ganzen Himmel und die Erde umarmen.
Dann setzte langsam die Ernüchterung ein. Als würde eine Droge ihre Wirkung verlieren. Die zermürbenden Ängste schlichen sich wieder ein, marterten seinen Verstand. „Befreit mich, ich will nicht sterben!“
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, kam sie, die wohltuende Verheißung, das metallene Klirren eines Schlüsselbunds in dieser dumpfen Stille. Die Nebeneingangstür wurde laut vernehmlich aufgesperrt. Freitag lauschte dankbar, trotz Grigoleits unflätigem Fluchen („Verdammter, verfluchter Mist!“), als der mehrere Male den Lichtschalter erfolglos klickend kippte und tastend aneckend wieder verschwand.
Nach kurzer Zeit kam er mit einer Taschenlampe zurück. Suchend, kreisend traf der Lichtkegel den Sicherungskasten im Nebengang.
Grigoleit wollte als Erstes den Sicherungsautomaten in seine alte Position drücken, der sprang aber mit einem blitzenden Knall sofort wieder heraus. Er erkannte, dass hier ein etwas komplizierterer Vorfall zu beheben war. Nicht nur eine leuchtende Glühbirne, die ihr Leben aushauchte, sich noch einmal lichthell aufbäumte und dann den ganzen Kellertrakt in gefährlicher Dunkelheit zurückließ. So folgerte der geforderte Hausmeister, dass er hier eine defekte Stelle aufspüren musste.
„Ja, ja, wenn was schwierich wird, haut Freitach einfach ab und ich muss alles ausbaden“, murmelte er ein wenig pathetisch.
Freitag, der in der Dunkelheit noch nicht entdeckt worden war, hörte jetzt das Aufschrauben eines Flaschendeckels, dann das laute, glucksende Schlucken.
„Ah, ja, das tut jut!“, stöhnte Grigoleit auf. „Alles Scheiße!“
Jetzt bewegte er sich ganz nah der geöffneten Tür vor dem Gang zum Archiv. Das funzelige Taschenlampenlicht eilte wie ein fährtensuchender Hund voraus, tanzte durch den Raum und brannte sich plötzlich in die Unfallstelle ein.
„Ach du meine Jiete, was um Herrjottswillen is denn hier passiert?“
Langsam führte er den Lichtkegel über das Chaos, dann hatte er ihn im Fokus, einen Teil von Freitags kreideweißem, blutverschmiertem Gesicht.
„Freitach, lebst du?“ Über die verstreuten Akten stolpernd, trat er näher und blendete den Verletzten. Der schloss die Augen. „Wie hast du das hinjekricht?“, fragte Grigoleit. „Hast du einen Wutanfall wejen de Nachricht jekricht? Du auch?“
Freitag verstand überhaupt nichts. Was bedeutete „du auch“? Er hätte zu gern nachgefragt, was in seiner Position – und geschwächt wie er war – jedoch nicht möglich war. Und schon erschien das Gespenst der Sorge, der immer wiederkehrenden Angst, tief in seinem Innersten verwurzelt. Alles gerade noch so herrlich Erträumte löste sich mit dieser Frage auf. Er fühlte sich wie ein geköpftes Huhn, das seinem soeben Erlebten noch entfliehen wollte, im Todeskampf mit den Beinen rudernd, strampelnd, ein letztes makabres, zielloses Flügelflattern, verblutend, zuckend, tot.
„Nein, kein Tod, ich will leben, ich atme, also lebe ich!“, fantasierte er.
Dabei erschien ihm ein Kindheitserlebnis, drängte etwas Unbeantwortetes in sein Bewusstsein.
~
In der Nebenstraße, auf dem Weg zur Volksschule, trottete er jeden Morgen an dem Schaufenster der Tischlerei und Sargmacherei Thomas Lange vorbei, was mit großen Buchstaben in schwarzer Farbe auf der roten Backsteinmauer des Gebäudes aufgetragen war. Hier verlangsamte er jedes Mal seine Schritte. Er zögerte, blieb stehen, um einen schwarz lackierten Edelsarg, mit einem großen silbernen Kreuz belegt, minutenlang anzustarren. Den Deckel der abgeschrägten Kopfseite zierte, als silbernes Relief herausgearbeitet, eine Taube mit einem Zweig im Schnabel. Verwirrt und mit einem unguten Gefühl musste er jedes Mal aufpassen, auf dem groben Kopfsteinpflaster nicht zu stolpern. Warum die Taube? Das Werkstatttor der Tischlerei war halb geöffnet. Man konnte die fleißigen Handwerker, in lange graue Kittel gekleidet, beobachten, die stumm ihre Aufträge abarbeiteten. Elektrische Sägen und Hobel kreischten, fetzten dem toten Holz helle Späne ab, die bis an das Tor wirbelten. Er traute sich nicht, einen Handwerker zu fragen, welche Bedeutung das Taubenrelief auf dem Sarg habe. Erst als er seine Mutter so häufig bittend, ja bettelnd bedrängte, die Gasse an einem freien Vormittag mit ihm aufzusuchen, um ihr etwas für ihn sehr Merkwürdiges zu zeigen. Doch die Antworten verwirrten ihn noch mehr, obwohl er als Achtjähriger schon sehr genau wusste, welche Funktion ein Sarg hatte. Das vorübergehende Zuhause eines Toten. Aber die Taube?
„Die Taube ist ein Zeichen dafür, dass sie die Seele vom Toten in den Himmel trägt“, suchte seine Mutter etwas verlegen und hilflos nach einer Antwort.
„Oder in die Hölle“, fabulierte der Junge etwas naseweis.
„Das weiß ich nicht, was da oben passiert.“
„Warum da oben?“, fragte er.
„Das weiß ich nicht, das entscheidet der liebe Gott!“ Ihre Stimme wurde immer unwirscher. „Jetzt komm und frag nicht so viel! Du wirst ja zum richtigen Schlaumeier.“ Sie griff nach seiner Hand und zerrte ihn vom Schaufenster weg.
„Und was hat der Zweig in ihrem Schnabel zu bedeuten?“, fragte er unbeirrt weiter. Ohne eine Antwort verließen sie die Gasse.
~
Hausmeister Grigoleit richtete den umgestürzten Holzstuhl auf, den Freitag wie einen eigenen Körperteil pflegte, und setzte sich breitbeinig darauf. Dann legte er die leuchtende Taschenlampe auf den Boden, sodass noch ein kleiner flacher Lichtkegel das Chaos traf und Freitag nur noch schemenhaft, fast gespenstisch sichtbar war. Er holte seine angebrochene Schnapsflasche aus der Kitteltasche, schraubte sie auf und trank glucksend ein paar Schlucke.
„Ach was, jleich werd ich das Licht reperieren und dann ruf ich ‚Oben‘ an. Wir brauchen wohl einen Rettungswajen. Das kann ich aber nich veranlassen, das missen die ‚da Oben‘ erledijen.“ Schmatzend und rülpsend nahm er noch einen kräftigen Schluck und wurde jetzt vertraulich. „Freitach, hast du wirklich keine Nachricht jekricht?“ Dabei hielt er die Schnapsflasche wie eine Trophäe in seiner großen Faust. „Freitach, ich kann dir nich mehr helfen. Dich da rausholen missen die Rettungskräfte. Ich bin dafir nich ausjebildet, denn vielleicht hast du dir die Wirbelsäule jebrochen und bist querschnittjelähmt“, faselte er mit ansteigend lallender Stimme. Er gönnte sich wieder einen kräftigen Schluck. „Vielleicht brauchst du ja jar nich mehr die Nachricht“, brabbelte er. Da Grigoleit bis auf ein klägliches Krächzen keine Antwort erhielt, spekulierte er, alles richtig entschieden zu haben. Seufzend trank er den Rest der Schnapsflasche aus, die daraufhin unkontrolliert aus seiner Hand glitt und klirrend auf den Steinboden fiel. Ab diesem Moment herrschte absolute Stille. Grigoleit war betrunken eingeschlafen.
Als unrhythmisches Schnarchen laut wurde, erkannte Freitag wieder, in welch aussichtsloser, vielleicht sogar lebensgefährlicher Lage er sich befand. Würden ihn weitere Ratten anfallen? Seine Kräfte, seine Konzentration und seine Willenskraft, wach zu bleiben, ließen merklich nach. Langsam breitete sich über seinen Verstand ein weißes Tuch. Sollte dies sein Ende sein?
Vater Erich Freitag, ein kräftiger, vierschrötiger Mann mit großen Händen, den so schnell nichts erschüttern konnte, arbeitete hart und klaglos als Hilfsarbeiter mit Körperkraft im Straßenbau. Was ihn auszeichnete: Er schaffte es, nach Augenmaß Kopf- oder Pflastersteine in akkurater Linie und notwendigem Gefälle zu setzen. Sein Chef schätzte seine Zuverlässigkeit, er trank keinen Alkohol während der Arbeit und war fast nie krank. Der eintönige, kräftezehrende Job machte ihn über die Jahre krumm und schweigsam. Er wurde nie befördert und beschwerte sich nicht darüber, obwohl gelegentlich jüngere Kollegen seine Vorarbeiter wurden. Erich Freitag glaubte schlicht daran, dass jeder seinen Platz, seine Aufgaben im Leben hatte.
Mit seiner Frau Liesbeth, die in einer Konservenfabrik arbeitete, bewohnte er eine düstere, ewig feuchte Kellerwohnung mit einem bescheidenen Ausblick auf ihre Grundstücksgrenze. In gusseisernen Streben vernietete, stumpfe Pfeilspitzen bildeten einen wehrhaften Zaun zur Straße. In ihrer Küche mussten sie ständig elektrisches Licht einschalten, weil dort nur ein Fensterloch zur Belüftung vorgesehen war. Einmal im Jahr, wenn die blasse Wintersonne ihren tiefsten Stand erreichte, krochen für wenige Wochen mittags blinzelnd Strahlen durch die Kellerfenster und leuchteten Ecken und Nischen des Wohnzimmers aus, als meinten sie es gut mit der Familie Freitag. Doch die arbeitete tagsüber und kam, wenn überhaupt, nur an wenigen Wochenenden in den bescheidenen Genuss.
Vielleicht hatte der Nachwuchs diesem Umstand sein Leben zu verdanken. Allerdings bereitete die Namensfindung des Neugeborenen Unstimmigkeiten, denn die Wahl der umsichtigen Mutter lehnte der Vater vehement ab.
„Fridolin? Fridolin Freitag, ein Name für Taugenichtse. Adolf, das wär doch was.“
„Unser Schuster in der Schwerthauser Straße heißt doch auch Fridolin, du weißt doch, Fridolin Möhring“, meinte die Mutter.
„Traust du dem etwa über den Weg? Du beschwerst dich doch immer, der ist viel zu teuer“, erwiderte der Vater unbeirrt misslaunig.
Nach einigem Hin und Her einigte man sich auf Bernhard. So hieß doch auch der Schornsteinfeger, Bernhard Patzke. Liesbeth Freitag konnte somit ihren Mann mit dem klugen Argument, dass Schornsteinfeger Glück bringen, vom Namen Adolf abbringen.
Der winzige Bernhard wuchs, häufig kränkelnd und verrotzt aufgrund ärmlicher Wohnverhältnisse, zu einem stillen Kind heran. Sobald es möglich und das Kind groß genug war, ging Mutter Freitag in privaten Haushalten putzen, um ein wenig dazuzuverdienen. Ihr Mann wollte sich irgendwann einmal einen Fernsehapparat kaufen können. Mit dem Fahrrad nahm sie den Kleinen überall mit hin. Anfangs band sie ihn in den Wohnungen, wenn es sich nicht vermeiden ließ, mit einer Hundeleine, das Halsband um seine schmächtige Taille gelegt, an Tisch- oder Stuhlbeine. Um ihn zu beschäftigen, legte sie ihm ein altes bebildertes Märchenbuch vor die Füße, welches er lange schweigend bestaunte, bis er darüber einschlief.
An dem Tag, an dem der Kleine es schaffte, sich von seiner Fessel zu befreien, indem er es fertigbrachte, das Halsband zu öffnen, entfernte er sich trotzdem nicht vom Fleck. Er legte sich lediglich vor das zerfledderte Märchenbuch der Gebrüder Grimm und träumte mit offenen Augen vor sich hin.
In seinem fünften Lebensjahr traute er sich, die stets frisch gebohnerte, fünfstufige Treppe in seinem Haus bis zur Wohnung der Hauptmieterin Edeltraud Wertheim zu erobern, die das gesamte angehobene Erdgeschoss bewohnte.
Frau Wertheim, Witwe eines Beamten höheren Dienstgrads, war stets auf Distanz bedacht. Nur der große Flur des Treppenhauses sorgte manchmal für eine flüchtige Begegnung mit Familie Freitag und der in einer kleinen darüberliegenden Mansardenwohnung lebenden Irma Banski. Man grüßte sich höflich, aber knapp und ohne jegliche verbindlichen Worte. Stets in elegantem Kostüm wirkte Frau Wertheim wie eine Dame aus besserem Hause und ließ durch Blicke ihre Unnahbarkeit und Abneigung gegen ihrer Meinung nach nicht standesgemäße Mitbewohner klar erkennen. So als begegneten sich Fremde. Den Jungen ignorierte sie, bis auf das eine Mal, als es sich nicht vermeiden ließ.
Der Kleine schaffte es, die Tür der Kellerwohnung zu öffnen, ohne dass seine Mutter etwas bemerkte, und stattete Frau Wertheim einen Besuch ab, indem er zaghaft gegen die dunkle, teils im Jugendstil verglaste Holztür klopfte.
Die überrascht blickende Unnahbare und das neugierig dreinschauende Kindergesicht, jetzt mit herunterhängender Unterlippe, was es ein wenig dümmlich aussehen ließ, starrten sich an.
Dann, mit einem Blick durch die halb geöffnete Tür, erlebte der Kleine eine vorher nie gesehene, prachtvolle Wohnung – wie im Märchen. Er kniete sich vor Frau Wertheim hin, als wollte er mit ihr spielen. Sie schauten sich an, er fragend von unten hinauf und sie irritiert von oben herab.
„Du musst jetzt zu deiner Mama gehen. Die vermisst dich sicherlich.“
„Wo bist du denn, Junge?“, kam aus dem Souterrain prompt der Ruf der heraufeilenden Mutter. „Ach, entschuldigen Sie, Frau Wertheim, entschuldigen Sie vielmals die Störung … Komm jetzt, Junge!“
Der rührte sich aber nicht und man konnte ihm ansehen, dass er gern an Frau Wertheim vorbeikrabbeln wollte, um deren Wohnung zu inspizieren.
„Der Kleine hat ja nichts angestellt. Es ist schon in Ordnung“, bemerkte diese unverbindlich.
Frau Freitag entschuldigte sich noch einmal und griff den Jungen, der sich mit herunterhängenden Armen und Beinen wie ein Sack Kartoffeln forttragen ließ.
Frau Wertheim schloss vornehm leise die Tür.
Dem Kleinen gingen die wahrgenommenen Bilder dieser Märchenwelt nicht aus dem Sinn und es war nur eine Frage der Zeit, bis er seinen Ausflug in seiner kindlichen Neugier und Naivität trotz Ermahnungen wiederholen würde. Nur diesmal wartete er den Zeitpunkt ab, als seine Mutter in der Küche Essen kochte und das Kochgeschirr scheppernd laut auf der einflammigen Herdplatte hin- und herschob, um nichts anbrennen zu lassen.
An die Tür klopfte der Kleine ohne Scheu. Frau Wertheim öffnete und es gab wieder erstaunte Blicke. Dieses Mal angewidert durch den Geruch einer Kohlsuppe und gebratenen Specks aus Familie Freitags Kellerwohnung – der Junge hatte unbedacht die Tür offen gelassen –, wollte sie ihn gerade ermahnen, nicht schon wieder von zu Hause wegzulaufen.
Doch der schlängelte sich geschickt an ihr vorbei, um dann über den dunkelroten Teppichläufer, gesäumt von einem meterhohen metallenen Kerzenständer, Bodenvasen und einem großen Marmorakt, in das Wohnzimmer vorzudringen. Er staunte und staunte mit offenem Mund über das viele Licht der großen Fenster mit schweren, goldenen Vorhängen, die dunklen Polstermöbel, die vielen Bücher in den Regalen und das hochglanzpolierte Klavier.
Frau Wertheim kam, auf einen Gehstock gestützt, mit langsamen Schritten auf den Jungen zu, als wollte sie ein Haustier einfangen. Ratlos, wie sie den Kleinen loswerden könnte, zögerte sie. Sollte sie die wahrscheinlich verschwitzte, mit einer nach Kohlsuppe und Speckbraten riechenden, essensverschmierten Kittelschürze bekleidete Mutter rufen? Und dann wieder diese ständigen überschwänglichen Entschuldigungen zu hören bekommen? Sollte sie doch die Tür verschließen, um das Bürschchen zu bändigen. So ging das nicht weiter.
Der Junge kroch derweil unter den Stubentisch. „Fang mich doch, fang mich doch!“, rief er.
Frau Wertheim schob ihren Rock ein wenig hoch und kniete sich mühsam nieder, ihn streng anschauend. „Kind, du musst jetzt gehen, deine Mama wartet sicherlich mit dem Essen auf dich.“
Und siehe da, der Kleine stand wie gefordert auf und ging.
„Tschüss, Tante.“
Frau Wertheim überlegte nach diesem Vorfall lange, wie sie diesen lästigen Zustand beenden konnte, ein für alle Mal!
Aber am folgenden Tag, ja, die ganze Woche, war das zaghafte Kinderklopfen an der Wohnungstür nicht zu hören. Die Belästigung wiederholte sich nicht. Der Junge kam nicht und Frau Freitag verstand es, jeden Kontakt im Flur durch eiliges Kommen und Gehen geschickt zu vermeiden.
Doch schließlich kam der Tag, an dem sich alles wendete.
In ihrer kinderlosen Ehe verschaffte sich Frau Wertheim vor Jahren Trost durch den Kauf eines reinrassigen weißen Pudels, dessen Stammbaum sogar urkundlich belegt war. Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung galten von da an kompromisslos ihrem Liebling. Auch dass ihr Mann frühzeitig verstarb, tat dieser Hingabe keinen Abbruch. Man hätte meinen können, dass ihr Leben sich dadurch verändert hätte, doch so war es nicht. Erst als ihr liebstes Wesen altersschwach und nach aufopfernder Pflege tot und zusammengerollt neben ihr im Bett lag und sie spinnert wehklagend beteuerte, dass es in den Hundehimmel käme, erfuhr sie, was Einsamkeit bedeutete. Sie meinte, es aufgrund ihrer beginnenden Gehbeschwerden trotz des schmerzlichen Verlusts nicht wagen zu können, einen Ersatz zu beschaffen.
Als sie wieder einmal voller Wehmut über eines der wertvollsten Lederhalsbänder aus dem Bestand ihres verstorbenen Lieblings streichelte, dämmerte ihr, so absurd es zu Beginn auch erscheinen mochte, dass der Nachbarsjunge ihre schmerzende Einsamkeit vielleicht durch seine kindliche Unbedarftheit lindern konnte. Der anfänglich lästige Kinderbesuch störte sie plötzlich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Anfangs wollte sie es nicht wahrhaben, aber sie vermisste dieses leise, zögerliche Anklopfen an ihrer Wohnungstür so sehr, dass sie sich schließlich dazu bewegte, ihre Eingangstür immer einen Spalt geöffnet zu halten. Diese Entscheidung fiel ihr wahrlich nicht leicht, hatte sie es doch nie gelernt, sich mit Proleten abzugeben. Sie hoffte schlicht, den Jungen auf diese Weise zu erreichen und ihn in ihre Wohnung zu locken, um ihn um sich zu haben. Ihre Unrast und Unentschlossenheit konnte sie nicht begründen.
Eines Tages wollte Frau Freitag spätnachmittags noch schnell einige Besorgungen machen. Während Vater Freitag sich im Flur seine Arbeitsschuhe ausziehen wollte, ließ ihn ein schrilles Quieken seines Jungen, so ungewöhnlich laut, als wollte man ein Ferkel abstechen, aufhorchen.
Dem heraneilenden Vater bot sich ein erschreckendes Bild: Der Kleine hatte in der Küche auf einem Holzbänkchen neben einem Paket Waschpulver eine kleine Schachtel mit der bunten Aufschrift Der neue Gurkenhobel für jeden Haushalt – blitzschnell, blitzsauber! entdeckt und neugierig aufgefriemelt. Es gelang ihm, ein darin befindliches Kunststoffbrettchen herauszuziehen. Beim Abreißen der schützenden Pappstreifen für die rasiermesserscharfen Stahlklingen war sein Daumen so tief in eine Klinge abgeglitten, dass die halbe Kuppe aufgeschlitzt worden war.
Das starke Bluten und schmerzerfüllte Kreischen ließen den arbeitsmüden Vater ungewöhnlich hektisch reagieren. Er griff sich ein Küchentuch, umwickelte fest die ganze Hand und zerrte den Jungen an der Schulter aus der Wohnung, aus dem Haus. Draußen packte er ihn, nahm ihn auf den Arm und hastete, mehr laufend als gehend, um einige Häuserblöcke zu ihrem Hausarzt Dr. Bachmann. Dort erkannte man den Notfall, das Blut sickerte bereits mahnend rot durch das Geschirrtuch.
Dr. Bachmann, ein älterer, dürrer Herr mit eingefallenen Wangen, einer goldenen Halbbrille, die ihm fast von der Nase fallen wollte, und einem altmodischen, bis zu den Waden reichenden weißen Arztkittel, konnte den Kleinen, der sich hilfesuchend an seinen Vater schmiegte, sofort behandeln. Die klaffende Wunde sah schlimmer aus, als sie war. Das brennend schmerzende Desinfizieren ließ den Kleinen zwar noch einmal aufheulen, es musste aber nicht genäht werden. Eine kleine Metallklammer wurde gesetzt. Der anschließende dicke, weiße Verband und eine Armschlinge versöhnten den Kleinen dann, der sich jetzt sehr wichtig fühlte. Trotzdem blieben ein leicht stechender Schmerz und ein dumpfes Pochen in der Hand.
Dr. Bachmann verabschiedete den tapferen Patienten: „Und morgen kommst du wieder und wir wechseln den Verband und das tut überhaupt nicht weh.“ Er wandte sich zum Vater. „Sie haben sehr gut gehandelt, es wird keine Entzündung geben, nur eine kleine Narbe.“
Nachdem von der Arzthelferin alle notwendigen Daten aufgenommen worden waren, ging der Vater, seinen Sohn an der gesunden Hand haltend, langsam und schweigend nach Hause.
Der Kleine schaute ihn glücklich an – seinen Vater. In diesem Augenblick begriff er, was das für ihn bedeutete.
Frau Wertheim, aufgeschreckt durch das Kinderschreien und das hastige Verlassen des Hauses von Vater Freitag mit seinem Kleinen, wartete neugierig mit halb geöffneter Wohnungstür auf die Rückkehr der beiden. Als sie dann im Flur den Verband des Jungen erblickte, stellte sie sich Herrn Freitag trotz ihrer Gehbeschwerden in den Weg. Sie hob ihren Gehstock fast drohend in die Höhe und forderte ihn leise, aber bestimmt auf, ihr in ihre Wohnung zu folgen.
Sie legte ein großes Handtuch auf ihr gediegenes Sofa und half dem Jungen, sich dort niederzulegen.
Der starrte sie mit großen Augen an.
Der noch immer fassungslose Vater, den eigentlich nichts so schnell erschüttern konnte, war dankbar für die ungewöhnliche Hilfe. Ihm wurde ein samtgepolsteter Stuhl angeboten und er schaute sich jetzt verwundert um. Er hatte diese Wohnung noch nie betreten und solchen Luxus nicht erwartet. Erklärend stammelte er unbeholfen, was sich zugetragen hatte.
„Ich habe nichts kaputt gemacht!“, krähte der Kleine dazwischen.
Frau Wertheim war irritiert von der Leidensgeschichte des Kindes und erstaunt darüber, wie nah ihr diese ging. Noch vor nicht allzu langer Zeit wollte sie diese Nähe doch auf jeden Fall vermeiden. Sie wusste deshalb sofort, dass dies eine Situation war, die ihr weiteres Leben verändern sollte.
Und prompt kam auch schon die ungeahnte Wende, denn jetzt platzte Mutter Freitag durch die offen stehende Tür herein. Sie erfasste die Tragweite der Situation nicht sofort und ließ vor Schreck ihren Einkaufsbeutel fallen, wodurch die darin befindliche Milchflasche zu lecken begann.
Frau Wertheim fühlte aufsteigenden Ärger, als sie die sich langsam durch den Stoffbeutel auf ihren Holzfußboden ausbreitende Flüssigkeit sah. Sie schaute in die Runde, sah in das verschwitzte Gesicht der überforderten Mutter, dann auf den noch immer erstaunt stummen Vater und weiter auf den fidel dreinblickenden Kindskopf, wobei ihr nicht entging, wie die Milchlache ungehindert in Richtung Teppich lief. Um einen größeren Schaden zu verhindern, griff sie sich ein bereitliegendes Handtuch und breitete es sorgfältig auf dem Schandfleck aus.
Da niemand sprach, fühlte sie sich verpflichtet, dabei den Unfallhergang lückenhaft und soweit sie es verstanden hatte, vorzutragen, während der Vater lediglich stumm nickend die Schilderung bestätigte.
„Tut nicht weh, tut gar nicht weh“, brabbelte der Kleine immer wieder dazwischen.
Frau Wertheim fragte hoffnungsvoll, ob sie den kleinen Patienten noch ein wenig beaufsichtigen dürfe, was die genervte Mutter kurz angebunden ablehnte.
Sie schulterte den Sohn, erinnerte den scheinbar immer noch überforderten Vater daran, die Einkaufstasche nicht zu vergessen, und verabschiedete sich mit einem müden „Danke“.
Dieser Unfall hatte der Familie Freitag gezeigt, dass man sich im Hause in der Not beistand. Auch wenn Frau Wertheim in der Regel unnahbar war, schließlich hatte sie doch bisher in ihrer Dünkelhaftigkeit keinen Kontakt gesucht.
Allein und einsam hagerte sie reformhausernährt vor sich hin. Ihr Glaube an den Leitspruch „Gesunder Körper, gesunder Geist“ veranlasste sie, ihrer Gesundheit wegen finanzielle Opfer zu bringen. Ihr ergrautes Haar war dünn und ließ stellenweise rosa Kopfhaut durchscheinen. Das markanteste an ihr war die rote Korallenkette, zweifach um ihren Faltenhals gelegt. Auf den Handrücken und im Gesicht wucherten Altersflecken unkontrolliert vor sich hin. Sie unternahm den unverkennbaren Versuch, ihren körperlichen Verfall durch ein gepflegtes Äußeres und Schminke zu kaschieren. Doch auch wenn sie sich noch so sehr um einen geraden Gang bemühte, der ihr sichtlich Schmerzen bereitete, musste sie sich damit abfinden, einen Gehstock zu brauchen.
Am folgenden Tag zur Kaffeezeit klopfte Frau Freitag, ihr Kind vor sich herschiebend, an die gepflegte Wohnungstür ihrer Nachbarin.
Frau Wertheim öffnete und schaute mit leicht erstauntem Blick in ihrer üblichen abweisenden Art, ohne sie hereinzubitten. Sie hatte Besuch und wollte eine peinliche Begegnung vermeiden.
Trotzdem trug Frau Freitag ein bestimmtes, laut vernehmliches „Herzlichen Dank“ vor, da sie sich jetzt an einer vermeintlich nachbarschaftlichen Verbundenheit erfreute.
Der Kleine versuchte derweil mutig in die Wohnung zu drängen.
„Frau Wertheim, noch mal herzlichen, herzlichen Dank im Namen von meiner Familie“, brachte sie selbstbewusst hervor.
In diesem Augenblick trat Hannelore Kiesler, eine ältere, elegant gekleidete Dame, aus dem hinteren Wohnzimmer. „Edeltraud, ist das der kleine Nachbarsjunge, von dem du uns erzählt hast? Der sich so böse verletzt hat?“, fragte sie neugierig. „Gertrud, komm doch mal, hier ist der Kleine von gestern“, rief sie nach hinten gewandt.
Gertrud Menzel, eine Frau von stattlicher Statur mit voll ergrautem, kurz geschnittenem Haar, kam langsam in den Flur, grüßte freundlich und forderte den Jungen auf, doch einmal näherzukommen.
Der schaute zu seiner Mutter hoch, ihr Einverständnis abwartend, die seine Hand freigab und ihn nach vorn schob.
„Ich habe da was für dich, mein Kleiner“, sagte Gertrud Menzel und ergriff seine gesunde Hand, um das nur zögernd folgende Kind in ein Nebenzimmer zu ziehen.
Man hörte ein blechernes Klappern und schon erschien der Entführte mit einer Handvoll Schokoladenkekse. Das Kind lächelte verlegen.
„Ach, wie süß!“, rief jetzt die zierliche Hannelore Kiesler, eine erschreckend bleiche Gestalt, die aussah, als würde sie unter einer bösartigen Krankheit leiden. Sie versuchte, das Gesicht des Kleinen zu tätscheln, und kniff ihm dabei in die Wange, woraufhin der erschrocken zurückwich.
Frau Wertheim schaute ein wenig missbilligend auf diese Szene. Ihr wollte es nicht gefallen, dass ihrer Hilfeleistung wegen so viel Aufhebens gemacht wurde. Dabei ließ sie die mit Schokoladenkeksen gefüllte Hand des Kindes nicht aus den Augen.
Die rundliche Gertrud legte ihre dicke Hand auf den etwas klein geratenen Kopf des Kindes, das sie aus seinen kackbraun gesprenkelten Augen fragend anschaute. Sie drehte sich Frau Wertheim zu.
„Edeltraud, können wir unseren Kleinen nicht ein wenig hierbehalten und ihm die Zeit verschönern, wo er doch so verletzt und hilflos ist? Seine Mutter kann dann unbesorgt ihre Angelegenheiten erledigen“, meinte sie, ohne das Einverständnis der Mutter einzuholen, geschweige denn den Kleinen überhaupt zu beachten.
Frau Freitag nutzte sofort die Gelegenheit, um sich erneut in ihrer überschwänglichen Art zu bedanken, als würde man ihr unendlich viel Gutes tun, obwohl über den Vorschlag noch gar nicht entschieden worden war.
„Danke, vielen, vielen Dank“, sagte sie und verschwand augenblicklich, ihrem Kind noch zurufend: „Ich bin bald wieder da, mein Junge.“
Der stand stumm da, wie ein Kalb, das nicht wusste, wo es hingehört, und fing jetzt leise an zu weinen. Mit der verbundenen Hand versuchte er unbeholfen, seine Tränen abzuwischen. Der dicke Verband verdeckte sein halbes Gesicht, was es so grotesk hilflos erscheinen ließ, dass die stattliche Gertrud den Kopf des Kindes tröstend an ihren dicken Bauch presste.
„Nicht weinen, du bist doch ein Junge und die weinen nicht“, flüsterte sie.
Jetzt trat die zierliche Hannelore heran und versuchte, ihre dürren Finger um die Taille des Kindes zu krallen, als wollte auch sie einen Teil der Beute abhaben. „Nicht heulen, mein Süßer.“
Der aber jammerte, durch die Berührung der knochigen Hand erschreckt, noch einmal los, mit dem Erfolg, dass sein Kopf noch fester, noch tröstender an Gertruds Bauch gepresst wurde, was ihm ein wenig den Atem nahm.
Auch Hannelore wollte auf ihre Art noch mehr Trost spenden und griff in seine Weichteile, um ihm verständlich zu machen, dass er ein Junge war, der nicht schwach sein durfte.
Die bedauernswerte Kreatur jaulte aber derart auf, als hätte man einem jungen Hund aus Versehen auf die Pfote getreten. In seiner Not ließ der Junge seine Schokoladenkekse fallen und versuchte vergeblich, sich zu befreien, was zur Folge hatte, dass er sich einnässte.
Frau Wertheim erstarrte, sah den Urin des Kindes wie ein Rinnsal aus der kurzen Hose an dessen Beinen herablaufen, sah die heruntergefallenen Schokoladenkekse auf ihrem Teppich.
„Was macht ihr denn mit dem Jungen?“, protestierte sie leise, als dürfte niemand mitbekommen, was hier stattfand.
Augenblicklich ließen die beiden Frauen von ihm ab, sahen dem breitbeinig, endlos Pinkelnden zu und baten um ein Badetuch.
Der ließ willenlos mit sich geschehen, dass man ihn vollständig entkleidete und wie einen Säugling auf das Handtuch legte.
„Ach, wie süß!“, kreischte Hannelore und ihre Augen funkelten sonderbar. Und sie versuchte, mit einer Ecke des Handtuchs den Wurmfortsatz zwischen den Beinen des Kleinen trocken zu tupfen, dabei drückte sie den Hoden des Kindes ein wenig und sah ihm ins Gesicht.
Der schrie vor Schmerz, wie ein Ferkel quiekend.