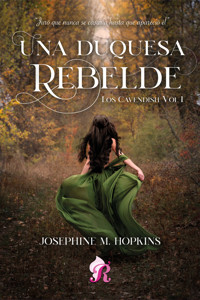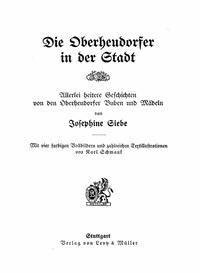0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Ähnliche
Hinweise zur Transkription
Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.
Weitere Hinweise zur Transkription finden sich am Ende des Buches.
Herrn de Charreards deutsche Kinder
Die Geschichte einer Familie
von
Josephine Siebe
Carl Flemming und C. T. Wiskott A.-G.
Berlin
Schwester und Bruder zu eigen
Flemmings Bücher für jung und alt
Herausgegeben von Börries, Freiherrn von Münchhausen
Große Reihe Band 7
1. Kapitel.
»Itze kommense!«
Bubenstimmen gellten laut durch das in der Mittagsglut träge ruhende Dorf. Mädelstimmen tönten nach, waren heller, höher, sie drangen in die Häuser ein und jach erhob sich da und dort lautes Rufen. Fragen und Gegenfragen sprangen von Haus zu Haus, Holzpantoffeln klapperten, Türen, Fenster wurden aufgetan, neugierige Gesichter schauten, und selbst der alte Pfarrer sah müde aus dem Fenster seiner Wohnstube.
Und wieder gellten die Bubenstimmen laut. »Nune biegense um de Ecke!«
Der alte Lemnitzer Karl schrak zusammen in seinem Ofenwinkel, in dem er seine Tage verdrömelte. Verdattert richtete er sich auf. »Sind's Schweden?«
»Niche doch, Vater, die kommen nune nie mehr. Hab nur niche Bange, die Pösener Herrschaft kommt itze gefahren.«
»Die Schweden, die Schweden!« lallte der Alte verzagt. »Da passe du nur druff, die finden wieder her.«
»Es tut dir niemand mehr was!« Frau Katarine Merfen, des Alten verwitwete Tochter, strich mitleidig dem Vater über das verstörte Gesicht. »Se ham uns genug getan.« »Gotte doch ganz genug.« Und einen Augenblick schwankte die große, blonde Frau, und ihre Augen hatten den Schreckensblick von damals, als die Schweden auf »friedlichem« Durchzug in das Dorf gekommen waren. »Itze ist lange Friede,« sagte sie gut zu dem Alten, und wiederholte feierlich: »Friede.«
»Das Wasser vor drei Jahren war 'n Anzeichen, sie kommen wieder,« brummelte der Alte stöhnend. Er war völlig versponnen in das trübe Erleben der Vergangenheit, ihm schimmerte keine Gegenwartshoffnung mehr, kein Tagerleben machte ihn mehr froh.
Die Tochter trat an das Fenster. Draußen auf der Landstraße rollte schwankend, schwerfällig ein Reisewagen daher. Groß war er und ungefüge. Der neue Besitzer des dem Dorfe Bucha nahen Gutes Pösen, Monsieur Anthoine de Charreard, saß darinnen, schlank, vornehm; neben ihm seine junge Frau Sophia Christine.
Es war ein recht zaghaftes Weiberseelchen, was da in einer Ecke des Wagens fast versank. Sophia Christine war nie sonderlich lebhaft gewesen, bedrückt, verschüchtert war sie bisher durch ihre Tage gegangen, aber seitdem ihr Vater, der herzogliche Geheime Rat Ries in Jena ihr stolz den früheren Hofmeister der Herzöge von Weimar, Kammerjunker Anthoine de Charreard, als künftigen Gemahl vorgestellt hatte, war sie ganz verstummt. Aus übergroßer Liebe zu dem Manne, und aus Verwunderung darüber, daß ihr stillverschwiegenes Sehnen Erfüllung gefunden hatte.
Dem schönen Kammerjunker war die zierliche Frau, die da neben ihm im Wagen saß, bisher herzlich gleichgültig gewesen. Er ersehnte Freiheit von dem drückenden Zwang des Hoflebens, ersehnte, Herr auf eigener Scholle zu sein. Darum, nicht um der Frau willen, die er freien sollte, hatte er dem Plan seiner fürstlichen Freundin, die er heimlich Feindin nannte, der Gemahlin des Herzogs Bernhard von Jena zugestimmt. Die Herzogin Marie stammte aus Frankreich wie er, und als er einst die junge Herzogin von Tremouville kennen gelernt, war sie ihm lieb geworden. Das war vergangen, es gelüstete ihn nicht danach, der Narr der übermütigen, hoffärtigen Dame zu sein, und als sie ihm in einer bösen Laune eine Bürgerliche, die liebliche Jungfer Ries zur Gemahlin vorgeschlagen, hatte er ja gesagt. Niemand ahnte ja, wie der schönste Mann von Jena des Treibens müde war, das am Hofe herrschte.
Seit dem Tage, da Gaston de Charreard mit seinem Sohn und seiner Frau in das von Kriegsstürmen durchtoste Deutschland geflüchtet war, weil der hugenottische Edelmann des allmächtigen Richelieus Rache fürchten mußte, hatte der junge Anthoine wenig Ruhe in seinem Leben gehabt. Armut, oft Not, Lagerleben, Hofleben: hierhin und dorthin getrieben war er im Wirrsal der Zeit, bis er endlich durch Vermittlung seines Paten, des Herzogs von Tremouville und Thours, am Hofe zu Weimar Unterkunft als Hofmeister der beiden jüngsten Prinzen gefunden hatte.
Und nun lag die Unruhe hinter ihm und er sollte eingehen in den Frieden, er sollte seine feste Heimat finden. Ein Haus und eine Frau.
»Da sinse!« Aus dem Hause des Hannes Schurks drängten sich vier Kinder. Alle strohblond, rotbäckig; aus aufgerissenen Blauaugen starrten sie den Wagen an, zwei die Finger im Mund, zwei in der Nase. Allen vier Strohköpfchen aber mißlang die Verneigung, zu der Frau Anne-Marie Schurks, die Mutter, sie durch Püffe und halblaute Scheltworte aufforderte, so gründlich, daß die vier untereinander purzelten, als wäre der Sturmwind in sie hineingefahren. Sophia Christine sah es, und ein ganz holdes Lächeln lief über ihr Gesicht, und dies Lächeln sahen die Kindsmutter und Frau Katarine Merfen zu gleicher Zeit, und die Merfin redete in das Zimmer hinein: »Die wird gut, Vater.«
Die Kindsmutter sagte das auch, als sie ihre Vier, die Kleinen sacht, die größeren mit Püffen und Verweisen, wieder auf die Beine stellte. Es redeten viele im Dorf das gleiche Wort mit erleichtertem Herzen. Denn den Buchaer Bauersleuten war es nicht gleichgültig, wer auf Pösen saß. Das Gut war Kirchlehen, und jede zweite Woche mußte der Pfarrer von Bucha in der kleinen Hauskapelle des Gutes Gottesdienst halten. Dagegen hatte kein Buchaer etwas einzuwenden, auch das Hingehen hätten sie gern getan, nur mußte es in Kirchsachen heißen, gleich zu gleich, und weil der letzte Besitzer, der Herr von Nesselrode, nie die kleine Dorfkirche aufgesucht hatte, war man andauernd gekränkt gewesen. Bis dann beim letzten Schwedeneinfall, Anno 1647, die Not so groß wurde, daß in dem übermenschlichen Jammer Gekränktsein und Groll unterging. Den Herrn von Nesselrode hatten sie erschlagen, von sechs Bauernhäusern und einem Dorf, das zu Pösen gehörte, war ein einziger Hof übriggeblieben, und der kleine Buchaer Teich vor dem Pfarrhaus war rot gewesen vom vergossenen Blut. Und dabei hatte kein Einwohner den Durchziehenden sich feindlich gezeigt.
An diese vergangene Not, an all die Hoffnungen, die sich an sein Dasein knüpften, dachte der Herr de Charreard nicht. Der blinzelte träge, schlafumfangen in die helle Mittagssonne hinaus. Seine Frau dagegen sah jedes Haus, jeden Baum und Zaun, jedes Kind auf der Gasse: alles was lief, rannte, flatterte und gackerte. Wie ein Kind freute sie sich an allem Gegenständlichen, verglich alles mit dem dunklen Heimatgäßchen und dem feierlichen steifen Zuhause ohne Mutterwärme. Als sie ein paar Blumen am Wegrand blühen sah, erfaßte sie eine unbändige Lust, diese zu pflücken. Sie beugte sich weit hinaus, dachte, sie möchte dem Kutscher ein Haltegebot zurufen, und dann erschrak sie doch, als plötzlich der Wagen mit einem Ruck anhielt.
Herr de Charreard erwachte jäh aus seinem Halbschlaf. War das Ziel erreicht?
Doch nirgends war ein Haus zu erblicken, und er entsann sich, daß bei einem Ritt, dem einzigen, den er, bei trübem Winterwetter dazu, in die neue Heimat unternommen, der Weg sich tief gesenkt hatte.
Der Kutscher war abgestiegen, er trat an den Wagenschlag und fragte mit einem gutmütigen Klang in der Stimme: »Wollen Gnaden enmal aussteigen?«
»Aussteigen! Mon Dieu, ist Er toll geworden?«
»Ich heeße nich Mongieh, ich heeße Jakob. Und mit dem Aussteigen ist's wegen dem Umfallen. Manchmal fällt er, weil's runner gieht! Un manchmal nicht, wie das so ist!«
»Der Wagen?« Monsieur Anthoine de Charreard krauste die Stirn, und der Kutscher sah ihn bedenklich an. Aber da steckte schon die liebliche Frau den Kopf auf ihrer Sitzseite hinaus und rief mit heller Freude: »Ach ja, gehen!«
Anthoine de Charreard stieg aus, er sah nun auch, daß der Weg steil war; er hatte Altersfurchen, und bergab laufende Wasser hatten tiefe Rinnsale gegraben. Rechts stieg der Berg an, links ging es steil hinab, Wacholderbüsche standen da und dünnstämmige Pappeln. Tiefer sah man in die Kronen alter Linden, zur Seite ein Stück zerfallene Mauer mit Brandspuren, ein grüner Schleier darüber, allerlei liebes, feines Unkraut breitete sich schon über eine zerstörte Wohnstätte.
»Wir müssen gehen, ma chère, der Weg ist nicht agréable.« Herr Anthoine de Charreard half seiner jungen Frau aus dem Wagen, dann reichte er ihr die Fingerspitzen. Sophia Christine legte schüchtern ihre Finger an seine und so standen sie beide, als wollten sie zum Tanz antreten.
Sie merkten es bald, der lehmige Weg voller Schrammen und Risse war kein Tanzboden, drei Schritte, und Herr de Charreard rief unwillig: »Impossible.« Er sah seine junge Frau kummervoll an und sah zu seinem grenzenlosen Erstaunen ein heiteres Glänzen in den schönen Augen. »Blumen, ach Blumen,« rief Sophia Christine kindlich froh. Sie löste ihre Hand rasch aus der des Mannes, raffte ganz flink ihr Kleid zusammen und pflückte ein paar Adonisröschen, eine blaue Glockenblume und wilde Kamillen, die sie zierlich zum Strauße fügte.
Und als hätte ihr das bunte Kraut Schwungkraft gegeben, mit so leichter Anmut schritt sie heiter den Berg abwärts, ihr Fuß fand sicher den Weg, aber auf halber Höhe blieb sie stehen. Sie sah in die grüne blühende Lindenherrlichkeit hinein. Sie atmete den Duft, der schwer und süß die Luft erfüllte, und sah die blühenden Linden umdrängt, umsummt von Hunderten von Bienen. Die feinen Stiele der Blätter erzitterten, so heftig war der Ansturm des fleißigen, kleinen Volkes.
Sophia Christine stieg auf einen Wegstein. Was sie da hörte und sah, war ihr eine fremde Musik, noch nie gesehenes Leben. Wie die kleinen Tiere hin- und herflogen, manche ganz beschwert von gelbem Blütenstaub, wie sie emsig sich in die Blumen einbohrten, das war Arbeit und Mühe. Sophia Christine wußte nicht viel vom Tun der Bienen, aber sie sah den rastlosen Fleiß, und unwillkürlich knüpfte sie ein Band von diesem tätigen Leben zu ihrem Leben hin. Und eine junge, frohe Arbeitsfreude ergriff sie. Sie tat einen Hupfer, landete ein wenig schwankend auf dem Weg und wandte ihr Gesicht jetzt ohne alle Scheu dem vornehmen Gemahl zu und rief: »So möchte ich werden!«
»Wie, Madame? Sie träumen wohl!« Herr Anthoine de Charreard sah zum erstenmal recht die holdselige Anmut seiner jungen Frau, darüber ging ihm seine feierliche Steifheit etwas verloren: er trat neben Sophia Christine, die hurtig wieder den Stein erstieg und ihrem Mann das summende, blühende Sommerwunder der Lindenkronen wies.
Sie standen beide, sahen, wie die Bienen auf und ab flogen, die Blüten sich bogen; dem Herrn de Charreard kam dabei der Gedanke, daß er früher immer an eine vornehme Frau gedacht hatte, die mit ihm zu Hofe gehen sollte. Kein Hausbienchen. Aber nun sah er den Wind in den Locken seiner jungen Frau spielen, er sah ihr frohes Kinderlächeln, und ganz sanft umfaßte er sie, hob sie von dem Stein herunter und sagte: »Wir wollen heimgehen, Madame!«
Und wieder legte Sophia Christine ihre Hand nur lose in die des Mannes und dann gingen sie sacht nebeneinander den Weg abwärts unter den tief schattenden Linden dahin. Bis sich der Weg ein wenig bog und die junge Frau einen hellen Freudenruf ausstieß.
Im Tal lag ein stattliches Anwesen. Freilich das Dach des Wohnhauses und die Ställe waren schadhaft; aber vor dem Haus blühte auch eine mächtige Linde, wilder Wein und Efeu rankten sich an den Mauern hoch, in einem kleinen Terrassengärtchen glühten Rosen; Sonne und Himmelsblau gaben dem Bild Farbe und Freude. Hinter dem Hause stieg ein mit Nußbäumen bepflanzter Berg empor, gegenüber krönte Nadel- und Laubwald die Höhen, und durch das Tälchen rann ein kleiner Bach so heiterschnell wie Kinder laufen.
Sophia Christine dachte an das düstere Haus in Jena, in dem sie an der Seite eines harten Vaters eine freudlose Jugend verlebt hatte. Und hier war Glanz auf Wiesen und Wegen, Glanz auf den Höhen, Glanz über dem Haus. Ein sommerfrohes Summen und Singen erfüllte die Luft, und Herr Anthoine de Charreard sah in den Augen seines Weibes den Widerschein alles Sommerglanzes und da strömte auch ihm aus dem stillen Tal Heimatfrieden entgegen. Jetzt hielt er die Hand seiner Frau nicht mehr, als schritte er mit ihr zum höfischen Tanz, er hielt sie fest umschlossen, und so gingen sie beide schweigend dem Hause zu.
Am Wegende gackerte eine Henne. Goldbraun, behäbig, zehn Küchlein umpiepsten sie. Und Sophia Christine vergaß, daß es für eine Madame de Charreard, Gattin des Kammerjunkers Monsieur Anthoine de Charreard, nicht schicklich war, auf dem Boden zu hocken wie ein Spielkind. Sie kniete nieder, breitete ihr Kleid weit aus und ließ mit einem kinderfrohen Locken Glucke und Küchlein in diesen Hafen laufen. »Und sie gehören uns,« rief die junge Frau mit einem innigen Sington in der Stimme.
»Ja, sie gehören uns, Sophia Christine.« Auch der Mann vergaß den höfischen Umgangston, sein Herz redete, da kam der Name weich und zärtlich heraus. »Doch nun komm, sie erwarten uns am Hause.«
Vor dessen Tür drängte sich ein Häuflein Menschen zusammen. Drei Mägde, die eine ältlich, ein Hofverwalter, und neben dem Knecht standen noch zwei Männer und drei Frauen. Die waren von der jenseitigen Höhe von dem Dorfe Zimmritz gekommen, es waren die letzten Anwohner des einst zu dem Gute gehörigen Dorfes, das die Schweden völlig zerstört hatten. Sie standen hager, gebeugt da, aber wie die junge, liebliche Frau so daherkam, ein Lächeln auf den Lippen, fanden auch sie ein karges Lächeln, war es doch, als wehe ihnen der Sommerwind eine lichte Wolke entgegen.
Und Sophia Christine, die bis daher das schweigsamste Jüngferlein auf der Welt gewesen war, fand warme, gute Worte, als sie in die von Gramlinien durchzogenen Gesichter blickte und die harte Hand des Hofverwalters ihre Rechte umschließen fühlte. In ihrem Herzen sprang ein Quell auf, und eine Anmut kam in Wort und Blick, die das verschüchterte Kind daheim nie besessen hatte. Auch Anthoine de Charreard fühlte Wärme, Freude in sich, auch er, dessen Hochmut einst manchen gekränkt, redete ohne Herablassung, mit heiter sicherer Würde zu den Leuten.
Steife, stelzbeinige, seltsam verschnörkelte Glückwünsche mußten die Beiden aushalten, feierliche Verzierungen waren den Sätzen beigefügt, aber es schwang immer ein guter Unterton mit und die Begrüßung gab beiden Parteien, den neuen Besitzern, den Dienstleuten und Anwohnern, das Gefühl, es wird mit uns zusammenstimmen.
Zuletzt durchzitterte eine ganz leise Ungeduld Sophia Christines Herz. Die galt dem Haus. Das lockte sie, die Kühle, die ihr aus dem weiten Flur entgegenströmte, die geschlossenen Türen, die dicken Mauern, alles hatte einen besonderen Reiz für sie, und sie zog den Mann mit heiterer Schelmerei hinein, als die alte Magd Röse ernsthaft fragte: »Darf ich Gnaden das Haus zeigen?«
»Ach ja, ach ja!« Das Haus ansehen, das eigene Haus, die neue Heimat.
Die Zimmer und Flure waren niedrig, aber geräumig. Nach dem Hof hinaus lagen zwei Zimmer und ein kleiner Festsaal. In dem standen fremd, gar nicht dem Raume sich einfügend, ein paar weißlackierte, mit rotem Damast überzogene Stühle neben einem alten Eichenschrank. Die Stühle hatte die Herzogin Marie gesandt. Den Schrank hatte der Geheime Rat Ries aus dem Nachlaß der alten Frau von Nesselrode erstanden. Die Bilder der letzten Nesselrodes hingen noch an den Wänden, ein paar Zinkkannen standen auf dem Schrank. Ein wunderliches Gemisch von Prunk und Ärmlichkeit bildete auch die Einrichtung der anderen Stuben. Drei, vier neue Stücke, das andere aus dem Nachlaß erstandenes, zum Teil hundert und mehr Jahre altes Hausgerät. Es hatte keine liebevolle Hand Herrn Anthoine de Charreard und seinem jungen Weibe das Heim bereitet. Sie flatterten wirklich wie ein paar verflogene Vögel in ein fremdes Nest, fühlten aber doch rasch die Wärme des Nestes. Und Sophia Christine ging mit der hellen Freude einer ganz jungen Frau durch alle Räume des Hauses. Oben im obern weiten Flur blieben sie vor einem grünen Schrank stehen, er zeigte die Zahl 1618.
»Damals hat's angefangen, das Unglück,« sagte die alte Magd leise, »den hat unsere alte Gnädige mitbekommen, als sie geheiratet hat.«
Sophia Christine strich linde über das Holz, nickte versonnen und fragte: »Wo liegt die Frau begraben?«
»In der Kapelle. Beide.«
Ach ja, es war eine Kapelle im Hause. »Wir wollen hineingehen,« sagte Sophia Christine fromm. Sie faßte nach der Hand des Mannes und ging still neben der alten Beschließerin die Treppe hinab. Vom unteren Flur bog ein schmaler Gang ab. Der führte nach der Kapelle. Die Magd öffnete das schmale Türlein, das nach einer kleinen Empore führte. In der Wand war ein Loch, und das Holzgetäfel schien locker. Die Magd schob es zurück, eine kleine Kammer, fensterlos und muffig, wurde sichtbar. »Darin haben wir alle gelegen, als die Schweden hier waren,« redete die Alte dumpf in die Dunkelheit hinein. »Herregott, Herregott, war das eine Angst! Wenn sie uns gefunden hätten, wär's uns gegangen wie dem Lemnitzer, dem sie Jauche in den Hals gegossen haben, bis er schier verplatzt ist. Unsere alte, gnädige Frau hat den Husten gehabt, da hat sie zum Heine gesagt: ›Mach mich tot, mach mich tot, ich verrate euch sunsten.‹ Wir han ihr'n Bett übergelegt und han gedacht, sie verstickt uns, aber sie ist am Leben geblieben. Der Herr unser Gott hab' sie selig, sie war gut zu Mensch und Vieh.«
Die Rede sank Sophia Christine tief ins Herz. Frommes Bitten quoll in ihr empor: Gott, gib mir auch eine solche Nachrede: »Gut zu Mensch und Vieh.«
Und dann gingen die Eheleute von der Empore hinab in die kleine Kapelle und die Magd ließ sie allein: »Itze müssen die alleine sein mit dem Herrgott,« sagte sie draußen.
Allein mit Gott, sie waren es beide.
Die Kapelle war klein, schmucklos. Ein dürftig ausgestatteter Altar, ein paar welke Kränze an der der Tür gegenüberliegenden Wand, ein paar Bänke zur Seite und an der Decke ein Gottesauge.
Eine Schwalbe flatterte ängstlich hin und her, sie war durch ein kleines, offenstehendes Lukchen an einem der bunten, spitzbogigen Fenster hereingeflattert, huschte ängstlich über Altar und Kanzel hinweg und fand den Ausweg nicht. Da öffnete Sophia Christine die Tür, um die Gefangene hinauszulassen, und ein breiter Strom Sonne floß in die Kapelle. In seinem Glanz knieten Anthoine de Charreard und sein junges Weib vor dem Altar nieder, waren still, und ihre Herzen waren voll Dank.
Hand in Hand traten sie beide aus dem Hause, traten auf den Hof, und da sah Sophia Christine rechts einen losen Zaun, der einen Garten vom Hofe schied, dahinter blühte es rosig, und des Mannes Hand festhaltend, lief sie auf den Zaun zu und rief jauchzend: »Da blühen Rosen, Rosen. Ach wir haben Rosen. Viele Rosen.«
2. Kapitel.
Herr Anthoine de Charreard hatte sich das Leben eines deutschen Gutsherrn sehr viel leichter, viel heiterer und abwechslungsreicher gedacht. Er spürte es bald, Arbeit würde seine Tage ausfüllen, rastlose Arbeit, die ihn frühe rief und ihn bis zum Abend begleitete.
Das Kirchlehen Pösen, einst ein stattlicher Besitz, auf dem die ritterlichen Herren von Scheiding gesessen hatten, war halb verfallen. Die Ställe schadhaft, einer ganz niedergebrannt, zum Dach regnete es herein oder schien die Sonne ins Haus, je nach des Wetters Laune. Vieh stand nur wenig in den Ställen; es waren nur ein paar magere, kümmerliche Tiere, es fehlte an Futter- und Brotgetreide, es fehlte eigentlich an allem. Und wie im Haus und auf dem Hofe, so sah es auch auf den Feldern aus. Vor drei Jahren war in der Gegend eine große Wasserflut niedergegangen, die hatte Schutt und Steine auf die Felder gespült, hatte vernichtet, was in den letzten Jahren nach dem großen Kriege mühsam aufgebaut worden war.
Ein Landsitz für heitere Feste, frohe Gesellschaft war das Gut wahrlich nicht. Es war wie ein Hohn, wenn die junge Hausfrau in dem kleinen Saal, in dem die seidenüberzogenen Stühle standen, auf und ab ging, nachsinnend, womit sie in aller Welt nur in den nächsten Wochen den Tisch bestellen sollte.
Dazu war Herr de Charreard kein Landwirt. Er konnte fechten, reiten, jagen, verstand sich auf die Kriegskunst und konnte zierliche Wortgewinde flechten, wenn es galt, ein Hoffest zu verschönen, doch von Ackerbau und Viehzucht verstand er kein Tipfelchen. Auch fehlte es an Geld, um die Schäden auszubessern. Der Geheime Rat Ries hatte seiner Tochter den Leinenschrank gefüllt, er hatte ihr dürftigen Hausrat mitgegeben und fünfundzwanzig Taler für Not- und Sorgentage, damit meinte er genug getan zu haben.
An einem warmen Sommerabend nun ging ein schweres Gewitter über dem stillen Tal nieder. Sophia Christine verschlief Donner und Blitz, so müde war sie von ungewohnter Arbeit, aber als sachte von der Decke herab ein Rinnsälchen in ihr Bett lief und der Regen dachte, nach dem Hausboden muß es doch noch eine Stube zum Hineinlaufen geben, da weinte die junge Frau bitterlich.
Und Herr Anthoine seufzte und schrieb am nächsten Tag einen beweglichen Bittbrief an seinen Schwiegervater, und Sophia Christine fügte an den hochzuverehrenden, hochgeliebten Herrn Vater die alleruntertänigste Bitte um Hilfe hinzu.
Die Antwort kam bald, sie brachte bittere Enttäuschung.
Der Geheime Rat Ries gedachte sich nochmals zu vermählen mit einer Frau Sibylle von Hellfeld. Diese hatte Sophia Christine schon in deren Kindheit alles gebrannte Herzeleid zugefügt. Er bedauerte sehr, nicht helfen zu können, schrieb aber, er hätte submissest dero Gnaden der Frau Herzogin das Schreiben alleruntertänigst überreicht und allergnädigst Hilfe versprochen bekommen.
Noch am gleichen Tage überbrachte ein reitender Bote dem Herrn de Charreard zweihundert Taler, der Brief dazu war aber so demütigend für den stolzen Herrn, daß dieser das Geld seiner Frau in den Schoß warf und davonrannte. Marie de Tremouville rächte sich dafür, daß Anthoine de Charreard zu stolz gewesen war, ihren Pudel und Hausnarren zu spielen. Sie sandte ihm das Geld wie ein Almosen.
Sophia Christine hörte zitternd den Zorn ihres Mannes toben. Das war nicht mehr der feine, höfliche Herr, und sie spürte zum ersten Mal: sie war nicht seines Stammes.
Und dann verging Stunde um Stunde und Herr Anthoine kehrte nicht heim. Über dem stillen Tal glühte schon die Abendsonne, als Frau Sophia Christine ihren Mann suchen ging. Der Weg führte sie durch den Leutragrund, und dabei gelangte sie an das einzige noch stehende Bauernhaus; auf halbem Wege zum Walde lag es. An dem kleinen Haus verließ die junge Frau der Mut, so allein weiterzugehen in den sinkenden Abend hinaus. Scheu klopfte sie bei den Bauersleuten an, die sie erst einmal flüchtig gesehen hatte.
In der niederen, holzgetäfelten Stube saß der Rabenvater, er las in einer Bibel, und neben ihm saß stille die Rabenmutter und spann.
Die alten Leute wurden nach ihrem Namen so genannt, denn Rabeneltern waren sie, weiß der allmächtige Himmel, nicht gewesen. Nur schwer geprüfte, hart geschlagene, arme Eltern. Drei schöne, blühende Kinder hatten die Soldaten aus Übermut mit fortgeschleppt. Wohin? Niemand wußte es. Nur den Jüngsten, der damals ein Büblein von fünf Jahren gewesen war, den hatte die Mutter im Hühnerstall bergen können.
»Herr erhöre mein Gebet und vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen,« tönte die Stimme des Bauern drinnen in der dämmrigen Stube.
Und draußen am Fenster stand holdselig wie der Frühling Sophia Christine in ihrer Herzensnot, und ihr zages Klopfen wurde noch einmal von dem dröhnenden Wort übertönt: »Erlöse mich um deiner Gerechtigkeit willen!«
»O du lieber Heiland,« rief innen plötzlich die Rabenmutter, »da steht ja die gnädigste Frau vom Schlosse und weint.«
Ja, Sophia Christine weinte, und es erschien ihr auf einmal ganz selbstverständlich, daß sie all ihre Not der alten, schlichten Frau in den Schoß schüttete, so wie ein Kind sein zerbrochenes Spielzeug: »Nun hilf mir du.«
Sophia Christine war nach dem frühen Tode ihrer Mutter ein einsames Kind gewesen und durch die Strenge des Vaters ein verschüchtertes Kind geworden. Ihr Seelchen war immer verschlossen geblieben, nie hatte eine Frau sie mütterlich im Arm gehalten, wie es jetzt die alte Bäuerin tat. Und der Madame de Charreard kam das gar nicht seltsamlich vor, daß sie der alten Bäuerin ihre große, große Angst um den Gemahl verriet.
Die Rabeneltern hatten ihn reiten sehen, und der große, blonde Bursche, der als Büblein im Hühnerstall gesteckt hatte, erbot sich, gleich nach dem Walde zu gehen. Vielleicht fand er die Pferdespur.
»Ich gehe mit,« rief Sophia Christine in ihrer großen Herzensangst.
»Das is niche gut. Der Christian setzt seine Beine schneller, das schafft besser.« Der Rat der Frau war verständig, und die Jüngere fügte sich der klugen Rede. Sie ließ sich in die Stube führen, und wie sie den alten Bauer am Tisch stehen sah, seine Hände fest über der Bibel gefaltet, und er sie mit seinen eigentümlich hellen Falkenaugen ansah, bat sie unwillkürlich: »Ach, lest doch weiter.« Sie schluckte an ihren Tränen.