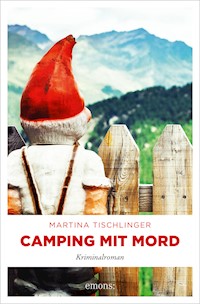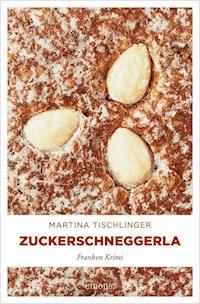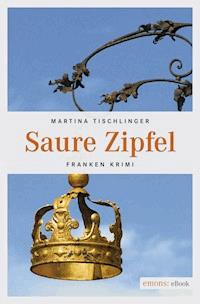Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Scheuerer
- Sprache: Deutsch
Frankens schamlosester Heiratsschwindler wird im Landgasthof »Zum Storchen« erstochen aufgefunden. Gebrochene Herzen pflastern seinen Weg, jedes mit einem Mordmotiv. Die »Storchen«-Wirtinnen Kreszentia, Cäcilia und Kathi sind fassungslos. Doch sind sie wirklich so harmlos? Kommissar Scheuerer hat so seine Zweifel. Die raubeinige und trinkfeste Kreszentia Bätz, die ein Faible für Leichenschmäuse hat, muss wohl oder übel eingreifen und zieht alle Register, die ihr beim Schnüffeln dienlich sein können. Prompt deckt sie pikante Geheimnisse auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Tischlinger
Herzbizzln
Franken-Krimi
Zum Buch
Geld futsch, Herz gebrochen! G’schlampert führen sich manche Hotelgäste auf! Was die alles in ihren Zimmern vergessen! Doch das schlägt nun wirklich dem Fass den Boden aus: In einem der Hotelbetten liegt eine Leiche. Die drei Wirtinnen – Großmutter, Mutter und Enkelin – des gepflegten Landgasthofs »Zum Storchen« im fränkischen Knoblauchsland sind schockiert. Noch dazu will keine von ihnen den Toten gekannt haben. Der kauzige Hauptkommissar Lutz Scheuerer von der Kripo Nürnberg hat da seine Zweifel. Was soll er denn dann dort zu suchen gehabt haben? Freiwillig ist Amadeus Riedinger nicht aus dem Leben geschieden – er wurde ermordet. Und der ausgebuffte Heiratsschwindler hinterlässt reihenweise abgezockte Frauen mit gebrochenen Herzen. Die raubeinige und trinkfeste Wirtin Kreszentia Bätz fürchtet, dass sogar ihre fesche Tochter ihm auf den Leim gekrochen ist. Durch ihre geliebten TV-Krimi-Serien versiert im Umgang mit dem Verbrechen, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ihre Methoden dabei sind: sehr speziell!
Martina Tischlinger lebt mit ihrem Mann in Nürnberg. Gelegentlich füllt sich ihr Heim mit erstaunlichen Charakteren: schrille, schräge, urige, auch fiese Typen, die sich schon mal am Frühstückstisch ins Gespräch einmischen, als seien sie aus Fleisch und Blut. Die Autorin ist selbst oft verblüfft, welches Eigenleben ihre Figuren auf dem Papier entwickeln. Sie sammelt starke Sätze, verzaubernde Wörter und Szenen, um sich damit in das Abenteuer, ein Buch zu schreiben, zu stürzen. Die Leidenschaft fürs Schreiben hat sie früh für sich entdeckt. Mehrere Franken-Krimis und Komödien wurden bereits veröffentlicht, auch unter einem Pseudonym. Außerdem sind zahlreiche Weihnachtsgeschichten und Kurzgeschichten erschienen, in Mundart auch beim Bayerischen Rundfunk.
Impressum
„Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)“
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Bildagentur-o / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7532-0
Zitat
Für Gerhard
Prolog
So, jetzt bin ich also tot.
Ich persönlich natürlich nicht. Ich bin nicht über den Jordan gegangen oder habe den Löffel abgegeben und ich schaue auch nicht die Radieschen von unten an. Und der Sensenmann, Herrschaften, kratzt mich nicht die Bohne!
Denn ich bin Amadeus Riedingers Seele.
Okay, sein Herz, das Hirn und die Lunge haben ihre Funktion eingestellt, und Sie können sich denken, die Sie hier an meinem Schicksal teilhaben, das ist für den Blutkreislauf und für den sonstigen komplizierten menschlichen Organismus gar nicht gesund. Daher hieß es für mein Fleisch und Blut: letzte Haltestelle Exitus.
Im Prinzip betrifft mich als Amadeus Riedingers Spirit dieses Drama nur peripher. Aber faszinierend ist der Vorgang doch, und während ich hier oben auf dem Kleiderschrank eines Hotelzimmers in einem fränkischen Kaff namens Gieglasreuth hocke und der Dinge harre, die da kommen mögen, betrachte ich meine fleischliche Hülle, die unter mir auf dem Hotelzimmerbett immer bleicher und starrer wird.
Ich war ein schöner Mann, ein bildschöner Mann. Man sagte mir eine gewisse Ähnlichkeit mit Franco Nero nach, als er schon etwas reifer war. Auf eine leichte Sonnenbräune habe ich immer Wert gelegt, auf einen flachen Bauch sowieso. Meinen gepflegten Dreitagebart und die grauen Schläfen fanden die Damen besonders apart.
Nicht einmal fünfundfünfzig bin ich geworden. Und wenn man mich noch länger hier herumliegen lässt, fange ich allmählich an zu müffeln. Wo mich doch immer der Hauch eines teuren Aftershaves umgeben hat.
Freiwillig bin ich nicht aus dem Leben geschieden. Das können Sie mir glauben!
Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was mir alles widerfahren ist, bis ich dieses erbärmliche Stadium erreicht habe …
Nur unter uns: Ich wurde ermordet!
Natürlich nicht ich, denn ich bin unsterblich. Ich bin ja, wie bereits gesagt, Amadeus Riedingers Seele, die hier festhockt und sich langweilt. Das bloß, weil immer noch niemand das Fenster aufgemacht hat und ich in ein anderes Lebewesen übergehen oder in die Unendlichkeit entfleuchen kann.
Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht allzu sehr erschrocken, weil plötzlich etwas mit den Sinnen nicht Fassbares zu Ihnen spricht. Mit dem Begriff »Seele« ist es ja so eine Sache. Ein großer Anteil der Lebenden zweifelt nicht an meiner Existenz, die anderen halten mich für einen Irrglauben. Dabei bin ich so wichtig! Ich bin die Sammlung der Emotionen eines Geschöpfes. Der Geist. Die unsterbliche Essenz. Das, was einen Menschen ausmacht.
Aber okay, ich bin sowieso nicht eine von den Nullachtfünfzehn-Seelen, ich bin von der cleveren und wissbegierigen Sorte. Ich werde mich nicht einfach damit zufriedengeben, dass der Haufen Organe, Haut und Knochen unter mir in Gottes kühle Erde eingebuddelt wird. Ich werde nicht »Und tschüss!« sagen und mich vom Acker machen.
Ich möchte mein garstig inszeniertes Ableben schon aufgeklärt wissen. Ja, ich brenne darauf zu erfahren, ob die Irdischen darauf kommen, wer mir respektive dem Menschen Amadeus Riedinger das Lebenslicht ausgeblasen hat.
Die Person hat bei ihrer Flucht zwar die Hotelzimmertür einen winzigen Spalt offen stehen lassen, woraufhin ich ihr nach meiner ersten Verblüffung über das Geschehene auf den Gang gefolgt und dann durch den Gasthof gezischt bin. Aber weder die weißhaarige Alte, die brabbelnd in der Küche rohe Klöße formte, noch das junge Ding mit dem Temperament einer Schlaftablette, die mir begegnet sind, hatten von dem grausigen Mord etwas mitbekommen. Und da beschloss ich, die Reinkarnation noch eine Weile zu verschieben.
Amadeus’ Mord aufzuklären, wird nicht einfach werden. Denn Menschen, die ihn lieber heute als morgen in einem Holzsarg oder einer Urne gesehen hätten, gibt es einige. Denn er war ein Hallodri.
»Hallo! Hört mich denn keiner!« Aber ich rufe vergeblich. Seelen haben kein Mundwerk. Seelen teilen sich subtiler mit.
Kapitel 1
Fanny Zieber latschte den Flur entlang, als drückte ihr die Last des Lebens auf die Füße. Es lag nicht daran, dass es Donnerstagvormittag war und sie von den acht belegten Hotelzimmern des Landgasthofs »Zum Storchen« im fränkischen Knoblauchsland erst bei drei geputzt und die Betten gemacht hatte. Nein, sie war gefrustet, weil es gerade mal Mitte Juni war und sie schon wieder pleite.
Es war wirklich zum Heulen. Sie hatte den Friseurbesuch vor dem Blick in den Geldbeutel geplant. Aber sie brauchte einen neuen Look, unbedingt. Leider hatte der Dorffriseur Preise wie ein Nobelcoiffeur in der Stadt, das nahm Fanny jedenfalls an, ohne jedoch je in so einem edlen Salon gewesen zu sein. Einen Hunderter verlangte der Kevin Pachtlmeyr fürs Färben, Schneiden und Föhnen. Hundert Euro! Und ihre Haare waren ja noch nicht einmal lang. Für diesen Batzen Geld musste Fanny viele Kloschüsseln putzen und angeschweißelte Betten aufschütteln oder neu beziehen. Über die Entsorgung so manch ekliger und anstößiger Fremdkörper zwischen den Kissen mochte Fanny erst gar nicht reden.
Und g’schlampert waren manche Menschen, das konnte sich einer gar nicht vorstellen, der kein Zimmermädchen war.
Eine neue Haarfarbe wäre echt cool gewesen. Ein krasses Pink statt ihres faden Pippi-Langstrumpf-Rotblonds würde den Blick vielleicht davon ablenken, dass sie gebaut war wie ein Strich in der Landschaft. Besonders, weil der Tobias am Samstag auch in den Club kommen wollte. Bisher hatte er sie nicht einmal mit dem Arsch angeschaut, aber voll aufgebrezelt und ohne Büstenhalter, vielleicht biss der heiße Schnuckel ja dann endlich an.
Fanny stieg vom zweiten Stockwerk eines höher ins Dachgeschoss. Dort befanden sich die drei Komfortzimmer und ganz hinten rechts die Wäschekammer mit den frischen Handtüchern und der gebügelten Bettwäsche für die Gästezimmer.
Links davon war ES. Das Zimmer Nummer dreizehn.
Schauerliche Geschichten rankten sich darum. Fanny versuchte, sie auszublenden, wenn sie das Zimmer turnusmäßig einmal wöchentlich putzen musste. Dies, obwohl es nur im äußersten Notfall vermietet wurde!
Manchmal, wenn Fanny gegen die sinnlose Zimmerreinigung des unbenutzten Raumes rebellierte, frischte die Senior-Chefin, Kreszentia Bätz, von allen Zenta gerufen, den Grund für diese absurde Regel für das Spatzenhirn auf: »Das Zimmer vom alten ›Storchen‹-Wirt wird ordentlich hergerichtet, um seinen Geist, der dort spukt, nicht zu verärgern. Außerdem wärd g’macht, wos iich soach!«
Seinen Geist nicht verärgern … ph! Fanny verdrehte bei solchen stussigen Aussagen schon aus reiner Gewohnheit die Augen. Aber eigentlich durfte man sich bei der Zenta über nichts mehr wundern, die war in ihren Augen steinalt, da war Aberglaube anscheinend etwas Selbstverständliches.
Doch der Tag wurde nicht besser. Fanny hatte das Ende des mit taubengrauem Teppichboden ausgelegten Ganges noch nicht erreicht, da wurden ihre Augen wie magisch vom »Spukzimmer« angezogen. Ihr gefror der Nacken vor Schreck. Du heiliger Bimbam, die Tür zu Zimmer dreizehn stand auf! Aber warum das denn? Es war doch gar nicht an einen Gast vergeben. Das Zimmermädchen kaute an ihren kurzen Fingernägeln. Genau genommen war die Zimmertür angelehnt, was »geschlossen« ziemlich nahekam. Direkt offen war sie also nicht, resümierte sie in wundersamer Logik. Am besten ignorierte sie ihre Feststellung.
Aber dann siegte doch die Neugier. Zaghaft schob sie die Zimmertür auf und riss sogleich die Hand wieder zurück.
Uih! Da lag ja einer auf dem Bett! Sofort meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Hatte sie womöglich ihren Arbeitsplan nicht richtig gelesen? War Zimmer dreizehn besetzt worden? Hätte sie es längst reinigen und die Handtücher wechseln müssen? Wenn es saublöd lief, bereits gestern schon? Das würde wieder Zoff mit der Zenta geben! Aber sie, Fanny, war dieses Mal nicht schuld, echt nicht. Für die Zimmerreservierungen war generell Cäcilia Bätz, Zentas Tochter, zuständig. Nicht jedoch für Zimmer dreizehn. Für das Spukzimmer fühlte sich die alte Wirtin persönlich verantwortlich. Fanny hätte ja rasch nachfragen können, aber ein Schmarrfon kam für die Zenta überhaupt nicht infrage. Schmarrfons, wie Smartphones aus ihrem Munde klangen, waren was für Backfische, die nach der Schule Langeweile hatten.
Backfische nach der Schule, hä? Begriffe zog die alte Wirtin manchmal aus der Schublade, das ging auf keine Kuhhaut!
Ein Ausspruch, der im Übrigen auch aus Zentas Jargon stammte.
Es kam häufiger vor, dass Fanny und sie verbal haarscharf aneinander vorbeischlitterten, im Großen und Ganzen mochten sie sich aber doch ganz gut leiden. Die schräge Alte und die Junge mit den Hirnfürzen.
Wie die Katze um die Maus strich Fanny um die unbesetzte Rezeption. Zimmerschlüssel dreizehn baumelte definitiv nicht am Schlüsselbrett, logisch, er steckte wahrscheinlich oben in der Tür. Unterdessen hatte Fanny ihren Arbeitsplan studiert, von Zimmer dreizehn stand darin kein Wort. Aber hatte Zenta gestern nicht was gemurmelt, von einem Gast, der … Ja, was war das nur gewesen, was die Zenta gebrabbelt hatte? Da die alte »Storchen«-Wirtin oft auch mit sich selbst redete, hatte Fanny auf Durchzug gestellt. Woher sollte sie wissen, ob das Gesagte für sie in ihrer Funktion als Zimmermädchen bestimmt war oder die Senior-Chefin ein Selbstgespräch führte?
Aber wenn sie, Fanny, doch aus Schusseligkeit eine Anweisung überhört hatte? Und der Gast sich über die feine Staubschicht auf den Möbeln und die Armee an Wollmäusen unterm Bett gewundert oder gar gegraust hatte? Fannys Herz begann, ungut zu klopfen.
Es wäre nämlich nicht die erste Anweisung gewesen, die sie »überhört« hatte. Wie eben die eiserne, dass Zimmer dreizehn grundsätzlich einmal wöchentlich in Schuss zu bringen war, egal ob es von einem Gast bewohnt wurde oder nicht. Durch die stille Arbeitsverweigerung schindete sie nämlich locker eine halbe Stunde mehr Freizeit heraus. Fanny bezweifelte überdies, dass es gewerkschaftlich geregelt war, ob ein Zimmermädchen ein Zimmer putzen musste, in dem es spukte.
Nervös knibbelte sie an dem Nagel ihres Zeigefingers. Blind und dumm stellen war nicht wirklich die Lösung des Problems. Und wäre es ihr nicht ausdrücklich verboten worden, sich in den Computer an der Rezeption einzuloggen, sie hätte flink nachschauen können, ob Zimmer dreizehn kurzfristig von einem neuen Gast gebucht worden war. Was dachten die »Storchen«-Wirtinnen eigentlich von ihr? Als ob Fanny heimlich surfen würde während der Arbeit, und wenn, dafür hatte sie doch ihr Handy. Von den Hotelcomputern hatte sie dennoch die Pfoten zu lassen.
Ich sollte zumindest melden, dass da einer in Zimmer dreizehn liegt und pennt, überlegte sie weiter. In sich gekehrt zog sie den Staublappen aus der Schürze ihres Zimmermädchenkleides, schüttelte ihn aus und steckte ihn wieder ein. Aber an wen sollte sie sich wenden? Die Zenta stand in der Küche und rollte die Kniedla für den Mittagstisch. Beim Formen der rohen Klöße sprach man sie besser nicht an, sofern man nicht eine scharfzüngige Bemerkung kassieren wollte. Wenn sich die alte Wirtin aus dem Hotelbetrieb auch ein Stück weit zurückgezogen hatte, das Küchenzepter nahm man ihr so schnell nicht aus der Hand und schon gar nicht den Kloßteig. Und Cäcilia, die Cilli, brütete im Büro gleich hinter der Rezeption über Schreibkram. Die Bürotür stand zwar offen, und zwar richtig offen, das hieß aber nicht, dass man sie stören durfte. Nein, das war kein guter Zeitpunkt, einer der beiden Frauen mit einer – wahrscheinlich ja doch nur – Nichtigkeit auf den Geist zu gehen, entschied Fanny und verließ die Rezeption. Sie würde noch einmal einen Blick in die Nummer dreizehn werfen.
Wenn ich Glück habe, ist der Mann fort und das Zimmer wieder leer, hoffte sie und bog schwungvoll um die Ecke, um ins Treppenhaus zu gelangen. Und prallte gegen eine Männerbrust.
»Obachd!«, schimpfte sie, unsicher, ob sie sich selbst meinte oder den jungen Burschen, in den sie gerannt war.
Einen verdammt gut aussehenden jungen Burschen. Was Fanny sah, würde sie um den Schlaf bringen. Voll der Hammer, der Typ hatte einen Body wie ein amerikanischer Baseball-Spieler. Justin Bieber war ein Schlaffi gegen ihn. Und Wahnsinn, diese Augen! Seitlich waren seine dunklen Haare kurz rasiert, ein paar Strähnen fielen ihm verwegen ins Gesicht. Er lächelte sie an, und wie. Halleluja! Wann hatte Fanny zum letzten Mal geküsst?
»Servus«, stammelte sie.
»Servus«, erwiderte er frech grinsend und in Fannys Unterleib explodierte eine Atombombe.
»Ich bin die Fanny.«
»Mats. Mein Name ist Mats.«
Schlagartig wurden in Fannys Gehirn sämtliche Funktionen logischen und rationalen Denkens heruntergefahren und ihr Geist und Körper schalteten in den Verliebtsein-Modus um. Ihre Organe spielten verrückt. Ihr Herz raste, in ihrem Magen bitzelte es, ihre Sinne waren vernebelt. In Fanny tobte ein wahres Gefühlschaos.
Mats tippte mit der Fingerspitze auf ihr Namensschild, das an ihrem hellblauen Dienstkleid steckte. »Bist du hier angestellt?«
»Ich bin Zimmermädchen hier. Und du?«
Nervös, weil sich ihre Augen an seinem Mund festgesaugt hatten, rettete sich Mats aus der etwas peinlichen Situation mit: »Äh, ich, na ja, ich such ’nen Job. Braucht ihr wen in der Küche?«
»Da musst du die Zenta fragen, die macht gerade die Kniedla.« Sie deutete vage Richtung Küche. Und als der Traumboy Anstalten machte, in die falsche Richtung zu gehen, also zum Hotelausgang, nahm sie ihn forsch bei der Hand und zog ihn in den Flur, der zur Küche führte. Wenn sie schon so einen Prinzen an der Angel hatte, ließ sie ihn doch nicht so einfach wieder los. Wohl spürte sie einen zarten Widerstand, aber schließlich folgte Mats ihr doch. Von Fanny ein wenig überrumpelt fragte er: »Sag mal, musst du denn nicht arbeiten?«
Prompt zuckte sie, so urplötzlich aus der rosa Wolke gerissen, zusammen. Arbeit?
»Ach ja! Meinen Job hätte ich jetzt beinahe vergessen«, kicherte Fanny laut. Dann drängte sich ihr unversehens der Schläfer in Zimmer Nummer dreizehn wieder in den Sinn und kratzte an ihrer guten Laune. Wenn sie Mats darum bat, vielleicht würde er sie begleiten, rauf in das gruselige Zimmer.
Gerade wollte sie sich zu der Frage durchringen, da hörte sie die Cäcilia rufen: »Bist du das, Fanny? Bist du fertig mit den Zimmern?«
Unglaublich, wie konnte ihre Chefin sie von hier aus bis in ihr Büro hinter der Rezeption hören?
»Jaaa, gleiiich«, krähte das Zimmermädchen genervt.
Mats zwinkerte ihr zu. »Lass dich nicht stören. Die Küche finde ich auch allein. Wir können uns ja später treffen.« Schon federte er davon.
Und Fanny hätte ihn so gerne behalten.
Wie beschwipst setzte sie ihren Weg fort. Doch hoppla, was lag denn da? Das Zimmermädchen ging in die Hocke. Manche Hotelgäste waren wirklich Ferkel, überall warfen sie ihren Müll hin. Und wer räumte ihn weg? Sie, die Fanny. Sie wollte gerade in den mit Blümchen bedruckten, leicht siffigen Einkaufsbeutel gucken, da rief die Cilli erneut nach ihr.
»Du weißt schon, dass mittags die neuen Gäste anreisen?«
»Jaaa!«
Nach Mats ging Fannys Arbeitsmoral völlig vor die Hunde. So ein toller Typ wollte sie daten! Noch dazu, wo er ein Stück älter war als sie. Fanny schätzte Mats auf Mitte zwanzig, sie war vor einem halben Jahr gerade erst volljährig geworden. Bestimmt hatte er Megaerfahrung in allem. In allem!
Nichtsdestotrotz war da immer noch der Mann in Zimmer dreizehn. Sie konnte unmöglich einfach darüber hinwegsehen, dass sie vielleicht doch versemmelt hatte, das Zimmer zu reinigen.
Der Schokoladenriegel, den sie hastig im Personalumkleideraum verschlungen hatte, war nur ein kurzes Seelenpflaster gewesen. Sie musste sich der unangenehmen Sache endlich stellen. Und egal, was sie auch machte, es war bestimmt falsch.
Die Hotelzimmertür war wie zuvor angelehnt. Fanny fasste sich ein Herz und drückte sie ganz auf. Das Bild wirkte unverändert. Der Schläfer lag in voller Montur, dunkelgrauer Anzug, weißes Hemd und Krawatte, rücklings auf der Bettdecke. Die Schuhe hatte er ausgezogen, was Fanny sehr löblich fand. Seine Hände ruhten auf seinem Bauch.
Fanny räusperte sich. Doch der Mann wachte nicht auf. Sie räusperte sich nachdrücklicher. Nichts. So tief konnte der doch nicht pennen, Mensch! Es herrschte eine seltsam düstere Stimmung in dem Raum. Mutig wagte sie ein paar Schritte auf das Bett zu.
Das Zimmer ist wirklich verflucht, züngelte es in ihrem Kopf. Mit ihrem Aberglauben liegt die Zenta wohl doch nicht so daneben.
Der Mann hatte ein attraktives Gesicht, obwohl er alt war, bestimmt vierzig oder fünfzig. Wäre er nur nicht so ungesund bleich gewesen. Ein seltsamer Stich fuhr ihr in den Leib. Wo hatte sie den Mann schon einmal gesehen?
Es war so still, dass Fanny glaubte, das Blut in ihren Adern rauschen zu hören.
Wieso hebt und senkt sein Brustkorb sich denn nicht, fragte sie sich entsetzt. Und auf einmal war ihr klar: Der Mann schlief nicht, der Mann war tot!
Amadeus’ Seele
Na endlich! Das hat ja gedauert.
Jaaa, Mädel, du kannst deinen Augen schon trauen, ich bin wirklich mausetot.
Ein Temperamentsbolzen scheint das Zimmermädchen nicht zu sein. Ich vermute zumindest, dass sie ein Zimmermädchen ist, schon weil sie wie als Beweismittel für ihre Arbeit sporadisch ein Staubtuch aus ihrer Schürzentasche hervorzaubert, ohne es jedoch über eine Oberfläche zu schieben. Staub scheint nicht ihr größter Feind zu sein. Wirklich Leben ist erst in sie geschossen, als ihr der Kerl in Jeans und Turnschuhen in die Arme gelaufen ist.
Seit gefühlt fünf Minuten steht sie nun da und knetet die Finger.
Ruf Hilfe, Mädel! Oder die Bullen, versuche ich ihr zu suggerieren.
Denn wenn sie nicht bald zu Potte kommt, erwäge ich doch, die Biege zu machen. Dann geht es up, up and away.
Aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich nicht wirklich etwas vor. Und wenn ich mich jetzt Richtung Nirwana aufmache, erfahre ich womöglich nie, ob Amadeus’ Mörder geschnappt wurde.
Aber vielleicht war es ja auch eine Mörderin? Ich als Amadeus’ Seele weiß es natürlich, aber ich mache mir da mal ein kleines Späßchen daraus, Sie auf die Folter zu spannen. Vielleicht sind Sie ja cleverer als die Polizei und bekommen schneller heraus, wer ihn auf dem Gewissen hat.
Kapitel 2
Zenta rollte Klöße. Es war ein sinnlicher Akt. Ein Ballett der Hände.
Sie griff mit den Fingerspitzen in die Schüssel und entnahm dem Kloßteig eine knapp faustgroße Portion, drückte mit den Fingerknöcheln eine Mulde in die Mitte, in die sie exakt vier Stück geröstetes Weißbrot gab, und rollte schließlich den noch unförmigen Klumpen geschickt zwischen den Händen, bis aus ihm nach sechs geschmeidigen Umdrehungen ein kugelrunder Kloß entstanden war. Den ließ sie sacht ins köchelnde Salzwasser gleiten. Griff sogleich wieder in den Teig. Alles in einem gleichmäßigen Rhythmus. Schließlich drehte Zenta das Gas herunter und die nach unten gesunkenen rohen Klöße durften nun gut zwanzig Minuten ziehen. Sobald die »Kniedla«, wie Klöße und Knödel im Fränkischen hießen, an der Wasseroberfläche des Kochtopfs tanzten, waren sie fertig zum Servieren.
Ein paar Tausend Kniedla hatte die Zenta in ihrem Leben schon gerollt, mit Weißbrotbröggerla gefüllt und zum Tanzen gebracht, und manchmal kam es ihr vor, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Hatte sie womöglich ihr Leben mit Kniedla-Rollen vergeudet?
Aber nein, solche Gedanken ließ Zenta Bätz erst gar nicht an sich herankommen, sie war zufrieden mit dem, was ihr der Herrgott zugeteilt hatte.
Ein halbwegs passables Witwendasein nach fünfzig guten Ehejahren mit dem Karl und ein lebenslängliches Recht, das Kommando in ihrer geliebten Küche der »Storchen«-Wirtschaft zu behalten, die seit dem Umbau »Landgasthof Zum Storchen« hieß, waren genug, um dankbar zu sein. Das Haus war 1901 erbaut worden, und Zenta hätte die schlichte Pension mit den fünf einfachen Zimmern gereicht. Doch nach dem Tod ihres Karl vor vier Jahren hatte ihre Tochter Größeres mit dem alteingesessenen Gasthof mit langer Familientradition geplant. Cäcilia hatte die Hälfte des »Storchen« geerbt und somit ein Mitspracherecht. Und so verkehrt waren die Modernisierung und Vergrößerung des Gastronomiebetriebs sowie der Umbau des teilweise denkmalgeschützten Fachwerkhauses, um die Hotelzimmerzahl auf zwölf Standard- und drei Komfortzimmer zu erhöhen, ja auch nicht gewesen. Im Nachhinein gesehen, wenn die monatelange Baustelle auch eine enorme Belastung für die Vierundsiebzigjährige gewesen war. Die Fetzen waren zwischen Mutter und Tochter geflogen! Sogar ihre Enkelin, die Katharina, hatte sich eingemischt, meist um die Wogen zu glätten. Doch jetzt herrschte wieder Frieden zwischen den drei Bätz-Frauen.
Bätz-Männer? Kreszentia war, wie bereits erwähnt, Witwe. Cilli geschieden und seitdem mit dem Landgasthof verheiratet. Und die Enkelin, die neunundzwanzigjährige Katharina, war noch auf der Suche nach dem richtigen Herzblatt. Derzeit schwirrte Giuseppe um sie herum, sehr zum Leidwesen von Cäcilia, die sich einen Hotelier als Schwiegersohn vorstellte und keinen Pizzabäcker.
Das letzte Kniedla schwuppte in den Topf. Zenta hielt die Hände unter den laufenden Wasserhahn und rieb sie sich hernach an einem Geschirrhandtuch trocken. Ein eigenartiges Glucksen ließ sie aufhorchen. Das kam doch nicht etwa aus dem Kniedlas-Topf? Da war das Geräusch schon wieder. Zenta fuhr herum. In der Küchentür stand Fanny, das Zimmermädchen, und schnappte wie ein Aischgründer Spiegelkarpfen nach Luft, gleichzeitig entkamen ihr diese seltsamen Laute.
Zenta ging auf das käsige Mädchen zu und nahm es in den mütterlichen Arm. »Wos is denn los, Maadla?«
Fannys Mund öffnete und schloss sich. Worte entströmten ihm nicht. Sie riss den Arm hoch und fuchtelte mit dem Zeigefinger herum. Die Augen der Senior-Wirtin folgten dem Finger. »Ich versteh dich ned. Komm, setz dich hin.«
Sie drückte das völlig verwirrte Mädchen auf einen Küchenstuhl. Was wohl das Zieberla wieder im Gedärm drückte? Es konnte doch bloß ein Mannsbild dahinterstecken. Zenta war auch einmal jung gewesen, aber das Gefühl von Liebeskummer lag so tief in der Vergangenheit begraben, und seitdem waren wahrlich andere Schicksalsschläge über sie hinweggerollt, dass ihr das Herzeleid wegen eines Mannes nurmehr wie ein vergänglicher Wadenkrampf in Erinnerung war.
»Ja, was is denn mit meinem Zieberla los? Glaub mers, mei Maadla, wenn der Kerl ned der Richtige für dich war, steht bald der nächste vor der Tür.« Ihren schmunzelnden Mund ränderten kleine Runzeln. Zenta hatte ein volles Gesicht und von der Landluft gefärbte rosige Wangen, aber mit jedem Lebensjahr waren auch neue Falten dazugekommen. Jahrelanges Training hatte ihr zu einer ausgeprägten Mimik verholfen und sie konnte beeindruckend die Stirn rümpfen. Damit hatte sie schon manchen Maulaffen spontan zum Schweigen gebracht.
Den Kosenamen hatte Fanny Zieber weg, obwohl sie kaum an ein Küken, an ein Zieberla, wie die gelben flauschigen Vogelbabys im Fränkischen genannt wurden, erinnerte. Fanny war lang, mager und knochig, dennoch bot sich die Verniedlichung ihres Familiennamens Zieber in Zieberla natürlich nur so an. Sie benahm sich mitunter genauso drollig wie ein frisch geschlüpftes Vögelchen und wackelte Zenta mit ruhelos zwitscherndem Schnabel hinterher.
Es war ein viel zu herrliches Wortspiel, um es nicht auszunutzen, fand Zenta.
»Im Zimmer dreizehn liegt ein Toter!« Endlich hatte das Zimmermädchen seine Sprache wiedergefunden.
»Wieso?«, fragte Zenta völlig unlogisch und Fanny zuckte mit den Schultern.
»Wer?«, krächzte die Alte, bei der die Schocknachricht anscheinend zeitverzögert ins Bewusstsein tröpfelte.
»Keine Ahnung! Aber er liegt da und schnauft nimmer!«
Zentas Augen wanderten zu den Kniedla im leicht dampfenden Kochtopf. Maike, die Küchenhilfe, bestückte Beilagensalate und nahm nichts um sich herum wahr. Zenta drehte vorsichtshalber das Gas ab. »Hopp!«, sagte sie und marschierte los.
Fanny rührte sich nicht von der Stelle. Offenbar wollte sie sich den Gestorbenen nicht noch einmal antun. Doch Zenta gab ihr mit einem weit ausholenden Armschlenker zu verstehen, dass sie sich in Bewegung setzen sollte.
»Was hast du denn im Zimmer dreizehn zu schaffen gehabt? Das wird doch immer montags geputzt«, stellte die alte »Storchen«-Wirtin klar und war bereits außer Atem, da hatten sie noch nicht einmal den Treppenaufgang erreicht. Der Landgasthof verfügte zwar über einen Aufzug, der war aber den Hotelgästen vorbehalten. Dass ihr Herz so kräftig wummerte, machte Zenta doch ein wenig Sorgen. Oder lag es an dem, was sie womöglich erwartete?
»Die Tür stand offen, und da bin ich rein«, erklärte Fanny, während sie ihr maulig hinterherstapfte und mäßig ein Gähnen unterdrückte.
Zenta zögerte vor der Zimmertür, kratzte sich am Kopf. Durch den Wasserdunst in der Küche kringelten sich ihre grau durchzogenen Haare. Dann klopfte sie energisch an und betrat das Zimmer.
»Da«, sagte Fanny. »Da liegt er.«
»Das sehe ich auch.« Zenta umrundete das Bett. Sie kniff die Augen zusammen und betrachtete den Mann. Schüttelte den Kopf und fischte eine Lesebrille aus ihrer Kittelschürze.
»Und?«, fragte Fanny und hielt schön Abstand von den beiden.
Beherzt fühlte Zenta den Puls des Mannes. »Tot.«
»Gell, sag ich doch.«
Noch das Handgelenk der Leiche im Griff, hob Zenta ihren Arm und deutete damit zur Hotelzimmertür. »Geh und hol meine Tochter!«
Fanny stürmte in Cäcilia Bätz’ Büro. Cilli wollte das Zimmermädchen schon anschnauzen, doch Fanny war schneller: »Wir haben einen Toten im Zimmer dreizehn. Ich soll Sie holen, sagt Ihre Mutter.«
Cilli zog die Hände von der Computertastatur weg und nahm Augenkontakt mit Fanny auf. »Was denn für einen Toten?«
»Eine Leiche. Eine tote.«
»Leichen sind immer tot, was redest du denn für einen Schmarrn daher?«
Fanny trippelte ungeduldig von einem Bein aufs andere, es sah so aus, als müsste sie dringend aufs Klo. Warum musste die Wirtin immer so erbsenzählerisch sein?
»Oben im Zimmer dreizehn, da liegt ein toter Mann. Ich hab den gefunden und Ihre Mutter geholt. Und die sagt, Sie sollen kommen.« Aber pronto, hätte Fanny zu gerne noch angefügt, schluckte es aber hinunter.
Cilli fuhr hoch und machte eine ähnliche Armbewegung wie vorhin ihre Mutter, um Fanny hinauszuschicken. Das Zimmermädchen wetzte durchs Treppenhaus hinter ihr her. Doch vor der offenen Hotelzimmertür stoppte Cäcilia unerwartet und Fanny lief auf sie auf, schubste dadurch ihre Chefin ins Zimmer.
»Ach du liebe Zeit!« Mehr brachte Cilli nicht heraus.
»Was machen wir denn mit ihm?«, fragte Zenta und nahm gelassen die Finger aus der Jacketttasche des Mannes, wischte sie sich aber mit gerümpfter Nase an ihrer dunkelblauen Kittelschürze ab. »Geld und Papiere hat er nicht einstecken.«
»Wie? Was machen wir mit ihm? Mama! Du hast ihn doch nicht etwa gefilzt?« Cilli war vor Aufregung ganz fleckig im Gesicht geworden.
»Ja, ich muss doch wissen, wer er ist.«
Zögerlich trat Cilli näher an das Bett und riss die Augen auf. »Aber wieso …?« Sie verschluckte sich, musste husten, brachte nur mühsam heraus: »Das Zimmer ist doch gar nicht vermietet.«
Fanny atmete erleichtert auf. Dem Stempel »Sündenbock« auf der Stirn war sie anscheinend entkommen.
»Jedenfalls hatte er den Zimmerschlüssel, schau hin, er steckt im Türschloss.«
Cilli kam plötzlich ins Trudeln und fing sich mit der Hand gerade noch am hölzernen Bettpfosten ab. »Der Kreislauf. Noch nichts gegessen«, entschuldigte sie ihren Schwächeanfall.
Zenta zog eine Augenbraue hoch, zum Zieberla sagte sie: »Du hast doch ein Handy, ruf die Polizei.«
Fanny erstarrte.
»Du hängst doch sowieso dauernd an deinem Schmarrfon, also, ruf die 110!«
»Wieso ich? Was soll ich denen denn sagen?«, nölte Fanny und versteckte wie ein kleines Mädchen die Hände hinter ihrem Rücken.
»Ich mach das«, half Cilli ihr aus der Patsche und verließ das Zimmer, um den toten Mann nicht länger anschauen zu müssen.
Draußen auf dem Flur lehnte sie sich gegen die Wand und atmete mit geschlossenen Augen tief durch. Sie fuhr sich durch das schwungvoll geföhnte, kinnlange, blonde Haar. Als sie Fanny dicht neben sich spürte, holte sie ihr Handy aus der verdeckten Rocktasche ihres modernen Dirndls und wählte die Nummer der Einsatzzentrale der Polizei.
»Die schicken einen Streifenwagen vorbei«, sagte sie schließlich und ging übers Treppenhaus und den Empfangsbereich des Gasthofs in ihr Büro. Fanny immer an ihren Fersen. Das Zimmermädchen zuppelte nervös an ihren Fingernägeln herum. »Warum, denken Sie, ist der Mann bei uns gestorben?«
Cilli setzte sich hinter ihren Schreibtisch. Das Büro war nicht sehr groß, eine überschaubare Besuchersitzgruppe und der gebogene Schreibtisch füllten den meisten Platz aus, dafür hatte sie einen beglückenden Ausblick auf eine Wiese, die bunt getupft durch lauter Wildblumen hinter dem Gasthof lag. »Wenn ich das wüsste, Fanny. Er war ja nicht einmal ein Gast«, sagte sie tonlos und blickte ins Nirgendwo.
Fanny erledigte das Reinigen der restlichen Zimmer im Hau-Ruck-Verfahren, denn sie konnte jede freie Minute brauchen. Niemand würde sich heute wirklich für funkelnde Badezimmerarmaturen und glänzende Fliesen interessieren. Durch den Leichenfund stand der Landgasthof kopf. Wen von den Hotelgästen würde es jucken, wenn sie mit dem Schrubber nur mal kurz die Runde machte und nicht hinter jedem Staubkorn einzeln her war, so hoffte sie jedenfalls. Die Kissen schüttelte sie rasch auf und zog die Zudecken glatt. Sie betätigte einmal großzügig die Klospülung, Hauptsache, eine neue Klopapierrolle hing in der Halterung. Dann betrachtete sie sich im Spiegel und machte ein Duck-Face.
Was für einen Dusel sie doch gehabt hatte! Gerade als sie das Büro ihrer Chefin verlassen hatte, um sich im Personalumkleideraum eine weitere Nascherei aus ihrem Rucksack zu holen, kreuzte Mats erneut ihren Weg. Die Frau in der Küche habe ihn fortgeschickt, berichtete er. Der »Storch« brauche keinen Küchenjungen.
Wahrscheinlich hatte Zenta den Ärmsten in ihrer fränkisch-charmanten Art angebellt. Fanny konnte sich das grantige Gesicht der alten Wirtin glatt vorstellen. Beim Kniedlamachen durfte sie niemand von der Seite anquatschen!
Mats sei anschließend noch durch den Landgasthof gestromert und habe ihn gerade verlassen wollen, da habe sie, Fanny, ihn aufgegabelt.
Das Zimmermädchen strahlte bei dieser Rückblende, dass ihr die Backen wehtaten.
So ein Glück aber auch! Wenn das nicht Schicksal war. Stell sich einer das vor, hätte der Zufall nicht seine Finger im Spiel gehabt, womöglich hätte sie Mats nie wiedergesehen. Und hätte Fanny nicht so fix geschaltet, er wäre sofort wieder abgedüst. Was war er nur so huschig und hibbelig wie auf Speed oder auf der Flucht? Doch dann hatte sie ihm von dieser un-glaub-li-chen Story erzählt: Sie, Fanny Zieber, hatte tatsächlich eine Leiche in einem der Hotelzimmer gefunden! So etwas kannte man doch sonst nur aus dem Fernsehen. Mats war auch ganz von den Socken gewesen.
Aber das Beste war – taterata: Später würden sie sich drüben in Luigis Pizzeria treffen! Ein Date in einer Pizzeria war zwar ein wenig old fashioned, aber mehr gab es in dem Kaff ja nicht. Kein Kino, keine coole Bar, von einem Club lag Gieglasreuth Lichtjahre entfernt. Starbucks? Pustekuchen! Das einzige Café am Ort war das Stehcafé der Bäckerei Hudelmeyer, und die ließen um achtzehn Uhr die Rollos herunter. Außerdem hatten dort die Wände Ohren. Vielmehr hatte die Bäckersfrau, die Hudelmeyerin, die Anneliese, besonders große, wenn es um das Aufschnappen von Neuigkeiten in Gieglasreuth ging. Der Tratsch wanderte bei ihr schneller über den Ladentisch als die backfrischen Kaisersemmeln, Brezeln und Bamberger Hörnchen.
Klar hätten sie sich auch in Nürnberg ins Nachtleben stürzen können, wo er bei seinen Eltern wohnte. Aber unter der Woche »einen draufmachen«, da zog Fanny nicht mit. Mats nahm das Leben viel, viel lockerer, jobbte mal hier, mal da. Wollte sich noch nicht festlegen. Dass er in Zentas Küche glücklich geworden wäre, bezweifelte Fanny. Doch Mats hatte für die Zukunft sowieso viel geilere Pläne. »Ich verdiene mir nur ein bisschen Kohle, bis ich mich auf die Reise mache, vielleicht diesmal Thailand«, hatte er fernwehgeplagt erzählt. Mats war nämlich ein Weltenbummler. Fanny fand ihn einfach SO cool!
Kapitel 3
Unterdessen waberte der Duft von Schweinshaxen und Wiener Schnitzeln aus Zentas Küche, floss wie ein Geist aus dem Küchenfenster und schaute sich in der Gegend um. Sogar die nahe liegenden Hotelzimmer bis ins Dachgeschoss kamen in den Genuss. Denn die alte Wirtin hatte vorhin das Fenster in Zimmer dreizehn gekippt, damit »die Seele des Verstorbenen entweichen« konnte.
Auch Polizeiobermeister Ludwig Gerndl bekam von dem leckeren Lüftchen etwas ab. Gerndl, der unter dem Bett nach der Geldbörse und den Papieren des Toten gesucht hatte, rappelte sich hoch und schnupperte geradezu andächtig.
Nachdem der Streifenpolizist und sein Kollege, der Huber Max, den Leichnam und das Hotelzimmer ordnungsgemäß in Augenschein genommen hatten, entschieden sie abschließend, die Kriminalpolizei müsse hinzugezogen werden.
Gerndl quälte sich nach wie vor. Ob die Zeit für ein anständiges Mittagessen ausreichte, bis die von der Kripo aus Nürnberg eintrafen? Die alltäglichen Mettwurst-Brote von daheim oder das gierig verschlungene Leberkäsweggla to go vom Metzger konnten nicht mit dem konkurrieren, was da Sinnliches in das Hotelzimmer strömte und über dem kalten Leichnam wie eine Dunstwolke stehen blieb. Ein Wunder, dass der bedauernswerte Bursche nicht wieder die Augen aufklappte.
Doch dann meldete sich Gerndls Pflichtbewusstsein. Er konnte sich unmöglich seelenruhig in die Wirtsstube hocken und die Wampe vollschlagen, während droben im Hotelzimmer eine Leiche lag.
Und so verabschiedete er sich vom Verspachteln einer deftigen Schweinshaxn, den köstlichen Geruch trug er weiterhin beharrlich in seiner Nase mit sich.
Der Streifenwagen vor dem Landgasthof zog natürlich die neugierigen Blicke der Gieglasreuther auf sich, die Cäcilia eisern ignorierte. Manche von den besonders Schaulustigen flanierten regelrecht vor dem »Storchen« auf und ab. Cilli sah sie sehr wohl von der Rezeption aus, doch sie tat so, als sei sie mit einer hochwichtigen Aufgabe am Computer beschäftigt.
Mit ihren Hotel- und Restaurantgästen verfuhr sie freilich nicht dergleichen. Wacker schiffte sie sich mit einer Notlüge durch deren besorgte Anfragen hindurch. »Ein Gast hat einen Schwächeanfall erlitten«, behauptete die Wirtin. »Da der Herr keine Papiere bei sich hat, haben wir die Polizei gerufen. Mögen S’ einen Schnaps?« Sie hatte sich extra eine Flasche Obstler und Gläser aus der Gaststube an die Rezeption bringen lassen.
Die meisten ließen sich mit einem Gratis-Stamperla ablenken, und fragte doch einer weiter, goss die Wirtin rasch nach. Sie selbst hätte gut und gerne auch einen Doppelten vertragen. Doch eine Schnapsfahne konnte sie sich schlecht erlauben. Die Kriminalpolizei musste jeden Augenblick eintreffen und sie wollte einen seriösen Eindruck machen. Was ihr beim Eintreffen der beiden, einem älteren, etwas skurril wirkenden Mann und einer Frau Mitte dreißig, durchaus gelang. Cilli hatte sich umgezogen und ihr »Feiertagsdirndl« ausgewählt. In dem himmelblauen Dirndl mit der grünen Schürze und der weißen Bluse mit den Puffärmeln sah sie wie einem Katalog für Trachtenmoden entliehen aus. Privat bevorzugte sie fesche Kleider und enge Röcke, und auch im Ort sah man fränkische Tracht nur noch zu Festlichkeiten. Aber Folklore kam halt gut an bei den Hotelgästen. Ihr zu Berge stehendes Haar, das ihr Entsetzen über den toten Mann im »Storchen« widerspiegelte, hatte sich nur durch eine Haarspray-Wolke fixieren lassen und thronte nun etwas starr auf ihrem Haupt.
Eigentlich hätte sie die Leute vom Polizeipräsidium Mittelfranken am liebsten auf der Straße vor dem Landgasthof abgepasst und heimlich durch den Lieferanteneingang ins Haus geschmuggelt, aber bis Cilli reagieren konnte, standen die schon vor der Rezeption.
»Ich bin Hauptkommissar Lutz Scheuerer von der Kripo Nürnberg, meine Kollegin ist Kriminalkommissarin Eva Leineweber«, stellte er sie vor.
»Cäcilia Bätz, ich leite den Landgasthof zusammen mit meiner Mutter, die allerdings im Moment in der Küche zu tun hat.« Sie gaben sich die Hand.
»Zeigen Sie uns bitte zunächst, wo sich der Tote befindet«, bat der Kripomann höflich und die Wirtin lotste Scheuerer und Leineweber in den Aufzug. Dort herrschte das typische betretene Fahrstuhl-Schweigen. Jeder bohrte mit den Augen Löcher in eine andere Wand. Es war wohl auch nicht üblich, bei einem Leichenfund nett und unverbindlich zu plaudern. Und für den Einstieg in die Befragung einer Zeugin eignete sich eine enge Aufzugkabine ohne beruhigende Musik auch wirklich nicht besonders.
Der Hauptkommissar war ein bisschen, na ja, anders, fand Cäcilia. Nicht etwa, dass sie – wie womöglich ihre Mutter – Horst Tappert oder Erik Ode erwartet hätte. Aber einen Kriminaler um die sechzig, der eine olivgrüne Kniebundhose, derbe Schnürschuhe und ein luftiges Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln trug, verblüffte sie doch. Den Vogel schossen der breitkrempige Hut und das blau-weiße Schnupftuch ab, das er sich um den Hals geknotet hatte. In diesem Aufzug hätte man ihn fürwahr getarnt als Hotelgast auf Wanderurlaub undercover in den Landgasthof einschleusen können. Nur seine rastlos jeden Winkel prüfenden Augen ließen auf einen wachsamen Ermittler schließen.
Kommissarin Leineweber war mit der schwarzen Jeans und der einfarbigen Bluse unter einer leichten Jacke erfrischend normal gekleidet und strahlte eine gesunde Sportlichkeit aus. Ihr Mund war malerisch geschwungen, nur Lächeln erlaubte sie ihm nicht.
Die Beamten lösten die Streifenpolizisten vor dem Hotelzimmer ab. Gerndl informierte sie darüber, dass der Tote weder seinen Ausweis noch sonstige Legitimationspapiere bei sich hatte, auch kein Handy.
»Das ist interessant«, stellte Scheuerer fest. »Ob da jemand die Identität des Mannes verschleiern wollte?«
»Ein sinnloser Versuch, wir finden doch heraus, wer der Tote ist«, erwiderte die Kommissarin lapidar und bat die uniformierten Kollegen: »Sagt ihr bitte dem Leichenbeschauer und auch den Kollegen vom Erkennungsdienst, sobald die eintreffen, Bescheid, wo der Leichnam ist.«
Als Cäcilia ihr ins Zimmer dreizehn folgen wollte, wies die Kommissarin sie dezent mit einer Handbewegung zurück auf den Flur. Unnötig, dachte Cilli. Meine Hautschuppen, Haare und Fingerabdrücke habe ich längst darin verteilt.
Wie auch Scheuerer zog die Kommissarin Einweg-Gummihandschuhe an und streifte sich Plastiküberzüge über die Sneakers, dann trat sie pietätvoll an das Bett und zu dem Toten. Cilli lugte ihnen neugierig nach.
»Wo sind denn die Schuhe von dem Mann?«, fragte Hauptkommissar Scheuerer an sie gerichtet und ging flugs auf die Knie, um unter das Bett zu schauen. Außer einer Wollmaus holte er nichts hervor.
»Fanny«, knurrte Cilli leise, und etwas lauter entschuldigte sie die Schlamperei: »Das Zimmer wird nicht vermietet.«
»Ja wieso denn nicht?«, fragte Scheuerer und neigte fragend den Kopf.
»Zu klein, zu wenig Licht, außerdem scheuen sich die Gäste vor der Nummer dreizehn«, behauptete die Wirtin.
Der Hauptkommissar streckte die Arme von sich und drehte sich einmal im Kreis. »Mit Verlaub, unser Büro im Polizeipräsidium ist nicht halb so groß und der Blick auf den Kastanienbaum ist prächtig. Und die Nummer dreizehn? Für manche ist die Dreizehn eine Glückszahl, aber bitte. Nun frage ich mich aber, wenn Sie sagen, das Zimmer wird nicht vermietet, was suchte der Mann denn dann in diesem Bett? Und wie ist sein Name?«
Cäcilia räusperte einen Kloß weg. Das wurde ja immer peinlicher. In dem Moment trampelte gefühlt eine Armee bestehend aus klumpfüßigen Elefanten die Treppe hoch, so hörte sich das näher kommende dumpfe Gepolter jedenfalls an. Ungebremst walzte eines der Rüsseltiere an Cilli vorbei. Eva Leineweber konnte sich nur durch einen Hopser zur Seite retten.
»Grüß Gott! Bätz!«, plärrte Zenta in den Raum. Es sollte bloß keiner auf die Idee kommen, dass sie sich von der Staatsgewalt einschüchtern ließ. Sie hatte nichts zu verbergen. Außerdem war es zur Hälfte ihr Wirtshaus und darin hatte sie das Sagen.
»Meine Mutter«, sagte Cilli in scharfem Ton. »Das sind Hauptkommissar Scheuerer und Frau Kommissarin Leineweber.« Und als Zenta frech wie Oskar schnurstracks auf den Hauptkommissar zustiefelte, wies ihre Tochter sie zurecht: »Die Polizei möchte nicht, dass wir das Zimmer betreten, Mama.«
»So?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Scheuerer betrachtete die alte Frau halb neugierig, halb amüsiert. Sie hatte wohl rasch eine saubere Kittelschürze übergezogen, man sah es an den korrekten Bügelfalten, aber auch daran, dass sie falsch zugeknöpft war und ein Teil der Schürze unten länger war als der andere. Für einen Blick in den Spiegel hatte es offenbar nicht gereicht. Noch dazu schien das Kleidungsstück aus einer Zeit zu stammen, in der die resolute Wirtin noch nicht XXL trug, denn der Stoff spannte sich straff über ihren Bauch.
Cilli schluckte einen Kommentar zum schrägen Outfit ihrer Mutter hinunter. Ihre Hand würde sie nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht pure Absicht war. Kreszentia Bätz neigte dazu, Menschen, die sie nicht kannte, etwas auf den Arm zu nehmen. Besonders, wenn sie ihr Mittagsseidla bereits intus hatte.
»Gut, dass Sie gekommen sind, Frau Bätz. Dann können Sie mir vielleicht verraten, wer der Tote ist?«, fragte Scheuerer sie. Die alte Wirtin kam, ohne auf den Protest der Kommissarin zu achten, noch näher und senkte das Haupt über die Leiche. Sie kniff die Augen zusammen und bewegte ihren Kopf, als würde sie den Leichnam scannen.
Wenn sie nun auch noch an ihm riecht, bringe ich sie um, grollte ihre Tochter still in sich hinein und hüstelte. Vielleicht verstand ihre Mutter ja das Signal. Doch die rieb sich mit der runzeligen Hand über die Stirn, schüttelte den Kopf. »Hm. Hmmm«, machte sie und studierte den Toten aufs Neue.
»Mutter!«
»Was denn?«
»Was tust du da? Wir haben doch vorhin schon festgestellt, dass wir den Mann nicht kennen.«
Zenta tat überrascht. »Ach ja?«
»Was aber macht er dann in Ihrem Hotelzimmer?«, fragte die Kommissarin, die sich weniger über die Posse amüsierte als ihr Kollege, der fasziniert das Schauspiel der Alten verfolgte. Eva Leineweber ließ sich nicht gerne verschaukeln. Hier ging es um einen Todesfall und die Todesursache galt es noch zu ergründen.
Scheuerer legte der alten Wirtin die Hände auf die Schultern und dirigierte sie sanft zur Seite. »Pardon«, sagte er und widmete sich der Leiche. Vorsichtig schob er einen Finger unter das Jackett-Revers des Toten und hob es leicht an.
»Wissen Sie, wo seine Schuhe sind?«, fragte er wie nebenbei und schnalzte bei dem, was er unter dem Anzugjackett sah, mit der Zunge. »Blut. Es ist Blut auf seinem Hemd. Der Mann hat aus einer Wunde geblutet.«
»Igitt, pfui Deifl!«, entfuhr es der Zenta, obwohl sie dies vorhin bereits selbst hatte feststellen müssen.
»Mama, pst!«
In die Kommissarin fuhr Leben. »Wo bleibt denn der Erkennungsdienst?« Zu den Bätz-Frauen sagte sie unmissverständlich: »Darf ich Sie bitten, unten zu warten. Wir kommen nach.«
Die Leiche, der Schock, die Polizei im Haus, Cäcilia war so angespannt, dass sie, als ihre Mutter und sie unten an der Rezeption ankamen, über Zentas Eskapade plötzlich lauthals lachen musste. Es war wie eine Befreiung. »Du bist mir vielleicht eine Marke.«
»Ph!«, machte Zenta. »Die brauchen mir nichts vormachen, ich schau mir jede Folge von den Rosenheim-Cops an, ich weiß, wie es bei der Polizei abläuft. Und was ist das denn überhaupt für ein wunderlicher Mensch, der mit seiner Wanderhose und dem zerknautschten Hut?«
»Na du brauchst gerade was sagen, wie schaust du denn aus?«
Zenta blickte an sich hinab. »Allmääächd!«
»Ja, Allmächd!« Ein einziger Vorwurf.
Zenta schlurfte ohne weiteren Kommentar in ihre Küche.
Cäcilia bezog Stellung hinter der Rezeption, die nicht durchgehend besetzt war. Sie saß gleich im Büro nebenan und hörte, wenn Gäste, der Briefträger oder Vertreter, die ihr erstklassigen Frankenwein, nachhaltige Bio-Bettwäsche oder computergesteuerte Küchenmaschinen schmackhaft machen wollten, den Eingangsbereich betraten. Üblicherweise langten die Stammgäste über die Theke und nahmen ihren Zimmerschlüssel selbst vom Schlüsselbrett oder trugen ihn ständig bei sich. Warum war ihr nicht aufgefallen, dass Nummer dreizehn fehlte? Wie lange war der Schlüssel schon fort? Was ihr aber am meisten im Magen lag, war die Person, die ihn unerlaubt an sich genommen hatte.
Kapitel 4
Kreszentia griff sich den Flaschenöffner aus der Küchenschublade und ließ den Kronkorken vom Bier ploppen. Er rollte unter den Edelstahlspülschrank. Maike, die junge Küchenhilfe, die ein sperriges Küchenbrett schrubbte, reckte nur kurz den Kopf, fuhr dann aber mit ihrer Arbeit fort. Beikoch Steffen, der, einen Sack Kartoffeln geschultert, soeben in die altgediente Küche geschlurft kam, reagierte überhaupt nicht. Einen gesunden Bierdurst hatte der Vierundzwanzigjährige schließlich auch.
Die Sonne warf ihr kräftiges Licht durch die offenen Fenster. Irgendein Vogelvieh zwitscherte auf dem Ast einer der knorrigen Kastanien vor dem Haus, als gäbe es für sein lautstarkes Konzert etwas umsonst.
Zenta goss das Helle in ein Glas, nahm einen ordentlichen Zug und wischte sich mit dem Handrücken den Bierschaum von der Oberlippe. Böse Zungen behaupteten, die alte Wirtin köpfte ihr erstes Seidla Bier gewohnheitsgemäß noch vor dem Mittagsläuten. Durch den entsetzlichen Vorfall hatte sie diesen Zeitpunkt verpasst und genoss das kühle Hopfengetränk jetzt umso mehr, was sie mit einem zufriedenen »Ahhh!« quittierte.
Aus gesundheitlicher Warte war Bier ja Medizin. Immerhin beruhigte Hopfen, und nach dem grausigen Leichenfund hatte sie einen Nervenbalsam dringend notwendig.
Eine namenlose Leiche im Zimmer des Gehenkten! Immer schon hatte sie es geahnt, ein Zimmer mit einer so schaurigen Vergangenheit konnte nur Ungemach bringen. Im Jahr 1929 hatte der alte Wirt seinem Leben darin ein Ende gesetzt. Da war der »Storch« noch ein einfaches Gasthaus, wenn damals auch mit einem Storchennest auf dem Giebel, gewesen und das Dachgeschoss nur der Wäscheboden mit einer Abstellkammer. Seine Frau hatte ihn an einem Seil von der Decke baumelnd darin aufgefunden. Verschuldet seien sie gewesen, sagte man. Der Feigling hatte sich einfach aus dem Staub gemacht und Eheweib und drei Kinder zurückgelassen, so Zentas ungerührte Meinung.
Und jetzt wieder ein Toter. Nachdenklich nahm die alte Wirtin einen weiteren Schluck. Noch dazu log ihre Tochter. Cäcilia kannte den Mann, davon war sie überzeugt. Käsbleich war die Cilli geworden, als sie der Leiche ins Gesicht geschaut hatte. War der Tote ihr heimlicher Liebhaber gewesen? Aber das hätte sie doch gemerkt, sie, ihre Mutter! War die Cilli in ihr altes Fahrwasser geraten? Schon als Teenager hatte sie sich hinter ihrem Rücken mit langhaarigen Taugenichtsen in Lederjacken und auf Mopeds getroffen. Da war der Tote auf Zimmer dreizehn schon ein anderes Kaliber.
»Bevor den der Rochus geholt hat, muss er ein adretter Mensch gewesen sein«, rekapitulierte Zenta vor sich hinmurmelnd.
»Welcher Rochus?«, wagte Maike zu fragen, das tropfende Küchenbrett fest in den Händen, als würde sie sich daran festhalten. Natürlich war es auch bis zu ihr vorgedrungen, dass man eine Leiche im Landgasthof gefunden hatte. Seitdem traute sie sich nicht einmal mehr allein aufs Klo.
Zenta hatte gar nicht gemerkt, dass sie laut gedacht hatte. »Kennst du die Redensart denn nicht? ›Wennsd ned Obachd gibst, hullt dich der Rochus.‹ Die stammt noch aus der Zeit der Pestepidemie. Der Schutzpatron der Pestkranken hieß Rochus, nach ihm ist auch der Nürnberger Rochusfriedhof benannt, wo die armen Teufel begraben wurden, die die Pest dahingerafft hat.«
»Ich bin nicht von Nürnberg, ich kumm aus Giegerlasreid«, erwiderte die Küchenhilfe kleinlaut. Das Gespräch wurde ja immer gruseliger. Die Pest! Maike wedelte mit dem Küchenbrett kreuz und quer durch die Luft. Wohl ihre ureigene Art abzutrocknen.
»Ej! Du machst mich ja badscherdnass«, maulte Steffen, der ein paar Tropfen abgekriegt hatte.
Zenta indes freute sich. Das Küchenmädchen hatte ihren Geburtsort ausgesprochen, wie es die Älteren der Knoblauchsländer Bauern taten: »Giegerlasreid«. Sie setzte das Bierglas an. Da schoss ihr ein blitzartiger Gedanke durch den Kopf und sie zuckte dermaßen zusammen, dass ihr das Bier über die Oberlippe schwappte. Rasch wischte sie sich mit einem Zipfel ihrer Schürze über den Mund.
Was, wenn ihre Tochter ein Stelldichein mit dem Mann gehabt und ihm beim Schnackseln der Schlag getroffen hatte? Aber nein, die Cilli würde doch nie im verrufenen Spukzimmer schnackseln! Sie trank erneut mit glucksenden Geräuschen. In ihrem Hirn wüteten abenteuerliche Szenen, die sie aber nicht über ihre Schamgrenze hinweg zu Ende fantasierte. Der alten Wirtin war warm geworden. Sie pustete sich in den Ausschnitt ihrer kurzärmeligen Bluse, die sie unter der Kittelschürze trug, und fing den Blick von Maike auf. Die Küchenhilfe schaute verschämt aus der Wäsche. Was denn? Sie hatte doch hoffentlich nicht wieder hörbar vor sich hin gewispert?
Mit einem knappen, aber unmissverständlichen Kopfnicken bedeutete sie Maike, dass sie sich wieder mit der Spüle und ihrer Aufgabe beschäftigen solle, und versank erneut in Grübelei. Warum hatte sich der Mann ausgerechnet in dieses Zimmer einquartiert? Um auszuschlafen wohl kaum. Die Cäcilia darauf anzusprechen, war im Moment keine gute Idee, entschied Zenta. Cilli war viel zu sehr von der Rolle. Und dann waren noch immer die Polizisten im Haus, und die ging es einen Hosenknopf an, was sich privat im »Storchen« abspielte. Sie würde mit der Aussprache auf einen günstigeren Moment warten.
Gedankenversunken ging sie ans Küchenfenster und reckte neugierig den Kopf hinaus. Ein seltsamer Kerl um die fünfzig lief draußen planlos hin und her, als würde er etwas suchen. Der Mann machte, wie viele zu lang geratene Menschen, einen Buckel, vermutlich, um einerseits kleiner zu wirken und andererseits nicht überall mit dem Kopf anzustoßen. Das gab dem Fremden etwas Schrulliges, auch weil er so verdruckst umherschaute. Seine Nase war ebenso beeindruckend groß, geradezu geschaffen, um an gefüllten Cognacgläsern zu schnuppern oder sie neugierig in fremde Angelegenheiten zu stecken.
»Was is denn des für a Vuugl?«, sagte Zenta vor sich hin. Plötzlich hob der Vogel den Finger und lächelte zufrieden. Was sich dabei für ein riesiges Gebiss offenbarte! Dann schritt er zielstrebig ums Haus auf den Haupteingang des Landgasthofes zu und entschwand Zentas Blickfeld. Die knallte ihr so gut wie leer gesüffeltes Bierglas aufs Fensterbrett und huschte erstaunlich flink aus der Küche. Entschlossen marschierte sie den Flur entlang. Bevor sie die Rezeption erreichte, stoppte sie und lauschte, ohne aus ihrer Deckung herauszukommen. Cilli sprach mit einem Mann, ganz sicher mit dem Kauz. Und die Brocken, die sie aufschnappte, gefielen ihr gar nicht. Mehrfach kam das Wort »Küche« in dem Gespräch vor, andere Gesprächsfetzen waren »mediterran«, »regional« und das böse Wort »vegan«, das nach Zentas Geschmack in einer fränkischen Küche nichts zu suchen hatte.
Was wollte der Kerl? Plante er eine Feier im »Storchen« und Zenta sollte das Menü dafür zubereiten? Aber warum sprach dann niemand mit der Küchenchefin, bitte schön?
Sie spähte um die Ecke. Zentas Nacken knirschte, so sehr verrenkte sie den Hals, doch anders konnte sie ihn nicht sehen. Wenn sie schon nicht alles von dem bösartigen Gespräch hören konnte, sapperlot! Der Kauz nickte unterwürfig bei jedem Wort, das Cilli sagte, und zeigte sein schreckliches Kau-Panorama. Cilli indes hielt ihre Freude über das Gespräch nicht zurück. Ihre Wangen hatten sich rosig gefärbt und sie klopfte die Fingerspitzen aneinander. Was führten die zwei im Schilde, ihre Tochter, die Geheimniskrämerin, und die grausliche Gestalt aus der Geisterbahn?