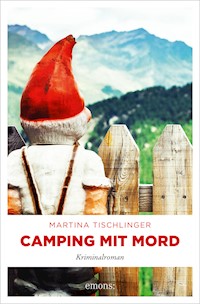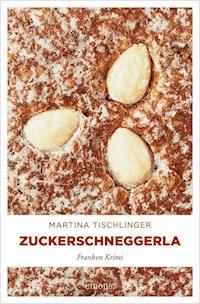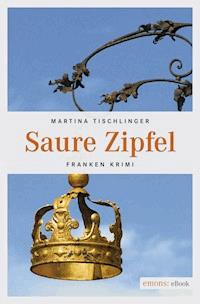Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Paula Frischkes
- Sprache: Deutsch
Was für ein Schock für das verschlafene Nest Kleinmichlgsees in Mittelfranken! Im Wald werden drei Leichen gefunden - zwei Frauen und ein Mann im Minirock. Geht ein unheimlicher Serienmörder um? Die ehrgeizige Kriminalkommissarin Paula Frischkes, vom Polizeipräsidium Mittelfranken strafversetzt, stürzt sich in die Ermittlungen. Doch leicht machen es ihr die störrischen Dörfler nicht. Und sie bemerkt nicht, dass der Mörder längst hinter ihr her ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Tischlinger, 1962 in Nürnberg geboren, studierte BWL, Außenwirtschaft und Marketing, doch ihre Leidenschaft gehört dem Schreiben. Zahlreiche Kurzgeschichten wurden veröffentlicht, auch für den Bayerischen Rundfunk in fränkischer Mundart. Außer im Radio ist sie bei Lesungen zu hören. Sie schreibt für das Sozialmagazin »Straßenkreuzer« in Nürnberg.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv:Don Fuchs/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susanne Bartel eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-783-3 Franken Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Gerhard
und meine Eltern
Zwei Leichen sind eine zu viel
Monis Mund stand selbst im Tod noch offen.
Was war sie für eine Quasselstrippe gewesen. Und nachtragend. Würde sie noch leben, sie würde Gift und Galle spucken.
He, kannst du mir sagen, was das hier soll? Bist du bescheuert, du Pfeife?
Er hatte seine Arme von hinten unter ihre Achseln geschoben und schleifte sie wie einen Sack Kartoffeln durch den Wald auf der Suche nach einem geeigneten Platz, an dem er sie ablegen konnte. Wenn er die Leiche mit genügend Ästen bedeckte, würde sie dort vielleicht wochen- oder monatelang liegen, bis sie ein Wanderer oder ein Pilzsucher entdeckte. Wahrscheinlich stark verwest, aasig, nicht mehr schön anzuschauen. Bäh, pfui Deifl!
Der Schweiß rann ihm über die Stirn und die Wirbelsäule hinunter. Dass eine Tote so schwer sein konnte.
Recht viel weiter durfte er nicht gehen, sonst wäre er wieder aus dem Wald draußen. Wahrscheinlich hatte er den Herrgottsacker sowieso schon längst erreicht, das Waldstück, das bereits zu Kleinmichlgsees gehörte.
Recht wäre das der Moni nicht gewesen. Zwischen den Einwohnern von Kleinmichlgsees und Ingreisch herrschte eine uralte Hassliebe wie bei allen Orten, die nah beieinanderlagen. Die Moni war geborene Ingreischerin und hätte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, auf Feindesboden abgeladen zu werden wie lästiger Sperrmüll.
Er warf einen kurzen Blick über seine Schulter und ging wieder ein paar Schritte rückwärts. »Herrschaft, Moni, etz mach dich halt ned so schwer!«
Mit einer Schubkarre hätte er sich wesentlich leichter getan. Aber daran dachte man doch nicht, wenn man einen Menschen umbrachte, ohne es direkt vorgehabt zu haben.
Im nächsten Moment stieß er mit dem Hacken seines Schuhs gegen einen Widerstand, stolperte und dachte noch: Scheiße, das fängst du nicht mehr ab! Er ließ die Moni los, dann drehte sich der Wald auch schon um ihn herum und er lag auf dem Rücken, alle viere von sich gestreckt wie ein Käfer.
Ungelenkig versuchte er, sich aufzurappeln, griff dabei in etwas Weiches und schaute, was es war. Er blickte in ein blutiges, verzerrtes Gesicht. Aber so hatte die Moni doch nicht ausgeschaut?
Blankes Entsetzen durchfuhr ihn. Das war gar nicht seine Leiche, da lag noch eine! Do legsd di nieder! Das war ja die Wanninger Christel aus Kleinmichlgsees!
»Des glaubt mir ka Mensch, ka Mensch glaubt mir des«, murmelte er immer wieder vor sich hin, während er die Moni wieder panisch packte und sie den gleichen Weg zurückschleifte.
Als er schon fast wieder bei seinem VWCaddy angekommen war, ein Gebrauchtwagen, der sich aber, wie sich gezeigt hatte, wunderbar zum Transport von sperrigen Gegenständen und Leichen eignete, schüttelte er den Kopf und fragte sich mit leicht bewegenden Lippen: »Warum hob ich die Moni ned einfach bei der Christel liegen lassen? Ich bin doch so a Depp!«
Okay, wirkliche Freundinnen waren die beiden nie gewesen. Bleede Goonz, so hatte die Moni die Christel genannt, nie aber näher definiert, warum die Kleinmichlgseeserin eine blöde Gans war.
Die Moni noch einmal zurückzuzerren war ihm dann aber doch zu doof. Also hievte er sie keuchend in den Wagen, breitete eine Wolldecke, die sie bisher zum Picknicken verwendet hatten, über sie und ging ein paar Meter zurück, um die Schleifspuren mit dem Fuß zu verwischen.
Fleisch
Das blitzend scharfe Fleischermesser fuhr durch das rosige Fleisch wie durch Butter. Ein tiefer, sauberer Schnitt.
Er hielt das Messer fest in der Hand, zerteilte erneut das Fleisch. Bei jedem Schnitt stöhnte Gitta leise auf.
Seine Finger waren wulstig, von einigen Narben entstellt und glänzten fettig. Alles an dem Kerl war groß geraten: Hände wie Teller, die Nase eine Birne. Auch sein Stiernacken war beeindruckend, aber präzise ausrasiert. Ein Kerl wie ein Klotz, doch hatte er ein Messer in der Hand, arbeitete er präzise wie ein Chirurg.
Die buschigen, an den Enden nach oben gebogenen Augenbrauen, die gewaltige Nase, der rabenschwarze Blick– wie der Teufel persönlich. Dabei war er gemeinhin doch als gutmütiger Mensch bekannt, war überall beliebt. Warum hatte sich die Natur zu einem angeblich sonnigen Charakter nur so eine finstere Fassade einfallen lassen?
Gitta rannen Schweißperlen in die Spalte zwischen ihren in einen Sport-BH gepressten Brüsten. Sie stöhnte. Sie keuchte. Ihr Herz schlug, ihr Puls raste. Sie dachte an das Ende. Warum tust du dir das an? Nein, Gidda, du musst an etwas anderes denken! Aber da war schon wieder das Messer. Sie sah das Fleisch auseinanderklaffen, konnte den Schnitt förmlich spüren, als sei es ihr Leib und nicht der saftige Laib Fleischkäse, der da von Metzger Erwin Popp bearbeitet wurde.
Was will ich?
Würde sie diese Frage nicht so sehr beschäftigen, sie wäre heute nicht so weit gejoggt. Für sie war es jedenfalls weit. Ein Sportler hätte wohl eher gesagt: so weit wie einmal kräftig ausgespuckt. In Zahlen ausgedrückt hieß das: gerade mal hundert Meter.
Was will ich? Leberkäsweggla oder doch Stadtworschdweggla?
Die elementare Frage nach der nächsten Brotzeit ließ die Qualen, die sie durchlitt, völlig nach hinten treten.
Nicht zu verachten wäre natürlich auch ein Bratworschdweggla.
Sie stampfte über den Asphalt. Ihre Füße waren kochende Klumpen, ihre Beine und die Lunge brannten wie Feuer, ihr Kopf stand kurz vor dem Platzen, nur der Gedanke an eine der vielen Sauereien vom Metzger Popp spornte sie an, sich nicht einfach sofort ins Gras zu werfen.
Beiß die Zähne zusammen! Du hast dir versprochen, dass du dir nach der Strapaze ein Leberkäsweggla gönnst. Leberkäsweggla, Leberkäsweggla, Leberkäsweggla, Leberkäsweggla…
Gitta Fürbringers Entscheidung war gefallen. Sie würde sich nach dem Joggen ein Leberkäsweggla der Metzgerei Popp genehmigen. Eine fünf Zentimeter dicke Scheibe mit einer braunen Kruste zwischen krossen Wegglahälften mit einem Batzen Senf. Dafür lohnte sich die Quälerei.
Jawoll! Gitta, gib Gas!
Sie lief an der Bäckerei vorbei, am Friseursalon, am Lebensmittelgeschäft und dem neumodischen Bio-Laden, dann war sie auch schon aus Kleinmichlgsees heraus. Denn wenn man Kirche, Friedhof und Wirtshaus noch erwähnte, hatte man alles Nennenswerte des Ortes auch schon genannt.
Die Endvierzigerin lief der Morgensonne entgegen, doch hätte die Sonne gekonnt, sie hätte sich am liebsten ein paar Wolken vor die Augen geschoben. Grässlich, was da auf sie zukam, und noch dazu in schreiendem Pink!
Gitta joggte nicht regelmäßig, nicht einmal oft. Vielleicht einmal im Jahr, wenn es denn hoch kam. Und das reichte dann auch wieder für lange Zeit, in der Gitta an Bauch, Beinen und Po ordentlich zulegte, aber leider ihre Garderobe nicht ab-.
So gesehen joggte Gitta nicht wirklich, sie stampfte, oder sagen wir, sie trat mit platten Füßen auf den Boden ein. Würde die Szene in einem Comic dargestellt werden, würde unter ihren Schritten die Erde erbeben und kleine Männchen würden durch die Luft gewirbelt werden.
Aber an sich war das alles ja egal, denn was zählten schon Äußerlichkeiten? Gitta war eine richtig gute Sau. Ein Typ Mensch halt, der gerne ausgenutzt wurde. Sie arbeitete als Kassiererin in einem Baumarkt, aber das tat im Moment rein gar nichts zur Sache.
Gitta passierte die Kleinmichlgseeser Ortsgrenze, stampfte am Sportplatz vorbei, stampfte entlang des Wäldchens, hoch zum Herrgottsacker, neben dem ein Bächlein gluckerte. Dort blieb sie hechelnd stehen und rieb sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Als ihr Atem wieder gleichmäßiger ging, drehte sie sich um. Kein Mensch würde es bemerken, wenn sie einfach wieder umdrehte, und daheim könnte sie sich ein ordentliches Frühstück genehmigen. Mit Spiegeleiern und Speck. Und Müsli– wegen der Gesundheit. Nachdem sie bei Metzger Popp gewesen war.
Lustlos betrachtete sie den schmalen Waldpfad, der ab hier anstieg. Doch wie um ihr die Entscheidung zu erleichtern, spürte sie auf einmal, wie der Hosengummi in ihren Bauch schnitt. Vielleicht doch noch ein paar Meter?
Plötzlich horchte sie auf. Im Wald rechts von ihr, raschelte es da nicht? Vielleicht ein Tier im Dickicht?
Noch einmal knackten Äste. Dann war es still. Viel zu still.
Instinktiv rannte Gitta los, dummerweise ging es steil bergauf. Doch Schiss war ein guter Motor, und so war sie schneller den Hügel rauf, als man es ihr zugetraut hätte. Schweißperlen kullerten ihr vom Haaransatz in die Augen. Sie brannten. Joggen, so eine saublöde Idee!
Als sich ihr verschwommener Blick wieder klärte, sah sie am Waldrand etwas länglich Fleischiges im zarten Grün liegen. Eine überdimensionale Fleischwurst, dachte Gitta zuerst, da ihre Gedanken fast immer ums Essen kreisten. Sie ging näher, weil ihre Neugier stärker ausgeprägt war als ihr Verstand.
An der Fleischwurst hingen kleine leicht gebogene Würste, fünf an der Zahl. Und die kleinen Würste hatten rot lackierte Fingernägel. Das war doch… Gitta kniff die Augen zusammen. Eine Hand?
Himmel, eine Hand!
Nach und nach realisierte sie, dass dort ein Mensch lag. Sie rasterte den grausigen Fund. Langes blondes, zerzaustes Haar, das halb ein Gesicht bedeckte. Eine blutige Nase, der die Spitze fehlte, unter den Nasenlöchern schwarz verkrustet. Ein ebenso blutiges Ohr lugte zwischen dunkel klebrigen Strähnen hervor. Bizarr verrenkte Gliedmaßen wie eine weggeschmissene Schlenkerpuppe. Schwarz schillernde Fliegen taten sich schon surrend gütlich. Gittas Nackenhaare stellten sich auf.
Allmächd, a Dode! Schau weg, Gidda, schau weg!
Doch etwas hielt ihren Blick wie magisch fest. Die kunstvoll lackierten Nägel, die kannte sie doch. Mit aufgepinselten stars and stripes. Mit so einem Dekor traute sich nur eine herumzulaufen: die Wanninger Christel.
Abber freili! Die blonden Hoar. Des iss’! Die Wanninger Christel! Ja, abber worum isn die dod?
»Christel?«, fragte Gitta, erhielt aber freilich keine Antwort. Plötzlich hatte es die Gitta sehr eilig. Mit der rechten Hand fummelte sie in ihrem Ausschnitt herum und zerrte einen nass geschwitzten Kunststoff-Brustbeutel in Neongrün heraus. In ihm befanden sich ein feuchter Zehner für die ursprünglich für später geplante Brotzeit und ihr Handy. Als sie die Tastensperre deaktiviert hatte, entfuhr ihr ein Fluch: »Ach, Zefix Halleluja, Akku leer!«
Und als wolle der Himmel ihre kleine Sünde sofort bestrafen, raschelte es wieder im Gebüsch. Der Mörder!
Nie wieder würde einer die Gitta schneller rennen sehen. Wenigstens ging es jetzt bergab. Und noch nie hatte die Gitta so vehement die Metzgerei Popp ignoriert. Doch das Unterbewusstsein war nun mal ein verdammt flinker Hund, und so knurrte ihr Magen wie ein wildes Tier, als sie in die Polizeiwache stürmte, ohne anzuklopfen.
Es war sieben Uhr dreißig. Richard Staudinger schüttete gerade Kaffeepulver in die Filtertüte, obwohl seine neue Vorgesetzte der Meinung war, sein Kaffee schmecke wie Eingeweichtes, hinter dem Bahnhof Zusammengekratztes. Er solle doch wenigstens einen Messlöffel nehmen, dann sei die Qualität seines Gebräus wenigstens täglich gleichbleibend mies und sie müsse sich nicht jeden Morgen auf einen neuen Geschmacksschock einstellen. Aber was konnte man von so einer schon erwarten? APreiß! Aus Berlin.
Was hatten sich die in den obersten Etagen eigentlich dabei gedacht? Die konnten doch keinen Preißn in ein mittelfränkisches Dorf versetzen. Noch dazu eine Frau! Staudinger grinste in die Kaffeetüte hinein.
Grad sieben Arbeitstage war sie auf dem Revier und schien sich jetzt schon unterfordert zu fühlen. Sie wollte alles auf den Kopf stellen und modernisieren. Was die sich einbildete! Wo der Hund verreckt war, da passierte halt auch nix. Und wer wusste denn, was diese Paula Frischkes versaubeutelt hatte, um in die Provinz versetzt zu werden? Eine Kriminaloberkommissarin. Das Schlimmste für die war bestimmt – Richard grinste wieder–, vom Polizeipräsidium in Nürnberg weg hierher gemusst zu haben. In Kleinmichlgsees war sie zwar Dienststellenleiterin, aber halt so ziemlich am Arsch der Welt für jemanden, der die Großstadtabgase zum Atmen brauchte. Ansonsten gab es womöglich schon noch ödere Orte auf der Welt. Irgendwo in der Mongolei oder der Antarktis.
Richards Gesichtsfarbe entsprach in etwa der seines Diensthemdes. Und auch der seines Haares. Beige war die offizielle Farbbezeichnung, aber manche sagten auch Pissgelb dazu. Und das zu einer moosgrünen Polizeihose. Hätte man Richard uniformiert in den Wald gestellt, er wäre gar nicht groß aufgefallen. Nein, eine Schönheit war er nicht gerade, aber darauf legte er auch keinen Wert.
Gelegentlich besorgte ihm seine Schwester Trudel Unterhosen und Oberhemden im Ausverkauf, damit er sich auch in der Freizeit sehen lassen konnte. Dabei hatte die Trudel den Hintergedanken, dass auch dieser einsame Topf vielleicht endlich mal einen Deckel fand, aber das wusste Staudinger natürlich nicht. Andererseits hauste noch eine zweite Seele in Trudels Brust. Sie würde ihren kleinen Bruder nur ungern aus der Hand geben. Aber dann sollte auch erst mal jemand eine Ehefrau für den Einsiedlerkrebs finden, die Trudel das hausfrauliche Wasser reichen konnte!
Richard Staudinger war vierzig, katholisch, noch immer Single und gleich nach der Pubertät ohne nennenswerten äußerlichen Einfluss zum Spießer herangereift. Nannte man ihn eine Couchpotato, nickte er zustimmend. Was wahr war, durfte auch gesagt werden. Er zeigte keinerlei Ambitionen, aus der Ein-Zimmer-Mansarde im Haus seines Schwagers, Trudels Ehemann, auszuziehen. Warum denn auch, wo ihm doch die Trudel die Wäsche machte und sie auch noch zusammenlegte?
Als Gitta schwitzend und keuchend in die Amtsstube stürmte, kippte Richard vor Schreck einen Schwups Kaffeepulver über den Filter. So viel Remmidemmi waren sie sonst auf dem Revier nicht gewöhnt. Das braune Gebrösel rieselte über das wackelige Beistelltischchen, auf dem die Kaffeemaschine, die Tassen, die alle eine Macke hatten, die Blechdose mit Trudels selbst gebackenen Spitzbuben – auch im Frühling!– sowie ein mit Bauernmalerei verzierter Kaffeefilterhalter standen.
»Die Wanninger… hüüü… is… hüüü… hiii…!«, keuchte die Gitta. »Dod… mausedod, mei… hüüü…«
Das konnte der Richard gerade leiden. Vor offiziellem Dienstbeginn reinplatzen und sich dann noch wichtigmachen. Um seine ihm auferlegte Überlegenheit zu demonstrieren, reagierte er erst einmal nicht. Fegte das verstreute Kaffeepulver mit dem gekrümmten Zeigefinger in seine hohle Hand, schüttete es in die Filtertüte und fuhr fort, Kaffee zu machen.
Gitta stützte sich mit beiden Armen auf dem Tresen ab, der das Volk von den Staatsdienern trennte, von Richard und seiner Kollegin Maria Heberle aber gerne als Brotzeitunterlage zweckentfremdet wurde.
Seitdem allerdings die Neue hier das Sagen hatte, verkniffen sie sich ausgiebige Mahlzeiten während der Arbeitszeit und knabberten stattdessen verstohlen an einer Breze oder einem Worschdweggla, die sie in ihren Schreibtischschubladen aufbewahrten. Dabei war was Richtiges im Magen doch so wichtig. Sagte die Trudel.
Gitta hob mühevoll den Kopf. »Die Wanninger hot wer umbracht!« Auf dem Tresen hatte sich ein Schweißpfützchen gebildet.
Umgebracht. Das Reizwort ließ Richard schließlich doch aufhorchen, dennoch drückte er erst einmal mit spitzem Zeigefinger und kreisender Zungenspitze auf den roten Einschaltknopf der Kaffeemaschine. »Wer?«, fragte er schließlich und schaute streng über sein Brillengestell hinweg. Erst jetzt sah er, in welchem Zustand die Gitta war.
»Die Wanninger Christel liegt im Wald.«
Richard zog sich die Hose am Bund hoch. »Wer sagt das?«
»No, iich!«
Richard ging zu seinem Schreibtisch und griff sich einen Notizblock und einen Kuli. »Wieso im Wald?«
Verständnislos starrte die Gitta ihn an. Ihr Kopf war rot bis in die Haarspitzen. »Ja, wos waß denn iich, warum die im Wald liechd? Sie liechd halt da.«
»Und warum warst du im Wald?«
Gitta straffte die Schultern und fuhr mit den Fingerspitzen an der Naht ihrer pinken Jogginghose entlang. »Schau iich vielleicht aus, als gängert iich ins Theater?«
Richard legte den Kopf schräg und überlegte, was Frauen im Theater trugen. In den letzten Jahren konnte man ja sogar in Jeans hin, ohne Schmarrn, tatsächlich. Seine Trudel hatte ihm Weihnachten vor drei Jahren Theaterkarten für die »Zauberflöte« im Nürnberger Opernhaus geschenkt, damit er mal was erlebte. Trotz der dauernden Singerei war er relativ schnell eingeschlafen und nur durch die Ellbogenknuffe seiner Schwester, die ihn begleitet hatte, wieder geweckt worden. Er grinste breit. »Theater, naa, naa. Du doch ned, du stehst doch mehr auf Schlager, Howard Carpendale und so.«
»Beim Joggen wor iich! Joo-gen!«
Von draußen vernahmen sie plötzlich erregtes Geschnatter. Eilfertig kritzelte Richard einige Wörter auf seinen Stenoblock. Sollten seine Kolleginnen mal sehen, was er schon vor Dienstbeginn alles leistete, während sie noch ihre Lippen anmalten!
Walnninger, Christel.
Wohnhaft Kleinmichlgsees.
Tot. Wald. Wo?
Warum?
Zeugin: Gitta Fürbringer, Kleinmichlgsees.
Baumarktangestellte. Ledig.
»Deine genauen Personalien nehme ich später auf«, sagte er und warf einen vielsagenden Blick zur Tür. Zwei Frauen auf einem Revier, wo sie eh bloß zu dritt waren. Hätten sie ihm nicht wenigstens einen Mann vor die Nase setzen können, das hätte nicht ganz so wehgetan. Warum nur war der alte Chef unter einen Lkw geraten? Scheiß Sauferei!
»Meine Bersonalien? Meine Bersonalien?«, ereiferte sich die Gitta mit sich überschlagender Stimme. »Iich wärd dir gleich meine genauen Bersonalien gebm! Du waßt doch, wer iich bin! Kümmer dich lieber um die Leich!«
Die Tür öffnete sich unter lautem Quietschen. Sie quietschte schon, so lange man zurückdenken konnte. Nach Maria flatterte Paula Frischkes in einem bunt geblümten Kleid herein und hängte ihren fliederfarbenen Blazer über die Bürostuhllehne. »Welche Leiche? Ist der Kaffee schon fertig?«, fragte sie, während sie etwas auf ein Post-it schrieb und das bunte Zettelchen an ihren PC-Monitor pappte. Karotten für Tannhäuser kaufen! Tannhäuser war ihr vor Kurzem geerbter Rammler, und Paula, die Stadtpflanze, vermutete, dass Kaninchen grundsätzlich Karotten fraßen.
»Christel Wanninger. Läuft gerade durch.«
»Die hot wer umbracht«, ergänzte Gitta.
»Mord?« Kommissarin Frischkes’ Gesicht glänzte plötzlich. Vielleicht konnte sie ja jetzt den bonierten Knalltüten aus dem Polizeipräsidium, ihrer vorherigen Dienststelle, und besonders ihrem Chef, zeigen, was in ihr steckte. Nie würde sie ihm die Versetzung verzeihen, nie! Kleinmichlgsees. Alleine der Ortsname war schon ein Schlag ins Gesicht. Hier bissen sich die Kühe vor Langeweile in die Schwänze.
»Die Christel?« Geräuschvoll schlug Maria sich die Hand vor den Mund und nuschelte dahinter hervor: »Aber bei der hab ich doch grad noch ein Tischgesteck bestellt. Für Elmars zehnjähriges Kegeljubiläum.«
Richard tippte das Ende des Kugelschreibers unablässig auf die Tischplatte. Knips, knips, knips, knips, knips… »Der ist schon zehn Jahre dabei? Aber Blumen? Für einen Mann?« Er verzog das Gesicht, als hielte man ihm ein Stück Backsteinkäse unter die Nase.
»Immerhin ein Gesteck mit einem Fähnchen, auf dem steht: ›Gut Holz, altes Haus!‹«, verteidigte sich Maria, aber Richard behielt die verzerrte Miene bei.
Paula schob ihr schulterlanges blondes Haar rechts und links hinter die Ohren, räusperte sich. »Mord?«, fragte sie erneut, jetzt aber lauter.
Gitta war schneller als Richard, was nicht verwunderlich war. Reden konnte sie besser als laufen, während Richard in beiden Disziplinen eher schlecht abschnitt. »Zumindest dod is. Aber so blutig, wie die da rumliechd, war des ka Herzkasper oder a Kreislaufgschicht.«
»Blutig? Und wo genau liegt die da rum?« Paula fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Na, oben am Herrgottsacker.«
Paula atmete entschlossen durch und schlüpfte wieder in ihren Blazer. »Herr Staudinger! Das schauen wir uns an.«
»Und der Kaffee?«
Sehn-, weil kaffeesüchtig blickte Paula zur Kaffeemaschine, den Duft in der Nase, das Glucksen des durchlaufenden Getränks in den Ohren. »Muss warten.«
Richard zog wieder ein Gesicht, eines von vielen aus seinem großen Repertoire. Es war das Gesicht Typ: Was störst du mich, wo ich gerade dabei war, den Weltfrieden zu sichern?
»Ich komm auch mit!«, rief Maria plötzlich und war bereits mit einem Arm in ihrer Uniformjacke, der sie sich gerade entledigt hatte, als unter grässlichem Quietschen die Tür erneut geöffnet wurde. Sie musste unbedingt geölt werden.
Ein geschminkter Mann um die vierzig mit Modelfigur, die jede Frau vor Neid erblassen ließ, stöckelte in Pumps in die Stube. Mit einem Taschentuch in seiner zarten Hand betupfte er sich die gepuderten Wangen. »Hach!«, machte der Typ, der auch von weiblichem Geschlecht hätte sein können. Seine Kronjuwelen sah man in dem hautengen weißen Hosenanzug jedenfalls nicht. »Da oben am Herrgottsacker liegt a toter Mensch«, näselte er.
Fredl Gruber war der Friseur von Kleinmichlgsees. Vor ein paar Jahren hatte er den Salon vom achtundsiebzigjährigen Rudi Hollermeier übernommen, der am Ende seiner beruflichen Laufbahn wegen seiner starken Sehschwäche gefürchtet gewesen war.
Fredl tat so einiges dafür, das werbewirksame Klischee des stockschwulen Friseurs aufrechtzuerhalten, aber so wirklich achtete keine der Frauen mehr auf seine Allüren, so war er halt, der Fredl. Vor allem konnte man mit keinem so schön tratschen wie mit ihm– er war ja gewissermaßen eine von ihnen. Niemand in Kleinmichlgsees war so eine elende Plaudertasche wie die allmählich alternde Tunte.
Dass der Fredl aweng anders war als der gemeine Kleinmichlgseeser, darüber sah man geflissentlich und gern hinweg. Schon als kleiner Bub war er a bisserla gaga gewesen. Hatte als Bürschla doch tatsächlich mit einer Marilyn-Monroe-Perücke auf dem Kopf den Kuhstall seines Vaters ausgemistet und sich 1989 in Ingreisch zur Wahl der »Stadtwurstkönigin« aufstellen lassen. Zum Gespött der Bewohner des verhassten Nachbarorts. Das Krönchen und die Schärpe hatte er freilich nicht gewonnen.
Wieder zog Richard seine Hose hoch, bevor er auf den Friseur zuschritt. »Was treibst du denn morgens im Wald?«
Fredl wurde tatsächlich verlegen, eine Regung, die man bei ihm so gar nicht vermutet hätte, sprach man ihm doch einen recht versauten Lebenswandel zu, zu dem er normalerweise auch stand. Er spielte mit den langen Kragenecken seines türkisfarbenen Seidenhemdes. »Ach, weißt, also, ich… vielmehr wir… Ich war mit dem Ingo, des is mei neuer Freund, gestern im ›Heißen Schmelztiegel‹ in Bamberg. Des Lokal kennt ihr wahrscheinli ned, weil… Na ja, jedenfalls weil’s so a schöne Nacht war… Also, der Ingo…« Fredl klimperte mit echten, aber stark getuschten Wimpern und boxte sich mit der beringten glitzernden Faust in die Handfläche. »Wenn der einmal loslegt…«
»Also, also, also«, echauffierte sich Richard, »das will jetzt hier wirklich niemand wissen. Ist der tote Mensch vielleicht die Wanninger Christel?«
»Wisst ihr des wohl schon? Ich hab sie gleich gar nicht erkannt, erst wie ich die Fingernägel gsegn hab, da hab ich zum Ingo gsagt: ›Des is doch die Christel!‹« Beleidigt stieß er Luft durch die Nase aus. »Aber bei mir hat sie die nicht machen lassen! Wer weiß, wo die schon wieder war. Wahrscheinlich in einem von den asiatischen Billig-Salons in der Stadt.«
»Du machst auch Fingernägel?«, fragten Maria und Gitta wie aus einem Mund.
»Freili!«
Maria, die ein klein wenig zur Pummeligkeit neigte, auch nicht besonders groß, aber im Großen und Ganzen eine natürlich Hübsche war, betrachtete ihre Fingernägel. Wenn sie nervös war, knabberte sie die Häutchen ab.
Fredl hatte ihre Reaktion sofort registriert. »Da mach ich dir French Nails, da sieht man nix mehr von der Schand. Und deine Haar könntest dir auch amol wieder schneiden lassen. Aweng was Flottes und Strähnla nei.«
Maria nickte schuldbewusst. Seit Jahr und Tag trug sie kinnlang, Pony, pure Langeweile in Aschbraun.
Paula Frischkes klopfte sich auf die Wangen, um aus diesem Komödienstadel wieder zu erwachen. »Vergessen Sie die Äußerlichkeiten, Maria! Auf geht’s, wie der Bayer so sagt. Bevor uns da noch mehr Leute über die Leiche stolpern.«
Richard runzelte die Stirn. Das hatte die Frischkes noch nicht ganz begriffen: Der Franke war doch kein Bayer!
Der Christel fehlt a Schuh
Nach Gittas Beschreibung und den Schweißrändern unter ihren Achseln stellte Paula sich darauf ein, in etwa den Großglockner besteigen zu müssen, um den Herrgottsacker zu erreichen. Doch sportlich durchtrainiert, wie sie war, federte Paula mit lockeren Schritten vom Ortsrand den Hügel hinauf, bis sie beinahe über Christels Arm stolperte.
Gab es etwa zwei tote Frauen?
Eine gleich hier unten und eine hoch drobm aufm Berg, juchhe?
Richard und Maria stapften schweigend hinter ihrer Chefin her. Sie waren nervös. Mit einer Leiche hatten es beide in ihrer Polizeilaufbahn noch nie zu tun gehabt. Und laut der Gitta war die Wanningerin schrecklich zugerichtet. So was kannte man aus dem Fernsehen, aber in natura? Vor der abgebrühten Berlinerin wollten sie nicht grad als Weicheier dastehen.
»Wird schon nicht schlimmer sein als beim Schlachten«, bemerkte Richard. Inzwischen bereute er, dass er sich keine Ausrede hatte einfallen lassen, um auf der Wache bleiben zu können.
»Ich schau auch beim Schlachten nicht zu«, sagte Maria. »Schlachten deine Eltern noch selber?«
»Nö«, machte Richard. »Ich hab ja nur gemeint.«
»Da ist sie!«, rief Paula. Wie bei der Fabel vom Hasen und Igel: Ich bin schon da!
Schweigend stellten sie sich im Halbkreis um die Leiche herum. Natürlich in angemessenem Abstand, um keine eventuellen Spuren zu verwischen. Auf den Wunden der toten Christel hockten schwarze Ballen aus aasfressenden Fliegen. Maria war käsig im Gesicht geworden, und Richard lutschte ein Nimm2-Bonbon, um das Magengrummeln zu unterdrücken.
»Wenigstens ist es schön kühl. Sonst würde sie ratzfatz zu stinken anfangen«, stellte Richard fest und zerbiss das Bonbon krachend. Die fruchtige Füllung, die er sonst so liebte, erinnerte ihn heute an alle möglichen körperlichen Absonderungen, sodass er den Batzen ausspuckte und sich dabei das Hemd versaute. »Da wird die Trudel wieder meckern«, murmelte er, während er mit Spucke versuchte, die klebrigen Tröpfchen wegzureiben, was die Katastrophe nur noch verschlimmerte.
»Was ist der armen Frau bloß zugestoßen?«, wunderte sich die Kommissarin. »Sieht aus, als wäre sie durch die Luft gewirbelt und auf den Boden geknallt.«
»Vielleicht war es eine Windhose? In letzter Zeit hört man ja immer wieder, dass auch bei uns plötzlich Tornados auftreten. Wie in Florida oder der Karibik.«
Die Frauen schauten Richard ungläubig an.
»Ich mein ja nur.«
»Sehen Sie, wie verrenkt der Unterarm ist? Der ist bestimmt gebrochen. Und da sind eindeutig Schleifspuren.«
»Und was hat man mit ihrem Gesicht angestellt?«
Christels gutmütiges Puppengesicht wurde durch Blutergüsse, Kratzer und mehrere blutige Wunden entstellt.
»Vielleicht hat ihr ein Marder die Nasenspitze abgefressen.« Richard zog die Nase hoch. »Oder ein Fuchs?«
»Musst du alles so blumig darstellen? Ich spei mich gleich!« Maria blies die Backen auf und rieb sich den Magen. »Mir hängt’s scho am Zäpfla.«
»’tschuldigung, Maria.« Von einem Knacken der Kniegelenke untermalt ging Richard in die Hocke. »Wenigstens hat sie noch ihren Schlüpfer an.«
»Du hast der Christel doch jetzt nicht unter den Rock geschaut?«, rief Maria entsetzt.
Paula half Richard mit der Hand hoch.
»Ich hab der Christel gar nicht untern Rock geschaut.«
»Hast du wohl!«
»Na gut. Also, ich hab nach ihrem Schlüpfer geschaut. Ob sie, äh, vergedings oder so wurde.«
»Die Trudel sticht dir die Augen aus, wenn die erfährt, dass du Frauen untern Rock schaust.«
Richards Schwester war katholisch, was im protestantischen Kleinmichlgsees so gut wie eine Ausnahme war, und achtete deshalb nicht nur auf Richards Wäsche, sondern auch auf seinen tadellosen Ruf.
Richard lief puterrot an. »Die Christel ist doch keine Frau mehr, sondern nur noch eine Leiche.«
»Richard!«
»Is doch wahr. Und ich hab doch nur nach ihrem Schlüpfer wegen sexueller Dings und so geschaut.« Beleidigt verschränkte er die Arme vor der Brust. »Ich tu doch bloß meine Arbeit. Aber wehe…!« Er schlenkerte drohend den Zeigefinger. »Wehe, du erzählst der Trudel was davon. Dann sag ich nämlich auch, dass du dir während der Arbeitszeit die Beine rasierst, und zwar mitm Rasierer vom alten Chef und ohne Seife!«
Maria pumpte sich auf wie das HB-Männchen.
»Schluss jetzt!«, plärrte Paula, bevor Maria sich entladen konnte. »Schluss mit dem Kindergarten. Jetzt gebt euch die Hände und vertragt euch. Wir haben hier eine Leiche.« Sie grinste. »Und die hat sogar noch ihren Schlüpfer an.«
Maria und Richard versteckten trotzig ihre Arme hinter dem Rücken.
»Vertragen, sonst gibt es keinen Nachtisch!« Paula gab nicht nach.
Zögerlich streckten sich die beiden die Hände entgegen.
»Friede?«
»Friede.«
Paula umkreiste die Christel. »Frau Wanninger trägt nur noch einen Schuh.«
»Den anderen wird sie wohl verloren haben«, stellte Richard fest.
»Aber wo? Sein Fundort könnte eine heiße Spur sein.«
»Oder der Mörder hat ihn als Souvenir behalten, als Fetisch«, begeisterte sich Maria. Was für ein Fall! Sexuelle Begierde, ein Mord aus Leidenschaft. Dann fiel ihr wieder ein, dass es sich bei der Toten um die Christel handelte. Christel, die immer ein gutes Apfelkuchenrezept parat gehabt hatte. Die Vorhänge hatte nähen können und die ihre Fenster immer streifenfrei geputzt hatte. So eine Frau und hemmungslose Leidenschaft?
»Noch wissen wir nicht, ob es Mord war. Obwohl ich sagen muss, das müsste schon ein seltsamer Unfall gewesen sein. Die Schleifspuren und das Szenario, also, beides zusammen sieht für mich so aus, als hätte jemand das Opfer in den Wald geschafft und sich dann vom Acker gemacht.«
Richard lachte polternd auf. »Genau, vom Herrgottsacker.«
»Jetzt gucken wir uns noch mal vorsichtig um, ob wir Christels zweiten Schuh finden, und dann rufe ich die Spusi und den Leichenwagen.«
Auf Zehenspitzen stiegen sie durchs knackende Gestrüpp und hielten die anderen über ihre Funde auf dem Laufenden: Cola-Dosen, Plastiktüten, Eispapierchen, ein Autoreifen, ein verrostetes Fahrrad.
»Ich hab ihn!«, rief Richard plötzlich und drehte sich vor Freude im Kreis wie ein Schoßhündchen, das erfährt, dass es mit Frauchen Gassi gehen darf.
»Respekt, Herr Staudinger! Gute Arbeit«, sagte Paula. Sie hatte eigentlich darauf spekuliert, den Schuh zufällig bei einer der Kleinmichlgseeser Seelen hinterm Sofa oder in der Mülltonne zu finden und so den Mörder überführen zu können.
Richard trug den Pumps wie eine Krone vor sich her. Sein Grinsen war breit und selbstgefällig.
Schweigend betrachteten sie den Schuh. Schauten dann runter zu Christels Füßen. Der Schuh, den sie trug, war rot.
»Deiner ist grün«, stellte Maria fest. Vorn auf der Spitze saß ein großer Glitterschmetterling.
Richards Mundwinkel sackten nach unten. »Eine Frau würde wohl nie zwei verschiedene…?«
»Nicht einmal im Vollrausch, Richard, äh, Herr Staudinger.« Es fiel Paula schwer, die richtige Anrede zu finden. In ihrer letzten Dienststelle waren sie alle per Du gewesen, aber zwischen ihren neuen Kollegen und ihr gab es noch eine Eisschicht, die schmelzen musste.
»Das tut mir jetzt leid mit dem Schuh«, sagte Richard zerknirscht und wollte den Pumps schon ins Gestrüpp kicken.
Also, an Mord hommer ja noch nie ghabt!
Der Hund hatte eine seltsame Methode zu fressen. Er packte mit der Schnauze einen Fleischbrocken, warf ihn in die Luft und schnappte ihn sich dann so vehement, dass seine Ohren dabei hin und her flogen. So fraß doch kein Hund!
Das kam davon, dass ihn seine Frau so verhätschelte. Am liebsten würde sie einen Schoßhund aus ihm machen. Aber ein richtiger Hund war er sowieso nicht. Mehr eine Promenadenmischung aus Schnauzer und Dackel, und wenn es ganz schlecht lief, könnte auch noch ein depperter Pudel dabei sein. Wasti hatte sie ihn getauft. Wasti! Wie originell.
Nicht einmal Essensreste durfte der Helmut an ihn verfüttern. Frauchen kaufte Leckerla beim Metzger und teures Dosenfutter. Natürlich das aus der Werbung. Mit fast bis zur Nase hochgezogener Unterlippe schaute er dem Hund weiter beim Fressen zu. Richtig bellen konnte der blöde Kläffer auch nicht.
Helmut zog geräuschvoll den Rotz hoch und säbelte sich ein Rädchen Stadtwurst ab, das er sich auf der Messerspitze in den Mund schob. Seufzend streckte er die Beine unter dem Küchentisch aus. Heute behinderte ihn niemand dabei, seine Alte saß ihm ausnahmsweise nicht gegenüber.
Durch die Vorhänge sah er zwei Frauen die Hauptstraße entlang auf sein Haus zukommen. Eine von ihnen war die Maria, die andere schien die neue Polizistin zu sein. Sie hatte einen energischen Schritt drauf und musterte interessiert die Geschäfte, die sie passierten. Vor dem neumodischen Bio-Laden blieb sie sogar stehen und schaute ins Schaufenster. Genauso starkes Interesse galt dem ehemaligen Schlecker-Markt, der nach wie vor leer stand.
Früher hatte Helmut noch eine gut gehende Autowerkstatt geführt, aber die Arthrose in den Gelenken hatte ihn gezwungen, sein Geschäft so weit herunterzufahren, dass er nur noch gelegentlich kleine Reparaturarbeiten übernahm.
»Was wollnern däi?«, brummte er und pulte mit der Messerspitze Dreck unter seinen Fingernägeln heraus. Da klingelte es auch schon.
Helmut ließ es klingeln.
»Herr Wanninger!«
Helmut reagierte nicht.
Klingeln und Klopfen. »Herr Wanninger!«
»Ich kauf nix!«
»Wir sind von der Polizei!«, rief die Kommissarin. »Machen Sie bitte auf! Wir müssen mit Ihnen reden, es ist wichtig.«
»Ich hob ka Zeit.«
»Helmut, ich bin’s, die Maria. Es geht um deine Frau.«
Helmut rammte das Messer in den Holztisch und erhob sich schwerfällig. Langsam schlurfte er zur Tür. Wie an jedem Werktag trug er einen Blaumann, vor allem, um sich vorzugaukeln, dass er noch immer voll im Arbeitsleben stand. Grau sah er aus, schon vor Tagen wäre eine Rasur nötig gewesen.
Als die Kinder damals noch im Garten um die Schaukel getobt waren und er Überstunden wegen der vielen Reparaturaufträge schieben musste, da hatten seine blauen Augen durch ein abenteuerlustiges Funkeln bestochen. Jetzt waren sie stumpf. Leidenschaftslosigkeit am Leben hatte das Feuer erlöschen lassen.
Er riss die Haustüre mit einem Ruck auf, sodass die Frauen zusammenzuckten.
Doch Paula hatte sich sofort wieder unter Kontrolle und streckte ihm die Hand entgegen. »Kriminaloberkommissarin Paula Frischkes, guten Tag! Dürfen wir reinkommen?«
Helmut stopfte beide Fäuste in die Hosentaschen und machte sich im Türrahmen breit. »Wos gibt’s?«
Paula klemmte sich die Haare rechts und links hinters Ohr. »Es geht um Ihre Frau. Wir haben keine guten Nachrichten. Wollen wir das nicht lieber im Haus besprechen?«
»Mei Frau ist ned daham.«
»Helmut, es is was Schlimmes passiert.« Maria fasste den brummigen Mann beim Ellbogen und schob ihn vor sich her ins Haus.
Das musste man Maria lassen, Biss hatte sie, dachte Paula. Aber sie selbst würde den Umgang mit den Bauernbüffeln auch noch lernen. Als junge Polizistin in Berlin hatte sie sich schon unter Junkies und Zuhältern behauptet, da würde sie sich von ein paar Brummelbären doch nicht den Schneid abkaufen lassen.
Im Gegensatz zu Maria fehlte Herrn Staudinger ein wenig der Pfeffer. Mit gespielt wichtiger Miene hatte er vorgegeben, einen Hinweis in der, so Staudinger, schon fast mysteriösen Serie an Gartenzwerg-Diebstählen erhalten zu haben. Seit Wochen verschwanden die putzigen Gesellen nun schon spurlos aus den Vorgärten von Kleinmichlgsees. Dem wolle er nachgehen und müsse deshalb dringende Telefonate führen. Paula vermutete, dass er die Schuhe von den Füßen streifen und ein kleines Nickerchen auf seinem Bürostuhl machen würde, sobald er in der Wache allein war.
In der Küche fiel ihr Blick sofort auf die volle Kanne in der Kaffeemaschine. Was sie jetzt für ein Tässchen geben würde! So wie sie Helmut Wanninger auf den ersten Blick eingeschätzt hatte, hätte sie nicht vermutet, dass er sich seinen Kaffee selbst kochte. Oder gab es noch Kinder oder eine Oma im Haus?
Wanninger setzte sich wieder an seinen Platz und schnitt sich ein weiteres Wursträdchen ab. Maria warf der Kommissarin einen fragenden Blick zu, unsicher, ob sie mit der Befragung anfangen sollte oder ihre Chefin das übernehmen wollte.
»Herr Wanninger, wir haben eine traurige Nachricht für Sie«, sagte Paula in dem Moment. »Wir haben Ihre Frau tot im Herrgottswinkel aufgefunden.«
»Am Acker«, verbesserte sie Maria schnell.
»Was?«
»Am Herrgottsacker.«
»Ach so, ja. Jedenfalls haben wir sie gefunden. Tot. Am Herrgottsacker.«
Helmut starrte sie an, den Brocken Wurst in die Wangentasche geschoben, hielt zwei Sekunden inne, dann kaute er weiter.
»Haben Sie mich verstanden, Herr Wanninger?«
»Tot. Warum?«
Paula zog sich einen Stuhl heran. Es war der, auf dem die tote Christel sonst immer gesessen hatte, aber das wusste sie natürlich nicht. »Das müssen wir jetzt herausfinden. Wann haben Sie denn Ihre Frau zuletzt gesehen? Haben Sie sie heute Nacht nicht vermisst?«
Der von der Spurensicherung hinzugezogene Arzt Dr.Michl hatte bei der augenscheinlichen Untersuchung der Leiche am Tatort festgestellt, dass Christel Wanninger seit etwa zwölf Stunden tot gewesen war. Sie sei jedoch nicht an Ort und Stelle verstorben und es müsse sich etwas Schreckliches ereignet haben, so grausam, wie die Tote entstellt war, hatte der Mediziner verlauten lassen. »Sieht aus, als wäre sie aus dem Zug gestoßen und von einer Dampfwalze überrollt worden«, so hatte er sich ausgedrückt, einen Kaugummi aus seiner Jackentasche gezogen und ihn sich in den Mund gesteckt. Er kaute intensiv und ließ dann eine große rosa Blase aus seinem Mund wachsen.
Dr.Michl war so um die fünfzig und hatte volles rabenschwarzes Haar. Vielleicht war es gefärbt, aber es war immerhin sein eigenes. Er hatte die Kaugummiblase zurück in den Mund gesaugt und sie dann platzen lassen. »Ich hab mir vor einem Vierteljahr das Rauchen abgewöhnt«, hatte er die Kommissarin angegrinst. »WollenS’ auch einen?«
Paula klopfte genervt mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. War der Wanninger in eine Schockstarre verfallen? »Haben Sie Ihre Frau denn nicht vermisst? Es muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass sie nicht neben Ihnen im Bett lag.«
»Ich schlaf im Wohnzimmer. Ich schnarch.«
»Und heute Morgen? Haben Sie da nicht bemerkt, dass sie nicht da ist?«
Wanninger zuckte mit den Schultern.
Sollte Paula jemals einen Mann länger als zwei Monate halten können, vielleicht eines Tages sogar heiraten, der liebe Gott möge sie vor solch einem Ignoranten bewahren.
Der Hund schlabberte schmatzend Wasser aus seinem Napf.
»Sie haben also bis eben nicht gemerkt, dass Ihre Frau fort ist?«
Helmut schüttelte den Kopf.
»Wer hat denn dem Hund sein Fressen und das Wasser gegeben?«
Der Mann zuckte wieder mit den Schultern. »Gestern mei Frau.«
»Leben Sie hier alleine mit Ihrer Frau?« Paula blickte sich um, als könne sich eine Rasselbande hinter dem Kühlschrank versteckt haben.
»Weihnachten kummt die Schwiegermutter.«
»Aber einen Sohn und eine Tochter habt ihr ja auch noch«, mischte sich jetzt Maria ein, während sie mit den Fingern prüfte, ob die Blumenstöckchen auf der Fensterbank Wasser brauchten. Sie waren brottrocken, was nicht zu der perfekten Hausfrau passte, die Christel nach außen hin gewesen war. »Die studieren in Köln und Münster. Gell, Helmut?«
Mit wässrigen Augen schaute er sie an. »Soll ich die etz anrufen? Ich muss denen doch sagn, dass ihr Mutter tot is.« Er stützte die Hände auf dem Küchentisch ab, stand auf, schlurfte zu einem kleinen Holzschränkchen, das an der Wand hing, und nahm eine Flasche Obstler und drei Stamperl heraus. Er goss sich ein und kippte den Schnaps hinunter. Dann fragte er mit Fingerzeigen kreuz und quer, ob die Polizistinnen auch einen wollten.
Beide winkten hektisch ab.
»A Selberbrannter. Aber fei ned schwarz, gell.« Zum ersten Mal verriet seine Miene Regung, dann schenkte er sich den nächsten ein.
Paula schob die Flasche resolut zur Seite. Besoffen brachte Helmut Wanninger ihnen noch weniger. Es sei denn, er war einer von denen, die der Alkohol gesprächig machte.
»Wos is denn etz mit meiner Frau passiert? Hots’ an Unfall ghabt?«
»Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht. Jedenfalls ist sie nicht im Herrgottswinkel gestorben. Sie wurde eindeutig dorthin gebracht.«
»Am Acker.« Wieder Maria.
»Herrgott, ja, dann eben am Acker.«
Der Wanninger ließ einen lauten Rülpser durch die Küche röhren, und die Frauen beugten sich wohlweislich aus der Schusslinie.
»Wor’s des?« Helmut stand auf. »Ich hob nämlich wos zu ärbertn.«
Paula und Maria blickten sich an. Erhoben sich.
Paula nahm die Obstlerflasche in die Hand und betrachtete das handbeschriebene Etikett. »Ein paar Fragen haben wir schon noch, Herr Wanninger. Aber vielleicht wollen Sie den Schock auch erst mal verdauen? Wir können auch dann später auf der Dienststelle noch einmal in Ruhe miteinander sprechen. Sagen Sie mal, hatten Sie Streit mit Ihrer Frau?«
»Ich?«
»Sie.«
»Naa.«
»Hatte jemand anderes Streit mit ihr?«
»Waß ned.«
»Wo waren Sie eigentlich gestern Abend?«
»Erschd schafkopfen, dann daham.«
»Schafkopf ist ein Kartenspiel«, warf Maria ein.
Paula nickte. So weit war auch sie schon ins bayerische Kulturgut vorgedrungen. »Wer war denn beim Schafkopfen dabei?«
»No, die andern halt.«
»Ich weiß, wer die andern sind«, sagte Maria. »Sind immer die gleichen Männer vom Stammtisch.«
»Wir werden das überprüfen.« Paula streckte Helmut Wanninger wieder forsch die Hand hin. »Na gut. Dann Wiedersehen.«
Diesmal griff Wanninger zu. Seine Hand war rau, der Druck fest.
»Komm halt heute Nachmittag oder morgen noch mal bei uns vorbei, Helmut«, sagte Maria.
Wanninger stupste den Hund mit der Fußspitze an, schaute zu Boden. »Wos passiert etz mit ihr? Muss ich wos wecher der Leich machen?«
»Ihre Frau kommt in die Rechtsmedizin nach Erlangen. Das ist immer so, wenn die Todesursache nicht klar ist. Wenden Sie sich an ein Beerdigungsinstitut, die sagen Ihnen schon, was zu tun ist.«
Wanninger nickte und schaute rüber zum Wasti, der den leeren Fressnapf ausleckte und dabei quer durch die Stube schob. »Brauchsd du ned an Hund, Maria?«
Fredl stach mit dem Stiel des Toupierkamms in die Haare von Gunda Möser. Wie konnte eine Geschäftsfrau nur so wenig aus sich machen, auch wenn sie nur die Inhaberin des angestaubten Tante-Emma-Ladens war? Er an ihrer Stelle hätte sich längst das stark ergraute Haar in Dunkelmahagoni gefärbt und sich einen flotten Kurzhaarschnitt verpasst. Warum legten manche Frauen, die die Lebensmitte erreicht oder überschritten hatten, nur keinen Wert mehr auf ihr Äußeres, insbesondere auf ihr Haar? Man musste doch nicht jeden mit der Nase darauf stoßen, dass man alt war. Und von wegen– zu seinem Alter stehen. Faulheit war das, reine Faulheit! Schönheit gab es nur in der Jugend gratis. Später war sie anstrengende Arbeit.
Wobei die Möserin auch noch auf eine Dauerwelle bestand, obwohl die doch längst out war. Aber so was von! Eine graue Dauerwelle. Kein Mensch ließ sich mehr eine Dauerwelle legen. Aber gut, die »Golden Girls« interessierte nun mal nicht, was ein No-Go war, Hauptsache, es war praktisch. Einfach waschen und an der Luft trocknen lassen. Hinterher liefen sie dann alle gleich aussehend wie eine Herde gelockter Schafe durchs Dorf. Aber da musste er durch. Fredl schraubte der Möserin einen dünnen Wickler in die nächste Strähne.
Die junge Kundschaft ging mehr und mehr in der Stadt fremd, die Kleinmichlgseeser, die ihm die Treue hielten, wurden mit ihm und der nostalgischen Einrichtung seines Salons alt. Salon Grüüber. Fast wie Glööckler. Der Harald war Fredls Gott.
Über die Waschbecken hätte man vielleicht noch hinwegsehen können, aber die Trockenhauben gehörten eindeutig ins Museum. Dass sich noch keine Kundin die Kopfhaut versengt hatte, grenzte schon an ein göttliches Wunder. Die Tapete ging mit viel gutem Willen als retro durch. Große orangefarbene und braune ineinander verschlungene Kreise. Das psychedelische Muster schlug einem leicht auf den Magen, aber nach Jahrzehnten hatte sich die Kundschaft daran gewöhnt, und meist döste man sowieso unter dem warmen Gebläse der Trockenhaube oder lauschte gebannt Fredls lebhaften Geschichten. Einzig die Plastikumhänge und Handtücher waren neu, Geschenke der Kosmetikfirma, von der Fredl seine Shampoos, Färbemittel und Haarsprays bezog.
Frau Möser lauschte dem Coiffeur nun andächtig.
»Da sag ich zu meinem Freund: ›Hörst du das auch? Ich glaube, wir werden beobachtet.‹ Und ob Sie es glauben oder nicht, Frau Möser, in dem Moment rennt ein Mann weg und mitten rein in den tiefen Wald. Ein Kerl wie ein Schrank. Können Sie sich das vorstellen? Die ganze Zeit hat der hinter einem Busch gehockt und uns beobachtet, wie wir Intimitäten austauschen.« Der Fredl erfand gern a bisserla wos dazu, was ihm aber niemand übel nahm, solang es der Spannung diente.
»Etz hörnS’ bloß auf!« Frau Möser schlug sich unter ihrem Frisierumhang beide Hände vor die Brust. »Am End war des noch der Mörder von der Christel!«
»Gell, Frau Möser, genau, was ich sag. Am End war es der Mörder. Wer weiß, was der mit uns gmacht hätt, hätt ich ned gmerkt, dass der hinter dem Busch hockt«, näselte Fredl, sein Markenzeichen, und rollte den nächsten Wickler auf.