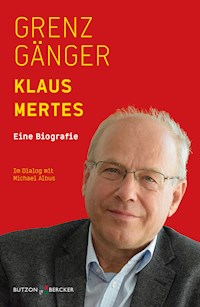Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Welche Werte brauchen wir wirklich, um in dieser Zeitenwende die Zukunft unserer Gesellschaft menschlich und lebenswert zu gestalten? Der Jesuit und Pädagoge Klaus Mertes ist überzeugt: Es ist die Herzensbildung, auf die es ankommt. In seinem Buch warnt er davor, unser Bildungssystem nur noch nach dem globalen Markt und den Ergebnissen der PISA-Studie auszurichten und plädiert dafür, die christlichen Grundwerte wieder stärker in die Mitte unserer Schulen und unserer gesamten Gesellschaft zu stellen. Dazu zählen für ihn eine Wiederentdeckung der Kultur des Hörens, der Stille und des Miteinanders, was nicht nur für unsere Schulen, sondern für unsere gesamte Gesellschaft zwingend notwendig ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
KLAUS MERTES
HERZENSBILDUNG
Für eine Kultur der Menschlichkeit
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Umschlaggestaltung: geviert.comUmschlagmotiv: © C Design Studio / shutterstock
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-451-39792-9ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83478-3
INHALT
I. HERZENSBILDUNG
Das Gleichnis vom »barmherzigen Samariter« gehört zu den bekanntesten Texten der Weltliteratur. Es erzählt die einfach klingende und doch sehr hintergründige Geschichte von einem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho von Räubern überfallen wurde: »Sie zogen ihn aus, schlugen ihn wund, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester auf jenem Weg hinunter, sah ihn an und ging vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Der kam an den Ort; auch er sah ihn an und ging vorüber. Ein Samariter, der unterwegs war, kam ebendahin, sah ihn an, und es war ihm weh ums Herz. Er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zum Wirtshaus und versorgte ihn. Am anderen Morgen zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Versorge ihn, und was du etwa dazuhin aufwendest – ich gebe es dir zurück, wenn ich wieder herkomme.«1 (Lk 10,30–35)
Ins Auge springt das dreifache »er sah ihn an«. Die Weise, wie der Mann aus Samarien sieht, unterscheidet sich allerdings vom Sehen des Priesters und des Leviten. Die unterschiedlichen Reaktionen machen das deutlich. Die einen gehen weiter, der andere bleibt stehen und wendet sich zu. Der Priester und der Levit »haben Augen und sehen nicht« (Mt 13,5), der Samariter hingegen hat Augen und sieht. Er sieht mit dem Herzen, entsprechend dem bekannten Wort aus dem Kleinen Prinzen: »Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« (Antoine de Saint Exupéry) Herzensbildung besteht in dieser spezifischen Wahrnehmungskompetenz.
Das ansprechbare Herz
Was hindert den Priester daran, mit dem Herzen zu sehen? Shalom Ben Chorin vermutet, dass er den Mann für tot hält. Er weicht ihm aus, um sich nicht zu verunreinigen. Wenn er den Leichnam berühren würde, könnte er für einige Zeit nicht mehr am Tempeldienst teilnehmen.2Das gilt auch für den Leviten. Denn auch er steht ja im Dienst des Tempels, zum Beispiel als Chorsänger. In beiden Fällen läge also die Pointe in der Gegenüberstellung »Ritual contra Herzenspflicht«.3
Der Priester und der Levit geben dem Ritual den Vorrang. Ihre Entscheidung steht, so gesehen, für mehr. Sie steht für eine Haltung. Die Haltung ist es, die mehr oder weniger blind macht. Vielleicht spüren die beiden Kleriker noch den leisen Impuls in ihrem Herzen, der ihnen zuflüstert: »Es könnte sein, dass der Mann nicht tot ist, sondern ohnmächtig.« Aber diese innere Stimme ist zu schwach angesichts des hohen Interesses daran, rechtzeitig und vor allem rein den Dienst im Tempel anzutreten. In ihrem Herzen, so könnte man sagen, haben sie bereits anders entschieden, bevor sie sich auf den Weg nach Jericho machten. Ihr Herz war beim Tempel. »Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.« (Mt 6,21) Oder vielleicht präziser: Ihr Herz war bei einer Pflicht, die für sie keine Ausnahme zuließ. Das machte ihre Haltung aus.
Der Samariter hingegen »sieht«. Es ist ihm »weh ums Herz«, und er geht hin. Vielleicht hat auch er eine Pflicht, der er eigentlich nachkommen müsste. Aber sie hält ihn nicht davon ab, dem inneren Impuls in dieser konkreten Situation den Vorrang zu geben und zu handeln. Dahinter steht eine Haltung: Sensibilität für Leiden kommt vor Regelsensibilität. Auch sinnvolle Regeln und Verpflichtungen müssen zurückstehen können, wenn die Möglichkeit besteht, ein Leben zu retten.
Für den Gesetzeslehrer, der das Gespräch mit Jesus und damit auch die Erzählung einleitete, enthält das Gleichnis noch eine weitere Provokation. Ihm, einem jüdischen Gesetzeslehrer, wird ausgerechnet ein Mann als Vorbild vorgehalten, der aus Samarien stammt. Das Verhältnis von Juden und Samaritern ist ja beiderseits angespannt. Wenn im Gleichnis nun ausgerechnet der Samariter im Unterschied zu den jüdischen Klerikern der Herzenspflicht folgt, ist ein weiteres Thema angesprochen. Die Frage, die der Gesetzeslehrer stellte, lautete ja: »Wer ist mein Nächster?« Zunächst einmal, so die Antwort im Gleichnis, einfach »ein Mann«, oder auch einfach »ein Mensch«, eben derjenige Mensch, der gerade halbtot am Wegesrand liegt. Jeder und jede könnte also »mein Nächster« sein, eben diejenige Person, über die ich gerade stolpere oder die sich mir gerade in den Weg stellt.
Es kommt aber noch etwas hinzu. Die Gegenfrage, die Jesus dem Gesetzeslehrer am Ende des Gleichnisses stellt, lautet: »Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem zum Nächsten geworden, der von den Räubern überfallen wurde?« Nun richtet sich das Scheinwerferlicht auf den Samariter, nicht mehr auf den halbtot geschlagenen Mann. Er ist dem Menschen am Wegesrande zum Nächsten geworden. Er, der Samariter, hat nämlich nicht gefragt, ob der geschlagene Mann am Wegesrand ein Jude, Römer, Grieche oder Samariter ist. Er hat diese Unterscheidung hinter sich gelassen. Er war offen für den Moment, ohne sicherheitshalber zu sortieren. Man kann daraus auf einen spontanen »menschlichen« Impuls schließen. Aber vielleicht steckt auch mehr dahinter, etwas, das mit Bildung im weitesten Sinne zu tun hat. Menschen nicht zu sortieren gehört zu seiner Haltung.
Die Frage, wer »mein Nächster« ist, wird bereits in der Tora diskutiert. Sie ist nie ganz ausdiskutiert, weil sie den Verstand immer »belästigen« (Immanuel Kant) wird. »An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« (Lev 19,18) Hier ist von den Kindern des eigenen Volkes die Rede. Das ist eine ziemlich weitgehende Einschränkung des Personenkreises, für den die Pflicht zur Nächstenliebe gelten soll. Nächstenliebe in diesem Sinne kann dann durchaus zusammengehen mit Gleichgültigkeit gegenüber denen, die nicht zu den »Kindern meines Volkes« gehören. Die Einschränkung auf die Kinder des eigenen Volkes wird allerdings in der Tora einige Zeilen später aufgehoben: »Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst.« (Lev 19,34) Doch damit sind wiederum nicht alle Fragen erledigt. Diskutiert wird weiterhin, ob mit dem »Fremden« (hebräisch: ger) auch schon der »Ausländer« (nokri) gemeint ist oder nicht. Zwar sind »Ausländer« in der Tora nicht rechtlos, aber eine Spannung zum »Fremden« bleibt dennoch bestehen, sofern unter dem »Fremden« der innerisraelitische Migrant zu verstehen ist.
Das führt zu der Frage, ob es eigentlich überhaupt erlaubt ist, zwischen dem Nahen, dem Näheren und dem Nächsten zu unterscheiden. Heute ist das Thema in der Migrationsdebatte besonders virulent. Haben Staat und Politik höhere Pflichten gegenüber den Angehörigen des eigenen Volkes als gegenüber Personen aus anderen Völkern, die die Grenze überschreiten, weil sie vor der Verfolgung oder Armut im eigenen Lande fliehen? Unvergessen ist die Szene im Juli 2015 zwischen Angela Merkel und einer Schülerin der Rostocker Paul-Friedrich-Scheel-Schule. Reem Sahwil ist mit ihrer Familie aus Palästina in den Libanon und von dort aus nach Deutschland geflohen. Sie erzählt der Bundeskanzlerin während eines Bürgerdialogs vor laufenden Kameras ihre Geschichte. Seit vier Jahren lebt sie in Rostock, sie will studieren und ihre Zukunft planen »so wie jeder andere auch«. Aber sie und ihre Familie können jeden Moment in den Libanon abgeschoben werden. Die Kanzlerin steckt in einer Klemme. Sie ist einerseits bewegt: »Du bist ein unheimlich sympathischer Mensch«, aber andererseits muss sie hart bleiben oder meint hart bleiben zu müssen, da ihr der hoheitliche Gestus eines spontanen, man könnte auch sagen: eines willkürlichen Gnadenaktes aus naheliegenden Gründen verwehrt ist. Sie sagt zu Reem: »Das ist manchmal auch hart – Politik.« Und weiter: Es könnten nicht alle kommen, das schaffe Deutschland einfach nicht; im Libanon und in Afrika säßen noch Tausende. Die Schülerin nickt, und dann fängt sie an zu weinen. Die Kanzlerin zögert kurz, geht auf Reem zu. »Du hast das doch prima gemacht«, sagt sie und will die Schülerin trösten. Der Moderator schaltet sich ein: »Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht.« Es gehe um die belastende Situation. »Das weiß ich, dass das eine belastende Situation ist, und deswegen möchte ich sie trotzdem einmal streicheln«, sagt Merkel – und streichelt Reem.
Auch wenn das Herz Not sieht, kommt es an Abwägungsvorgängen nicht vorbei. Im Falle des Samariters ist die Lösung einfach: Hingehen, helfen, sorgen. Und dann weitergehen. Der Samariter scheint ein wohlhabender Mann zu sein, vielleicht ein Händler. Er kann aus der Fülle schöpfen. Und er scheint in dieser Situation für sich allein stehen und für sich allein handeln zu können. Er nimmt niemandem etwas, wenn er gibt, weil das, was er gibt, nichts ist, worauf andere einen Anspruch haben könnten, etwa seine Kinder, seine Familie oder andere Personen: Angestellte, Gläubiger, wer auch immer. Spontane Regungen des Herzens können aber in Zielkonflikte führen, wenn dritte und vierte Personen in meine Entscheidung mit hineingezogen werden. Menschen handeln in der Regel nicht für sich allein. Spätestens dann aber, wenn es um mehr geht als um zwei Personen, kommt die Kategorie der Abwägung mit ins Spiel. Wem entziehe ich mich, wenn ich mich einer ande- ren Person zuwende? Wem enthalte ich etwas vor, wenn ich gebe? Manchmal sind da Kompromisse nicht möglich. Not und Liebe fordern Entscheidungen heraus, die nur dann stimmen, wenn sie nicht halbherzig erfolgen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter stellt zwar die Herzenspflicht über die Folgsamkeit gegenüber dem Ritual. Aber das lässt sich nicht verallgemeinern, zumal nicht jeder gefühlte Anspruch an mich schon meine Herzenspflicht ist. Um hier unterscheiden zu können, bedarf es also der Offenheit für Abwägungsprozesse, auch auf der Ebene des Herzens.
Für Abwägungsprozesse braucht es Gründe für die eine und Gründe für die andere Richtung. Das gilt auch für die Abwägung auf der Ebene des Herzens. Blaise Pascal brachte es auf den Punkt: »Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point – Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt.«4Die Gründe des Herzens lassen sich nicht auf die Begriffe der Vernunft bringen, jedenfalls nicht diejenige Sorte von Vernunft, wie sie Pascals Zeitgenosse René Descartes verstand. Herzensgründe haben ihre eigene Logik. Sie stehen eher für Ausnahmen als für Regeln. Sie lassen Widersprüche zu. Aber gerade deswegen sind sie noch lange nicht bloß irrational. Die Logik des Herzens ist eine Logik eigener Art. Die biblische Tradition bringt das zum Ausdruck, indem sie – im Unterschied zu den platonischen Traditionen – den Verstand im Herzen ansiedelt, nicht im Kopf.
Beide Logiken – die des Herzen und die des Verstandes – sind einander nicht hierarchisch zugeordnet, so als ob die eine Logik die andere beherrschen könnte. Es bleibt dem Herzen Spielraum gegenüber der Vernunft mit ihren allgemeinen, widerspruchsfreien Geltungsansprüchen. Das ist nicht antirational gemeint. Herz steht nicht gegen Vernunft, wie es dumme Sprüche nahelegen nach dem Motto: »Wenn das Herz brennt, rußt der Verstand.« Gerade das gebildete Herz weiß, dass es sich nicht so verhält. Im besten Fall reichen einander Herz und Vernunft die Hand, und für den Fall von Spannungen zwischen beiden gibt es keine einfachen Lösungen durch prinzipielle Voroder Nachordnung des Verstandes vor dem Herzen oder umgekehrt.
In der ignatianischen Tradition hat das komplexe Zusammenspiel der beiden Logiken in dem Modell von drei Erkenntnisstufen Ausdruck gefunden, auf denen Entscheidungen getroffen werden. Ich stelle mir zur Veranschaulichung den Samariter vor, der den geschlagenen Mann ansieht, aber zugleich auch weiß und spürt, dass er ernst zu nehmende Pflichten hat, die ihn dazu drängen, weiterzugehen. Die rationale Abwägung auf der Ebene der Vernunft ist die erste Stufe, die ihm zur Verfügung steht. Dort werden Pro- und Contra-Argumente abgewogen und bilanziert. Auf der zweiten Stufe geht es um »spüren und verkosten«5der inneren »Bewegungen«,6ein nach innen hin gerichteter Vorgang. Auf dieser Stufe lässt der Samariter das Besondere der Situation an sich heran und versucht, es innerlich zu erfassen. Er spürt, wie sich die beiden Waagschalen in seinem Inneren hin- und herbewegen, bis sich ihm zeigt, auf welche Seite der beiden Alternativen die innere Waage sich neigt. Solche Reflexion setzt innere Freiheit gegenüber äußerem Druck voraus, eine spezifische Form von Festigkeit, die zur Herzensbildung dazugehört. Und schließlich gibt es die dritte Stufe der Erkenntnis durch unmittelbare Evidenz.7Hier muss nicht mehr abgewogen werden, denn es besteht zweifelsfreie Klarheit. Man kann sich den Samariter auf allen drei Stufen der Erkenntnis vorstellen. Jedenfalls: Indem er sich dem Menschen in Not zuwendet, ist er es, der dem Menschen zum Nächsten geworden ist, und zwar durch seine Entscheidung. Ignatius würde sagen: durch seine »Wahl«.
Es gibt noch ein Argument dafür, Differenzierungen im Begriff des Nächsten zuzulassen und zu reflektieren: Nur ein Allgegenwärtiger kann sich allen Menschen als Nächster zuwenden. Menschen sind nicht allgegenwärtig. Der Samariter befindet sich nicht überall, sondern auf einem bestimmten Weg, und er wendet sich einem Halbtoten zu, nicht allen, nicht einmal allen anderen Halbtoten auf dem Weg. »Sie zogen ihn aus, schlugen ihn wund, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen.« Der Samariter geht eine besondere Verantwortung gegenüber diesem einen Menschen ein. Er kann die Verantwortung nicht abschütteln, wenn er den nächsten Geschlagenen am Wegesrand sieht, um sich dann diesem zuzuwenden. Wer Verantwortung für andere Menschen übernimmt, schränkt sich damit auch in seinen Handlungsmöglichkeiten ein.
Die Logik des Herzens drängt zu Entscheidungen. Diese haben in der Folge auch einen exklusiven Aspekt. (Ehe-) Partner haben einander gegenüber höhere Pflichten als gegenüber Menschen, mit denen sie nicht verheiratet oder sonst wie verbunden sind. Eltern haben höhere Pflichten gegenüber ihren eigenen Kindern als gegenüber den Kindern anderer Eltern. Die eigenen Kinder sind ihnen die Nächsten« geworden. Sie haben keinen Erziehungsauftrag gegenüber den Kindern anderer Eltern. Die höheren Pflichten, die sie gegenüber den eigenen Kindern haben, sind nicht verallgemeinerbar. Oder anders herum gesagt: Sie haben gegenüber den Kindern anderer Eltern nur verallgemeinerbare Pflichten. Es wäre ja herzlos, wenn sie sich einem Kind, dessen Not sie lindern könnten, nur deswegen nicht zuwenden würden, weil es nicht ihr Kind ist.
Die Exklusivität von besonderer Verantwortung hebelt also den »ethischen Universalismus« keineswegs aus. Das gehört zur Pointe des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Egal ob Jude, Samariter, Grieche oder Römer – das wehe Herz« überwindet die Grenzen von Volks-, Stammesoder Clanzugehörigkeit. Übernahme von Verantwortung schränkt zugleich Handlungsmöglichkeiten ein. Das bleibt eine Spannung. Sie wird auch im Herzen gefühlt. Sie ist nicht nur eine Spannung zwischen Herz und Verstand. Nur das ungebildete Herz entzieht sich dieser Spannung durch trügerische Eindeutigkeit.
Das ungebildete Herz
Die beiden Kleriker im Gleichnis vom barmherzigen Samariter geben der Regelobservanz den Vorzug vor der Sensibilität für Leiden. Je öfter sie dies tun, umso mehr wird diese Entscheidung zu ihrem Habitus, zu ihrer Grundhaltung. Das Ergebnis ist Gleichgültigkeit, mangelnde Herzensbildung. Sie kann einhergehen mit intellektueller Hybris. Bildung – oder das, was sich für Bildung hält – sowie Regelobservanz können Hand in Hand gehen. Man muss ja geschult sein, um das ganze Regelwerk, seine genehmigten Ausnahmen und den jeweils neuesten Stand der Auslegungstradition zu kennen, die »Überlieferung der Alten« (Mk 7,5). Der Samariter kennt diese komplexen Diskurse nicht. In diesem Sinne ist er »ungebildet«.
Im November 1939 versuchte der Schreiner Georg Elser auf eigene Faust, Hitler und die Führungsspitze der Nazis durch ein Attentat töten. Nach dem Münchner Abkommen vom 30. September 1938 war er endgültig zur Überzeugung gekommen, dass Hitler einen neuen Krieg plane und dass nur noch seine Tötung großes Unheil abwenden könne. Er zündete eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller. Das Attentat scheiterte. Elser wurde festgenommen und nach Folter und mehrjähriger Einzelhaft am 9. April 1945 im KZ Dachau ermordet. Die Nazis hielten ihn deswegen so lange fest, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Elser, ein »ungebildeter« Arbeiter, auf eigene Faust gehandelt hatte. Sie hielten ihn für eine Marionette ausländischer Geheimdienste und suchten deswegen nach Netzwerken und Drahtziehern hinter ihm, die es nicht gab. Auch nach 1945 konnte man sich nicht vorstellen, dass ein einfacher Schreiner über so viel politische Urteilskraft verfügte, um aus eigener Einsicht schon vor 1939 vorhersehen zu können, dass Hitler und die Nazis auf einen Krieg zusteuerten. Noch im Jahre 1999 war in seriösen bildungsbürgerlichen Kreisen der Vorwurf zu hören, Elser habe mit seiner Tat seine »politische Beurteilungskompetenz« überschritten. »Konnte … ein Durchschnittsbürger nach dem Münchner Abkommen im Herbst 1938 … begründet mutmaßen, dass ein Krieg, für den Hitler verantwortlich sein wird, unvermeidlich sein wird«,8wie Elser erkannte? Natürlich nicht! Oder eben doch?
Rückblickend kommt der Hochmut von solchen »Gebildeten« vor dem Fall. Es verhält sich ja genau umgekehrt. Weite Teile der gebildeten Schichten in der Weimarer Republik bis hin zu renommierten Intellektuellen und Universitätslehrern gingen Hitler und dem Nationalsozialismus ideologisch auf den Leim. Sie schätzten ihn taktisch falsch ein, hielten ihn für beherrschbar und steuerbar. Mehr noch: Belesene Vertreter der »konservativen Revolution« konnten oder wollten die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und die »Schmach von Versailles« nicht verwinden. Sie waren trotz aller äußeren Bildung emotional durch »alt gewordenen Zorn« gesteuert, durch nicht verwundene Kränkung.9Sie lieferten Hitler und den Nationalsozialisten die nötigen Begriffe für ihre Sprache. Sie bereiteten das Terrain für sie vor, auch wenn sie auf zugleich auf Hitler und sein Umfeld herabschauten, weil sie sie als Emporkömmlinge verachteten. Intellektuelle Hybris macht blind. Hingegen waren es oft einfache Leute, die »Ungebildeten«, die das richtige Gespür für den verbrecherischen Charakter des Regimes hatten.10Man kann ein Martin Heidegger sein und trotzdem einem Georg Elser an Herzensbildung unterliegen. Das gilt auch für die gelehrten Historiker, die sich nicht einmal nach dem Krieg dem Gedanken öffnen wollten, dass Elser aus eigener Motivation heraus handelte.
Das Gegenstück zur Hybris sind Minderwertigkeitsgefühle. Wer ein Leben lang hört: »Du bist nur ein Samariter« (oder: »Du bist nur ein Schreiner«), denkt am Ende tatsächlich, er sei tatsächlich »nur« ein Samariter (oder »nur« ein Schreiner). Auch diese Selbsteinschätzung kann sich in einer Haltung verfestigen, die blind macht. In der geistlichen Tradition wird sie unter dem Stichwort der »falschen Demut« verhandelt. Aus falscher Demut ergeben sich Pathologien des Herzens, die eine zerstörerische und auch selbstzerstörerische Macht haben, da die – reale oder bloß gefühlte – Minderwertigkeit als Abwertung durch andere erlebt wird.
Falsche Demut zeigt im schlimmsten Fall ihr wahres Gesicht, wenn sie in Hass umschlägt. Die Berliner Philosophin Hilge Landweer hat in diesem Zusammenhang kürzlich auf die Unterscheidung von Hass und Verachtung hingewiesen.11Das Gefühl des Hasses kommt aus der Opferposition, Opfer im Sinne von victim,12