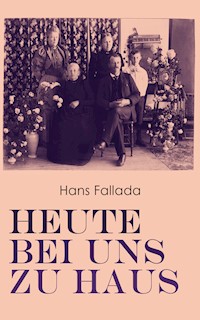
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Heute bei uns zu Haus" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Wir lebten in Frieden miteinander, mein Kühlein und ich. Wir waren mit ihr zufrieden, sie gab alle Tage an die zwanzig Liter Milch, sie war still und sanft, ohne alle Untugenden. Und auch sie schien zufrieden mit uns, gerne fraß sie ihre Portion Futterrüben und Wruken, darauf einen Arm Heu, darauf Stroh, so viel, daß sie satt wurde. Dann legte sie sich hin, käute wieder und produzierte Milch. Gott, sie war keinesfalls das Ideal einer Kuh; die Zeiten sind längst vorüber, da wir die beste Kuh landauf und landab im Stalle hatten. Man hat glückliche Zeiten mit seinem Vieh und weniger glückliche, aber so unselige Zeiten, daß wir mit unserer Kuh in Zwietracht lebten, haben wir jetzt zum erstenmal." Hans Fallada (1893-1947) war ein Künstler der Neue Sachlichkeit. Er orientiert sich an der Realität, auf die damalige Gesellschaft und auf deren Probleme ein, z. B. die Armut vieler Menschen. Die Voraussetzung dafür war ein kritischer Blick auf die damalige Gegenwart. Die Umgebung wurde nüchtern und realistisch dargestellt. Die soziale, politische und wirtschaftliche Wirklichkeit der Weimarer Republik, die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges und die Inflation waren beliebte Motive. Die Themen, die die Gesellschaft bewegten, fanden sich in der Literatur wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Heute bei uns zu Haus
Inhaltsverzeichnis
I. Kapitel Mit dem Heiraten fängt es an
Am Anfang und am Ende dieses Buches und auf allen seinen übrigen Seiten ist von meiner Frau Suse die Rede – auch wo nicht von ihr gesprochen wird. Sie erst hat mich zu dem gemacht, was ich geworden bin, sie hat einen Verbummelten wieder das Arbeiten gelehrt, einen Hoffnungslosen die Hoffnung. Durch ihren Glauben, ihre Treue, ihre Geduld wurde aufgebaut, was wir heute besitzen, was uns alle Tage freut. Und das alles geschah ohne viele Worte, ohne Aufhebens, ohne Schulmeisterei, einfach dadurch, daß sie da war, daß sie in guten und schlimmen Stunden zu mir hielt. Daß sie an mich glaubte. Daß sie so war, wie sie war. Güte und Geduld und Verzeihenkönnen, auch wo sie nicht verstand.
Heute, da ich diese Zeilen schreibe, feiern wir unsern vierzehnten Hochzeitstag, das heißt wir feiern ihn nicht, wir denken daran, daß wir jetzt dreizehn Jahre zusammengehören. Keiner menschlichen Gemeinschaft, die so lange gedauert hat, bleiben Stürme und Enttäuschungen erspart. Manches Jahr gab es, da konnte ich stolz sagen: »Wir haben uns noch nie gestritten. Wir sind immer einer Ansicht gewesen. Was ich wollte, wollte auch sie.«
Nun kann ich das nicht mehr sagen. Doch, wir haben uns gestritten. O ja, wir waren manchmal sehr verschiedener Ansicht. Und vor allem: da wir beide keine redseligen Menschen sind, so haben wir uns auch angeschwiegen. Das Anschweigen durch Wochen, durch Monate ist ein furchtbares Kampfmittel. Wir sind beide Wasserkantenmenschen, wir konnten zur Vollendung schweigen. Kein noch so wilder Zank ist auch nur halb so schlimm wie Schweigen. Diese ewige tote Stille im Haus, dieses trockene Schlucken statt eines ersten einlenkenden Wortes, dieses verstellte Parlieren vor den Kindern und den Haustöchtern und den Gästen – und dieses abgrundtiefe Schweigen, sobald wir beide wieder allein miteinander waren! Monate! Schreckliche Monate! Doch mit Glanz und Gloria stieg aus alledem wieder unser Zusammengehörigkeitsgefühl auf. Sie vergaß es auch in den dunkelsten Tagen nicht, daß wir zusammengehörten. Ich mochte noch so schwierig, noch so unleidlich sein, ich mochte mit allen Streit anfangen, wegen jeder Kleinigkeit wüten: sie bekam mich wieder zurecht. Einfach dadurch, daß sie da war. Daß ihre Güte, ihre Geduld, ihre Liebe über alles triumphierten. Daß sie unermüdlich wieder von vorn anfing, aufbaute, wo alles zerstört schien.
Da ich davon erzählen will, wie wir zu unserm kleinen Landeigentum kamen, muß ich zuerst berichten, wie ich zu Suse kam. Denn ohne Suse wäre nie etwas mit einem Eigentum geworden.
Es war im Jahre 1928, und ich saß in einem möblierten Zimmer in der Stadt Hamburg. Die Arbeitslosigkeit war schon ziemlich schlimm. Auch ich war arbeitslos, aber stempeln ging ich darum doch nicht. Ich brauchte ja so wenig zum Leben, nach einer Zeit der Verschwendung hatte ich mir fast völlige Bedürfnislosigkeit angewöhnt. Ich war der stolze Herr einer alten Schreibmaschine, und wenn gar kein Geld mehr im Hause war, lief ich die Hamburger Exporthäuser ab, bis ich Adressenaufträge hatte. Ich schrieb Adressen in allen Sprachen, deutsche zu zwei Mark fünfzig das Tausend, ausländische für einen Taler. Ich glaube, ich war konkurrenzlos billig.
Außer der Schreibmaschine besaß ich noch einen Anzug, einen Handkoffer mit ein bißchen Wäsche und drei oder vier Büchern und einen völligen Mangel an Ehrgeiz. Es war mir ganz egal, ob etwas aus mir wurde und was aus mir wurde. Ich war mittlerweile fünfunddreißig Jahre alt geworden und hatte eingesehen, daß sich alles Abstrampeln nicht lohnte. Ich hatte eben kein Glück. Wozu sich anstrengen? In meinen Papieren stand von Geburt an: Pechvogel.
Sechs Tage in der Woche bestand mein Essen aus Brot, zwei Bücklingen und einem halben Liter Milch, am siebenten Tag aß ich an einem Mittagstisch warm. Wenn ich nicht grade Adressen tippte, was möglichst selten geschah, trieb ich mich in der Stadt umher, am Hafen, im Gängeviertel. Ich kannte die seltsamsten Menschen und die anrüchigsten Kneipen; es machte mir Vergnügen, recht hundeschnäuzig mit mir und andern umzugehen. Meine Familie, will sagen, meine Eltern hatten mich noch immer nicht ganz aufgegeben, so oft und so gründlich ich sie auch entmutigt hatte. Aber ich hatte meine Familie aufgegeben, ich schrieb nur selten und kaum der Wahrheit gemäß.
Kurz gesagt: ich war mit aller Welt böse, weil ich noch immer nichts war. Nur mit mir war ich nicht böse, ich fand mich als Gesellschaft völlig ausreichend. Ich wohnte bei einer alten Frau in Hammerbrook, fünf Treppen hoch unter dem Dach. Meine Stube war hell und luftig, mit weißen Möbeln und buntgeblümten Bezügen, alles immer blitzsauber. Es war eigentlich das Zimmer der Tochter, in dem ich hauste, aber von dieser Tochter hatte ich noch nie etwas zu sehen bekommen. Ihre Kleider hingen noch in meinem Schrank, und dort konnten sie auch meinetwegen ruhig hängen bleiben. Ich brauchte den Schrank nicht, meine Kleider trug ich auf dem Leibe.
Allmählich erfuhr ich, was mit dieser ständig abwesenden Tochter los war. Sie war schon lange nierenkrank, und nun war sie von der Versicherung in ein Bad geschickt worden. Sie war eigentlich Lageristin in einem Engros-Geschäft für Damenputz, ein sehr fleißiges Mädchen, wie ihre Mutter stark betonte. Ihre Mutter, meine Wirtin, hielt nicht viel von mir, sie war auch fleißig, und ich war meistens stinkfaul. Morgens lag ich noch um zehn im Bett und sah mir die Stubendecke an. Wäre ich nicht ein so pünktlicher Zahler und ein so nüchterner Mensch gewesen, ich wäre nicht lange der Mieter dieser arbeitsamen Frau geblieben. So ließ sie mich hausen, nicht ohne Schelten, und an spitzen Bemerkungen über meine Bücklinge und den halben Liter Milch fehlte es nie.
Eines Tages nun teilte mir meine Wirtin mit, daß ich binnen vierundzwanzig Stunden mein Zimmer zu räumen habe, denn nun komme ihre Tochter zurück. Das war mir ganz egal, ob ich wohnen blieb oder weiterzog. Einen Winkel, in den ich meinen Handkoffer setzen, ein Bett, in das ich mich legen, eine Stubendecke, die ich anstarren konnte, fand ich überall. Hamburg war mir sowieso über, und der Hafen war mir über, und so bummelte ich auf den Hauptbahnhof und suchte mir ein Reiseziel. Ich wählte es nach meinem Barbestand, zu weit ab durfte es nicht liegen, eine Anzahlung auf die Zimmermiete mußte auch da sein, und das übrige würde sich schon finden. Das übrige hatte sich noch immer gefunden.
Der Morgen kam, und vom Hamburger Hauptbahnhof fuhr wohl mein projektierter Zug. Ich aber lag noch in meinem Bett und starrte die Decke an. Des Lebens Überdruß hatte mich wieder einmal besonders kräftig angefaßt, ich fand es so sinnlos, irgendwohin zu fahren, um was zu finden? Die Fortsetzung dieses Lebens? Also nichts!
Schließlich aber wurde ich doch aufmerksam auf ein ungewohntes Huschen und Wispern draußen auf dem Gang und dachte: ›Aha!‹
Darauf dachte ich: ›Das ist aber noch zu früh. Heute abend erst sollte ich rücken!‹
Ich stand langsam auf, stopfte, was ich besaß, in mein Köfferchen und ging in die Küche. Meine Wirtin war völlig allein. »Hören Sie«, sagte sie ein wenig aufgeregt, »die Suse ist schon gekommen. Können Sie das Zimmer nicht gleich räumen?«
»Der Koffer steht schon auf dem Gang«, antwortete ich. »Wieso überhaupt Suse? Ich denke, Ihre Tochter heißt Anna?«
»Heißt sie auch, aber wir haben sie immer nur Suse genannt, weil sie so susig ist.«
›Auch noch susig!‹ dachte ich. ›Wenn Suse wenigstens von Sausen herkäme! Aber susig und dann noch zu früh kommen!‹
Laut aber sprach ich: »Also denn tjüs! Ich haue ab!«
»Aber wohin denn?« rief die Schlummerolsche. »Ich muß doch die Post nachschicken können!«
»A. O. I.«, sprach ich würdig. »Alles ohne Interesse. Lassen Sie die Post an die Absender zurückgehen oder stecken sie hinter den Spiegel. Ich komme vielleicht mal wieder längs. Tjüs, Ollsche!«
»Oller verrückter Kerl!« rief sie mir noch nach.
Ich trällerte die fünf Treppen hinunter mit meinem Köfferchen, aber auf dem Gang unten sauste mich ein großes, helles, blondes Mädchen fast über den Haufen.
»Hoppla!« rief ich. »Ich denke, Suse kommt von susig, und nun kommt es doch von Sausen!«
»Ach so, Sie sind der Herr, der bei Mutter wohnt! Das ist aber gar nicht so eilig, daß Sie ausziehen, ich richte mich ganz gut eine Weile in Mutters Stube ein.«
Sie sah mich ziemlich neugierig an, die Ollsche hatte ihr wohl schreckliche Geschichten von mir erzählt. Und ich sah sie auch ziemlich neugierig an.
»Hätte ich das vor einer Stunde gewußt, wäre ich noch eine Weile im Bett liegengeblieben«, sagte ich schließlich. »Aber nun ist es doch ein angebrochener Tag, und ich ziehe!«
»Dann also alles Gute!« sagte sie, schüttelte mir unvermutet die Hand und sauste die Treppe hinauf.
Ich starrte ihr nach. Ich weiß sehr wohl, ein feiner Mann starrt einer Dame, die die Treppe hinaufläuft, nicht nach, und noch dazu derart unverschämt! Aber ich muß es leider sagen, daß ich nie ein feiner Mann war und auch nie ein feiner Mann werde. Ich starrte ihr unverschämt und mit Vergnügen nach. Ihre Beine liefen so schlank und blank die Treppe hoch, das Klipp-Klapp ihrer Absätze klang wie Geläut: Tripp–trapp–treppe!
Was eigentlich mit mir passiert war, davon habe ich keine Ahnung und kann also auch nicht davon berichten. Immerhin war ich fünfunddreißig Jahre alt und bei weitem nicht mehr das, was man einen heurigen Hasen nennt ... War es nun Liebe auf den ersten Blick oder war sonst was Rätselhaftes dabei, jedenfalls fuhr ich in einer völlig veränderten Stimmung in eine Stadt, die wir nach berühmten Mustern ›Altholm‹ nennen wollen. Nein, solche Geschichten machte ich natürlich nicht, daß ich nun in der Stadt Hamburg blieb, alle meine Dispositionen über den Haufen warf und jede Gelegenheit suchte, die junge Dame wiederzusehen. Nichts derart. Natürlich fuhr ich.
Aber etwas hatte sich doch verändert in mir, und wenn ich nur das lange Bettliegen aufgab. Ich hatte in Altholm irgendwelche Bekannte, und durch sie bekam ich dann auch eine Stellung. Plötzlich war ich ein tätiger Erwerbsmensch mit einem Bruttoeinkommen von hundertzwanzig Mark im Monat bei vierteljährlicher Kündigung. Ich hatte so lange in der Flaute gelegen, es überraschte mich selbst, wieviel Spaß es mir machte, daß jetzt wieder ein bißchen Wind in meinem Segel stand.
Du lieber Gott, ich lief nun nicht etwa herum und dachte immerzu an jenes kurze Kennenlernen im Treppenhaus. Ich stellte mir auch nicht die Beine vor, wie sie die Treppe hinaufgelaufen waren, ich war auch nicht stählern entschlossen, jetzt etwas Rechtes zu werden und dann vor meine verflossene Schlummermutter zu treten und sie um die Hand ihrer Suse-heißt-Anna zu bitten!
Nichts von alledem! Ich lief durch die Straßen Altholms und warb Anzeigen und Abonnenten für ein sachte dahinsterbendes Blättchen. Ich aß alle Tage warm im Guttempler-Haus und nach dem Essen zwickerten wir einen Kaffee aus. Zwickern ist ein ziemlich gerissenes holsteinisches Bauernspiel mit zweiundfünfzig Karten und einem Joker. Abends ging ich dann müde ins Bett und schlief ohne alle Träume von einer ferne ersehnten Geliebten.
Aber der Wind in den Segeln, der war es! Daß mir nach einer langen Periode der Schlaffheit und Gleichgültigkeit das Leben wieder Spaß machte! Hundertzwanzig Mark im Monat waren gewiß nicht erschütternd, ich hatte als zweiundzwanzigjähriger Bengel schon tausend Mark im Monat verdient (was mir gar nicht gut bekommen war), aber ich war wieder was, ich tat wieder mit. Abends lag ich im Bett und griente. Daß ich heute den Teppich-Bolle herumgekriegt hatte, uns doch ein Inserat zu geben, das freute mich! Teppich-Bolle hatte es ganz und gar nicht gewollt, aber ich hatte ihn weich gequatscht!
Die ganze Welt sah anders aus, wenn man zu einer richtigen Arbeit aufwachte. Es war bei mir, wie wenn über totes, ausgefrorenes Land der Frühling gekommen ist, plötzlich wurde es überall grün. Plötzlich fand ich es störend, daß ich gar keine Nachrichten mehr aus dem Elternhaus bekam. Jawohl, ich hatte meiner Wirtin gesagt, sie solle die Briefe zurückgehen lassen oder hinter den Spiegel stecken – vielleicht waren sie wirklich hinter den Spiegel gesteckt worden?
Schwindelte ich mir was vor, ging es mir um etwas ganz anderes als um Elternbriefe? Ich weiß es nicht mehr zu sagen, genug, ich fuhr über Sonntag nach Hamburg. Ob wirklich Briefe am Spiegel steckten, daran erinnere ich mich nicht, aber das weiß ich noch, daß die Ollsche nicht zu Hause war, wohl aber die Suse.
Was ist da noch viel zu erzählen? Wir beide haben einander vom ersten Augenblick an gern gemocht. Es war Winter, naßkalter, schmutziger, nebeliger Hamburger Winter. Aber wir waren jede Stunde miteinander unterwegs. Wir gingen nebeneinander her, wir froren, aber wir dachten gar nicht daran, daß wir froren. Wir hatten uns so unendlich viel zu erzählen, unser ganzes Leben hatten wir uns zu erzählen, wir vergaßen darüber alles.
Ach, diese Liebe auf den Straßen einer großen Stadt, die kein Heim hat! Manchmal jetzt sehe ich die jungen Liebenden nebeneinander hergehen, dicht und doch noch nicht eingehängt, und miteinander sprechen. Dann fällt die lange Stille zwischen sie, in der sie nur aneinander denken, ausruhen in dem Gefühl, zueinander zu gehören. Dann fangen beide wieder an zu reden, als hätte keines geschwiegen.
Und dabei wandern sie, sie streifen so viele Menschen und sehen nur sich. Ihre Füße gehen über die von tausend Füßen abgeschliffenen Granitplatten, und ihnen ist, als gingen sie einen ganz neuen Weg, den noch niemand vor ihnen gegangen. Manchmal bleiben sie vor einem Schaufenster stehen, aber sie sehen nichts. Sie stehen nur so da, vielleicht berühren sich ihre Hände einen Augenblick, dann ist es, als zitterte durch sie ein elektrischer Schlag.
Heute wie einstens wandern sie durch die Straßen der großen Städte, viele viele Kilometer, beieinander. Ihre Füße brennen, aber es treibt sie immer weiter, es ist, als erreichten sie gehend, miteinander redend und miteinander schweigend stets neue Bezirke ihres Innern, die das andere jetzt kennenlernen muß. Liebe auf den Straßen – wie sie mich an den, der ich einstmals war, erinnert! Hungrig und arm, zu arm, um sich auch nur eine Stunde in ein Cafe zu setzen, unsagbar reich!
Immer brachte mich Suse zum letzten Zug nach Altholm. Sie stand auf dem Bahnsteig und winkte mir nach. Aber kaum allein, fiel mir schon ein, was alles ich ihr zu erzählen vergessen hatte. Beim trüben Licht des Gasstrumpfs im Abteil des fahrenden Zuges fing ich an, ihr den ersten Brief nach unserer Trennung zu schreiben. Ich schrieb immer weiter, in Gedanken, im Halbschlaf, im Traum. In dieser Zeit habe ich ihr jeden Tag einen Brief geschrieben und manchen Tag zwei.
Und was waren das für Briefe! Nicht solche Zettelchen, kaum angefangen schon zu Ende, nein, es waren richtige Briefe, für einfaches Porto nahm die Post keinen von ihnen an! Ich glaube, mein Rekord war ein Brief von sechsunddreißig engzeiligen Schreibmaschinenseiten – wie ich daneben noch meine Tagesarbeit erledigte, ist mir heute rätselhaft. Wahrscheinlich schlief ich kaum noch, ich war mager wie ein Windhund, und wie ein Windhund jagte ich auch durch die Straßen, auf der Jagd nach Abonnenten und Inserenten. Ich mußte doch Geld verdienen!
Ein so ausgedehnter intensiver Verkehr konnte nicht lange vor den Augen von Suses Mutter verborgen bleiben. Ich habe es ja schon deutlich genug gesagt, daß Suses Mutter meine ganze Person mißbilligte, ich war ein geborenes Faultier, ein Mann, der morgens noch um elf im Bett lag und die Decke anstarrte! Ich sehe es noch, wie die gute Olsch ihre Fäuste über den Küchentisch weg gegen mich schüttelte: ich sollte ihr Mädchen nicht in Schanden bringen, ich nicht! Oh, meine liebe dermaleinstige Schwiegermutter nahm kein Blatt vor den Mund, sie sagte mir gründlich Bescheid!
Uns aber fiel es wie Schuppen von den Augen, und selten hat ein Paar so vergnügt einer zornigen Standpauke gelauscht! Selbstverständlich, wir konnten ja heiraten! Eine großartige Idee – schönen Dank, liebe Schwiegerolsch! Selbstverständlich, Sie haben vollständig recht, ich verdiene nicht annähernd genug, um einen Hausstand zu begründen, und ich besitze noch immer nicht mehr als einen Handkoffer mit ein bißchen Wäsche. Aber was macht das? Sie arbeitet weiter im Damenputz en gros in Hamburg und ich als Zeitungswerber zu Altholm – aber dann gehören wir doch zusammen!
Selten hat ein Paar mit so völlig unmotivierter Hast geheiratet wie wir. Ich glaube, wir haben uns ganze acht- oder neunmal bis zu unserer Heirat gesehen. Wir konnten es gar nicht abwarten, uns in Ketten zu schlagen. Selbstverständlich stießen wir mit überwältigendem Ungeschick unsere gesamte Verwandtschaft, auf beiden Seiten, mit unserer Heirat vor den Kopf! Alle stellten wir vor die vollendete Tatsache, niemand erfuhr vorher etwas davon. Das war natürlich wieder einmal meine Idee, ich bin mein Lebtage der ungeschickteste Diplomat von der Welt gewesen. Natürlich konnte ich Verwandtschaft nicht ausstehen! Ich hatte sämtlichen Verwandten, am meisten aber meinen lieben Eltern, soviel Sorgen gemacht, daß ich ihnen das nun schon gewaltig übelnahm! Sollten sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern – was ging das die an, ob wir heirateten! Und ganz selbstverständlich bezog ich auch Suses sämtliche Verwandtschaft in diese Abneigung ein – größtenteils ohne sie überhaupt zu kennen. Und ebenso selbstverständlich brauchten wir lange Zeit, um die Verwandtschaft wieder zu versöhnen.
Nur mit Suses Mutter machte ich eine Ausnahme – warum weiß ich eigentlich nicht. Bei ihr hätte ich den meisten Grund gehabt, sie aus der Verwandtschaft zu verstoßen, denn noch immer hatte sie keine Sympathien für den fünfunddreißigjährigen Mann, der es noch zu nichts im Leben gebracht hatte, öfter sagte sie es mir recht deutlich, gar nicht durch die Blume, daß ihre Tochter nicht mutig, sondern ›mall‹, das ist verrückt, sei, sich mit so einem, wie ich war, einzulassen.
Im stillen gab ich ihr sogar recht. Das heißt ich fand zwar nicht, daß Suse mall, wohl aber, daß sie geradezu tollkühn war, auf den Heiratsvorschlag einzugehen. Tief im geheimsten Innern habe ich bis zur letzten Stunde geglaubt, es würde noch etwas dazwischen kommen, sie würde sich besinnen und abspringen. Und wer weiß, ob mir das – trotz all meiner Liebe – nicht ganz recht gewesen wäre. Denn zum erstenmal im Leben hatte ich Angst, wie das alles weitergehen würde, wenn es wirklich zu einer Heirat kam.
Für mich hatte ich nie Angst gehabt, aber jetzt kam sie – die Angst vor der Verantwortung. Suse erwartete so viel von mir, sie hielt mich wirklich für etwas, das spürte ich, trotzdem sie nie ein Wort darüber sprach. Was aber war ich? Ein Mann, der mit einem seltenen Geschick sich selbst alle Lebensmöglichkeiten zerstört, der alle hilfreichen Hände müde gemacht hatte. In einem Alter, wo alle meine Schulgefährten schon in sicheren Stellungen saßen als Ärzte, als Anwälte, als Oberstudienräte, als Sanskritforscher und Professoren – da war ich der kleine Anzeigenwerber eines dahinsterbenden Blättchens!
Aber Suse sprang nicht ab! Am Sonnabend vormittag um neun Uhr sagte ich der gänzlich überraschten Schwiegermutter, um halb elf würden wir auf dem Standesamt getraut, und sie möge doch als Trauzeugin ihr gutes schwarzes Kleid anziehen. Suse hatte sehr zu trösten an ihrer Mutter, die war ganz verzweifelt, kein Festessen vorbereitet, keine Gäste geladen, die Schwestern der Braut wußten gar nichts. »Ihr lauft ja zusammen wie die Wilden in Afrika, und ebenso werdet ihr in vier Wochen wieder auseinander laufen!«
Zwischen den Tröstungen Suses setzte ich der Schwiegermutter auseinander, daß weder Essen noch Gäste notwendig seien, wir führen direkt hinter der Trauung nach Berlin. Es war ein Sonnabendvormittag, der Sonntag lag vor uns, und den Montag hatten wir beide frei bekommen, wir planten eine Hochzeitsreise von zwei und einem halben Tag!
Ich sehe meine Schwiegermutter noch vor dem Standesamt stehen: es war ein kalter, regnerischer Tag, dieser fünfte April 1929. Die Trauung hatte sich etwas verspätet, wir hatten zu tun, unsern Zug auf dem Hauptbahnhof zu erreichen. Überstürzt kletterten wir auf die nächste Elektrische. Sie stand da, mit einem grimmigen Gesicht, dem das Weinen doch so nahe war. Da kam der fremde Kerl und schleppte ihre geliebte Jüngste mit sich fort. Es war nicht abzusehen, was daraus wurde! Gutes aber gewiß nicht.
Wir aber fuhren nach Berlin. Im Zuge saß ich, betrachtete heimlich den schmalen goldenen Ring – mit vereinten Kräften hatte es sogar zu echt goldenen Ringen gereicht. Das erste Glied einer langen Kette, das einzig sichtbare Glied einer unsichtbaren Verkettung – wie würden die anderen Glieder aussehen? Würden sie sehr drücken? Würde ich wünschen, dieses erste Glied nie auf mich genommen zu haben?
Ich begegnete Suses ein wenig gespanntem Blick. Sie dachte an Berlin und an meine Freunde, die uns dort erwarteten: ihr Debüt in einer neuen, ganz anderen Welt. Sie hatte Lampenfieber. Ich nickte ihr zu, und wir traten beide auf den Gang des D-Zuges hinaus, hielten uns dort bei der Hand, fühlten, daß wir zueinander gehörten, und die Welt glitt an uns vorüber.
Natürlich wurde Berlin ein Erfolg, will sagen, Suse wurde bei meinen Berliner Freunden ein Erfolg. All jene, die mich einmal jung und hoffnungsfroh gekannt hatten, die dann mit Bekümmernis meinen Niedergang erlebt und sich doch noch ein Stück Glauben an meinen Stern bewahrt hatten – all diese, ach, es waren nicht mehr viele, begrüßten Suse mit einer Freude und mit einer Herzlichkeit, als habe sie immer zu ihnen gehört.
Für Suse war es eine fremde Welt, Menschen dieser Art hatten nie zu ihrem Verkehrskreis gehört. Lange fühlte sie sich unsicher, sie war sehr still. Aber sie hatte immer zu ihnen gehört, sie besaß ihr Bürgerrecht in der Welt allen wahrhaften Menschentums, wo Auszeichnungen verliehen und Liebe und Vertrauen gegeben werden unabhängig von Stellung und erlerntem Wissen. Ich war sehr stolz auf meine Suse, ich fühlte mich jenen Hamburger jungen Männern sehr überlegen, die nie gemerkt hatten, mit wem sie da alle Tage umgegangen waren.
Gute zwei Tage – und zurück in das kleine Leben, sie kehrte heim zum Damenputz und ich zu meiner Zeitung. Wir würden sparen, sparen, sparen, arbeiten und sparen, bis wir endgültig in die Stadt Berlin heimkehren konnten! Eiliger Abschied auf dem Hamburger Hauptbahnhof, zwei junge Eheleute trennen sich.
»Schreib auch bald, Junge!«
»Ich fange sofort im Zuge an. Den ersten Brief stecke ich schon ein, wenn ich in Altholm ankomme!«
Habe ich es nicht erwähnt, daß es in Hamburg bei unserer Trauung nieselte, und daß es in Berlin regnete, jede gesegnete Stunde? Nun, wir waren beide mehrfach um die Füße herum gründlich naß geworden, und viel Zeug zum Wechseln hatten wir nicht in unserm gemeinschaftlichen Köfferchen. Das Schicksal spuckte uns beiden gleich zu Anfang unserer Ehe kräftig in die Suppe. Mit dem Sparen wurde es nichts, das Geldausgeben gelang uns schon besser. Erst war die Suse verschnupft, dann hustete sie, dann blieb sie im Bett, und dann wurde sie krank geschrieben: Nierenentzündung. Wieder einmal, nachdem sie grade sechs Monate auf der Nase gelegen hatte!
Aber das konnte ich nun wirklich nicht einsehen, daß sie da in Hamburg einsam und verlassen in ihrem Bett liegen sollte! Mußte sie krank sein, konnte sie das ebensogut und zehnmal besser bei mir in Altholm. Hundertzwanzig Mark sind nicht viel, aber wie die klugen Leute, die es nie versucht haben, mitteilen, lebt ein junges Ehepaar ja eigentlich billiger als ein Junggeselle. So mietete ich denn ein möbliertes Zimmer auf dem Kuhberg zu Altholm, mit Küchenbenutzung.
Es hat ja doch seine Vorteile, wenn man so ein Werber ist, immer auf den Beinen, immer in der Stadt herum. Kein Chef kann einen kontrollieren. Alle Augenblicke brach ich zwischen zwei Werbungen auf dem Kuhberg ein, da lag meine Frau im Bett. Man denke sich dies: nach sechsunddreißig einsam verbrachten Jahren eine Frau, die nur auf mich wartete, die für alles, was ich erlebte, Interesse hatte, die immer Partei für mich nahm!
Ich fegte und wischte Staub, ich pflegte und küchelte, ich kaufte ein und packte aus – und dann stürzte ich wieder los auf mein nächstes Opfer, mit einem Elan, keines widerstand mir! Ich schaffte Geld ins Haus, unsere Abonnentenzahl stieg sprunghaft, jeden Tag um drei oder vier, das waren Zeiten! Ich sehe mich da noch in der kleinen Küche stehen, die unter der Dachschrägung eingebaut war, gradestehen konnte ich nicht, und da komponierte ich die wunderbarsten Diätgerichte, die alle salzlos sein mußten. Wie sich das festgesetzt hat in mir! Noch heute kann ich kein normal gesalzenes Gericht essen, mir schmeckt alles versalzen, Suse hat die salzlose Kost längst über, ich nicht!
Und das Leben geht weiter, Suse läuft wieder herum, aber nun ist natürlich kein Gedanke mehr an Trennung. Wir haben uns so aneinander gewöhnt, was wir Jahre ertrugen, die Einsamkeit, scheint uns nun nach ein paar Monaten Umlernens untragbar. Sie sollte wieder in ein Geschäft gehen? Keineswegs! Hier bist du, bei mir bleibst du – von nun an bis in alle Ewigkeit!
Zwar das Geld, dieses verdammte Geld! Ich quetsche aus meinem Blättchen heraus, was nur möglich ist. Wir kochen Erbsen für die halbe Woche, und weil unser Appetit auf Erbsen stark nachläßt, reichen die Erbsen für eine ganze Woche – und dann feiern wir eine Orgie in frischen Krabben aus dem fettigen Papier und verschwenden alle Ersparnisse!
Der Kuhberg, diese Tauentzienstraße Altholms, ist zu teuer für uns, wir ziehen in eine Dachwohnung, wiederum möbliert, denn Möbel haben wir natürlich immer noch nicht. Rechts wohnt eine Arbeiterin aus der Lederfabrik, links eine uralte Oma – was hatten wir für gute und getreue und hilfreiche Nachbarn!
Wir nehmen auch ein Kind an, Hulemule, eine kleine verstoßene Straßenkatze, die sich naß und verhungert zu uns gefunden hatte. Sie machte uns viele Sorgen, die Hulemule, sie konnte das Herumtreiben nicht lassen. Suse putzte sie, Suse hatte ihr ein Sandkistchen eingerichtet, Hulemule hatte es gut und warm und satt bei uns. Aber immer wieder riß sie aus, blieb zwei, drei Tage fort und kam naß und stinkend und verhungert wieder zu uns zurück. Dann schalt Suse die böse Hulemule aus, sie rieb sie trocken und putzte sie und machte sie warm, bis sie wieder schnurrte, und dabei schalt sie das böse, das unverbesserliche, das herumstrolchende Kind.
Ich aber dachte vielleicht ein bißchen an einen Sohn, der sich auch immer wieder herumgetrieben hatte, und der nur nach Hause gekommen war, um wieder satt und warm zu werden, und der dann wieder ausbrach, ohne alle Dankbarkeit. Ich dachte vielleicht auch ein bißchen an meine eigenen Kinder, die ich doch eines Tages haben würde – ob die eines Tages auch so böse wie die Hulemule sein würden? In dieser Zeit lernte ich ein wenig anders über meine Eltern denken, wir kamen uns wieder etwas näher. Vielleicht machte es die Hulemule, vielleicht aber auch die Suse, daß der ewige alte Egoist ein wenig anders fühlen lernte.
Wie sollte es weitergehen? Trotzdem wir sehr sparten, reichte das Geld immer nur grade hin. Kein Möbelstück konnte angeschafft werden, Berlin lag ferner denn je. Ich lief durch die Straßen, ich drückte hundert Klingelknöpfe, ich leierte mein ewiges Sprüchlein ... Alle vier Wochen war ein Paar Schuhsohlen durchgelaufen, und was ein Mann, der bei jedem Wind und Wetter draußen sein muß, an Kleidung verbraucht, ist einfach niederschmetternd.
Da ist unser alter Chefredakteur – wollen wir ihn Stuff nennen? Nun gut, Herr Stuff, dieser Chefredakteur, der zugleich Lokalreporter, Gerichtssaal-Berichterstatter und Kritiker für Film, Theater und Konzerte ist, sagte eines Tages zu mir: »Ich habe da für Sonntag zwei Freikarten von der Reichsbahn für eine Tagesfahrt ins Blaue. Wollen Sie die Karten haben, meine Frau will nicht. Sie müßten aber eine Viertelseite über die Fahrt schreiben.«
»Da muß ich erst meine Frau fragen«, antwortete ich. »Heute nachmittag kriegen Sie Bescheid.«
Am liebsten hätte ich gleich ja gesagt, aber wir gingen stark auf Ultimo zu, und in unserer Kasse war tiefe Ebbe. Suse und ich rechneten hin und her, die Fahrt war frei, aber schließlich mußten wir ja auch was essen. So ganz ohne Geld loszufahren, das wagten wir doch nicht. Schließlich erwies sich der Drang, aus der Stadt herauszukommen, als zu groß: wir wagten unsere letzten fünf Mark und fuhren!
Es war ein strahlend heller Sommertag, der ganze Zug war vollgestopft mit vergnügten Menschen, die rieten, wohin wir wohl fuhren? Nun, wir fuhren über den damals noch neuen Hindenburgdamm auf die Insel Sylt. Wir stiegen aus in Westerland, ich nahm Suse bei der Hand, und wir liefen zum Strand. Wir sind beide immer Wassermenschen gewesen, Berge, nun meinetwegen, ganz schön, aber Wasser, du lieber Gott, Wasser, das Herrlichste von der Welt! Und Altholm war gänzlich wasserfrei.
»Los, Suse, ich rieche die See schon! Lauf!«
Aber am Strande harrte unser eine grimmige Enttäuschung, der Strand war durch Wälle und Draht gesichert gegen uns. Da waren kleine Einlaßkarten mit Schildern: ›Tageskurtaxe pro Person eine Mark‹ stand darauf zu lesen. Drunten sahen wir in der Sonne die See blitzen, aber sie war sicher vor uns. »Zwei Mark von unsern fünf Mark opfern, bloß um in das Gitter gelassen zu werden? Kein Gedanke daran! Komm, Suse, mal muß ja dieser dämliche Drahtzaun ein Ende nehmen!«
Und wir marschierten los.
(Wie sich das alles verknüpft! Diese beiden Karten von der Reichsbahn, diese Frau Stuff, die keine Fahrtlust hatte, unsere Geldknappheit, die uns die zwei Mark Kurtaxe verbot – und nun marschieren wir beide, noch völlig ahnungslos, dem Wendepunkt unseres Lebens zu. Wären diese Zeilen je geschrieben worden, wenn wir die zwei Mark ausgegeben hätten? Ich ahne es nicht! Aber es ist alles doch recht rätselhaft!)
Wir marschieren durch Sonne und Sand am Draht entlang, wir wandern durch die ein wenig extravagante Badeeleganz Westerlands mit Brusttüchlein und scharf gebügelten Strandhosen als ein paar städtisch gekleidete Leute. Suse trägt ihr Kashakleid – weiß der Henker, was ein Kashakleid ist, woher es seinen Namen hat. Aber ich habe nie ein Kleid so geliebt wie dieses Kashakleid mit seinen zarten, pastellhaften Farben. Sie trug es die ganze erste Zeit unserer Bekanntschaft und Ehe, an den schönsten Tagen. Wie viel ist uns aus dieser Zeit abhanden gekommen, ich denke nicht mehr daran, aber manchmal grolle ich noch heimlich mit Suse, daß sie nicht wenigstens ein Fitzelchen von dem Stoff aufbewahrt hat. Mir ist, als müßten bei seinem Anblick die alten goldenen Tage wieder aufleuchten, da wir uns noch so neu waren, da wir ein ganz anderes, ein ganz ungeahntes Leben zu zweien begannen. Aber es ist fort, ich kann es mir noch vorstellen, ich sehe sie noch darin, jung, lachend, unbekümmert, unenttäuscht. Und dann vergeht alles, und das Gesicht von heute kommt mit den Kleidern von heut. Ich erinnere mich nur.
Ich hatte es ganz richtig geahnt: auch der böswilligste Drahtzaun nimmt einmal ein Ende, und durch eine verlassene Dünenwildnis gerieten wir in einen Ort, der sich Kampen nannte. Wir aßen zu Mittag, Entenbraten – nie werde ich diesen köstlichen Entenbraten vergessen! Und nachdem wir die Zeche bereinigt hatten, erwies sich, daß wir noch Geld genug besaßen, um mit der Bahn von Kampen nach Westerland zurückzufahren. So gingen wir einmal ans Außenwasser und dann ans Binnenwasser, wir saßen still und rochen die See, die Wolken wanderten über uns hin, Wind kam auf, die Wellen hatten plötzlich weiße Köpfe, es wurde kühl ...
»Komm, Suse, laß uns noch einmal auf das hohe Ufer gehen und zur See hinabschauen. Wir haben noch gute zwanzig Minuten, bis unser Zug fährt.«
Unser Schicksal hat sich wirklich alle Zeit gelassen, in der letzten Minute griff es zu. Denn als wir da nun an das hohe Ufer kamen, stand dort ein großer braungebrannter Mann mit einer Baskenmütze auf dem Haupt. Er sah mich an, ich sah ihn an.
»Fallada!« sagte er.
»Ja, sind Sie das denn wirklich?« fragte ich staunend. Und nach zehnjähriger Trennung und Schweigen schüttelten sich Verleger und Autor die Hand.
Hier muß ich es gestehen, und ich lege dieses Geständnis nur in aller Eile und mit einer gewissen Beklommenheit ab, daß ich bereits in den Jahren 1919 und 1920 zwei Romane veröffentlicht hatte – als gänzlich unausgegorener junger Dachs. Es waren so eine Art Pubertätsromane, den Zeitverhältnissen entsprechend in etwas gestammeltem Deutsch geschrieben – und ich habe mich nie überwinden können, auch nur eine Zeile dieser Selbstbeschau wiederzulesen. Längst habe ich sie aus dem Buchhandel zurückgezogen, sie sind eingestampft, auch meine ältesten Freunde tun umsonst Kniefälle, sie bekommen doch kein Exemplar davon zu sehen.
Aber mein Verleger hatte diese beiden Bücher nicht vergessen; nach so vielen Jahren des Schweigens erkannte er seinen Autor wieder, der doch nur einer von vielen war (der aber einen nie abgearbeiteten Vorschuß erhalten hatte).
»Mensch, Fallada, was machen Sie denn eigentlich?«
Wir wurden der Frau des Verlegers vorgestellt, und zu vieren strebten wir nun dem Kampener Bahnhof zu. Ich stand stark unter dem Eindruck, daß die Verlegerin nicht grade gnädigen Auges auf diese so plötzlich aufgetauchten literarischen Bekanntschaften ihres Mannes schaute, die selbst für Kampen ein wenig schäbig gekleidet waren. (O Kashakleid, geliebtes!) So fiel mein Bericht etwas eilig und dürftig aus.
»Aber das ist doch nichts für Sie!« rief der alte Menschenkenner, der auch Ungesagtes zu hören verstand. »In so einem Kaff rumlaufen und Abonnenten werben! Sie müssen nach Berlin, Mensch!«
Ich tauschte mit der Suse einen eiligen, aufglühenden Blick. Dann bemerkte ich, daß ich kaum aufs Blaue hinaus nach Berlin ziehen könne ... die Arbeitslosigkeit ... ohne die geringste Reserve ...
Jetzt warf er einen abschätzenden Blick auf uns beide. »Was würden Sie in Berlin als Minimum zum Leben gebrauchen?« fragte er.
Wieder ein rascher Blicktausch mit Suse. »Das müßten wir uns erst ausrechnen. Dürfen wir es Ihnen schreiben?«
»Schön, schreiben Sie mir das möglichst bald. Ich besorge Ihnen dann eine Stellung, abgemacht!«
»Aber denken Sie bitte daran, daß ich sechs Wochen vor dem Quartalsersten kündigen muß!«
»Natürlich, natürlich! Wird gemacht! Verlassen Sie sich nur auf mich! Und nun Hals- und Beinbruch!«
Schon in der Bahn fingen wir beide zu rechnen an. Wir rechneten noch, als wir in Altholm waren. In der Wohnung rechneten wir weiter, und bis in den Traum hinein verfolgten uns Zahlenkolonnen unter den Titeln: Inventar – Wäsche – Brot – Fleisch – Gemüse – Kolonialwaren – Licht – Fahrgeld ... Es war gar nicht so einfach. Schon war uns klargeworden, daß die Hulemule nicht unser einziges Kind bleiben würde. Im nächsten Frühjahr ...
Das komplizierte die Rechnung außerordentlich, wir würden zwei möblierte Zimmer brauchen. Was kosteten in Berlin zwei möblierte Zimmer? Wir setzten den Mietspreis auf hundert Mark fest und kamen endlich auf ein Bruttogehalt von zweihundertfünfzig Mark. Es schien uns eine unverschämte Forderung, aber billiger war es nicht zu machen. Wir mußten ja so viel anschaffen, besonders auch für das Baby – wir hatten rein nichts! Mit Zittern und Zagen setzte ich die Zahl 250 in meinen Brief, mit Bangen steckten wir ihn in den Kasten – und nun warteten wir auf die Antwort. Wir warteten eine Woche, zwei Wochen, wir warteten auch länger. Am 15. August hätten wir auf den 1. Oktober kündigen müssen, aber ich wagte es nicht: Berlin schwieg. Weiter rannte ich auf der Jagd durch die Straßen Altholms, und nach den Tagen überwältigenden Hoffens überfiel mich die schwärzeste Verzweiflung.
Der Oktober ging vorüber, grau und naß empfing uns der November, immer grauer wurde meine Stimmung. Manchmal horchte ich drauf hin, wenn Suse bei ihrer Arbeit sang. Sie hoffte immer noch, die Arme! Es gab gar nichts mehr zu hoffen, weiter hieß es durch die Straßen Altholms zu traben, auf der Jagd nach den immer seltener werdenden Abonnenten. In Kürze würde unsere Zeitung dahinsterben – und was dann? Ich kann es auf meinen Eid nehmen, daß ich in diesen Monaten kein sehr fröhlicher junger Ehemann war. Suse lernte es gleich von Anfang an kennen, was trübe Stimmungen waren.
Der 15. November, der Kündigungstermin auf den 1. Januar, nahte. Ich entschloß mich zu einem zweiten Brief, den ich hinter Suses Rücken absandte. Dieser Brief war schon beweglicher gehalten, auch erniedrigte ich meine Gehaltsforderung auf zweihundert Mark. Ein Zimmer tat es schließlich auch – trotz Baby.
Neues Warten – und nichts erfolgte! Langsam verblaßten unsere einst so goldenen Hoffnungen. Meine Stimmung wurde wieder besser. Ich mußte mich eben mit meinem Schicksal abfinden. Auch in Altholm ließ es sich leben. Wenn die Zeitung einging, würde sich schon etwas anderes finden.
Dann, am 23. Dezember, als wir überhaupt nicht mehr an Berlin dachten, kam ein Brief in grünem Umschlag, auf grünem Papier. Es kam der Brief. Kurz und bündig: ab 1. 1. hätte ich eine Stellung für zweihundertfünfzig Mark in Berlin, am 2. Januar hätte ich mich um acht Uhr morgens auf dem Verlag zu melden.
Suse und ich, wir waren wie mit der Keule erschlagen! Da war das Glück, die große Chance, die hundertfach ersehnte, auf die wir längst nicht mehr zu hoffen gewagt hatten – und wir hatten nicht gekündigt! Eine gute Woche nur noch bis zum Antrittstermin!
»Ach!« sagte Suse. »Sie werden dich hier schon gehen lassen. Erzähle ihnen nur alles, sie werden deinem Glück schon nicht im Wege stehen!«
»Hätte er nur sechs Wochen früher geschrieben!« stöhnte ich.
»Er hat uns eben eine Weihnachtsfreude machen wollen«, meinte Suse.
»Natürlich, aber ...«
Später lernte ich, daß mein Verleger nicht im geringsten an Weihnachtsfreude gedacht hatte. Vielmehr hatte er die Einrichtung des Komposthaufens: alle Dinge, die er nicht gleich erledigen konnte oder wollte, kamen auf einen ständig wachsenden Haufen und lagerten dort ab. »Sie haben keine Ahnung«, sagte er mir später oft, »wieviel Sachen sich durch bloßes Lagern von selbst erledigen! Mein Komposthaufen ist eine wunderbare Einrichtung!«
Nahte aber irgendein verlegerischer Urlaub (in diesem Fall ein längerer Weihnachtsurlaub), so trat des Verlegers Sekretärin in Tätigkeit. Schon seit Jahrzehnten war sie bei ihm. Im Verlage hieß sie nur Anita, die Holzkuh, und sie war stolz auf diesen Namen. Mit unerschütterlicher Ruhe ertrug sie das ganze Jahr hindurch alle Temperamentsschwankungen ihres Chefs. Und ebenso unerbittlich hielt sie ihn zur Erfüllung seiner Pflichten an. Vor jedem Urlaub mußte der Komposthaufen abgetragen werden, da half ihm gar nichts. Anita war von zähem Holz.
Vor diesem Urlaub hatten auch meine beiden Briefe im Komposthaufen gelegen. Letzten Endes verdanke ich also die Änderung meiner Lebensumstände und meinen Wiedereintritt in die deutsche Literatur Anita, der Holzkuh ...
Ich ging also meinen schweren Gang zu dem derzeitigen Altholmer Brötchengeber. Schließlich konnte der Gang so schwer nicht sein. Der Mann hatte mir oft genug versichert, daß ich der überflüssigste Mensch unter der Sonne sei und daß er keine Ahnung habe, warum er mir eigentlich mein Gehalt zahle. Aber nun hörte ich es natürlich ganz anders, ich hatte schon das Richtige geahnt. Plötzlich war ich vollkommen unersetzlich. Jawohl, ich konnte gehen, aber erst nach ordnungsmäßiger Kündigung, am 1. April. Oder ich besorgte einen Stellvertreter, einen Ersatzmann, zu den gleichen Bedingungen, unter denen ich gearbeitet hatte, mit meinen plötzlich so ausgezeichneten Fähigkeiten ...
Nun, nachdem ich Ängste ausgestanden hatte, gab er mich frei. Schließlich war er doch nicht ›so‹, Suse hatte es richtig geahnt, er wollte meinem Glück nicht im Wege sein. Am letzten Dezember, am Silvestertag trafen wir in Berlin ein, mit sehr wenig Geld und mit zwei Handkoffern. Den letzten Tag des alten und den ersten des neuen Jahres verbrachten wir auf der Zimmersuche. Sie erwies sich als erstaunlich schwierig. Sobald eine Vermieterin – und leider waren es alles Frauen – meiner lebhaft gerundeten Frau ansichtig wurden, waren die Verhandlungen schon am Ende. Wir wurden nicht einmal zur Besichtigung der Räumlichkeiten zugelassen. Kindergeschrei? Windelwäsche? Danke bestens – nicht für uns!
Schließlich – Suse konnte schon keine Treppen mehr steigen – fanden wir zwei alte Leutchen in der Gegend von Alt-Moabit, die entweder keinen Blick für den Zustand meiner Frau oder gegen Kinder nichts einzuwenden hatten, wahrscheinlich weil sie selbst nie Kinder gehabt hatten. Es waren sogar zwei Zimmer, anständige große Räume; die Brandmauer des Hauses zeigte gegen den Bahnhof Bellevue, noch heute ist sie mit einer Reklame für ›Kupferberg Gold‹ bemalt.
Noch heute, wenn ich auf dieser Strecke fahre, betrachte ich nachdenklich diese Malerei. Hinter ›Gold‹ haben wir über ein Jahr gehaust, aber das war auch das einzige Gold, das wir in diesem Jahr zu sehen kriegten. Denn die beiden Zimmer kosteten einhundertvierzig Mark im Monat, und netto bekam ich etwa zweihundertzwanzig Mark. Achtzig Mark blieben uns fürs Leben. Wir haben es ja irgendwie geschafft, wir haben sogar noch die Aussteuer für das Baby gekauft, aber wie wir das fertiggebracht haben, ist mir heute noch ein Rätsel. Ich weiß nur, daß wir immerzu rechneten, und daß ein fehlender Groschen zu langen Diskussionen führte.
Am 2. Januar war ich natürlich pünktlich um acht Uhr auf dem Verlag; wenn wir privatim schwerste Sorgen hatten, dort sollte man nichts davon merken! Noch hatte ich keine Ahnung von der Art der Arbeit, die mich erwartete, ich wußte nicht einmal, ob ich auf dem Verlag selbst arbeiten sollte.
Aber nun war es doch der Verlag selbst. Ein bleichgesichtiger, etwas fetter Herr mit einer schwarzen Zigarre im Mund, die er halb rauchte, halb kaute, jedenfalls aber auch beim Sprechen nicht aus dem Munde nahm, führte mich mit ein paar genuschelten Worten in meine Tätigkeit ein: ich sollte das Besprechungswesen neu ordnen. Der Verleger selbst war noch in Urlaub.
Kommt in einem Verlag ein neues Buch heraus, so werden Besprechungsexemplare an Zeitungen und Zeitschriften versandt. Manche Blätter, die und deren Kritiker der Verlag kennt, erhalten die Bücher von selbst, andere fordern sie sich an. Nun möchte der Verlag natürlich gerne, daß seine Neuerscheinungen auch wirklich besprochen werden. Damit haperte es aber oft. Es schlichen sich auch Büchermarder dazwischen ein, die überhaupt nicht daran dachten, die Bücher zu besprechen, die gar keine Gelegenheit dafür besaßen. Bei andern Blättern forderte erst die Zeitung, dann die Feuilletonredaktion, dann noch jeder einzelne Kritiker ein Exemplar an. Paßte man nicht auf, so war der Verlag im Handumdrehen viele Hunderte von Exemplaren los, ohne irgendeine Leistung dafür zu erhalten.
Mein Amt sollte es nun sein, übersichtliche Listen über den Versand dieser Besprechungsexemplare anzulegen, aus denen auf einen Blick zu ersehen war, wer wann was erhalten hatte. Weiter mußte ich dann die von zwei Ausschnittbüros übersandten Kritiken aus den Zeitungen ordnen und in eben diesen Listen abbuchen, so daß allmählich klar zu erkennen war, was die Böcke, was die Schafe waren.
Eine solche genaue Organisation aufzuziehen (und sie auch in Ordnung zu halten), das hat mir immer viel Spaß gemacht. Mit Eifer entwarf ich ein Listenformular und konstruierte Heftmappen dazu. Alles fiel etwas überlebensgroß aus, sehr handlich waren diese Mappen nicht, aber was mußten sie auch alles enthalten! Hunderte von Zeitungen und Zeitschriften, sämtliche Neuerscheinungen mußten auf Jahre hinaus eingetragen werden können. Ich entwarf also, legte alles dem bleichen Herrn mit der Zigarre vor, erhielt eine genuschelte Billigung, und nun wurde gedruckt, gebunden, beschriftet, eingerichtet ...
Worauf ich mich auf wahre Berge von Zeitungsausschnitten stürzte. Ich las, ordnete, klebte ein, buchte – kurz, aus dem Straßenläufer war ein Bürositzling geworden! Mir gefiel das ausgezeichnet.
Meinem Verleger weniger. Es kam der Tag, da er aus seinem Urlaub zurückkehrte, es kam die Stunde, da ich vor meinen Chef befohlen wurde. Stolz auf meine vorzügliche Organisation ergriff ich die ungeheuern Mappen, ein freundliches Mädchen öffnete und schloß hinter mir die Türen, und ich trat in das Allerheiligste.
Ich konnte meinen Chef nicht sehen, er mich auch nicht: die Mappen verbargen die Hälfte meines Leibes. Er sah nur zwei Beine hereinwandeln, sehr dünne Beine. Aber ich hörte ihn. Du lieber Himmel, wie schrie er!
»Sie sind wohl wahnsinnig geworden!« schrie er. »Was bringen Sie denn da an?! Das sollen Besprechungslisten sein? Mist ist das! Ich soll mich wohl auf den Bauch legen, wenn ich darin was nachsehen will?! Um solchen Bockmist anzurichten, habe ich Sie also aus Altholm geholt! Mit Idioten hat man zu tun! Nur mit Idioten! Herr Meyer! Herr Müller! Herr Schulze! Herr Schmidt! Fräulein Bauch! Fräulein Lauch! Fräulein Tauch! Kommen Sie doch mal her! Haben Sie das gesehen, was der Fallada da angerichtet hat?! – Und das haben Sie zugelassen?! Ich sage es ja, alles Idioten, mein ganzer Verlag besteht aus Idioten! Kaum kehrt man einen Augenblick den Rücken ...«
Mein guter alter Verleger! Niemand von seinen Angestellten nahm seinen Wutausbruch tragisch, er brauchte von Zeit zu Zeit so etwas! Aber ich, sein neuester Angestellter, kannte diese Ausbrüche noch nicht. Bleich stand ich hinter meinen Mappen, ich sah uns schon auf der Straße, und wir ›erwarteten‹ in knapp anderthalb Monaten!
Trotzdem war ich noch immer von der Vorzüglichkeit meiner Organisation überzeugt. Schwach gegen das starke Löwengebrüll anmeckernd, versuchte ich hinter den Mappen zu erklären, zu zeigen, zu verteidigen – so sehr meine Kollegen auch abwinkten.
Man mußte den Löwen brüllen lassen, dann hörte er von allein auf. Ich machte ihn nur immer wilder. Schließlich flog ich mit meinen Mappen aus dem Allerheiligsten. Zerschmettert, schlimmster Ahnungen voll. Der erste Lichtblick in der allgemeinen Finsternis meiner Lebensaussichten war unser Kontorbote Manne, der im Durchgangszimmer damit beschäftigt war, Post fertigzumachen. Bei meinem Anblick hob er den Kopf und sagte als echter Berliner: »Fallada, morjen früh kommen Se aber mit frisch jewaschener Brust: morjen früh erschießt der Chef Ihnen!«
Ein bißchen atmete ich auf. Also wurde dieses Gebrüll nicht so tragisch genommen, noch war unsere und des Ungeborenen Existenz nicht bedroht. Ich habe es dann auch erlebt, wie der Chef sich allmählich mit den unhandlichen Mappen abfand. Langsam gab er zu, daß sie auch Vorteile hatten. Dann, als die gedruckten Formulare erschöpft waren, sagte er mit einem halben Lächeln: »Na, lassen Sie wieder welche drucken. Schließlich haben sich die Untiere doch bewährt.«
Aber bis wir soweit waren, hatten wir noch über manchen Berg zu klettern. Vorläufig beherrschte mich noch völlig die Sorge um unser Auskommen. Es war klar, von dem Gehalt konnten wir nicht leben, ich mußte etwas dazuverdienen. Nun hatte mein Brotgeber eine seltsame Einrichtung getroffen, ohne ein Wort zu mir, ohne eine Erklärung. Auf dem ganzen Verlag wurde bis abends fünf oder sechs gearbeitet, ich aber hatte jeden Tag um zwei Uhr Büroschluß, so hatte er es angeordnet. Dieser listige alte Verleger! Nie hatte er mit einem Wort meine früher erschienenen Bücher erwähnt (auch nicht den Vorschuß). Nie hatte er sich erkundigt, ob ich wohl Lust hätte, etwas Neues zu schreiben. Aber er schickte mich um zwei Uhr nach Haus, er gab mir den halben Tag frei. Er war ein großer Menschenkenner, er las es mir an der Nase ab, daß ich zu den Menschen gehörte, die immer beschäftigt sein müssen, die stets etwas vorhaben müssen. Die Zeit meines Nichtstuns war eine Zeit des Gelähmtseins, von Krankheit gewesen, nun war ich wieder gesund. Wenn mir kein anderer Arbeit auftrug, machte ich mir selber welche.
Hinter ›Kupferberg Gold‹ setzte ich mich an den Schreibtisch und fing an, Papier vollzuschreiben. Oh, ich hatte meinen Stoff, ich hatte in Altholm so einiges gesehen, erlebt, gehört. Ich fing an, einen Roman zu schreiben, des Titels ›Ein kleiner Zirkus namens Monte‹.
Ich schrieb mit tausend Zweifeln, oft ganz mutlos. Ich hatte es mir technisch so schwierig wie nur möglich gemacht. Nach meinen ungeliebten Erstlingen, die gar zu persönlich gewesen waren, sollte der Autor diesmal im Buch ganz fehlen. Mit keinem Wort sollte er andeuten, was er selbst über das Erzählte dachte, das war Sache des Lesers. Wie ich geächzt habe! Wie ich darüber verzweifelt bin, daß ich nie »beschreiben« wollte, daß die ganze Entwicklung in Dialogform gegeben werden sollte! Sagte er, sagte sie – ich konnte das schon nicht mehr sehen.
Daß ich das Buch je zu Ende geschrieben habe, verdanke ich nur meiner niederdeutschen Hartnäckigkeit. Ich war überzeugt, es war alles Mist – aber ich war hartnäckig wie ein Maulesel. Es mußte zu Ende geschrieben werden, da es einmal angefangen war. Halbe Geschichten habe ich nie gemocht.
Dann wanderte das Manuskript, da es nun einmal geschrieben war, auf den Verlag. Die Lektoren lasen es, der Verleger las es. Ich muß sagen, daß er nach jenem ersten Zornesausbruch wegen meiner überdimensionierten Mappen der angenehmste Chef gewesen war. Er hatte nie den Arbeitgeber herausgekehrt, sein Ton war immer freundschaftlich gewesen. Aber nun klang er doch noch anders. Er hatte richtig getippt, er hatte eine gute Nase gehabt: in diesem halb verbummelten Menschen steckte etwas. Ein Verlagsvertrag wurde geschlossen ...
Und dann kam der große Glücksschlag: eine illustrierte Wochenschrift entschloß sich zum Vorabdruck des Romans, der in ›Bauern, Bonzen und Bomben‹ umgetauft war. Das war damals eine sehr mutige Tat, denn einmal wimmelte dieser Roman von den deftigsten Derbheiten, zum andern mußte er ›oben‹, ›bei den Roten‹ heftigsten Anstoß erregen. Aber die Zeitung entschloß sich, sie wollte sogar zwölftausend Mark für das Wagnis zahlen! Liebe Leute, zwölftausend Mark – Suse und ich gerieten ja wohl völlig aus dem Häuschen! Zwölftausend Mark, das war Reichtum, das bedeutete Sorgenlosigkeit – dafür konnte man sich die halbe Welt kaufen! Unterdes war unser Erstgeborener längst eingetroffen und schrie die Wände hinter der Sektreklame dauerhaft an. Natürlich würden wir nun aus der Steinwüste hinausziehen. Wir würden uns in irgendeinem Vorort ein Häuschen kaufen. Wir würden Möbel anschaffen, Wäsche, Kleidung! Und Bücher, natürlich Bücher! Es war wie ein Taumel! Soviel Glück war eigentlich gar nicht möglich!
Meiner zweiflerischen Veranlagung entsprechend war ich natürlich nicht ohne Befürchtungen. Würden die illustrierten Herren nicht noch zurückweichen? Würden sie auch zahlen? Eigentlich war es ja unmöglich, einen so derben Roman in einer Illustrierten zu veröffentlichen! Suse sollte schon sehen, wir hatten uns umsonst gefreut. Ich sah streng darauf, daß an unserer sparsamen Lebenshaltung nichts geändert wurde!
Aber die Wochenschrift zahlte, es kam die Stunde, da das Geld beim Verlag einging. Ich fand mich auf der Kasse ein. Der Verlag war damals ›ein bißchen klamm‹, ich bekam eine Abschlagszahlung, fünfhundert oder tausend Mark, weiteres würde ich später erhalten. Aber was kümmerte mich das weitere?! Wir hatten eine ungeheure Barsumme in der Hand. Wir gingen einkaufen.





























