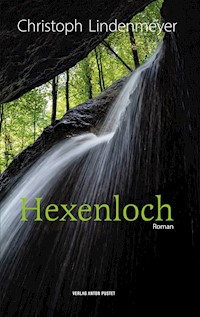
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abgeschottet. Ausgedient. Kalt war es geworden. Die Stadt wirkte stiller als in den Jahren zuvor, Mirabellpark und Plätze fast menschenleer. An vielen Schaufensterscheiben klebten Plakate: Abverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Europa und die Welt hatten schwere Jahre hinter sich. An Kälte hatte sich Wolff, leitender Redakteur eines großen deutschen Medienunternehmens, mittlerweile gewöhnt. Im Münchner Funkhaus war die vitale Gesprächskultur längst zum Erliegen gekommen. Einsilbig mied man einander. Was ihm beim Rundgang um die vornehme Salzburger Villa besonders zu denken gab, waren die schweren schmiedeeisernen Gitter vor jedem Fenster. Suchte hier jemand Schutz? Oder war gar hier gefangen? Ein in sich gekehrter Hörfunkregisseur, eine Schauspielerin am Ende ihrer Karriere, ein Toningenieur im Krankenbett, ein undurchsichtiger Salzburger Kunsthändler – und ein Gemälde des Landschaftsmalers Carl Wilhelm Hübner, das offenbar einst in der Nationalgalerie Oslo hing. Was verbindet sie miteinander? Wolff, der schon in Christoph Lindenmeyers Roman Teufelsgasse mit journalistischem Spürsinn einen mysteriösen Todesfall aufklären konnte, sieht sich in Hexenloch unvermittelt in eine beklemmende Serie von Ereignissen zwischen Salzburg und München verstrickt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Lindenmeyer
Hexenloch
Roman
Gefördert durch:
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Anton Pustet
5020 Salzburg, Bergstraße 12
Sämtliche Rechte vorbehalten.
Umschlagfoto: ©Tanja Kühnel
Grafik, Satz und Produktion: Tanja Kühnel
Lektorat: Martina Schneider
eISBN 978-3-7025-8095-7
Auch als gedrucktes Buch erhältlich
ISBN 978-3-7025-1058-9
www.pustet.at
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Anmerkung des Autors
Dank
Leseprobe Teufelsgasse
Zu Hause bin ich der Vater, der Ehemann,der Mensch, den gerade nervt,dass der neue Nachbar alte Bäume direkt hinterunserem Grundstück gefällt hat. Gehe ich mit ihm in den Kampf?Nein, ich habe Wichtigeres zu tun, ich habe noch viel vor.Aber ich habe eine Gartenmauer bauen lassen,um mein Territorium zu sichern.
Samy Molchoin der Süddeutschen Zeitung
1
Es war noch Zeit.
Wolff hatte es nicht eilig.
Er hatte es sich in vielen Jahren angewöhnt, vor der Zeit am Ort zu sein. Sich einen Überblick zu verschaffen. Die Atmosphäre zu spüren. Die Wege zu erkunden. Entspannt da zu sein, wenn es so weit war.
Am Vormittag noch hatte sich eine Konferenz im Münchner Funkhaus endlos in die Länge gezogen, die Wortbeiträge aus den Programmbereichen und Redaktionen konnten vorausberechnet werden. Von wem sie kamen und worum es ging. Wolff hatte sich nicht an der Debatte beteiligt. Er wusste, dass die Entscheidung längst auf der Führungsebene und in den Ausschüssen der Aufsichtsgremien getroffen war. Wozu sollte eine solche Alibidiskussion taugen? Aber es war spannend für ihn gewesen, als unbeteiligter Beobachter seine eigene Prognose zu kontrollieren. Wer sagt was? Wie wird argumentiert? Wie hoch ist das Erregungspotenzial? Wer verlässt genervt die Konferenzrunde vorzeitig?
Wolff arbeitete lang genug in diesem Haus, um die soziografischen Prozesse zu kennen. Selten lag er daneben. Zweimal – doch – nur zweimal hatte er heute Vormittag daneben gelegen. Denn zwei jüngere Redakteurinnen meldeten sich, drängten sich vor. Wolff fand das gut, obwohl er damit nicht gerechnet hatte. Sie argumentierten knapp und scharf, aber ohne jede Emotion gegen die geplante Zusammenlegung mehrerer aktueller Redaktionen, begründeten ihre Position sehr klar. Sie glaubten, die Veränderung im Organisationsschema noch aufhalten zu können. Dabei war sie längst als Beschlussvorlage der Intendanz in den Gremien beraten und in einer nichtöffentlichen Sitzung auch beschlossen worden. Er vertraute seinen verlässlichen Informanten. Auch seiner Informantin aus dem Rundfunkrat, die ganz offensichtlich Wolff, seine Arbeit als Führungskraft, als Autor und als Moderator im Programm schätzte. An die Namen der beiden nassforschen Kolleginnen konnte er sich nicht mehr erinnern. Er hatte bisher auch nicht mit ihnen zu tun gehabt. Trotzdem war es ihm peinlich. Schließlich hätte er sich erkundigen können. Das würde er nächste Woche nachholen.
In den letzten Jahren war die offene Gesprächskultur im Haus endgültig zusammengebrochen. Es war weitgehend totenstill gewesen, leer, ohne Bewegung. Selbst die Dame am Empfang, die Wolff seit mehr als einem Jahrzehnt kannte und in ihrer Freundlichkeit ihm gegenüber zu schätzen gelernt hatte, klagte immer wieder darüber, wenn Wolff kurz bei ihr stehen blieb. »Kein Mensch, wissen Sie. Kein freundliches Wort mehr. Wir wissen gar nicht, auf wen wir warten. Warum wir hier sitzen.«
»Das geht vorbei«, hatte Wolff ihr geantwortet. Sie hatte ihm zugenickt. »Glauben Sie?«
Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen arbeiteten im Home-office. Nur wenige aus den aktuellen Redaktionen kamen ins Haus. Die Moderationen außerhalb der Sendekomplexe und Studios ließen sich nicht in Heimarbeit realisieren. Die vertrauten Winkel der Raucher waren verwaist, die Informationsbörse der Kantine funktionierte nicht mehr. Selbst in der wärmenden Frühlingssonne vor dem Hochhaus stand in den Pausen niemand mehr herum. Es herrschte eine kalte Funktionalität. Jeder und jede, die es konnten, hielten Abstand. Noch schwirrten die Mauersegler nicht über der Stadt, aber der Mai würde kommen. Alles wird gut, zitierte Wolff in Gedanken den bayerischen Ministerpräsidenten.
Die einst übervolle Tiefgarage war immer noch fast leer. Das lag neben dem Homeoffice auch daran, dass so viele Redaktionen bereits im künftigen Sendezentrum weit außerhalb der Innenstadt arbeiteten. Kommen weniger Menschen in das Funkhaus, dann gibt es weniger Probleme. Zudem verzichteten immer mehr junge Leute auf ein eigenes Auto. Brauchten sie eines, dann nutzen sie Carsharing oder kamen auf E-Rollern zum Dienst. Inzwischen gab es längst einige Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage.
Wolff startete seinen Wagen. Er würde in aller Gelassenheit nach Salzburg fahren. Er freute sich darauf, die noch schneebedeckten Alpen wiederzusehen, im Radio Ö1 zu hören und vom Urlaub zu träumen, auch wenn er keinen hatte. In der Rösterei auf dem Irschenberg würde er frische Kaffeebohnen kaufen, Brasil und Verona, und sich einen Cappuccino zum Mitnehmen bestellen.
Jetzt war er hier.
In diesem Außenbereich Salzburgs war er noch nie gewesen, vielleicht war er einmal nachts auf dem Heimweg nach München vorbeigekommen, aber er war sich nicht sicher. In der Dunkelheit achtete er nicht wie tagsüber auf die sich verändernden Architekturen im Umkreis der Stadt, auf die immer spröder werdende Landschaftsgestaltung und die Versiegelung einstiger Felder. Wer wusste denn schon, wie es hier vor einigen Jahren noch ausgesehen hatte? Grün. Ländlich. Schatten unter den Bäumen. Wind über den Wiesen und Feldern. In den Außenbezirken herrschte eine Gebrauchsarchitektur vor. Einfallslos. Zweckbestimmt. Frei von jeder Ästhetik bei der Fassadengestaltung. Kreuz und quer gestellt, als gäbe es keine Bebauungspläne. Vielleicht aber dienten diese, weil es sie wohl ganz sicher geben musste, auch ganz anderen Interessen. Wer kannte noch die alten Pläne der einstigen Dorfkerne, ihre architektonische Harmonie, die Plätze, Bäche und die Sichtachsen im ländlich bebauten Raum? Jetzt war längst alles zur Stadt geworden. Die Außenbezirke fraßen sich auf das Zentrum zu, die Stadt floss in ihre Umgebung hinein. Nur da und dort leuchteten vereinzelte Bauten aus der Farblosigkeit der Stadtgestaltung auf. Solitäre, Einzelstücke, freistehende Gebäude ohne Bezug auf die Umgebung, glitzernd wie Diamanten, die in der Einförmigkeit der Außenbezirke fast dekadent anmuteten. Eine faszinierende Ästhetik, die völlig isoliert wirkte. Wie vom Himmel herabgefallen. Denn ihrem Beispiel folgte kein anderes Neubauprojekt.
Wolff sah, dass hier alles doch ganz anders war.
Hier. Sein Navigationsgerät hatte ihn in das Quartier etwas südlich von Parsch in den Stadtteil Aigen geführt, einen der teuersten Wohnbezirke der Landeshauptstadt Salzburg. Der Bahnhof liegt nahe, der Turm der Stadtpfarrkirche zum Heiligen Johannes dem Täufer ragt mit seiner großen und seiner kleinen Kirchturmzwiebel über die Dächer. Wolff hatte nach der Vormittagskonferenz in München im Internet kurz recherchiert: In Aigen wohnten vor allem Prominente und Reiche, wobei – wie er dachte – es zwischen beiden nur geringe Unterschiede gibt. Porsche. Die Piechs. Thyssen-Henne. Beckenbauer. Alter und neuer Geldadel. Und dann und wann war auch ein bedeutender Mensch aus der Kultur hierhergezogen. Musik. Theater. Show.
Die Villa Walburga, umbenannt in Villa Lamberg, später die Villa der Familie Trapp. Sound of Music, ein Park außen herum, landwirtschaftliche Flächen. 1938, hatte Wolff gelesen, hatten die Trapps emigrieren müssen, um sich einer Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entziehen. Die Villa blieb deshalb aber nicht unbewohnt.
Ein alter und ein neuer Friedhof. Raumgreifende Familiengräber hatten keinen Platz mehr auf dem Gottesacker des alten Kirchleins, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg um seine eigene Achse gedreht und erweitert worden war. Ein Schloss. Ein Park. Irgendwie, dachte Wolff, ein Legoland als Kontrast zur Salzburger Altstadt, miniaturisiert, übersichtlich, einem Kurort für die einstigen Verwaltungsbeamten und Militärs ähnlich, die sich hier ansiedelten. Wolff hatte das alles gar nicht gewusst, aber er fuhr nicht gern zu Terminen in Orte, über die er keine Informationen hatte. Oft kaufte er sich eine Lokalzeitung, um dann seine Gesprächspartner mit lokalen Kenntnissen zu überraschen. Eine schlichte Methode, die aber immer Wirkung zeigte.
Wer hier zwischen Aigen und Parsch wohnte, interessierte ihn nicht. Wer hier zuhause ist, muss seinen Müll in den Tonnen entsorgen, im Supermarkt einkaufen, zur Apotheke fahren oder im nächstgelegenen italienischen Feinkostladen zwischen Kaffeesorten, Champagner und anderen Spezialitäten auswählen, aber – so stellte es sich Wolff vor – sie werden höchstwahrscheinlich nicht selbst in die Geschäfte gehen. Es gibt dafür Personal. Gärtner, Zugehfrauen, Hauswirtschafterinnen, Chauffeure, persönliche Referenten, oder wie man das nennt. Die Annahme ist unrealistisch, dass die Hauseigentümer sich in die Schlange der Kunden vor den Geschäften oder dem Postamt einreihen. Die Apotheken liefern frei Haus. Auf den Briefkästen sind meist keine Namen angegeben. Die Briefträger wissen trotzdem genau, wohin sie die Post auszuliefern haben. Die Parkplätze vor den Villen sind meist für zwei Fahrzeuge angelegt, die Garagentore breiter als ein Stand auf dem Salzburger Weihnachtsmarkt, und morgens werden viele Fahrzeuge noch gar nicht bewegt, weil die Dienstfahrzeuge mit laufendem Motor vor den Häusern stehen.
Ob es so wirklich zugeht?
Wolff war sich sicher, dass es sich morgens in diesem Viertel nicht anders verhielt als im Taunus nahe Frankfurt am Main, oder in Wiesbaden, wo die Investmentchefs und die Banker wohnen, die Fernsehleute und die Firmengründer, oder in München-Grünwald, wohin aus dem Zentrum zwar eine Straßenbahnlinie führt, die aber nur in Ausnahmefällen Passagiere aus und zu den Villen transportiert. Er ertappte sich dabei, ungerecht zu werden. Das sind Klischees, dachte er. Wenn ich hier ein Haus, eine Villa geerbt hätte? Wolff hatte – eigentlich – nie ein größeres Erbe angetreten, das ihm ein Leben ohne seine Arbeit im Funkhaus ermöglicht hätte.
Nein, dachte er, ich hätte das nie gewollt!
Nein, dachte er, es ist gut, so wie es ist.
Ja, dachte er, eigentlich bin ich ein glücklicher Mann.
Jetzt stand er vor dem Haus.
Die einstöckige Villa mit dem hohen Dach, bedeckt mit mediterranen, an Venedigs Dachlandschaften erinnernden Ziegeln, verglasten Dachgauben und den um die Fenstereinfassungen herum gemalten abstrakten Lüftlmalerei-Motiven stammte wohl aus den Fünfzigerjahren, war also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges errichtet worden. Das Haus wies eine symmetrische Struktur auf. Eine Haustür, nein, ein Eingangstor in der Mitte, rechts und links identische Flügel in der erkennbaren Hausfrontansicht. Das Tor war aus schwerem Holz mit Schnitzereien und Intarsien gefertigt, ein Bollwerk für jeden, der hier unbefugt eindringen will. Wolff sah, dass eine Kamera auf den Eingangsbereich justiert war. Im Vorgarten war eine weitere Kamera auf einem Pfahl montiert. Keine Leitungen. Die Kameras würden ihre Bilder in das Haus funken, falls es keine Attrappen waren. Möglich wäre es.
Das war es aber nicht, was Wolff auf einmal verstörte.
Er sah: Die Fenster der Villa waren vergittert. Schwere schmiedeeiserne Gestelle – in der Wand verankert – selbst die Dachfenster in den Gauben versteckten sich, was Wolff anfangs nicht bemerkt hatte, hinter Gittern. Die Kellerfenster waren ebenfalls vergittert.
Wolff fiel ein, dass in seiner Jugend der Hausarzt seiner Familie einmal gesagt hatte: Die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Weshalb auf einmal die Erinnerung an einen uralten, eigentlich vergessenen Satz?
Das Haus ist ein Spiegelbild der Seele, wandelte Wolff den Satz ab. Wer hier lebt, sondert sich ab. Sperrt sich ein. Lebt hinter Gittern. Fühlt sich vielleicht sicherer.
Muss aber große Angst haben. Es gibt elektronische Warnsysteme gegen jeden Einbruchsversuch, Apps, die sich an das nächste Polizeirevier wenden, Kameras (die waren immerhin schon da), Lichtschranken, Bewegungsmelder und Hunde. Türschlösser, innen durch einen Querbalken verriegelt. Scheinwerfer, die jede Bewegung registrieren und plötzlich fast taghell aufstrahlen. Sicherheitseinrichtungen, die sich diskret tarnen und deshalb fast unsichtbar sind.
Eine Villa als Hochsicherheitstrakt. Hinter den Gittern Gefangene. Oder Schutzbedürftige.
Es war noch Zeit. Er ging auf und ab.
Ihm fiel sein Fernsehkollege Dieter Wieland ein, der große alte Mann mit seiner für Gemeinden wie Städte unbequemen Stadtentwicklungs-, Architektur- und Landschaftsplanungs-Kritik. Der Filmautor hasste falsche Gartenzäune und vergitterte Fenster. In unzähligen Fernseh-Dokumentationen hatte Wolff von Wieland gelernt, in dörflichen Strukturen auf die hässliche Glasbaustein-Ästhetik, auf Kreisverkehrs-Möblierungen und verstädterte Renovierungen alter Gebäudestrukturen zu achten: Ob der inzwischen sehr alte Kollege, den er persönlich nie kennengelernt hatte, noch grimmiger geworden war, zorniger denn je? Er ist kompetent geblieben, ein Seismograf der örtlichen baulichen Verirrungen in den stadtnahen Gemeinden und Dörfern. Von ihm hatte er gelernt, und er erinnerte sich jetzt wieder daran, dass die alten Bauernhöfe nie nach blick-ästhetischen Gesichtspunkten errichtet worden waren, also die Fenster der Wohnhäuser nicht den Ausblick auf die Schönheit der Täler boten, sondern dass die Anwesen Schutz gewährten gegen die Westwinde mit ihren Böen, dem Hagel, den Regenschauern und dem Schnee. Die Ställe sind den Häusern vorgelagert, und wer aus dem Fenster schaut, blickt nicht nach außen, nicht nach unten in die Weite der Täler, sondern nur bis zum nächsten Hügel, auf dem Silberdisteln und Schusternägel und Gebirgsenziane wachsen und im Frühling oft die Kühe stehen, bevor sie zu den Almen hinaufgefahren werden.
An der Außentür auf dem Briefkasten kein Namensschild. Zwei Angaben nur:
O.A. und E.v.H. – eingefräst in eine blank polierte Messingtafel. Wolff konnte die Initialen natürlich entziffern. Otto Achatz, Elisabeth Achatz geb. von Harnier. Er wusste, wen er gleich besuchen würde. Links und rechts vom Hauseingang zwei Buchsbäume in kugelförmigem Zuschnitt. Am hölzernen Eingangstor ein Dauerkranz mit Strohblumen. Also doch, dachte Wolff, nicht Stadt, sondern Land. Vielleicht die Sehnsucht nach Rustikalem. Hinter dem Gitterwerk. Und hier vorne nur ein kaum beachtetes Zeichen für die heimlichen Träume. Es wäre aber auch denkbar, dass es sich nur um vordergründigen Dekorations-Schnickschnack handelte. Weil viele Haustüren mit Strohblumen geschmückt waren. Die Blumen mussten nicht gegossen werden. Wolff würde sich, wenn er das Haus erst betreten hatte, heimlich nach ähnlichen Accessoires umsehen.
Bevor er hierhergekommen war, hatte Wolff Lust verspürt, am Nachmittag noch eine halbe Stunde durch die Stadt zu flanieren. Er hatte den Mirabell-Parkplatz angesteuert, nahe der Bergstraße, nicht weit entfernt vom Mozarteum. Ein paar Schritte nur zur Linzer Gasse. Das Parken hier war teuer, aber es kam ihm darauf jetzt nicht an. Die Stadt wirkte stiller als sonst. Der Mirabellgarten war immer noch fast menschenleer. Von ihrem fast komatösen Zustand in den letzten Jahren hatte sich Salzburg, nicht anders als andere Städte, immer noch nicht erholt. Auf vielen Schaufensterscheiben klebten Plakate: Abverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Im Modeladen gleich vorne an der Brücke war immer noch jener elegante Damenmantel ausgestellt, den Wolff vor mehr als zwei Jahren schon entdeckt hatte, als er sich auf die Suche nach der letzten Wohnung seines Chefredakteurs gemacht hatte, der in dieser Stadt ums Leben gebracht worden war. Der Mantel hatte keine erkennbare Staubschicht. Vielleicht wurde er jeden Morgen mit dem Staubwedel gereinigt, aber niemand kaufte das schöne Stück. Manche Schaufensterscheiben waren innen mit weißer Farbe bemalt worden. Niemand kann in die toten Läden hineinsehen, niemand von drinnen auf die Straße schauen, aber drinnen ist wohl niemand. Im Mozarteum hörte Wolff anders als früher keinen einzigen Ton. Niemand übte auf dem Klavier, niemand spielte Violine. Kein Gesang. Niemand gab hörbar den Takt vor. Vor allem: Es gab keine jungen Leute, die durch die Halle eilten. Vor dem Mirabellgarten ein paar Hundebesitzer. Selbst die angeleinten Hunde bewegten sich, als wären sie noch nicht aus dem Schlaf aufgewacht. Das Café am Park rechts hinter dem Landestheater war noch nicht geöffnet.
Heute Morgen hatte Wolff im SZ-Magazin ein Interview mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe gelesen. Auch sie war in der neuen Welt nach den lähmenden Jahren noch nicht angekommen, fühlte sich noch von ihnen umklammert, wenn sie sagte: »Die zunehmende Verzwergung der Welt und die neue Scheu vor menschlicher Begegnung, so nötig das gerade ist, machen mir große Angst. Es spricht viel gegen das Reisen, global und in meinem Leben. Und doch wäre unsere Welt ohne das Reisen eine schrecklich engstirnige.« Die Seite hatte Wolff aus dem Magazin herausgerissen. Er wollte das Zitat auf seinem Schreibtisch zu den anderen Notizen legen, auf denen er seine Einfälle, spontanen Gedanken und Beobachtungen festhielt.
Noch begrüßte sich niemand mit Handschlag. Selten sah er Menschen, die sich umarmten. Immerhin war der ungelenke Ellenbogengruß verschwunden, diese kumpelhafte, dem Ententanz entlehnte Begrüßungsgeste, die Wolff nicht leiden konnte.
Zum Glück hatte Wolffs Stammcafé Isaak in der Linzer Gasse geöffnet. Es lagen nur wenige Zeitungen aus, eigentlich nur die Salzburger Nachrichten und die Kronen Zeitung. Die anderen Blätter waren wohl eingespart worden in den letzten Jahren, die so schwer auch über dieser Stadt lagen. Er genoss die Melange. Den Ortsteil Salzburg-Aigen würde er schnell finden, mehr als 20 Minuten bräuchte er dorthin nicht. In die Getreidegasse würde er heute nicht gehen. Vielleicht wäre dort mehr Betrieb. Wolff musste auch sein Zimmer in dem Hotel beziehen, das er von München aus gebucht hatte. Das Frühstück war auf der Homepage als wonderful angepriesen worden, 4 Sterne hatten ihn in das Viertel südlich des Kapuzinerbergs gelockt, und die Übernachtung würde ihn einen Einzelbett-Zimmerpreis in Höhe von 90 Euro kosten. Für Salzburger Verhältnisse war das noch günstig.
In der Ferne, irgendwo hinter den Altstadtgassen drüben auf der anderen Seite der Salzach, schwoll der Ton eines Martinshorns an. Es zerriss die Geräuschlosigkeit der Stadt, entfernte sich und Wolff vernahm dann nur noch einen einzelnen dunklen Ton. Die dunklen Töne setzen sich durch, dachte er. Die Stadt gefiel ihm besser als früher. Die Patina der Ruhe tat ihr gut. Seltsam, dass dunkle Töne länger zu hören waren. Er hatte immer geglaubt, dass sich schrill-hohe Signale im Gehör besser einnisteten.
Jetzt aber war es an der Zeit.
Wolff stand vor dem Haus. Der Termin war auf 18 Uhr vereinbart worden. Es war jetzt 10 Minuten später. Zu früh hatte er nicht kommen wollen. Er klingelte. Im Haus hörte er einen dezenten Ding-Dong-Gong. Das Papier, in das sein Blumenstrauß aus blauen Hortensien eingepackt war, sollte er dezent entfernen. Nur in England werden Blumensträuße im Papier überreicht. Oder war das auch in Frankreich üblich? In Österreich jedenfalls nicht. Aus der Umhängetasche ragte der Hals einer Champagnerflasche heraus. Wolff hatte ihn in dem italienischen Feinkostladen in Parsch entdeckt. Nur wenige Kunden waren im Laden gewesen. Auf der Eingangstür klebte ein Plakat: »Wir haben es geschafft! Wir warten auf Sie!«, aber Wolff war zu abgelenkt gewesen, um später zu wissen, ob es sich um ein Werbeplakat des Ladens, der Salzburger Festspiele, des Golfplatzes, des Museums der Moderne oder des Landestheaters gehandelt hatte. Nach den letzten Jahren war ihm das auch egal.
Niemand öffnete.
Wolff drückte noch einmal auf die Klingel. Wieder hört er das Ding-Dong. Im Haus blieb es still. Es gab keine Bewegung. Er prüfte im Mobiltelefon die eingetragenen Termine. Alles stimmte. Es war so vereinbart worden.
Noch einmal klingeln? Das wäre zu aufdringlich, deshalb wartete Wolff. Aber nichts geschah. Was machte man in solchen Situationen? Nach dem ersten Selbstzweifel, einen Termin versäumt zu haben, die Selbstkontrolle. Wolff schlenderte vom Tor zum Gehweg und wieder zurück. Noch einmal läuten? Er wählte die Festnetznummer, wartete auf das Tuten. Dann endlich eine Stimme, als er das Mobiltelefon schon einstecken wollte: »Hallo?« Wolff sagte: »Hier Wolff! Ich stehe vor Ihrer Haustüre!« Eine Frauenstimme antwortete: »Entschuldigen Sie, Herr Wolff, wir haben ein Problem mit der Hausglocke. Sie funktioniert nicht. Schön, dass Sie sich melden. Einen Augenblick bitte! Wir erwarten Sie!«
Wolff hörte den Türöffner summen.
Die Haustüre, groß wie ein Scheunentor, öffnete sich. Aus ihr trat, wie auf einer Schauspielbühne, der Regisseur: »Entschuldigen Sie, mein Lieber. Das ist uns außerordentlich peinlich. Die Türglocke funktioniert nicht. Die Elektrik hat uns im Stich gelassen. Wie lange stehen Sie schon vor unserem Haus? Wie schön, dass Sie da sind. Hatten Sie eine gute Reise? Kommen Sie!«
Wolff trat ein. Das Blumenpapier hatte er in seine Jackentasche gesteckt.
2
Gibt es einen stahlblauen Himmel über München?
Heute Morgen ist es so. Über Nacht wurden die Schleierwolken weggefegt, die Sonne sticht, sie blendet in der Reflexion auf den Fensterscheiben des Hochhauses. Der Dunst über der Stadt hat sich verzogen. Hoch über den Dächern ziehen noch keine Vögel ihre Bahnen, aber unten auf der Straßenebene tummeln sich Blaumeisen, Spatzen und Grünfinken. Die Amseln sind in der Stadt nicht mehr da. Man sagt, eine Amselkrankheit habe ihren Bestand radikal reduziert. Es wird Frühling. Haben nicht alle seit Jahren darauf gewartet? Ein herrlicher Tag. Doch. Auf einer Kastanie im Augustiner-Biergarten sitzt ganz oben eine der selten anzutreffenden Amseln. Sie flötet in den Morgen, wartet auf eine Antwort aus einem anderen Revier. Aber es bleibt still.
Ulf Beck wird nichts von dem schönen Wetter haben. Seinen Tag wird er im fensterlosen Produktionsstudio zwischen dem vierten und dem fünften Stock des Studiobaus verbringen, und wenn er heute Abend wieder vor dem Funkhaus stehen wird, ist die Sonne schon zum Horizont im Westen hinabgetaucht. Die großen künstlerischen oder dokumentarischen Produktionen können nur in den exzellent ausgestatteten Studios realisiert werden. Wenn Beck mit seiner Arbeit als Toningenieur beginnt, haben die Redaktionen, Dramaturgen und Dramaturginnen monatelang, manchmal sogar seit ein, zwei Jahren die Produktion vorbereitet. Es gibt auch Produktionen, das weiß Beck, die fast ein Jahrzehnt Vorlauf haben. Es ist vor allem bei internationalen Urheberrechten oft sehr schwierig, die Rechteinhaber zu überzeugen. Amerikaner wollen am liebsten ein multimediales Gesamtpaket verkaufen, weil sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Struktur, seinen Programmauftrag wie seine Finanzierung nicht kennen, ihm aber zutrauen, eine weltweite Vermarktung der lizensierten Stoffe voranzubringen und den Gewinn einzustecken. Eine absurde Vorstellung. Zudem muss die Finanzierung großer Produktionen vorab geklärt werden, denn die eigenen Budgets reichen für sie nicht aus. So gilt die Suche aufgeschlossenen Koproduktionspartnern in den Sendern oder externen Institutionen, die sich für die Projekte engagieren. Und die Programmplanung besteht ja nicht nur aus der Summe einzelner Produktionen. Die Spielpläne, die Halbjahresprogrammplanung weisen eine Mischkalkulation auf: Ein Drittel Neuproduktionen, ein Drittel Autorenproduktionen, also Hörstücke, die von den Autorinnen und Autoren selbst produziert werden, ein Drittel Übernahmen großer Stücke von anderen Sendern im In- und Ausland, zudem gibt es Einsparpotenziale durch eine Wiederholung wichtiger Repertoireproduktionen. Das vorgeschriebene Sparziel für die Etats wächst von Jahr zu Jahr. Die Redaktionen wehren sich mit guten Argumenten: Ihre Produktionen würden nicht einfach weggesendet und lagerten dann Jahrzehnte in den Archiven, sondern neben den linearen Programmen würde sich durch die neuen Ausspielwege mit Live-Streaming, Podcasts und Mediatheken ihr Publikum nachweisbar vervielfachen, was die Medienforschung längst zweifelsfrei festgestellt hat. Solche Erfolge verlangen aber nach aufwendiger Studiotechnik, schnell gestrickte Billig-Produktionen nutzen sich ab und haben keinen Bestand über längere Zeit.
Beck kennt den Kampf um Budgets und die Auseinandersetzungen um die Finanzierung. Er wird meist frühzeitig in die Programmpläne der Redaktionen eingebunden, denn sie haben ein Mitspracherecht bei der Besetzung des technischen Personals. Die Produktionszeit muss im Voraus kalkuliert und beantragt werden, die Besetzungsbüros werden von Redaktion und Regie beauftragt, erste Anfragen an Schauspielerinnen und Schauspieler zu richten. Mindestens zwei Tage gelten der Sichtung und Speicherung benötigter Geräusche und anderer akustischer Elemente, die digital abrufbar sind. Wichtige Requisiten müssen organisiert werden. Die neueren Produktionen aber verzichten meist auf akustischen Realismus, weil sich alle Räume durch die digitale Akustik, musikalische Elemente und Geräuschfragmente besser darstellen lassen als durch eine naturalistische Akustik. Wenn zunehmend Features wie Hörspielproduktionen auch als Autorenproduktionen hergestellt werden, oft in enger Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Komponistinnen, wenn sie den Ausstrahlungsnormen des Senders durch eine private technische Bearbeitung entsprechen sollen, muss die Vorplanung perfekt erfolgen. Flüchtigkeitsfehler bedeuten, dass sich eine Produktion verteuert.
Die meisten Regisseure arbeiten freiberuflich. Diesen Monat in München, im nächsten dann in Hamburg oder Köln oder in Berlin. Oft auch in Basel oder Wien. Oder in Baden-Baden. Die Redaktionen wissen genau, welche Manuskripte sie welchen Bearbeitern, welchen Regisseuren und Regisseurinnen anvertrauen wollen, und wer die Regie übernimmt, wissen genau, mit welchen darstellenden Künstlerinnen und Künstlern am besten gearbeitet werden sollte. Die Teams haben sich in vielen Jahren miteinander eingespielt, im besten Fall ist die Freude über ein Wiedersehen im Studio groß.
Ulf Beck ist vor Jahren einer der ersten Toningenieure gewesen, der sich in kürzester Zeit mit der damals neuen digitalen Studiotechnik vertraut gemacht hatte. Einige Kolleginnen und Kollegen, die meisten älter als er, verweigerten sich der technischen Revolution. Sie wollten in der vertrauten analogen Welt bleiben. Tatsächlich war die Arbeit am Bildschirm eine große Belastung. Auch Beck hat festgestellt, dass er abends oft rot entzündete Augen hat. Berufsrisiko, denkt er. Aber die Digitalisierung der Arbeit im Studio hat ihn vom ersten Tag an fasziniert.
Gestern Abend hat er Gustav Mahlers Alpensymphonie als Film fertiggestellt. An den Wochenenden reist er privat mit seinem Campingbus in das Voralpenland oder gleich in die Berge, um mit seiner Kamera alle möglichen Motive einzufangen: sehr früh am Morgen, wenn die Natur aufwacht. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn der Film bei den wenigen Menschen gut ankommt, die er zur Präsentation seines Werks nach Hause einlädt. Oft arbeitet er länger als vier Jahreszeiten an seinen Musikfilmen. Ein wunderbarer Ausgleich zu seiner Arbeit im Funkhaus. Am liebsten ist Beck allein unterwegs. Wenn seine Frau auf ihn warten muss, fühlt er sich gestresst. Gute Motive einzufangen bedarf unbegrenzter Zeit. Das hat seine Frau inzwischen auch verstanden und akzeptiert. Jetzt kommt sie nicht mehr so oft auf seine Foto- und Filmexkursionen mit wie früher. Aber sie ist nicht verärgert über seine Fotoausflüge. Denn Ulf ist ja nicht an jedem Wochenende unterwegs.
Es wird wärmer. Ein letzter Blick auf das Hochhaus, die Sonne steht höher als vorhin, die Amsel ist weggeflogen. Beck wird jetzt in eine andere Welt eintauchen.
Wie Jean-Paul Sartres »Eingeschlossene« ist jetzt gleich das Team in den abgedunkelten Produktionsräumen wieder auf sich allein gestellt. Tagelang. Wochenlang. Ein von der Welt ausgegrenztes Biotop, dem sich niemand aus dem Team entziehen kann. Jede Stimmungslage wird registriert, jede Müdigkeit, jeder Ärger. Man kann keine falsche Entscheidung verstecken. Da ist nichts außer der Arbeit, sie ist nicht sichtbar wie das Werk eines Bildhauers, einer Malerin, sondern nur indirekt auf den Bildschirmen in endlosen Kurven präsent. Zur Grafik gewordene Akustik. Störungen sind nicht erwünscht. Früher brachte der Studiowart noch Getränke aus der Kantine, aber seine Planstelle wurde abgeschafft. Jetzt muss man in den Kantinenbau gehen. Einen Kaffee für das Team zu organisieren bedeutet, aufatmen zu können, das Tageslicht zu sehen, sich im Treppenhaus und im Hof zu bewegen. Für wenige Minuten. Denn alle warten. Niemand entkommt im Studio der gegenseitigen Kontrolle. Ein Innenleben, vielleicht dem in einem Raumschiff vergleichbar oder einer Forschungsstation im ewigen Eis. Höchste Konzentration in der Camera obscura. In der Black Box des Funkhauses. Dabei entstehen dort faszinierende neue Welten, Dokumentationen des Elends wie des menschlichen Glücks, Produktionen der Leichtigkeit und des hintergründigen Humors. Ohne Hoffnung auf die Kreation herausragender Hörstücke würde niemand hier freiwillig arbeiten.
Beck freut sich seit Langem auf die Produktion. Mit dem Regisseur Otto Achatz, dem »Otsch«, wie er im Team genannt wird, versteht er sich seit Jahren ausgezeichnet. Es bedarf meist keiner großen Diskussionen zwischen ihnen. Kurzes Kopfnicken, schmale Kommandos, ein skeptischer Blick, eine Handbewegung. So läuft die Kommunikation. Otsch schätzt kein großes Palaver. Wir sind hier, um zu arbeiten, sagt er. Beck findet das in Ordnung. Nervig sind Leute, die in das Studio kommen, um zu plaudern. Niemand braucht sie jetzt. Beck schaltet das rote Licht draußen vor der Türe an: Achtung Aufnahme! Es schreckt manchen ab, der nur einmal vorbeischauen möchte.
Doch heute ist alles anders. Otsch zittert. Otsch läuft hin und her. Otsch setzt sich auf den Regiesessel, steht wieder auf, setzt sich wieder hin, steht auf. Er wirkt nervös. Unruhig. Bei jeder Gelegenheit braust er auf. Zwei Schauspielerinnen hat er gestern regelrecht gequält: Immer wieder mussten sie ihren Dialog sprechen. Otsch war nicht zufrieden. Alles noch einmal bitte! Mehr Gefühl bitte, mehr Verzweiflung bitte. Die Frauen klagen doch über den gewaltsamen Tod eines Kinds. Nein, das ist zu sentimental. Etwas leiser bitte. Ihr atmet an der falschen Stelle. Warum zeigt Ihr nicht, wie sich die Frauen fühlen? Es kann doch nicht so schwer sein, sich in die Rolle hineinzudenken. Otsch wird laut. Wir brechen ab! So geht das nicht. Pause. Er geht im Studio auf und ab. Niemand darf ihn ansprechen.
Und heute? Otto Achatz ist regelrecht aggressiv. Er ist doch sonst ein so feiner Kerl. Bringt morgens Croissants mit in das Studio, mal einen Blumenstrauß, mal eine Packung erlesener Pralinen. Er begrüßt die Tontechnikerin und die Regieassistentin mit einem angedeuteten Handkuss. Ein Kavalier der alten Schule. Sein Blick ist heute stechend, anders als sonst. Otsch starrt auf die Bildschirme. Dann wird er laut. So geht das nicht. Wir müssen umbesetzen. Die beiden schaffen das nicht. Die Tür zwischen dem Regieraum und dem Aufnahmeraum steht offen. Die Schauspielerinnen haben jedes Wort verstanden. Beck will etwas sagen. Doch Otsch schüttelt den Kopf. Shut up!, soll das heißen. Beide Schauspielerinnen verlassen den Regieraum. Eine hat Tränen in den Augen. »Das wird ein Nachspiel haben«, sagt die andere. »Hast du das gehört?«, fragt Beck.
Otsch antwortet: »Ich habe nichts gehört. Ich denke nach.«
»Die kommen nicht wieder«, sagt Beck.
»Das ist mir egal«, sagt Otsch. »Was hast du gesagt?«
»Wir machen weiter«, sagt Otsch. »Ich will alle Fassungen mit den beiden hören.« Er starrt auf die Bildschirme. »Bitte schneller. Wir haben keine Zeit zu verlieren.« Die Schauspielerinnen beraten sich, kommen wieder in das Studio zurück. Eigentlich, denkt sich Beck, sind das völlig normale Spannungen, wie sie immer wieder in einer Produktion entstehen können, und doch liegt heute eine verletzende Schärfe in der Luft. Sie proben weiter, zeichnen auf. Verwerfen. »Noch einmal bitte, aber jetzt besser. Ich habe es Ihnen erklärt. Auf Zeichen bitte!« Otsch fragt: »Wo ist mein Stift?« Er liegt neben ihm auf dem Regietisch. Beck fragt, wann sie eine Pause einplanen können. Ein paar Minuten Freiheit aus dem Studiokäfig. Otsch antwortet nicht, sondern starrt auf die Bildschirme, während die letzten zehn Minuten Aufnahme abgehört werden. »Ruhe bitte!«, sagt Otsch, »Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr euch unterhaltet.« Aber es hat sich niemand unterhalten. Die einzigen akustischen Signale kommen aus den Verstärkerboxen. Beck fragt noch einmal nach der Pause. Otto Achatz antwortet nicht. Er sieht aus wie ein Dirigent, der die letzte Dimension eines Pianissimo mit seinen Händen ertasten will. Die Tontechnikerin nebenan zuckt mit ihren Schultern. Zeigt ihr Verständnis für das Gefühl im Team, dass mit Otsch etwas nicht stimmt.
Irgendwann ist auch dieser Tag vorbei. Der Weg durch die Drehtür des Funkhauses, dann die Freiheit. Abendsonne ohne Kraft, Abendluft rein. Licht. Vor allem die Luft des beginnenden Frühlings. Wir sind nach den Jahren der Isolation vielleicht alle etwas verrückt geworden, denkt Beck. Man muss in dieser Dunkelkammer verrückt werden. Ich rede mal mit Al Wolff. So kann es in der Produktion nicht weitergehen. Wolff wird schon wissen, was zu tun ist. Ich schaue in den nächsten Tagen mal bei ihm vorbei, ob er in seinem Büro ist. Das ist besser als ihn anzurufen. Die meisten gebührenpflichtigen Parkplätze vor dem Funkhaus sind frei. Früher war das anders.
Beck erinnert sich an einen Satz von Victor Hugo, den er kürzlich in einem Manuskript der Wissenschaftsredaktion gelesen hat: »Der Dichter ist eine Welt, eingeschlossen in einen Menschen.« Otsch ist ohne Zweifel ein Meister der Worte, wenn auch kein Dichter. Aber auch in ihm ist eine Welt eingeschlossen. Beck aber kann sich die Innenwelt seines Regisseurs überhaupt nicht vorstellen. Er hat ja genug damit zu tun, seine eigene Welt zu ergründen.
In den Pausen erzählt Otsch gelegentlich aus seinem Leben. Er karikiert manche Prominente, die er auf Empfängen, Vernissagen oder in der Staatsoper getroffen hat, er ist ein Meister der Imitation. Alle lachen. Otsch bleibt dabei immer ernst. Er lacht nie über seine Witze.
3
Otto Achatz stand in der Tür.
Wie immer trug er einen blau-grauen Trachtenjanker aus feinem Tuch, um den schmalen Hals hatte er einen roten gemusterten Schal geschlungen. Bei anderen Männern sähe das vielleicht lächerlich aus, aber zu Otsch passte es. Auf seine grellbunten langen Socken mit den merkwürdigsten Motiven, die er – wie er sagte – immer wieder einmal bei Harrods in London einkaufte, war er besonders stolz. Er trug sie nicht anders als Sir Peter Jonas einst seine grellbunten Socken getragen hatte, der frühere Intendant der Münchner Staatsoper. Avantgarde an den Füßen. Geschmacklose Accessoires oder ein Zeichen eigener Unangepasstheit? Wolff konnte sich keinen Reim darauf machen. Aber er entwickelte Sympathie für diese kaum sichtbaren Zeichen individueller Mode in einer Umgebung der schwarzen und grauen Anzüge. Wann immer Wolff den Opernintendanten sah, versuchte er, die Farbe der Socken zu erraten, bevor sie ihre Signale unter dem Hosensaum heraus funkten. Jonas trug gerne rote Socken, Achatz bevorzugte grüne Socken mit eingestickten Motiven von der Jagd, dem Hockeyspiel oder dem Segelsport.
Das Haus verfügte auch innen über einen konsequenten, symmetrischen Grundriss. Otsch erklärte, dass seine Frau in der linken Hälfte der Villa wohne, er in der rechten. Beide verfügten über die gleiche Wohnfläche. Hinter der Eingangshalle, die beide Haushälften verband, lagen das Speisezimmer, eine Küche und ein Salon, hinter dessen großen Fenstern sich ein gepflegter Garten öffnete. Hinter der Hecke, die sich als Abgrenzung in den Garten drängte, vermutete Wolff einen Swimmingpool.
Der Rasen war vom feuchten Laub des Winters freigekehrt, die Büsche waren geschnitten und die Rosenstöcke begannen aufzublühen. Eine unbezahlbare Idylle, dachte Wolff, würden nicht die schweren Gitter den freien Blick einschränken. Er würde verrückt werden in diesem Gefängnis. Da musste jemand große Angst haben, um sich in diesem feudalen Haus derart einzusperren, sich selbst so auszugrenzen. Ob der Blick der beiden Hauseigentümer beim Vorübergehen der Stäbe auch ermüdete? Wolff brach den Gedanken ab. Rilke passte nicht in dieses Ambiente.
Aus der Eingangshalle schraubten sich links und rechts Treppen in das obere Stockwerk, in dem wahrscheinlich die Schlafräume und die Arbeitszimmer lagen, denn hier unten entdeckte er keinen Schreibtisch. Es wäre interessant zu wissen, ob die beiden Haushälften im oberen Stockwerk durch einen Gang miteinander verbunden waren, aber Wolff dachte schnell, dass ihn dies nichts anging. Es war zu privat, und auch als Gast heute würde er gegenüber seinen Gastgebern seine sprichwörtliche Distanz wahren. Mit keinem Künstler, keiner Regisseurin, keinem Autor duzte er sich. Es gab wenige Ausnahmen, die in früheren Jahren begründet waren.
Otsch bot ihm einen irischen Whisky an. »Meine Frau wird gleich zu uns kommen. Sie hat noch zu tun«, sagte er. »Der Whiskey stammt aus einer Destillerie, die ich gelegentlich besuche. Auf Ihr Wohl! Schön, dass Sie uns endlich einmal besuchen!«
»Ich habe Ihre Frau schon länger nicht mehr gesehen«, sagte Wolff, aber Otsch reagierte nicht. Wolff blickte durch das fast bodentiefe Fenster in den Garten.
»Ach ja, die Gitter«, sagte Otsch, der Wolffs Irritation bemerkt haben musste, »wissen Sie, nach ein paar Wochen sieht man sie nicht mehr. Aber sie verschaffen uns doch eine gewisse Sicherheit. Man kann ja nie wissen …«
Im Salon stand ein Spinett, aus hellem Holz gefertigt. Auf dem Instrument lag eine in Schweinsleder gebundene kostbare Bibel, die Wolff auf das 16. Jahrhundert schätzte. Auf dem Buch getrocknete Silberdisteln, umwunden von einer Kette aus bunten Holzperlen. Dekoration. Offensichtlich spielte niemand auf dem Spinett.
Wolff schlenderte zur eingebauten Bücherwand, die über eigens ausgesparte Flächen verfügte, um Platz für Bilder zu schaffen. Er entdeckte eine Kohlezeichnung des Münchner Impressionisten Heinrich von Zügel. Sie zeigte wie so viele seiner Tier- und Genre-Gemälde eine Gruppe von Kühen, die sich in einem offenen Stall zusammendrängen. Die Signatur verriet das Jahr 1914 als Entstehungsjahr. Ein düsteres Bild. Zügels Bilder aus der Dachauer Landschaft, aus Belgien und den Niederlanden galten vor Jahrzehnten noch als wertvolle Anlage, inzwischen waren die Verkaufspreise eingebrochen und es gab immer wieder einmal in den Münchner Galerien Ölgemälde und Kohlezeichnungen im Angebot, und selbst bei internationalen Auktionen erzielten Zügels Werke keine besonders hohen Preise mehr. Der Kunstmarkt veränderte sich schnell. Vielleicht stiegen in den nächsten Jahren die Preise wieder. Wer konnte das schon wissen.
»Ein echter Zügel«, sagte Wolff, aber Otsch reagierte nicht. Er fixierte Wolff mit starrem Blick, er hing wohl einem Gedanken nach, dann räusperte er sich, ging ein paar Schritte auf ihn zu und sagte: »Ach ja. Das ist ein besonderes Bild, das Elisabeth von ihrem Vater geerbt hat, der es von seinem Vater übernommen hat. Sie hängt an dem Bild. Es ist von Zügel, aber das wird Ihnen nicht viel sagen.«
»Ein echter Klee?«, fragte Wolff, als er ein kleinformatiges Bild in einem schmalen Silberrahmen entdeckte. Wieder antwortete Otsch nicht. Wolff betrachtete die Zeichnung, die die Silhouette eines Engels zeigte. Ähnliche Motive hatte er im Paul-Klee-Zentrum in Bern gesehen, am meisten hatte ihn damals die Zeichnung des weinenden Engels fasziniert. Nach Bern fuhr er gerne, wann immer es sich ergab. Er liebte die Wellenlandschaft des Zentrums, seine weißen Kurven, von Renzo Piano in den Hang hineingesetzt, künstliche Hügel in der Landschaft, Symbole für den Fluss der Zeit. Dieser Engel hier wirkte heiter. Im Regal beleuchtete eine versteckte Lampe das Porträt mit schwachem Licht. Zu viel Lux würden der Zeichnung schaden, sie würde verblassen.
Ein paar Schritte weiter. Wolff wollte sich nicht setzen, bevor Elisabeth Achatz von Harnier nicht erschienen war. An der Seitenwand des Salons entdeckte Wolff ein alpenländisches Motiv. Kräftige Farben. Großes Format. Schneebedeckte Dächer vor der Bergkulisse. »Ein Segantini?«, fragte Wolff, aber Otsch gab keine Antwort. »Meine Frau kommt jetzt gleich«, sagte er, »ich weiß nicht, weshalb sie noch nicht da ist. Wollen wir uns setzen?« Er zeigte auf eine Sitzgruppe mit weißer Lederbespannung.
Sie setzten sich.
Wolff stand wieder auf. »Entschuldigung, darf ich das Bild an der Wand drüben auch noch ansehen?« Otsch sagte nichts, musterte Wolff aber genau.
Der Auftritt von Elisabeth Achatz von Harnier. Wolff hörte, wie sie aus ihrer Haushälfte die Treppe herunterschritt. Dann stand sie im Salon und füllte mit ihrer Präsenz den Raum. Sie hielt Wolff ihre Hand hin, verhüllt von einem weißen Handschuh. »Mein Lieber!«, flötete sie, schüttelte ihre blonden Haare und erwartete von Wolff einen angedeuteten Handkuss, den Wolff aber verweigerte. »Gnädige Frau«, sagte er nur. »Wissen Sie, nach den letzten Jahren muss man sich ja schützen«, sagte sie. »Sie haben völlig recht.«
Elisabeth von Harnier, wie sie sich offiziell nannte, war in der Öffentlichkeit bekannter als ihr Mann Otto. Sie stand seit Jahren auf großen und kleinen Bühnen, spielte Charakterrollen in Filmen und erwähnte in den Interviews der Programmzeitschriften gerne ihre Mutter als Vorbild, die eine der ersten Fernsehansagerinnen in Deutschland gewesen war. Auch sie war eine aristokratische Erscheinung gewesen. Überall dabei, wo sich die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft trafen, immer in Sichtweite irgendeiner Kamera, sodass sich manche Beobachter fragten, wie sie es dauerhaft schaffte, in der Öffentlichkeit so dominant und präsent zu sein. Zu politischen Fragen hatte sich ihre Mutter nie geäußert, niemand erwarte das von ihr, hatte sie erklärt, und sie wolle ihr Publikum nicht verärgern, was sie aber nicht daran hinderte, vor mehr als zwei Jahrzehnten für den Stadtrat der Landeshauptstadt München zu kandidieren. Natürlich auf der Liste der Konservativen, die sich mit ihrer Prominenz schmückten. Aber es waren kaum Redebeiträge in der Fraktion oder im Plenum von ihr überliefert, das war auch nicht notwendig. Sie war dabei gewesen und sie war wichtig.
Elisabeth sah Wolff an. »Wie schön Ihre Blumen sind«, sagte sie und dankte ihm. »Ich freue mich, dass ihr euch schon gut unterhaltet.« Wolff betrachtete verstohlen das Ölgemälde an der anderen Wand. »Sie sind ein Kunstkenner, mein Lieber, das sehe ich auf den ersten Blick!« Sie nahm Wolffs Arm und führte ihn zu dem Bild. »Kommen Sie, schauen Sie!« Das sei ihr Lieblingsbild, verriet sie ihm. Es stamme aus dem Erbe ihres Großvaters. »Er liebte es sehr. Mein Vater liebte es sehr. Ich liebe es auch.«
Später am Abend, Wolff hatte sein Zimmer im Hotel bezogen, öffnete er eine Tüte gesalzener Erdnüsse und eine kleine Flasche Grüner Veltliner. Er hatte noch Appetit, denn der Imbiss bei Otsch und Elisabeth hatte nur aus einer italienischen Vorspeisenplatte, einem Korb mit Baguette und einem sehr anständigen Wein bestanden. Welch merkwürdiger Abend, dachte Wolff. Otto Achatz hatte sich verändert. Er hatte auf Wolff heute Abend zerstreut, unkonzentriert, abwesend, fast teilnahmslos gewirkt. Elisabeth hatte geplaudert wie immer: elegant aber hohl. Sie hatte nur von sich und ihren Engagements erzählt. Als Wolff ganz kurz Otsch auf die Produktion im Funkhaus ansprechen wollte, erwiderte der Regisseur nach einer langen Bedenkzeit: »Heute Abend wollen wir doch nicht über unsere Arbeit reden. Aber: Wir kommen gut voran. Ich bin bald wieder in München, vielleicht sehen wir uns.« Dabei hatte er Wolff wieder mit starrem Blick angesehen. Er hatte nicht in seine Augen gesehen, sondern blickte auf Wolffs Lippen. Elisabeth hatte die Aufmerksamkeit sofort auf sich gezogen, erklärte ihr Desinteresse an Politik, obwohl niemand das Thema erwähnt hatte. »Wenn du dich politisch äußerst«, sagte sie, »dann verlierst du deine Fans. Das wusste schon meine Mutter.« Wolff war bekannt, dass sie im Netz viele Follower hatte. Merkwürdig nur, überlegte er, dass sie sich trotz ihrer politischen Abstinenz immer im Dunstkreis von Politikerinnen und Politikern zeigte, in den Clubs der Rotarier und der Lions-Freunde, in der richtigen Box im richtigen Festzelt auf der Wiesn in München, na ja, in den letzten Krisenjahren war das Oktoberfest abgesagt worden. Elisabeth hatte sich in diesen stillen Jahren andere Auftrittsmöglichkeiten suchen müssen. Man las in den Gesellschaftskolumnen der Boulevardzeitungen, wo sie sich neue Strümpfe (glitzernd) kaufte und in welchen Sozialeinrichtungen sie Lesungen abhielt. »Die alten Menschen sind ja unendlich dankbar, wenn ihnen Geschichten erzählt werden«, sagte sie. Aber zuletzt waren auch die Lesungen ausgefallen.
Das Hotel war nicht einmal zu einem Viertel ausgebucht. Nur zwei Gäste traf Wolff in der Bar, unter dem gedämpften Licht unterhielten sie sich leise. Zwei müde Leute an einem müden Abend. Mehrere Halogenleuchten waren ausgefallen. Niemand hatte sie erneuert. Es gab keine dezente Musik. Es gab nur diesen Raum in seinem Halbschlaf. Wolff zog es vor, auf sein Zimmer zu gehen.
Im Norden lag die Salzburger Altstadt. Der Nachthimmel reflektierte matt die Lichter über den Plätzen und Gassen. Das Fenster ließ sich ohne Problem öffnen. Es roch frisch, aber die Landschafts- und Stadtkulisse, die er in der Dunkelheit nur als Silhouette erkennen konnte, war nicht frisch, sondern wirkte auf ihn wie eine eingefrorene Struktur des Stadtlebens, das es längst nicht mehr gab und das es auch so bald nicht mehr geben würde. In München hatte Wolff immer wieder solche Ermattungsgefühle erlebt – wie bleierner Dunst hatte sich eine früher nie erlebte Langsamkeit auf den Straßen wie in den heißen Augusttagen seiner Kindheit ausgebreitet, wenn die Hitze alles lähmte und seine Eltern kaltes Wasser in die Badewanne einließen, um die Wohnung zu kühlen.
Erneut dachte er, wie merkwürdig sein Besuch im Haus Achatz gewesen war. Otto hatte ihn vor zwei Wochen, als sie sich im Marmorfoyer des Funkhauses trafen, nach Salzburg eingeladen. »Kommen Sie doch bei uns vorbei«, hatte er gesagt, »meine Frau und ich fänden das sehr schön.« Doch heute Abend hat Wolff eine Freundlichkeit erlebt, die auf ihn wie ein künstliches Ritual wirkte. Otsch folgte kaum dem Gespräch mit Elisabeth, wobei Wolff wenig sagen konnte, denn der Bühnenstar überforderte ihn mit seinen Wortkaskaden. Selbstbeschreibungen wechselten sich ab mit den Psychogrammen von darstellenden Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie es zu tun hatte. Otsch verfolgte mit den Augen, wer gerade sprach. Elisabeth lachte, auch wenn es keinen Grund gab, zu lachen. Sie plauderte für sich und vor sich hin, mit großen, weit ausholenden Gesten.
Das Grundstück, ja, es stamme noch von ihrem Großvater, einem Industriellen, der sich unbedingt in Salzburg-Aigen niederlassen wollte. Um das Jahr 1933 herum sei ihm der Baugrund angeboten worden. Das Haus hätten sie dann nach dem Krieg von einem Architekten bauen lassen, der ihre Wünsche in seinen Bauplänen berücksichtigte. Ihr Großvater, Geheimer Kommerzienrat und politisch nicht ohne Einfluss, hatte seit seinen ersten Berufsjahren Bilder gesammelt. In den späten Dreißigerjahren sei der Markt geradezu überschwemmt worden mit wertvollen Bildern, Stichen und Lithografien, da habe er immer wieder einmal zugegriffen. »Man muss einen Blick für Kunst haben«, sagte Elisabeth Achatz-von Harnier.
Wolff stand in seinem Hotelzimmer auf und holte aus dem Kühlschrank noch ein Fläschchen Grüner Veltliner. Drei kleine Flaschen hatte er entdeckt. Der Wein war leicht, spritzig und kühl, und Wolff spürte, wie sich seine depressive Stimmung verzog, fast wie feuchte Kälte, wenn endlich wieder die Sonne scheint. Die Möbel des Hotelzimmers waren aus hellgrauem Holz gefertigt, der Raum wirkte elegant. An den Wänden hingen zwei Poster im Silberrahmen: Motive des Surrealisten Leherb. Wolff besaß seit Langem das Plakat »I like Mozart«, das Helmut Leherbauer 1972 für die damalige Österreichische Fremdenverkehrswerbung entworfen hatte: Das junge Genie Mozart sitzt auf einem schweren Motorrad und startet aus der blauen Grundfarbe, wie sie für Leherbs Bilder typisch ist, voller Lebenslust zum Betrachter heraus. Das andere gerahmte Poster zeigte ein »Mädchen, das auf einer Wolke Cello spielt«. Beide Motive waren international beliebte Ikonen der Festspielstadt gewesen. Wolff hatte beide Poster gekauft, das Exemplar mit dem Mädchen konnte er zu Hause nicht mehr finden. Es war nun alles unendlich lange her, und Wolff hatte erst viele Jahre später die verträumte, surrealistische, vielleicht auch kitschige Kunst Leherbs für sich entdeckt. Inzwischen waren die Plakate pro Exemplar mit 300 Euro bei Ebay im Angebot zu finden. Der Künstler war längst berühmt geworden. Ein Politiker in Wien hatte gegen Leherbs Konzeption für den österreichischen Pavillon bei der Biennale 1964 und das »Zeitzerstörungsmanifest« erfolgreich interveniert. Tote Tauben, an die blauen, mit Wasser besprühten Wände genagelt, Flitterpuppen und Regenschirm-Skulpturen als Beitrag der Alpenrepublik zur internationalen Kunst: wie widerlich und dekadent. So wurde nichts aus Leherbs Venedig-Beitrag, aber seine Bekanntheit war gestiegen. Jahrzehnte später erbrachten seine teuersten Bilder mehr als 50 000 Euro bei Auktionen. Wolff hatte sich damals aber sehr schnell von Leherbs Kunst verabschiedet. Er hielt die Grafiken und Malereien von Leherbs Frau Lotte Profohs für interessanter, aber die junge Muse hatte ihrem Ehemann zuliebe ihren Beruf aufgegeben. Ein Jammer, fast wie bei Robert und Clara Schumann, hatte Wolff immer gedacht. Leherb wirkte, je länger Wolff sich mit ihm befasste, als zu glatt, zu dekorativ auf ihn. Er wandte sich den abgründigen, heiteren, mythologischen Dimensionen in den Bildern von Arik Brauer zu, einst ein Freund Leherbs in der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Als Wolff aber auch ihn als zu verträumt, zu bunt, zu detailverliebt empfand, hatte er in einer großen Ausstellung der Wiener Albertina Gottfried Helnwein für sich wiederentdeckt, dessen Bilder ihn früher immer abgeschreckt hatten. Verletzte Kinder, blutend, bandagiert, Kinder in SS-Uniformen: Wer hält das schon aus? Aber die Albertina-Ausstellung hatte auf Wolff gewirkt, als halte er sich zum ersten Mal in einer Kathedrale auf. Tief erschüttert hatte er das Gebäude über die markante Freitreppe verlassen, draußen war es sommerlich warm, aber in seinem Inneren spürte Wolff eine Vereisung. Helnwein war mit seinem dramatischen Fotorealismus doch einer der ganz Großen unter den ihm bekannten österreichischen Künstlerinnen und Künstlern.
Hier im Hotelzimmer passten aber die Poster Leherbs sehr gut zum Image der Festspielstadt, ihre Motive flockiger, heiterer, mehr ein Soufflé als das ewig andauernde Bombardement in den Schaufenstern der Altstadt mit Mozartkugeln, den Originalen in den Originalverpackungen und den späteren Kopien der Produktnachahmer.
Wolff ging das Ölgemälde im Haus von Otto und Elisabeth Achatz, das er den ganzen Abend betrachtet hatte, nicht aus dem Kopf, bis ihn Elisabeth eingeladen hatte, das Bild im breiten Goldrahmen genauer zu betrachten. Carl Wilhelm Hübner hatte es mit seinem Namen Carl Hübner signiert. Titel: »Die Auswanderer«, entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Elisabeth hatte mit ihren weißen Handschuhen sanft den Bilderrahmen berührt, kaum sichtbaren Staub aus den Fugen der goldenen Girlanden gewischt, geplaudert und erklärt, wonach Al Wolff sie gar nicht gefragt hatte. »Dieses Bild hing mal in der Nationalgalerie in Oslo.« Wolff hatte sie angesehen. »Ach ja, Bilder gehen viele Wege. Verschlungene Pfade. Man muss das alles gar nicht wissen. Jetzt ist es hier und wir lieben es sehr.«
Immer wieder war Elisabeth sehr sanft mit ihren weißen Handschuhen über den goldenen Rahmen gefahren. »Schauen Sie«, hatte sie gesagt, »ich zeige Ihnen etwas. Otsch, hilf mir einmal bitte!«
Gemeinsam hievten Sie das Bild etwas nach oben und lösten es vom Haken in der Wand. Dann stellten sie es sehr vorsichtig auf den Parkettboden und drehten es um. »Sehen Sie? Hier ist eine Expertise aufgeklebt.«
Wolff beugte sich vor.
Auf der Rückseite der Leinwand war ein Schreiben unter einer durchsichtigen Folie befestigt. Unter der Querleiste des rückseitigen Holzrahmens sah Wolff ein amtliches Schreiben mit dem Briefkopf
NASJONALGALLERIET Oslo, dunkelbraun vergilbt in den Jahrzehnten unbekannter Wege durch die Kunstmärkte. Darunter handschriftlich:
Sehr geehrter Herr,
Das Bild Hübners »Die Auswanderer« befindet sich nicht mehr in unserer Galerie, ist als Leihgabe an irgendeiner öffentlichen Gebäude übergeben seit mehrere Jahre. Was die Sujet betrifft bedauere ich keine Mitteilungen geben zu können.
Mit vorzüglicher Hochachtung.
Die Unterschrift war in der diffusen Beleuchtung des Salons für Wolff nicht entzifferbar. Sie sah wie eine Chiffre für den Namen Johann H. Langomer aus, aber da sollte man sich nicht festlegen. Er hatte ja kein Recht, mit einer Lupe den Beipackzettel des Bildes im Haus seiner Gastgeber zu studieren. Datum: 18. Juni 1934.
Die Jahreszahl alarmierte Wolff.
»Sehr interessant«, sagte er nur. »Ich danke Ihnen, dass Sie sich so große Mühe für mich gemacht haben. Vielen Dank, gnädige Frau. Danke Otsch.«
Sie hatten den schweren Goldrahmen mit dem Gemälde wieder an die Haken in der Wand gehängt. Wolff wollte sich unbedingt das Gemälde noch einmal in Ruhe ansehen.
Elisabeth von Harnier sagte, dass er das selbstverständlich machen könne, wann immer er wolle und Zeit dafür habe.
Es gibt harte, volle Tage.
Wolff hatte einen solchen Tag hinter sich. Die Konferenz. Die Autofahrt. Den Gang durch Salzburg. Den Abend in dem vergitterten Haus. Die gequälte Unterhaltung. Die fantastischen Bilder im Haus Achatz. Den Heimweg. Aber er war nicht müde. Morgen Mittag würde er wieder in München sein. Es tat ihm gut, wenigstens für einen Tag Abstand zum Funkhaus zu haben. Schlafen konnte er später. Er wollte jetzt noch nicht schlafen gehen. Seinen Wein hatte er noch nicht ausgetrunken. Er setzte sich an den kleinen Schreibtisch und blätterte die Gästemappe durch. Solche Abende waren nicht schlecht. Wolff fühlte sich gut.
Das Übliche. Wolff schlug die Mappe ganz hinten auf. Ein Verzeichnis der Fernsehkanäle, der kostenfreien privaten und öffentlichrechtlichen Sender. Ganz unten in der Liste internationale Newskanäle, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender Europas. Dann die Übersicht über die pay tv-Angebote, die blue movie-Spezialkanäle. Uninteressant.
Wandertipps. Ortsgeschichte. Schwarz-weiß-Fotos von Aigen, wie es früher aussah. Bunte Bilder aus der Jetztzeit. Fröhlich lachende Menschen auf Wanderwegen. Badegäste, die sich erfrischen. Seit Jahren hatte es keine Wandergruppen mehr gegeben, die Bäder waren geschlossen worden, niemand stieg in die Bäche und Flüsse. Die Natur war geschlossen worden. Und jetzt, wo sie wieder geöffnet war, hielten Befürworter und Gegner der starken Einschränkungen Abstand gegenüber Menschen und Natur. Das hätten sie viel früher machen müssen, dachte Wolff.
Dann fand er einen anderen Werbetext aus der Region Aigen. Er las, dass das ursprüngliche Dorf aus einem Pfarrvikariat entstanden war und zunächst 1935, in ganzer Breite dann aber 1939 in die Stadt Salzburg eingemeindet wurde, ein Jahr nach dem Jubel über den Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich auf dem Wiener Heldenplatz. Ein kleiner Teil war an die Gemeinde Elsbethen gefallen. Ob sich die Lokalpolitiker damals gestritten hatten? Oder hatte es Chancen für einen fairen Dialog über die jeweiligen Interessen gegeben? Beide Jahre standen für die ersten perfekt organisierten Aufmärsche der Uniformträger. Für Fanfarenzüge. Für Fahnenappelle. Für die bedingungslose Zuwendung zum größten Führer aller Zeiten. Aber Wolff entdeckte keine Informationen darüber in dem kleinen Katalog. Natürlich: immer wieder das Schloss. Historische Fotos über die erst lockere, dann dichte Bebauung im künftigen Villenviertel zwischen dem Schloss und dem Bahnhof. Erst wurde auf Abstand zur Salzach geachtet, dann breiteten sich größere Bauten auf größeren Grundstücken am Fluss aus. Das Leben war schön hier draußen vor der engen Altstadt Salzburgs. Die Landschaft war schön. Der Blick auf den Fluss und die Berge war schön. Alles war schön – und bunt. In der ausverkauften Heimat der Alteingesessenen entstanden die Heimaten der Neuen. Sie brachten ausreichend Kapital mit, sie wussten, was sie wollten. Sie bauten, sie grenzten sich ab, sie sicherten ihr Terrain. Bekannte Entwicklungsmuster. Im Dunstkreis von München war das nicht anders gewesen. In der Peripherie war es genauso: Die älteren Häuser wurden abgerissen, die baumbestandenen Gärten planiert. Luxuswohnungen, übrigens gefielen sie Wolff in ihrer Glasästhetik, wurden in Neubauten aufeinandergestapelt, die immer gleichförmiger wirkten. Mal waren die riesigen Glasfenster zu den Terrassen und Balkonen und Vorgärten rechteckig und glatt, mal rundeten sie sich, wobei sich Wolff immer fragte, wie solche Wohnungen mit runden Glasfassaden sinnvoll möbliert werden konnten. Aber das war ja nicht sein Problem. Vor den Häusern gab es schmale Grünstreifen. Als es noch erlaubt war, breiteten sich hier pflegeleichte Steingärten aus, die aber nicht wasserdurchlässig waren, denn die kostbaren Steine wurden mit Kunststoff-Folien vor dem Absacken oder dem Besatz von Moos geschützt. Inzwischen hatten die Behörden solche Steingärten verboten. Hinter den Wohnkästen schmale Handtuchstreifen Grünland. Wenige Büsche. Ein, zwei große Terrakotta-Blumentöpfe. Ein abdeckbarer Gas-Grill. Luxusgeräte. Aber auch eingeschwärzte Feuerstellen auf rostigen Rädern. Solche Geräte müssen gepflegt werden, sonst können sie nicht mehr benutzt werden. Der Rasen kurzgeschnitten. Mag sein, dass man dort gut wohnt und sich auch wohl fühlt, dachte Wolff immer, aber er versuchte immer schnell, solchen Mainstream-Architekturen auszuweichen. Und jetzt saß er hier in Salzburg-Aigen, trank seinen Wein und blätterte die Selbstdarstellung eines Ortsteils durch, dem die Zukunft wichtiger war als die Vergangenheit.
Dann aber dies.
Eine halbe Seite im Prospekt. Der Aignerpark. Ein schöner Park, so wie es andere schöne Parks gibt. Das hatte Wolff schon verstanden. Ihm stach ein Name in die Augen: HEXENLOCH. Und er las:





























