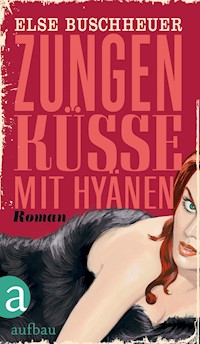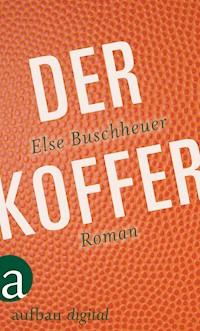15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wann ist ein Mensch ein Mensch, und was hat das damit zu tun, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Ist Helfen männlich? Weiblich? Menschlich? Ist es am Ende nur ein Schrei nach Liebe?
Buschheuer: »Ich hab auch nie zu einem Partner gesagt: Jetzt streng dich mal bisschen an. Rubbel hier. Rubbel da. Es war immer toll für mich, weil ich ja verliebt war. In Liebesdingen bin ich unverführbar. Es sei denn, jemand kommt und sagt: Ich glaub, ich bin impotent.«
Therapeutin: »Aha, weil du dann denkst, du kannst ihm helfen.«
»Tapfer wie ein Samurai und dazu auch noch komisch zieht Else Buschheuer in die Schlacht um die eigene Seele und rettet so ganz nebenbei die des Lesers.« Doris Dörrie
Sie ist radikal in der Selbsterforschung. Ihre Triebfeder ist unbedingte Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Wie Kolumbus sucht sie neue Kontinente, geht an die Grenzen der menschlichen Existenz, dorthin, wo es weh tut und sie sich selber spürt: bei den Sterbenden, den Alten, den Dementen, bei Geflüchteten, Gestrandeten, Obdachlosen. Was aber ist ihr Impetus? Fürsorge? Sehnsucht? Kontrollwut? Ist sie einfach nur bekloppt? Muss sie sich vielleicht mal lockermachen?
Mit Selbstironie, Verve und Leidenschaft erzählt Else Buschheuer von einer Reise nach außen, in die Grenzbereiche des Lebens und unserer Gesellschaft, und von einer Reise nach innen, an die Wurzeln von »So-Sein« und Identität. Eine rigorose Selbstsezierung, schonungslos offen, geistreich und pointiert, eine persönliche Bestandsaufnahme, die unvermutet zur Diagnose unserer gesellschaftlichen Verhältnisse wird – und zu der existentiellen Frage: Was ist ein Mensch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Ähnliche
Zum Buch
Wann ist ein Mensch ein Mensch, und was hat das damit zu tun, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Ist Helfen männlich? Weiblich? Menschlich? Ist es am Ende nur ein Schrei nach Liebe?
Else Buschheuer ist radikal in der Selbsterforschung. Ihre Triebfeder ist unbedingte Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Wie Kolumbus sucht sie neue Kontinente, geht an die Grenzen der menschlichen Existenz, dorthin, wo es weh tut und sie sich selber spürt: bei den Sterbenden, den Alten, den Dementen, bei Geflüchteten, Gestrandeten, Obdachlosen. Was aber ist ihr Impetus? Fürsorge? Sehnsucht? Kontrollwut? Ist sie einfach nur bekloppt? Muss sie sich vielleicht mal lockermachen?
Mit Selbstironie, Verve und Leidenschaft erzählt Else Buschheuer von einer Reise nach außen, in die Grenzbereiche des Lebens und unserer Gesellschaft, und von einer Reise nach innen, an die Wurzeln von »So-Sein« und Identität. Eine rigorose Selbstsezierung, schonungslos offen, geistreich und pointiert, eine persönliche Bestandsaufnahme, die unvermutet zur Diagnose unserer gesellschaftlichen Verhältnisse wird – und zu der existentiellen Frage: Was ist ein Mensch?
»Tapfer wie ein Samurai und dazu auch noch komisch zieht Else Buschheuer in die Schlacht um die eigene Seele und rettet so ganz nebenbei die des Lesers.« Doris Dörrie
Zur Autorin
Foto: © Astrid Weiske
Else Buschheuer wurde 1965 in Eilenburg bei Leipzig geboren; sie war Reporterin, TV-Moderatorin, Kolumnistin und eine von Deutschlands ersten Bloggerinnen. Von 2001–2005 lebte sie in New York City; vielbeachtet waren ihre Berichte über die Anschläge vom 11. September. Heute lebt sie als Schriftstellerin in Berlin. Bisher erschienen: Ruf! Mich! An!, Masserberg, Venus, Der Koffer, Verrückt bleiben! und Zungenküsse mit Hyänen.
ELSE
BUSCHHEUER
HIER NOCH WER
ZU RETTEN?
ÜBER DIE LIEBE, DEN TOD
UND DAS HELFEN
Alle Geschichten in diesem Buch beruhen auf wahren Erlebnissen – manche Namen, Orte und Erkennungsmerkmale wurden zum Schutz der Beteiliigten verfremdet.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
Umschlagfoto: © Astrid Weiske
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-22978-8V002
www.heyne.de
»Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.«
HILDE DOMIN
Für Sabine Knoll
VORWORT
Im Folgenden wird erforscht: das sogenannte Helfersyndrom
Frauen sind angeblich von Haus aus fürsorglicher. Nach allem, was ich inzwischen über mich weiß, bin ich eine untypische Frau. Ich tanze gern aus der Reihe – trotzdem ziehe ich schneller mein Hilfsangebot aus der Tasche als John Wayne den Colt.
Liegt der Grund dafür im Mangel oder im Übermaß? Wovon wird das Verhältnis zwischen Selbstsucht (zu viel) und Selbstlosigkeit (zu wenig) reguliert? Ist selbstloses Helfen für einen »selbst-bewussten« Menschen überhaupt möglich? Ist es gesund, eigene Bedürfnisse zugunsten anderer zu unterdrücken?
Ist manchen Menschen das Wegschenkenwollen in die Wiege gelegt, wird diese Charaktereigenschaft biografisch erworben? Wir alle schlingern zwischen Arm und Reich, Gleichschaltung und Individualität, Gut und Böse. Aber manche von uns sind glückliche Sklaven im Steinbruch fremder Herren. Warum? Warum denn nur? Was treibt uns an, ungebeten an anderen herumzureparieren, unsere Lebenskraft mit Riesenkannen in fruchtlose Baustellen zu gießen, zwang- und reflexhaft andere retten, heilen, »besser« machen zu wollen? Was versprechen wir uns davon? Anerkennung? Liebe? Transzendenz?
Haben wir Menschen einen eingebauten Schieberegler zwischen Altruismus und Egoismus, der der Feinregelung bedarf? Brauchen wir einen Endorphinschub, der ohne Alkohol und Drogen jederzeit – und auch noch zum Wohle Dritter – herstellbar ist? Ist es vielmehr einfach Teil unserer Natur, anderen zu helfen? Sind wir Helfenden die eigentlich Normalen? Die Welt ist ungerecht. Können wir anderen das wirklich tatenlos mit ansehen? Und falls ja, was macht das mit uns? Stumpfen wir ab wie Soldaten im Krieg? Leiden wir dann am Nichthelfersyndrom?
Wer bin ich? Wer will ich sein? Was bleibt, wenn man sich selbst wie eine Zwiebel schält? Gibt es Freiheit in der Bindung? Wer drückt die Knöpfe, wenn ich futschikato bin? Werden alle Menschen Brüder? Und falls ja, was ist dann mit der weiblichen Energie, nach der ich mich so sehne?
Wohin die Reise geht? Wohin sie für uns alle geht: nach Haus! Zu uns selbst.
GRUPPENMEDITATIONEN
Die unterbrochene Hinbewegung
Wir sollen nicht mit überschlagenen Beinen sitzen. Wir sollen die Augen schließen und gleichmäßig atmen. Wir sollen uns das kleine Kind vorstellen, das wir einmal waren. Wir sollen die Hand des kleinen Kindes, das wir einmal waren, ergreifen. Wir sollen das kleine Kind, das wir einmal waren, beim Namen rufen. Wir sollen in das kleine Kind, das wir einmal waren, hineinschlüpfen.
Wir sind nun im Kinderkörper. Wir hören unsere Kinderherzen pochen. Wir tapsen mit unseren Kinderfüßen über die Dielen.
Zur Mutter. Dort ist sie. Die Mutter ist in der Küche. Sie macht Essen. Wir nähern uns der Mutter und legen unsere kleine klebrige Hand auf ihren Oberschenkel, auf ihren Rock. Sie reagiert nicht. Wir rufen sie, wir zupfen am Rocksaum. Sie reagiert nicht.
Wir sollen nicht mit überschlagenen Beinen sitzen. Wir sollen die Augen schließen und gleichmäßig atmen. Wir sollen uns die berufstätige Frau vorstellen, die wir sind. Wir sollen in die berufstätige Frau, die wir sind, hineinschlüpfen.
Wir sind nun im Körper der Frau. Wir sind gerade nach Hause gekommen, verschwitzt und müde. Wir müssen Wäsche waschen. Wir müssen einen Brief an die Krankenkasse schreiben. Wir müssen telefonieren und gleichzeitig kochen.
Wir hören die Kinderfüße, die über die Dielen tapsen.
Wir spüren die kleine warme Hand auf unserem Bein. Wir reagieren nicht. Jetzt nicht, denken wir. Wir spüren das Zupfen an unserem Rocksaum. Nerv nicht, denken wir. Ich kann grad nicht.
GUTMENSCH, GESCHEITERT
Aufzeichnungen aus New York, East Village, 2002
Ein Obdachloser vorm Tempeleingang. Ein kalter Morgen, der Himmel über New York tief und nass, zum Auswringen. Jackenwetter. Regenschirmwetter. Ich hocke mich neben ihn. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich neben jeden Obdachlosen in New York hocke, obwohl das ein tagesfüllender Job wäre und gut für das Training der Beinmuskulatur, aber in diesem Fall muss ich einfach.
Der Mann sieht aus wie der Renoir-Fälscher aus dem Amélie-Film, der mit der Glasknochenkrankheit. Denselben traurigen, klugen Ausdruck im von Alkohol verwüsteten Gesicht. Er zittert am ganzen Leib. Er riecht nach Scheiße. Seine Ohren sind dreckverkrustet, seine Kopfhaut von einer Flechte überzogen. In seinem entzündeten Gesicht hängen Hautfetzen. Das Weiße in seinen Augen ist rot. Er trägt ein kurzärmeliges T-Shirt. Neben ihm steht eine Papptüte mit Schnapsflasche drin. Ich frage ihn, wie er heißt. Er antwortet, aber ich kann ihn nicht verstehen. Er hat keine Zähne mehr und spricht ganz leise. Ich frage ihn, ob er Hunger hat. Er sagt nix. Ich sage, es reicht, wenn er nickt. Er nickt. Also gehe ich hoch und hole ihm einen Bagel und etwas Obst. Er nimmt den Bagel in die Hand, dreht ihn und sieht ihn verwundert an. Dann gibt er ihn mir zurück. »Ich kann das nicht essen, Girl«, sagt er. Dasselbe mit dem Obst. Er nimmt es, riecht daran, gibt es mir wieder.
Ich frage ihn, ob er Durst hat. Er sagt nix. Ich sage, es reicht, wenn er nickt. Er nickt. Also gehe ich wieder hoch und mache ihm eine Tasse Tee. Ich brauche eine Weile, aber er ist noch da, als ich zurückkomme. Er hält die heiße Tasse in der Hand und riecht daran. »Ich kann das nicht trinken, Girl«, sagt er und gibt sie mir zurück.
Ich hocke noch eine Weile da, ratlos, die Teetasse in der Hand, und schweige mit ihm. Dann bietet er mir von seinem Schnaps an. »Ich trinke nicht«, sage ich. Er bietet mir von seinen Zigaretten an. »Ich rauche nicht«, sage ich. Ich frage ihn, ob er mit reinkommen will, ein Bad nehmen. »Ich bade nicht«, sagt er. Ich frage ihn, ob er mit in den Tempel kommen will, beten. »Ich bete nicht«, sagt er und lächelt zahnlos. »Du siehst, Girl, wir passen nicht zusammen.«
WARUM MACHST DU DAS?
(Also, ICH könnte das nicht)
Das Schönste am Fasten ist der Tag, an dem der Hunger verblasst und der Geist sich in lichte Höhen aufschwingt: das sogenannte Fastenhoch. Einmal las ich während eines Fastenhochs in einer Zeitung ein Interview mit der Milliardärin Susanne Klatten. »Wenn man mit Mitte fünfzig für viele immer noch ›die Erbin‹ ist, ist das schon befremdlich«, sagte sie.
Ich setzte mich hin und schrieb ihr. Dass sie aktiv ihren Namen mit einer großen Aufgabe verbinden müsse wie Nobel, wie Obama, notfalls wie Hartz, bis der Name mit der Aufgabe – zum Beispiel Gesundheitsprävention – verschmilzt, sodass spätere Generationen vielleicht nicht mehr den Menschen kennen, aber alle das Projekt.
Mit dem Einstecken des Briefes war für mich die Sache erledigt, bis ich Wochen später die Mail eines gewissen Dr. Appelhans erhielt. Die von mir vorgeschlagene Gesundheitsreform sei »sicher unterstützenswert«, schrieb er, aber Frau Klatten engagiere sich zu gleichen Teilen für kulturelle Bildung, Natur sowie die Förderung von Unternehmertum. Zusätzlich habe sie mit ihrem Bruder jüngst dreißig Millionen Euro für die Entwicklung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung zur Verfügung gestellt, wo auch das Thema »public health« inklusive Prävention eine Rolle spiele.
Immerhinque, würde Vater Tadellöser sagen.
Inzwischen hatte ich ein Buch über Joseph Pilates aus Gelsenkirchen gelesen. Der Pilates-Erfinder hatte in seinen späten amerikanischen Jahren John F. Kennedy ähnliche Briefe geschrieben wie ich Frau Klatten. Der fühlte sich offenbar auch zur Weltrettung berufen.
Ein Jahr später, Juni 2017, im nächsten Fastenhoch, lese ich in der Zeitung, dass es 2050 in Deutschland zehn Millionen Menschen geben wird, die über achtzig sind, davon drei Millionen Demente, die meisten Frauen. Vielleicht würde ich eine davon.
Meine Idee: Ich werde Altenpflegerin! Eine muss es ja machen! Ich beginne sofort mit der Umsetzung und stelle mich an drei Schulen vor. Man versichert mir, ich sei keinesfalls zu alt. Ich würde nach der dreijährigen Ausbildung immer noch »zwölf Berufsjahre ranklotzen können«. Am Abend vorm Vorstellungstermin sitze ich mit meinen Nachbarn in einer Kneipe in unserer Straße bei unserem monatlichen »Rieslingabend«.
»Warum machst du das?«, fragen Paul (Vorruhestand), Johanna (IT-Managerin) und Matthew (Musikbusiness). »Na ja, einer muss es ja machen«, sage ich.
Und alle am Tisch unisono: »Also, ich könnte das nicht!«
DIE ROTE KARTE
Du sollst nicht in den Kuchen aschen!
Für ein Praktikum im Pflegeheim brauche ich einen Gesundheitspass, eine sogenannte »rote Karte«. Im Gesundheitsamt ist sie mit großen, unübersehbaren Piktogrammen ausgeschildert. Das Ganze hat die Anmutung eines Pilgerwegs. Im Wartezimmer sitzen zwei Afrikanerinnen. Ich frage, ob ich eine Nummer ziehen müsse. Sie nicken. »In Deutschland immer«, sagt die eine. Als ich sitze, füllt sich der Raum schnell mit Menschen. Aus ihren Unterhaltungen schließe ich auf Küchenpersonal, Krankenhaus, Catering. Punkt vierzehn Uhr fangen mit einem trockenen Knall die Lichter auf den Tafeln an zu leuchten, und wir werden in der Reihenfolge des Nummernziehens zügig zu vier Schaltern gerufen. Die zuständige Sachbearbeiterin ist mit meiner Angabe »Altenpflege« vollkommen zufrieden, verlangt zwanzig Euro, drückt mir Zettel in die Hand und schickt mich zum Lesen derselben zurück ins Wartezimmer. Ich bin die einzige im Wartezimmer, die sich die Belehrung des Gesundheitsamts Mitte von Berlin gemäß § 42 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz durchliest:
Zuerst werden alle Personengruppen zusammengefasst, die in ihrem Beruf Lebensmittel in die Hand nehmen, dann wird belehrt: Lebensmittel dürfen nicht mit Mikroorganismen verunreinigt werden. Deswegen darf zum Beispiel keinen Durchfall haben, wer seinem Beruf nachgeht, keine infizierten Wunden, keine Hautkrankheit, keine Cholera, keine gelben Augäpfel, keine offenen Stellen, nichts, was nässt und eitert.
Schmuck müsse abgelegt, die Hände müssten häufig gewaschen und desinfiziert werden (auch die Fingerkuppen, Fingernägel und der Daumen von allen Seiten). Im Weiteren geht es um Hautpflege, Schutzkleidung, Verhalten (nicht in die Suppe niesen oder aschen). Einzelne Krankheiten werden erklärt: Salmonellen, Shigellose (bakterielle Ruhr), Gastroenteritis, Hepatitis A oder E, Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera etc.
Nach einer halben Stunde – so viel Zeit hatten wir für die Lektüre – werden alle Wartenden in einen abgerissenen Vorführraum gebeten, und ein Mitarbeiter bittet uns, ein Video anzuschauen. Die Themen werden nun noch mal mit Schauspielerin durchgeorgelt. In Erinnerung wird mir bleiben, dass Gesichtspiercings im Großküchenbereich abgeklebt werden müssen.
Die »Zeugnisverteilung« danach verläuft stumm und ohne Jubel. Person für Person verlässt das Gebäude mit dem Dokument und strebt zügig dem öffentlichen Nahverkehr zu. Draußen wartet niemand mit Zuckertüte. Auf den Straßen im Wedding setzt der Feierabendstau ein. Warum mache ich das?
AUSDRUCKSKRISE
Wer bin ich? Wer will ich sein?
Warum auch immer ich das mache, mein Projekt »Altenpflegeausbildung« läuft auf vollen Touren. Erstmals im Leben habe ich Bewerbungsmappen gekauft, bin im Besitz von taufrischen Bewerbungsfotos, auf denen ich tüchtig und unglamourös aussehe wie Mutter Drombusch, ich habe ein Anschreiben verfasst und einen tabellarischen Lebenslauf geschrieben. Natürlich ist mir klar, dass alles, womit ich in »meiner« Welt punkten kann (wo ich publiziert habe, wie viele wie erfolgreiche Romane, bei welchen Zeitungen ich welche Essays veröffentlichte, was ich in Radio und TV moderierte, wen ich alles Tolles kenne), hier nichts gilt.
In der Welt der Werktätigen, in die es mich aus unerfindlichen Gründen drängt, bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Für die Bewerbung habe ich mein Abiturzeugnis kopiert, das dreißig Jahre lang keine Sau sehen wollte, und meinen vergilbten DDR-Fachschulabschluss als Bibliothekarin. Aber was sagen diese Papiere über die, die ich heute bin, aus? Was bin ich wert draußen auf dem Arbeitsmarkt?
Im Wartezimmer sind außer mir nur eine fünfunddreißigjährige Tattoofrau und ein Junge mit Zahnspange. Potentielle Mitschüler? Wir werden alle drei gemeinsam hereingerufen. Die Direktorin begrüßt uns gut gelaunt. Es ist der sechzehnjährige Junge, mit dem ich die Schulbank drücken würde, die Tattoofrau – die altersmäßig meine Tochter sein könnte – ist seine Mutter. Die Direktorin würde uns beide vom Fleck weg nehmen, den Buben und mich. Fehlt noch ein Ausbildungsbetrieb. Sie fragt, welche Art von Pflegeeinrichtung mir denn am meisten liegen würde, ob ich in einem »normalen« Pflegeheim arbeiten möchte oder auf der Wachkomastation, bei körperlich Behinderten oder bei Dementen? »Ach«, antworte ich etwas ratlos, »klingt alles toll.«
Die zweite Schule lädt mich zum schriftlichen Eignungstest ein. Ich bestehe mit siebenundzwanzig von siebenundzwanzig Punkten. Jetzt wird mir mulmig. Ich möchte diese Ausbildung wirklich gern haben. Mit einem Fingerschnippen. Aber schaff ich das? Läuft die Maschine noch wie geschmiert? Ich bin bereits mehrfach repariert, bin Tod und Wahnsinn von der Schippe gesprungen. Aktuell stehe ich auf der Warteliste für eine Hornhauttransplantation.
Gibt es nicht auch im Menschen außer Sollbruchstellen und natürlichem Verschleiß so etwas wie eine geplante Obsoleszenz – eine geheimnisvolle eingebaute Maximalhaltbarkeit wie beim Drucker?
DIE SADISTISCHE HELFERPERSÖNLICHKEIT I
(So fühlt sich das auf der anderen Seite an)
Noch in derselben Nacht – Donnerstag – bewerbe ich mich bei einem Pflegeheim in meiner Nähe. Am nächsten Tag kommt eine Mail vom Büro des Klinikchefs, ich solle am Montag telefonisch mit ihm Kontakt aufnehmen.
Dreißig Minuten später trifft meine Freundin Lissy ein, mit der ich verabredet bin. Wir sitzen in meiner Küche und erzählen. Ich von meinen Pflegeerfahrungen, sie von dem Pflegeheim, wo sie gerade war, um einen Verwandten zu besuchen.
Lissy: »Wo sollst du Montag anrufen?«
Ich sage den Namen des Pflegeheims.
»Das gibt’s ja nicht. Da komm ich grad her. Wer hat dir geschrieben?«
Der Klinikchef. Ein Herr Sowieso.
»Nicht möglich!«
Wir schütteln die Köpfe über die Synchronizität der Ereignisse, ich erzähle von meinem Synchronizitätsordner, in dem ich Beispiele sammle für das nichtkausale Zusammentreffen zweier Ereignisse. Lissy ist Herrn Sowieso, dem Klinikchef, verschiedentlich begegnet. Er sei »ziemlich speziell«. Lissy ist sehr höflich, und wenn sie »ziemlich speziell« sagt, beschreibt sie einen Albtraum. Mein Telefonat mit Herrn Sowieso verläuft dann am Montag auch entsprechend. Mit schneidender Stimme fragt er, wann ich vorbeizukommen gedenke.
Ich: »Ich hab Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Zeit.«
Er, pfeilschnell: »Mittwoch?«
Mittwoch hab ich einen Schnuppertag im Pflegeheim in Frohnau. Aber das muss ich dem ja nicht auf die Nase binden.
»Mittwoch muss ich arbeiten«, sage ich.
»Ab wann?«
»Ab sieben.«
»Gut, dann kommen Sie um sechs Uhr fünfzehn.«
So kommt der Tag heran – O ging er wieder! (Mörike)
Um vier Uhr fünfzehn klingelt der Wecker, schon kurz nach sechs stehe ich Gewehr bei Fuß – Unpünktlichkeit soll mir keiner vorwerfen. Herr Sowieso, ein hemdsärmeliger Glatzkopf, kommt mir aus seinem Büro entgegen, winkt mich stumm und ohne Händedruck durch, teilt mir einen Platz zu und verschwindet, um – nur sich – einen Pott Kaffee zu holen.
Als er zurückkehrt, lässt er sich hinter seinen riesigen Schreibtisch plumpsen und kritisiert umgehend meine zurückgelehnte Körperhaltung. Ich richte mich auf, doch das gefällt ihm auch nicht.
»Hand auf den Tisch, das macht man nicht. Ich beobachte alles ganz genau. Das ist ein Bewerbungsgespräch.«
Nun wäre es mir ein Leichtes, den Mann ein Arschloch zu nennen und den Raum zu verlassen, aber ich bleibe sitzen. Erblicken und Erblicktwerden. Nicht nur sieht der hemdsärmelige Glatzkopf mich, nein, er sieht gleichzeitig, dass ich ihn sehe. Also verändert meine Anwesenheit ihn und seine mich. Ich suche einen Ausbildungsplatz und kann mir keinen Affront leisten.
Etwas Süffisanz vielleicht. Nur ein Terzlein.
»Wie möchten Sie denn, dass ich sitze?«
»Das müssen Sie schon selber wissen.«
Sie ahnen es sicher schon, das Gespräch mit dem Glatzkopf wird keine Sternstunde der Zwischenmenschlichkeit. Ich soll von mir erzählen (aber er scheint nicht zuzuhören). Ich soll schweigen (aber dann schweigt er auch). Ich soll Fragen stellen (aber nicht die, die ich dann stelle). Herr Sowieso, so viel ist klar, ist ein gewohnheitsmäßiger Herunterputzer. Die Bewohner des Pflegeheims, vor allem aber die Mitarbeiter, tun mir leid.
»Warum wollen Sie den Beruf ergreifen?«, fragt er.
»Vielleicht hab ich ein Helfersyndrom«, sage ich.
Darauf er: »Das wäre schlecht.«
Wäre ich jünger und gesünder, hätte ich den Wunsch, durch ein weiteres Stahlbad zu gehen, ich würde es nunmehr ganz unbedingt darauf anlegen, hier angestellt zu werden. Ich würde eine investigative Geschichte schreiben über Herrn Sowieso, eine Wallraffiade. Da ich nicht jünger und gesünder bin, aber klüger als Herr Sowieso vermutet, ja, ich möchte sogar annehmen, klüger als Herr Sowieso selbst, bleibe ich ruhig.
»So, und jetzt dürfen Sie Fragen stellen«, sagt er.
»Wie viele Bewohner sind hier?«
»Das sage ich nicht.«
»Wie viele Fachkräfte und Azubis?«
»Das sage ich nicht.«
»Wie lange sind Sie schon Leiter des Heims?«
»Das fragt man nicht.«
»Wie alt sind Sie?«
»Das fragt man nicht.«
»Welche Fragen soll ich Ihnen denn stellen?«
»Müssen Sie selber wissen.«
Herr Sowieso, wir danken für das Gespräch.
ICH BIN DA, HEINZ
Und die Seele? Fliegt sie hinaus?
Ich besuche meine Tante Uschi in Bitterfeld. Wir sitzen in ihrem Garten. Eine riesige Hornisse attackiert uns. »Mach mal Sterbehilfe«, sagt Tante Uschi, die mich gern neckt, seit ich den Sterbebegleitungskurs beim Hospiz mache, und schiebt mir Paral über den Tisch, ein Insektenspray »mit der natürlichen Kraft der Chrysanthemen«.
Ich lege auf die Hornisse an und schieße so präzise, dass sie, schaumig tropfend, zu Boden rutscht. Sie landet auf dem Sockel eines Gartenzwerges und dreht sich dort um die eigene Achse, ohne allerdings das Brummen zu unterlassen. »Na, mal sehen«, sagt Tante Uschi, zündet sich einen Zigarillo an und betrachtet mit Interesse das zuckende Tier. »Die leidet aber mächtig!«
»Das weiß man nie«, sage ich und muss an Herrn Wetterling denken. Herr Wetterling hatte laut gerasselt und mit den Armen immer wieder ins Leere gegriffen. Einmal hatte er mir dabei eine versetzt, und ich war erschrocken gewesen von dieser jenseitigen Schlagkraft. Ich war außer mir. Ich rief die Ärztin. Der Mann schien entsetzlich zu leiden. Man musste doch etwas tun!
Wetterling war nicht mein erster Sterbender. Ich hatte schon einige Jahre zuvor in Kalkutta im von Mutter Teresa gegründeten »Heim für mittellose Sterbende« von den »Missionarinnen der Nächstenliebe« Todkranke betreut. Aber das war anders gewesen. Die Menschen dort waren im Akkord gestorben. An Unterernährung, Tuberkulose, Hepatitis, Aids. Herr Wetterling war ein Krebspatient. Zur Schmerzeinstellung stationär. Austherapiert, wie es heißt. Final. Ihn betreute ich im Zuge meines Hospizkurses, über den sich Tante Uschi immer lustig macht.
Die Ärztin beruhigte mich. Das In-die-Luft-Greifen sei bei Sterbenden normal, ein Reflex. Herr Wetterling leide möglicherweise gar nicht. Jedenfalls weniger, als es den Anschein habe. Er erlebe jetzt Dinge, über die wir nur mutmaßen können, Sensationen, von denen wir nie erfahren werden, erst in der Stunde unseres Todes. Ich solle mich lieber auf einen Stuhl setzen, nicht auf den Bettrand. Wer weiß, ob Wetterling das wollen würde. Man soll Sterbenden nicht auf die Pelle rücken.
Die Ärztin öffnete das Fenster (Damit die Seele hinausfliegt? Sie verneinte energisch. Für frische Luft!) und ließ mich mit Wetterling allein. Viele Schläuche und Kanülen steckten in seinem Körper. Sein Brustkorb pumpte. Der Puls am Hals zuckte wie wild. Sein Kopf stieß ruckartig in die Luft. Seine entzündeten Augen traten hervor, aus seinem Mund quoll gelblicher Schaum. Der ganze Mann klang wie eine riesige, brodelnde Kaffeemaschine. Es gab Momente, da wollte ich selber sterben. Es gab Momente, da wollte ich schreien: »Stirb doch endlich! Hör auf mit diesen schrecklichen Geräuschen!«
Ähnlich wie die Hornisse erweckte auch Herr Wetterling nicht meinen Brutpflegetrieb. Sterben sieht nicht gut aus, klingt nicht gut, riecht nicht gut. Bei einer Geburt dabei sein, das finden wir schick. Eine Patenschaft für ein Kind in Afrika übernehmen – das ist lobenswert, schön weit weg, überdies niedlich. Aber die Gegenwart eines Sterbenden bringt uns in allergrößte Bedrängnis. Wir wissen nicht, was man tut, was man sagt. Niemand hat uns gelehrt, was man tut, was man sagt.
Wir wollen das nicht miterleben müssen, wir wollen einfach nur weg. Wenn die todkranke Oma fragt: »Muss ich sterben?«, lügen wir: »Ach wo, das wird wieder.« Und geben Fersengeld. Und überlassen sie ihrem Geschick. Und treffen uns nachher auf dem Friedhof wieder.
Ich blieb an Wetterlings Bett, kühlte seine harte gelbliche Stirn, hielt seine blau geäderte Hand und sagte, wenn sein Blick für den Bruchteil einer Sekunde aus weiter Ferne zurückkam: »Ich bin da, Herr Wetterling, Sie sind nicht allein.«
Mehr nicht. Mehr war nicht zu tun. Äußere Ruhe und innere Bewegung. Sein Sterben und mein Nichtstunkönnen wühlten mich auf. Diese Aufwühlung galt es auszuhalten, so lange es eben dauerte. Geduld haben. Stillsitzen. Einfach nur da sein. Nicht meine Stärken. Immer wieder ging ich ins Bad, einfach weil ich mich bewegen musste, unter dem Vorwand, den Waschlappen anzufeuchten.
Doch dann wurde Herr Wetterling unruhig, atmete hastiger, röchelte. Ich nahm das als Indiz dafür, dass er meine Anwesenheit wünschte. Er wollte nicht allein sein. Als ich im Badezimmer des Krankenzimmers seine Utensilien sah, Kulturtasche, Rasierwasser, Seife in Seifendose, Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, als mir bewusst wurde, dass er diese Dinge nun nicht mehr brauchen wird, dass sie bald in eine Tüte gepackt und den Hinterbliebenen mitgegeben werden, wurde sein Tod greifbar. Da stirbt ein Mensch. Ich nahm die Fieberkurve und suchte seinen Vornamen: Heinz.
»Also, ich könnte das nicht«, sagt die Schwester, die nach dem Rechten schaut, und verlässt das Zimmer.
Heinz. Ich und Heinz. Ich hielt seine Hand, streichelte seine eingefallenen Wangen und lauschte dem Gurgeln seiner Organe. Ich atmete mit ihm gemeinsam, wie ein mithechelnder Ehemann im Entbindungskurs, in der irrwitzigen Hoffnung, wenn ich immer langsamer atme, dann wird vielleicht auch er langsamer atmen, wird friedlicher werden, einschlafen können. Obwohl er in den folgenden Tagen mehrfach »Ich kann nicht mehr« flüsterte, obwohl es oft so aussah, als sei gleich alles vorbei, schien er am Leben festzuhalten. In seiner Karteikarte war vermerkt »nicht religiös«. Ob er deswegen schwer stirbt? Weil er vor dem Nichts steht? Oder gibt es noch etwas, was er klären will? Steht ein Abschied aus?
»Warum, um Himmels willen, machst du das?«, hatte Tante Uschi fassungslos gefragt, als vor zwei Monaten mein Kurs im Hospiz begann. »Warum machst du nicht was Lebensbejahendes? Ein Weinseminar, einen Kochkurs?«
Uschi, die wohl weiß, dass wir alle sterben müssen, hat ein regelrecht feindseliges Verhältnis zum Tod. Sie ist wütend auf die Schneeglöckchen, die wieder blühen werden, wenn sie längst modert. Sie hasst die Sonne, den Mond, Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Meere und die Berge, alles, was wiederkommt, alles, was ewig ist. Sie will den Tod nicht, der sich unaufhaltsam nähert. Bei sich selbst hält sie jedes Anzeichen von Verfall für vorübergehende Schwäche. Gleichaltrige sind für sie alte Leutchen. Wenn sie noch mal so jung wäre wie ich, dann hätte sie Besseres zu tun als Sterbebegleitung, sagt sie. Und doch studiert sie täglich die Todesanzeigen und erschrickt, wenn sie dort ihr Geburtsjahr findet. Nicht ein späteres, nicht ein früheres – ihres. »Wirst noch mal froh sein, eine Sterbebegleiterin in der Familie zu haben«, hatte ich auf Uschis Tirade geantwortet. Und sie hatte gesagt: »Werd bloß nicht frech!«
Sterben macht keinen Spaß. Dem Sterbenden nicht und den Anwesenden nicht. Insofern schickt die Hospizbewegung der Himmel. Dort ist man konsequent aufs Sterben eingestellt und macht es sich zur Aufgabe, es liebend zu begleiten. Sterbende, die sich fürs Hospiz entscheiden, dürfen ihr Haustier mitnehmen, dürfen rauchen, dürfen trinken, dürfen ihre Zimmer dekorieren und endlich alle Fragen stellen, die sie aus Takt der eigenen Familie nicht gestellt haben.
Und doch, Hospiz ist Endstation. Wer ins Hospiz geht, der sagt Ja zu seinem Tod. Er findet sich ab.
Für den normalen Verdränger ist es schwer, sich dauerlächelnden Hospizlern gegenüberzusehen, die vom »schönen Tod« sprechen. Das hat etwas Eingeweihtes, Sektenhaftes. Was bitte kann schön sein am Tod? Der Tod ist doch schrecklich. Endgültig. Tabu. Muss man wirklich darüber reden? Kann man das nicht diskret abwickeln?
Eine Schwester hat mich in das Verabreichen künstlichen Speichels aus dem Sprühfläschchen eingewiesen. Die Patienten nehmen den gern, sagt sie. Man soll Sterbenden nicht viel zu trinken geben. Sie können kaum mehr schlucken. Die Flüssigkeit wird nicht mehr abgebaut, sondern ins Gewebe eingelagert. Ich sprühe Herrn Wetterling halbstundenweise künstlichen Speichel in den ausgetrockneten Mund, um ihm Erleichterung zu verschaffen. Das Geräusch, das er daraufhin macht, nehme ich als Zustimmung. Erst einige Stunden später, nachdem ich mir die Flüssigkeit selbst testhalber in den Mund gesprüht habe, höre ich auf. »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Wetterling«, rufe ich, halb lachend, halb weinend, »ich wusste nicht, dass das so eklig schmeckt.« Von da an feuchte ich seinen Mund mit dem Waschlappen an.
Die Stunden vergehen langsam. Die Handschuhe, die mich die Schwester bat anzuziehen, habe ich längst abgestreift. Würde ich von Latex gestreichelt werden wollen in der Stunde meines Todes?
Wetterlings Atem macht mir klar, was für ein ungeheures Pensum so ein menschliches Herz hat. Das Blut durch den Körper zu pumpen. Und die Lunge, dieser unermüdliche Blasebalg. Und die lebensmüden Nieren. Wo fängt ein Sterben an? Versagen die Organe nach und nach? Steigt der Tod von den Füßen aufwärts zum Kopf? Bleibt zuerst das Herz stehen? Bricht es? Und was ist mit der Seele? Gibt es eine? Und, wenn ja, fliegt sie hinaus?
Jetzt hocken wir hier schon mehr als zwei Tage. Da können wir eigentlich du sagen. »Ich bin da, Heinz. Du bist nicht allein. Jetzt hast du’s gleich geschafft.« Dabei kenne ich Herrn Wetterling nicht. Er war schon kaum mehr ansprechbar, als ich ihn traf. Er ist ein Fremder für mich, ich bin eine Fremde für ihn, unsere Begegnung ist vollkommen frei von persönlichem Ballast. Wir begegnen uns als die, die wir im Moment der Begegnung sind. Ich sitze am Bett eines Mannes, der mein Vater sein könnte, der irgendjemandes Vater ist. Vielleicht hat er Kinder. Und wie sind diese Kinder? Und wo sind diese Kinder? Warum sind sie nicht bei ihm? Und warum bin ich bei ihm?
Später wird Wetterlings Familie das Zimmer betreten, vollkommen überfordert mit der Situation. Die Frau wird schluchzen, die Tochter wird schweigen, der Vater wird röcheln, es wird die Frage im Raum stehen: Wie siehst du nur aus? Was tust du uns an? Was wird ohne dich? Wie geht es weiter, wenn du stirbst? Und aus dem liebenden Abschied wird ein Vorwurf, eine Komplikation. Der Sterbende soll nicht gehen. Er soll am Leben bleiben, für seine Familie, die seinen Tod nicht aushalten kann. Egoismus und Angst, nackte Angst. Vielleicht ist das Sterbenlassen schwerer als das Selbersterben.
Am dritten Tag, nachmittags, atmet Herr Wetterling dreißig Sekunden nicht. Dann atmet er wieder. Dann atmet er wieder dreißig Sekunden nicht. Dann atmet er wieder. Dann atmet er eine Minute nicht. Er ist jetzt ganz ruhig und sieht nach oben, an die Zimmerdecke. Ganz unspektakulär. Sein Gesicht sieht ein wenig schief aus und ändert die Farbe. Stirbt er? Ist er schon gestorben? Ich fühle nach seinem Puls und finde ihn nicht vor Aufregung. Ich streichele ihn, vielleicht fühlt er es noch, vielleicht geht er gerade hinüber ins Jenseits, aber er regt sich nicht. Ich nehme seine Hand. Sie setzt mir keinen Widerstand entgegen. Und genau in dem Moment, in dem ich zu beobachten glaube, wie sich sein Gesicht verändert, entseelt, genau in dem Moment, als ich begreife, dass er gestorben ist, tut er einen tiefen Seufzer, einen Seufzer, der mir durch Mark und Bein fährt. Danach atmen wir beide nicht mehr (ich vor Schreck, er, weil er tot ist).
Ich öffne das Fenster weit. Heinz ist tot, ich lebe noch. Warme Sonnenstrahlen fallen in mein Gesicht. Die Gardinen wehen. Ich rufe die Ärztin. Sie stellt den Tod fest. Ich schließe seine Augen, aber sie gehen immer wieder auf. Lange muss ich die grauen Lider halten, bis sie geschlossen bleiben. Die Familie wird benachrichtigt. Sie wird in einer halben Stunde hier sein. Die Schläuche und Apparaturen werden entfernt. Ich falte Wetterlings Hände auf der Brust. Die Familie trifft ein, als es mir eben gelungen ist, seinen Mund zu schließen. Er sieht nun aus, als schliefe er.
Die Hornisse liegt zusammengekrümmt auf Tante Uschis Terrasse. Ganz klein plötzlich, ganz harmlos und still. Im Tod hat sie jeden Schrecken verloren. Tante Uschi schnippt sie mit der Schuhspitze ins Gebüsch.
DIE SADISTISCHE HELFERPERSÖNLICHKEIT II
Schluss mit lustig, Freundchen!
Ich bin fast achtzehn. Ich liege seit Wochen stationär auf der Infektionsstation des Krankenhauses Hermannswerder. Ich habe eine Meningoenzephalitis, eine Entzündung von Gehirn und Hirnhaut. Niemand darf mich besuchen. Nur von Weitem sehe ich Menschen hinter einer Glasscheibe stehen und winken. Bevor ich krank wurde, war ich hübsch. Bevor ich krank wurde, war ich verliebt. Bevor ich krank wurde, hab ich zum ersten Mal Sex gehabt. Mit einer Frau. Und tags darauf mit einem Mann.
Ich habe Kopfschmerzen, entsetzliche Kopfschmerzen. Ich bin traurig. Ich bin allein. Ich darf nicht aufstehen, nicht lesen, nicht Radio hören, nicht telefonieren, sonst »steigen die Zellen«.
Ich darf kein Kissen unterm Kopf haben, sonst »steigen die Zellen«. Ich liege auf dem Rücken wie eine Dosensardine, aus dem Tropf läuft eine Flüssigkeit in mich hinein wie zur Haltbarmachung einer Leiche. Ich weiß nicht, ob ich sterben werde, ob ich wieder gesund werde, ich weiß nicht, ob der, in den ich verliebt bin, gerade eine andere küsst, ich weiß nicht mal, wie lange ich hier schon liege. Ab und zu kommen Menschen in weißen Kitteln herein und stechen mir Nadeln in den Körper. Meine Schulklasse fährt zur Abiturfahrt nach Leningrad.
Es gibt hier nur eine Möglichkeit menschlicher Zuwendung: die Klingel. Manchmal klingele ich eine Stunde lang, und niemand kommt. Manchmal blickt mich ein freundliches Gesicht hinter der Schutzmaske an, streicht mir jemand über den Arm, schüttelt das Kopfkissen auf, spricht mit mir.
Heute hat Schwester Rabiata Dienst. Sie hasst Patienten, besonders junge, hübsche, besonders welche, die dauernd klingeln, die ihrer Meinung nach grundlos klingeln, so wie ich. In der Hand hat sie einen Waschlappen, hart wie ein Topfkratzer, und sie ist sehr wütend.
»Du hast es so gewollt«, sagt sie und hält mir den dornigen Lumpen wie eine Waffe vor. Dann wäscht sie mich damit. Sie wäscht mich grob im Gesicht, unter den Armen, an Brust und Bauch, sie schiebt und zieht und reibt das harte Ding auf meiner Haut herum, sie rubbelt zwischen meinen Beinen, bis ich blute.
DAS GESICHT, DAS ICH VERDIENE
und das Gesicht, das ich mir wünsche
Punktgenau, wenngleich weit entfernt, das Bewerbungsgespräch mit Herrn Sowieso verwunden zu haben, komme ich an der zweiten Adresse des Tages an, im Pflegeheim in Frohnau. Die Köchin öffnet und schickt mich hinauf auf die Pflegestation, ich soll mich bei Marius melden.
Ich frage eine Leasingkraft, die zur Entlastung der Belegschaft für einen Tag gebucht ist, nach Marius. Sie sieht abenteuerlich aus mit ihren angeklebten Fingernägeln, dem schwarz gefärbten Pony, dem Emo-Make-up. Sie grinst mich kaugummikauend an und zeigt auf eine Frau im Pflegerkittel, die gerade aus einem Zimmer hastet.
»Die war mir gleich unsympathisch«, sagt sie. Die grußlos Vorbeieilende musternd, denke ich Sachen wie: In einem gewissen Sinn sind wir alle die Bildhauer unseres Gesichts, lange bevor sich der Schönheitschirurg auf diesen Posten bewirbt. Michelle Pfeiffer fällt mir ein. Sie hatte Anfang der Neunziger Jahre in einem Interview auf die Frage, wie sie ihre Schönheit erhalte, die Antwort gegeben: »Ich achte auf meine Mimik.«
Seitdem beobachtete ich die Gesichter der Menschen genauer, vor allem in Momenten, in denen sie sich unbeobachtet fühlten. Zu beobachten, ohne zu bewerten, ist die höchste Form menschlicher Intelligenz, sagt Krishnamurti. Gelingt nicht oft. Es ist faszinierend, wie sich die Mimik nicht etwa entspannt, sondern vielmehr entgleist, in Alltagsfrust, Bärbeißigkeit, wie sie abgleitet ins sorgenvolle Abbild der Ahnen, und bei denen, die einschlummerten, die wegsackten in andere Welten, lugte manchmal schon das Totengesicht durch. Gern hätte ich diesem oder jenem zugerufen, was ich als Kind beim Fratzenziehen von Erwachsenen gehört habe: »Hören Sie auf, so ein Gesicht zu ziehen. Sonst behalten Sie das nämlich. Für immer.«
Ich bin mir nicht sicher, ob Michelle Pfeiffer sich der philosophischen Tragweite ihrer Bemerkung bewusst war, inzwischen scheint sie ihre Strategie geändert zu haben; erst neulich sah ich sie komplett durchgebotoxt in einem Spielfilm.