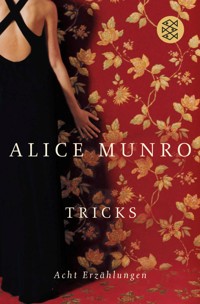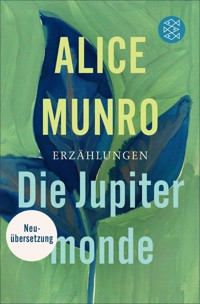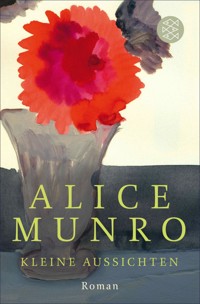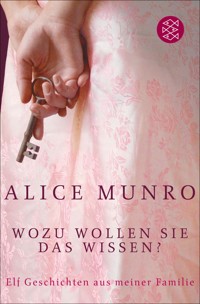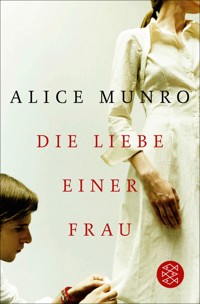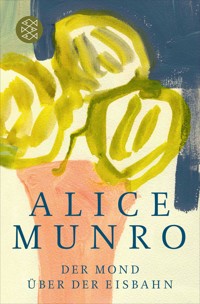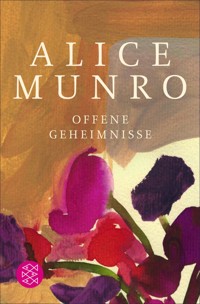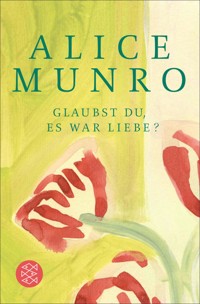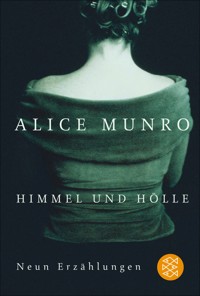
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nobelpreis für Literatur 2013 In neun Geschichten, die vordergründig alltäglich-harmlos wirken wie ein Kinderspiel, lässt Alice Munro rätselvolle Beziehungen und verdrängte Schuld aufblitzen. Sie erzählt von bestürzend kühnen Momenten des Ausbrechens aus dem eigenen Leben: das ist der Stoff, aus dem ihre Erzählungen sind. Die Geschichten entführen den Leser an jenen einzigartigen Ort, an dem eine unerwartete Wendung den Bogen eines ganzen Lebens zum Aufleuchten bringen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alice Munro
Himmel und Hölle
Neun Erzählungen
Aus dem Englischen von Heidi Zerning
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Sarah Skinner mit Dank
Hasst er mich, mag er mich, liebt er mich, Hochzeit
Vor Jahren, als die Züge noch auf vielen Nebenstrecken verkehrten, betrat eine Frau mit hoher, sommersprossiger Stirn und rötlichem Kraushaar den Bahnhof und erkundigte sich nach dem Versand von Möbeln.
Der Stationsvorsteher liebte es, mit Frauen seine Späßchen zu machen, insbesondere mit den unscheinbaren, denen das auch zu gefallen schien.
»Möbel?«, sagte er, als wäre noch nie jemand auf eine derartige Idee verfallen. »Tja. Na. Um was für Möbel geht’s denn?«
Ein Esszimmertisch und sechs Stühle. Eine komplette Schlafzimmereinrichtung, ein Sofa, ein Couchtisch, Beistelltische, eine Stehlampe. Außerdem eine Vitrine und ein Büfett.
»Halt mal stopp. Sie meinen, ein Haus voll.«
»So viel dürfte es kaum sein«, sagte sie. »Es sind keine Küchensachen dabei, und es reicht nur für ein Schlafzimmer.«
Ihre Zähne drängten sich in ihrem Mund vor, als machten sie sich auf einen Streit gefasst.
»Sie brauchen einen Möbelwagen.«
»Nein. Ich will sie mit der Bahn aufgeben. Sie sollen in den Westen, nach Saskatchewan.«
Sie sprach laut, als wäre er taub oder blöde, und etwas an ihrer Aussprache stimmte nicht. Eine Einfärbung. Er dachte an Holländisch – die Holländer zogen jetzt in die Gegend –, aber sie war nicht so drall wie die holländischen Frauen und hatte auch nicht deren hübsche rosa Haut und deren blondes Haar. Sie mochte noch keine vierzig sein, aber was half das? Sie war eben keine Schönheit.
Er wurde dienstlich.
»Erst einmal brauchen Sie einen Lastwagen, um sie von da, wo sie jetzt sind, hierher zu bringen. Und wir wollen mal schauen, ob es ein Ort in Saskatchewan ist, der an der Bahnstrecke liegt. Sonst müssen Sie dafür sorgen, dass sie abgeholt werden. Beispielsweise in Regina.«
»Es ist Gdynia«, sagte sie. »Das liegt an der Bahnstrecke.«
Er holte ein speckiges Kursbuch herunter, das an einem Nagel hing, und fragte sie, wie man das buchstabierte. Sie nahm sich den Bleistift, der auch an einer Schnur befestigt war, und schrieb auf einen Zettel aus ihrer Handtasche: GDYNIA.
»Aus welchem Land kommt das denn?«
Sie sagte, das wisse sie nicht.
Er griff sich den Bleistift, um die Zeilen im Kursbuch durchzugehen.
»Da gibt’s ja viel, wo nur Tschechen sind oder Ungarn oder Ukrainer«, sagte er. Im selben Moment fiel ihm ein, dass sie zu denen oder jenen gehören konnte. Aber schließlich sprach er nur die Wahrheit.
»Da haben wir’s, stimmt, es liegt an der Strecke.«
»Ja«, sagte sie. »Ich möchte die Möbel am Freitag aufgeben – lässt sich das machen?«
»Wir können sie dann verladen, aber ich kann Ihnen nicht mit Bestimmtheit sagen, an welchem Tag sie ankommen«, sagte er. »Das hängt davon ab, welcher Zug Vorrang hat. Ist jemand da, um sie in Empfang zu nehmen, wenn sie eintreffen?«
»Ja.«
»Am Freitag geht ein gemischter Zug, um vierzehn Uhr achtzehn. Der Lastwagen kann die Sachen Freitag früh abholen. Wohnen Sie hier in der Stadt?«
Sie nickte und schrieb die Adresse auf. Exhibition Road 106.
Die Häuser in der Stadt waren erst vor kurzem nummeriert worden, und er konnte sich von dem angegebenen Ort kein Bild machen, obwohl er wusste, wo die Exhibition Road lag. Wenn sie zu dem Zeitpunkt den Namen McCauley genannt hätte, wäre sein Interesse vielleicht größer gewesen, und die Dinge hätten unter Umständen einen ganz anderen Lauf genommen. Da draußen standen neue Häuser, nach dem Krieg erbaut, obwohl sie »Kriegshäuser« genannt wurden. Er nahm an, dass es eines von denen war.
»Bezahlen Sie, wenn Sie die Sachen aufgeben«, sagte er.
»Außerdem möchte ich eine Fahrkarte für mich für denselben Zug. Freitagnachmittag.«
»Zum selben Fahrtziel?«
»Ja.«
»Sie können im selben Zug bis Toronto fahren, aber dann müssen Sie auf den Transcontinental warten, Abfahrt zweiundzwanzig Uhr dreißig. Möchten Sie Schlafwagen oder zweiter Klasse? Im Schlafwagen haben Sie ein Bett, zweiter Klasse sitzen Sie im Personenwagen.«
Sie wollte einen Sitzplatz.
»In Sudbury warten Sie auf den Zug von Montreal, aber Sie steigen da nicht aus, Sie werden abgekoppelt und an den Montreal-Zug angehängt. Dann weiter nach Port Arthur und dann nach Kenora. Sie bleiben im Zug bis Regina, und da müssen Sie aussteigen und die Regionalbahn nehmen.«
Sie nickte, als sollte er sich beeilen und ihr endlich die Fahrkarte geben.
Er ließ sich Zeit und sagte: »Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Möbel zur selben Zeit ankommen wie Sie, die werden wohl erst ein oder zwei Tage später eintreffen. Das hat mit dem Vorrang zu tun. Werden Sie abgeholt?«
»Ja.«
»Gut. Denn wahrscheinlich ist da kaum so was wie ein Bahnhof. Die Städte da draußen, die sind nicht wie hier. Das sind meistens ziemlich primitive Nester.«
Sie bezahlte nun ihre Fahrkarte, von einer Rolle Geldscheine aus einem Stoffbeutel in ihrer Handtasche. Wie eine alte Dame. Sie zählte auch ihr Wechselgeld nach. Aber nicht, wie eine alte Dame es zählen würde – sie hielt es in der Hand, ihre Augen huschten rasch darüber hin, und trotzdem, das merkte man, registrierte sie jeden Penny. Dann kehrte sie sich unhöflich ab, ging grußlos.
»Also bis Freitag«, rief er ihr nach.
Sie trug an diesem warmen Septembertag einen langen, graubraunen Wollmantel, dazu derbe Schnürschuhe und Söckchen.
Er goss sich gerade Kaffee aus seiner Thermosflasche ein, als sie zurückkam und ans Schalterfenster klopfte.
»Die Möbel, die ich verschicke«, sagte sie. »Das sind alles wertvolle Stücke, so gut wie neu. Ich will nicht, dass sie verkratzt oder angeschlagen oder sonst wie beschädigt werden. Ich will auch nicht, dass sie anschließend nach Vieh stinken.«
»Ach, wissen Sie«, sagte er. »Die Eisenbahn ist ganz gut darauf eingestellt, alles Mögliche zu transportieren. Und wir benutzen auch nicht dieselben Güterwagen für Möbel wie für Schweine.«
»Es ist mir nur darum zu tun, dass die Sachen so einwandfrei ankommen, wie sie hier abgehen.«
»Tja, ich sage mal, wenn Sie sich Möbel kaufen, dann stehen die im Geschäft, stimmt’s? Aber haben Sie je darüber nachgedacht, wie die dahin gekommen sind? Die sind nicht in dem Geschäft angefertigt worden, oder? Nein. Die sind irgendwo in einer Fabrik angefertigt worden und in das Geschäft transportiert worden, und das höchstwahrscheinlich mit dem Zug. Da dem so ist, leuchtet es doch wohl ein, dass die Eisenbahn weiß, wie sie damit umzugehen hat?«
Sie sah ihn immer noch an, ohne ein Lächeln oder irgendein Eingeständnis ihrer weiblichen Unvernunft.
»Das hoffe ich«, sagte sie. »Das will ich sehr hoffen.«
Der Stationsvorsteher hätte, ohne darüber nachzudenken, gesagt, dass er alle in der Stadt kannte. Was hieß, dass er ungefähr die Hälfte kannte. Und die meisten von denen, die er kannte, waren Alteingesessene, »richtige« Städter in dem Sinne, dass sie nicht erst gestern angekommen waren und keine Pläne hatten weiterzuziehen. Die Frau, die nach Saskatchewan wollte, kannte er nicht, weil sie weder in seine Kirche ging noch in der Schule seine Kinder unterrichtete, noch in irgendeinem Geschäft oder Restaurant oder Büro arbeitete, das er aufsuchte. Sie war auch nicht mit irgendeinem der Männer im Elks oder Oddfellows oder Lions Club oder im Veteranenverein verheiratet. Ein Blick auf ihre linke Hand, als sie das Geld hervorholte, hatte ihm verraten – und ihn nicht überrascht –, dass sie unverheiratet war. Mit den Schuhen und mit Söckchen anstelle von Strümpfen und am Nachmittag ohne Hut und Handschuhe hätte sie eine Farmersfrau sein können. Aber sie hatte nicht das Zögernde, das die im Allgemeinen an sich hatten, die Verlegenheit. Sie hatte keine ländlichen Manieren – sie besaß überhaupt keine Manieren. Sie hatte ihn behandelt, als wäre er ein Auskunftsautomat. Außerdem hatte sie eine Stadtadresse aufgeschrieben – Exhibition Road. Eigentlich erinnerte sie ihn an eine Nonne in Zivil, die er im Fernsehen gesehen hatte und die von ihrer Missionsarbeit irgendwo im Urwald berichtete – wahrscheinlich hatte sie ihre Nonnentracht abgelegt, damit sie da leichter herumklettern konnte. Diese Nonne hatte hin und wieder mal gelächelt, um zu zeigen, dass ihr Glaube die Menschen glücklich machte, aber die meiste Zeit hatte sie ihr Publikum angeblickt, als glaubte sie, dass andere Menschen hauptsächlich auf der Welt waren, um von ihr herumkommandiert zu werden.
Johanna hatte sich noch etwas vorgenommen und immer wieder hinausgeschoben. Sie musste in das Modengeschäft Milady’s und sich etwas zum Anziehen kaufen. Sie hatte dieses Geschäft noch nie betreten – wenn sie etwa Socken kaufen musste, ging sie zu Callaghans Herren-, Damen- und Kinderkleidung. Sie hatte viele Sachen von Mrs Willets geerbt, Sachen wie diesen Mantel, der unverwüstlich war. Und Sabitha – das Mädchen, für das sie in Mr McCauleys Haus sorgte – wurde von ihren Kusinen mit teuren abgelegten Kleidern überschüttet.
In der Auslage vom Milady’s standen zwei Schaufensterpuppen in Kostümen mit ziemlich kurzem Rock und kastenförmiger Jacke. Ein Kostüm hatte die Farbe von rostigem Gold, das andere war grün, ein weiches Dunkelgrün. Große grelle Ahornblätter aus Papier lagen um die Füße der Puppen verstreut und pappten hier und da an der Scheibe. Zu einer Jahreszeit, in der die meisten Menschen bemüht waren, die Blätter zusammenzuharken und zu verbrennen, waren sie hier der Clou. Ein Schild mit schwarzer Schreibschrift klebte diagonal auf dem Glas. Darauf stand: Schlichte Eleganz, die Mode für den Herbst.
Sie machte die Tür auf und ging hinein.
Direkt vor ihr zeigte ein Standspiegel sie in Mrs Willets’ gutem, aber unförmigem langen Mantel, mit ein paar Zentimetern stämmiger, bloßer Beine über den Söckchen.
Das machten die Ladenbesitzer natürlich mit Absicht. Sie stellten den Spiegel da hin, damit man gleich eine Vorstellung von seinen Mängeln bekam und sofort – so hofften sie – daraus den Schluss zog, dass man etwas kaufen musste, um das Bild zu verändern. Ein so durchsichtiger Trick, dass er sie veranlasst hätte, auf dem Absatz kehrtzumachen, wenn sie nicht mit einem festen Ziel hereingekommen wäre und gewusst hätte, was sie brauchte.
Entlang einer Wand war eine Stange mit Abendkleidern, alle passend für Ballköniginnen mit ihrem Tüll und Taft, ihren träumerischen Farben. Und dahinter, in einer Vitrine, damit profane Finger sie nicht berühren konnten, ein halbes Dutzend Hochzeitskleider, rein weißer Schaum oder vanillegelber Satin oder elfenbeinfarbene Spitze, bestickt mit silbrigen Perlen oder mit Staubperlen. Winzige Oberteile, langettierte Ausschnitte, verschwenderische Röcke. Auch als sie noch jünger war, wäre eine solche Extravaganz nie in Betracht gekommen, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Erwartungen, der unsinnigen Hoffnung auf Verwandlung und Seligkeit.
Es dauerte zwei oder drei Minuten, bis jemand kam. Vielleicht hatten sie ein Guckloch und musterten sie, meinten, sie sei nicht ihre Art von Kundin, und hofften, sie würde wieder gehen.
Das tat sie nicht. Sie ging an ihrem Spiegelbild vorbei – vom Linoleum an der Tür auf einen weichen Teppich –, und endlich öffnete sich der Vorhang am Ende des Ladens und Milady persönlich trat hervor, in einem schwarzen Kostüm mit Glitzerknöpfen. Stöckelschuhe, schlanke Fesseln, der Hüftgürtel so eng, dass ihre Nylons schabten, goldenes Haar straff zurückgekämmt von ihrem geschminkten Gesicht.
»Ich würde gern das Kostüm im Schaufenster anprobieren«, sagte Johanna mit einstudiertem Tonfall. »Das grüne.«
»Ach, das ist ein reizendes Kostüm«, sagte die Frau. »Das im Schaufenster ist zufällig eine Achtunddreißig. Sie sehen eher aus wie – vielleicht eine Zweiundvierzig?«
Sie schabte voran in den hinteren Teil des Ladens, wo die gewöhnlichen Sachen hingen, die Kostüme und Kleider für den Tag.
»Sie haben Glück. Da ist die Zweiundvierzig.«
Als Erstes sah Johanna auf das Preisschild. Mehr als doppelt so viel, wie sie erwartet hatte, und sie dachte nicht daran, das zu verbergen.
»Es ist reichlich teuer.«
»Es ist sehr feine Wolle.« Die Frau suchte herum, bis sie das Etikett fand, dann las sie eine Materialbeschreibung vor, der Johanna nicht richtig zuhörte, weil sie sich den Saum vorgenommen hatte, um die Verarbeitung zu prüfen.
»Es fühlt sich leicht wie Seide an, aber es trägt sich wie aus Eisen. Wie Sie sehen, ist es ganz gefuttert, ein hübsches Seide-mit-Kunstseide-Futter. Sie werden feststellen, dass es sich nicht aussitzt oder die Form verliert wie die billigen Kostüme. Sehen Sie den Samt an den Ärmelaufschlägen und am Kragen und die Samtknöpfchen an den Ärmeln.«
»Ich seh sie.«
»Das sind die Feinheiten, für die Sie bezahlen, die sind anders einfach nicht: zu bekommen. Ich liebe diese Samtbesätze. Die sind übrigens nur am grünen – das aprikosenfarbene hat sie nicht, obwohl der Preis genau derselbe ist.«
Es war tatsächlich der Samt auf dem Kragen und an den Ärmeln, der dem Kostüm in Johannas Augen diesen dezenten Hauch von Luxus verlieh und sie zum Kauf reizte. Aber sie dachte nicht daran, das zu sagen.
»Ich kann es ja mal anprobieren.«
Darauf hatte sie sich schließlich vorbereitet. Saubere Unterwäsche und frischer Körperpuder unter den Achseln.
Die Frau besaß genug Takt, sie in der hellen Kabine allein zu lassen. Johanna mied den Spiegel wie Gift, bis sie den Rock zurechtgezogen und die Jacke zugeknöpft hatte.
Anfangs betrachtete sie nur das Kostüm. Es war gut. Es passte gut – der Rock ungewohnt kurz, aber an der ungewohnten Machart lag es nicht. Das Problem war nicht das Kostüm, sondern das, was daraus hervorschaute. Ihr Hals und ihr Gesicht und ihre Haare und ihre großen Hände und ihre dicken Beine.
»Wie kommen Sie zurecht? Darf ich mal schauen?«
Schauen Sie, so viel Sie wollen, dachte Johanna, aus grober Wolle wird nie ein feines Tuch, das werden Sie gleich sehen.
Die Frau betrachtete sie erst von einer Seite, dann von der anderen.
»Dazu brauchen Sie natürlich Ihre Nylons und Ihre hohen Absätze. Wie fühlt es sich an? Bequem?«
»Das Kostüm fühlt sich gut an«, sagte Johanna. »An dem Kostüm ist nichts auszusetzen.«
Das Gesicht der Frau veränderte sich im Spiegel. Sie hörte auf zu lächeln. Sie sah enttäuscht und müde aus, aber freundlicher.
»Manchmal ist das eben so. Man merkt es erst, wenn man etwas anprobiert. Der Haken ist«, sagte sie, wobei in ihrer Stimme neue, wenn auch gemäßigtere Überzeugung aufklang, »der Haken ist, Sie haben eine gute Figur, aber eine kräftige Figur. Sie sind grobknochig, na und? Zierliche Samtknöpfchen sind nichts für Sie. Quälen Sie sich nicht mehr damit. Ziehen Sie es einfach aus.«
Dann, als Johanna wieder in ihrer Unterwäsche dastand, pochte es, und eine Hand reichte durch den Vorhang.
»Ziehen Sie das mal über, einfach so.«
Ein braunes Wollkleid, gefüttert, mit hübsch gerafftem Glockenrock, Dreiviertelärmeln und schlichtem runden Ausschnitt. Schlichter ging es nicht, bis auf den schmalen goldenen Gürtel. Nicht so teuer wie das Kostüm, dennoch ein stolzer Preis, wenn man bedachte, dass so gut wie nichts dran war.
Wenigstens hatte der Rock eine schicklichere Länge, und der Stoff wirbelte elegant um ihre Beine. Sie wappnete sich und schaute in den Spiegel.
Diesmal sah sie nicht aus, als wäre sie zum Scherz in dieses Kleidungsstück gesteckt worden.
Die Frau kam und stand neben ihr und lachte, aber vor Erleichterung.
»Es liegt an der Farbe Ihrer Augen. Sie brauchen keinen Samt zu tragen. Sie haben Samtaugen.«
Solchem Schmus wäre Johanna sonst mit Hohn begegnet, in diesem Moment allerdings schien er zu stimmen. Ihre Augen waren nicht groß, und wenn sie nach der Farbe gefragt worden wäre, hätte sie gesagt: »Wohl so ein Braunton.« Aber jetzt sahen sie wirklich dunkelbraun aus, weich und leuchtend.
Nicht, dass ihr plötzlich in den Kopf gekommen wäre, sie sei hübsch oder dergleichen. Nur, dass ihre Augen eine hübsche Farbe hätten, wenn sie ein Stück Stoff wären.
»Ich möchte wetten, dass Sie nicht oft Pumps tragen«, sagte die Frau. »Aber wenn Sie Nylons anhätten und nur ein bisschen Absatz … Und ich wette, Sie tragen auch keinen Schmuck, und Sie haben ganz Recht, das brauchen Sie auch nicht bei dem Gürtel.«
Um das Verkaufsgeschwafel zu beenden, sagte Johanna: »Dann ziehe ich es mal aus, damit Sie es einpacken können.« Sie bedauerte, dass sie das sanfte Gewicht des Rocks und das dezente goldene Band um ihre Taille nicht mehr spürte. Sie hatte noch nie in ihrem Leben dieses komische Gefühl gehabt, von dem, was sie anzog, verschönt zu werden.
»Ich hoffe doch, es ist für einen besonderen Anlass«, rief die Frau, als Johanna rasch in ihre jetzt schäbig wirkenden Alltagssachen schlüpfte.
»Es ist wahrscheinlich das Kleid, in dem ich heiraten werde«, sagte Johanna.
Sie war überrascht, das aus ihrem Mund kommen zu hören. Es war kein schlimmer Fehler – die Frau wusste nicht, wer sie war, und würde wahrscheinlich auch mit niemandem reden, der es wusste. Trotzdem, sie hatte sich vorgenommen, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Es war wohl das Gefühl, dieser Person etwas zu schulden – dass sie zusammen die Katastrophe des grünen Kostüms und die Entdeckung des braunen Kleides erlebt hatten und dadurch einander verbunden waren. Was Unsinn war. Diese Frau hatte die Aufgabe, Kleidung zu verkaufen, und das war ihr gerade gelungen.
»Oh!«, rief die Frau aus. »Oh, das ist ja wunderbar.«
Ja, vielleicht, dachte Johanna, aber vielleicht auch nicht. Schließlich konnte sie irgendwen heiraten. Einen armseligen Farmer, der ein Arbeitstier brauchte, oder einen röchelnden alten Halbkrüppel, der eine Pflegerin suchte. Diese Frau hatte keine Ahnung, was für einen Mann sie im Visier hatte, und es ging sie auch nichts an.
»Ich weiß schon, es ist eine Liebesheirat«, sagte die Frau, als hätte sie diese missmutigen Gedanken gelesen. »Darum haben Ihre Augen im Spiegel so geleuchtet. Ich habe es in Seidenpapier eingeschlagen, Sie brauchen es nur herauszunehmen und aufzuhängen, und der Stoff wird wunderbar fallen. Sie können es leicht aufbügeln, wenn Sie wollen, aber wahrscheinlich wird das gar nicht nötig sein.«
Dann musste das Geld die Besitzerin wechseln. Beide gaben vor, nicht hinzuschauen, aber beide schauten hin.
»Das ist es auch wert«, sagte die Frau. »Man heiratet nur einmal im Leben. Naja, so ganz stimmt das nicht immer …«
»In meinem Fall stimmt es«, sagte Johanna. Ihr Gesicht hatte sich heiß gerötet, denn von Heirat war genau genommen nicht die Rede gewesen. Nicht einmal im letzten Brief. Sie hatte dieser Frau etwas anvertraut, was sie sich erhoffte, und vielleicht brachte das Unglück.
»Wo haben Sie ihn kennen gelernt?«, fragte die Frau, immer noch in diesem Ton sehnsüchtiger Fröhlichkeit. »Wie sind Sie sich zum ersten Mal begegnet?«
»Durch die Familie«, sagte Johanna wahrheitsgemäß. Sie hatte nicht vor, mehr zu sagen, hörte sich aber weiterreden. »Auf dem Volksfest. In London.«
»Auf dem Volksfest«, sagte die Frau. »In London.« Sie hätte genauso gut »auf dem Opernball« sagen können.
»Wir hatten seine Tochter und deren Freundin bei uns«, sagte Johanna und dachte, eigentlich wäre es zutreffender gewesen, zu sagen, dass er und Sabitha und Edith sie, Johanna, bei sich hatten.
»Jedenfalls kann ich sagen, mein Tag war nicht verloren. Ich habe für das Kleid gesorgt, in dem jemand eine glückliche Braut sein wird. Das genügt, um meine Existenz zu rechtfertigen.« Die Frau wickelte ein schmales rosa Band um den Kleiderkarton, knotete eine große, überflüssige Schleife und schnitt mit einem bösen Schnipp ihrer Schere das Ende ab.
»Ich bin den ganzen Tag hier«, sagte sie. »Und manchmal weiß ich gar nicht, was ich hier eigentlich mache. Ich frage mich, was machst du hier eigentlich? Ich dekoriere das Schaufenster neu, ich tue dies, ich tue das, um die Leute anzulocken, aber es vergehen Tage – ganze Tage –, da kommt kein Mensch zur Tür herein. Ich weiß – die Leute meinen, diese Kleider sind zu teuer – aber sie sind gut. Es sind gute Kleider. Qualität hat eben ihren Preis.«
»Die Leute müssen hereinkommen, wenn sie solche da wollen«, sagte Johanna mit Blick auf die Abendkleider. »Wo sollen sie denn sonst hingehen?«
»Das ist es ja eben. Sie gehen woandershin. Sie fahren in die Stadt – da gehen sie hin. Sie fahren fünfzig Meilen, hundert Meilen, auf das Benzin kommt’s ihnen gar nicht an, und sagen sich, auf die Weise kriegen sie was Besseres, als ich hier habe. Dabei gibt’s nichts Besseres. Nicht an Qualität, nicht an Auswahl. Nichts. Bloß, weil sie sich genieren würden, zu sagen, sie hätten ihr Hochzeitskleid hier im Ort gekauft. Oder sie kommen herein und probieren etwas an und sagen, sie müssen es sich überlegen. Ich komme wieder, sagen sie. Und ich denke bei mir: Ach, ja, ich weiß, was das heißt. Es heißt, sie werden versuchen, dasselbe billiger in London oder in Kitchener aufzutreiben, und auch wenn’s nicht billiger ist, kaufen sie’s da, wenn sie erst so weit gefahren sind und keine Lust mehr haben, länger zu suchen.«
»Ich weiß auch nicht«, sagte sie dann. »Vielleicht wäre alles anders, wenn ich von hier wäre. Hier bleiben die Leute sehr unter sich, finde ich. Sie sind wohl nicht von hier?«
»Nein«, sagte Johanna.
»Finden Sie nicht, dass die Leute hier sehr unter sich bleiben? Außenstehende haben es schwer, an sie heranzukommen, meine ich.«
»Ich bin’s gewohnt, für mich zu sein«, sagte Johanna.
»Aber Sie haben jemanden gefunden. Sie werden nicht mehr für sich sein, und das ist doch herrlich? An manchen Tagen denke ich, wie schön es wäre, verheiratet zu sein und zu Hause zu bleiben. Ich war natürlich früher verheiratet, aber gearbeitet habe ich trotzdem. Ach, ja. Vielleicht kommt der Mann im Mond hereinspaziert und verliebt sich in mich, und ich habe ausgesorgt!«
Johanna musste sich beeilen – das Bedürfnis der Frau, mit jemandem zu reden, hatte sie aufgehalten. Sie wollte wieder im Haus sein und ihren Einkauf wegpacken, bevor Sabitha aus der Schule kam.
Dann fiel ihr ein, dass Sabitha gar nicht da war, da sie am Wochenende von der Kusine ihrer Mutter, ihrer Tante Roxanne, geholt worden war, um in Toronto wie ein reiches Mädchen zu wohnen und eine Schule für reiche Mädchen zu besuchen. Aber sie ging weiterhin schnell – so schnell, dass ein Klugschwätzer, der sich beim Drugstore herumdrückte, ihr zurief: »Wo brennt’s denn?«, worauf sie ein wenig langsamer ging, um nicht aufzufallen.
Der Kleiderkarton war lästig – woher sollte sie auch wissen, dass das Geschäft seine eigenen rosa Kartons hatte, auf denen in violetter Schreibschrift Milady’s stand? Der verriet sie sofort.
Es war dumm von ihr gewesen, von Hochzeit zu reden, obwohl er nichts dergleichen erwähnt hatte, und daran hätte sie denken müssen. So viel anderes war gesagt – oder geschrieben – worden, von so viel Zuneigung und Sehnsucht war die Rede gewesen, dass es schien, als wäre die Hochzeit selbst nur aus Versehen nicht zur Sprache gekommen. So, wie man davon spricht, am Morgen aufzustehen, und nicht davon, zu frühstücken, obwohl man es sicherlich vorhat.
Trotzdem hätte sie den Mund halten sollen.
Sie sah Mr McCauley auf der anderen Straßenseite entgegenkommen. Das war nicht weiter schlimm – selbst wenn er direkt auf sie zugegangen wäre, hätte er den Karton bestimmt nicht bemerkt. Er hätte einen Finger an den Hut gelegt und wäre an ihr vorbeigegangen, und vermutlich hätte er sie als seine Haushälterin erkannt, aber vielleicht auch nicht. Er hatte anderes im Kopf, hatte wahrscheinlich eine ganz andere Stadt vor Augen als alle Übrigen. An jedem Arbeitstag – und manchmal versehentlich auch an Feiertagen oder Sonntagen – legte er einen seiner dreiteiligen Anzüge an, seinen Sommer- oder Wintermantel, seinen grauen Filzhut und seine blank geputzten Schuhe und ging von der Exhibition Road zu seinem Büro in der Innenstadt, das er immer noch unterhielt, über einer ehemaligen Sattlerei. Es galt immer noch als Versicherungsagentur, obwohl er schon seit geraumer Zeit keine Versicherungen mehr verkauft hatte. Manchmal stiegen Leute die Treppe hinauf, um ihn aufzusuchen, ihm vielleicht eine Frage über ihre Policen zu stellen oder eher noch über Grundstücksgrenzen, die Geschichte einer Liegenschaft in der Stadt oder einer Farm im Umland. Sein Büro war mit alten und neuen Karten voll gestopft, und er kannte kein größeres Vergnügen, als sie auszubreiten und sich auf eine Erörterung einzulassen, die weit über die gestellte Frage hinausging. Drei- oder viermal am Tag kam er heraus und spazierte die Straße entlang, wie jetzt. Während des Krieges hatte er den McLaughlin-Buick in der Scheune aufgebockt und war überallhin zu Fuß gegangen, um ein Beispiel zu geben. Fünfzehn Jahre später schien er immer noch ein Beispiel geben zu wollen. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, wirkte er wie ein freundlicher Grundbesitzer, der sein Eigentum besichtigte, oder wie ein Pfarrer, der beglückt seine Gemeinde betrachtete. Natürlich hatte die Hälfte aller Menschen, denen er begegnete, keine Ahnung, wer er war.
Die Stadt hatte sich verändert, sogar in der Zeit, seit Johanna hier lebte. Der Handel zog hinaus an die Fernstraße, wo ein neuer Discountladen aufgemacht hatte, dazu ein Canadian Tire und ein Motel mit einer Bar und Oben-ohne-Tänzerinnen. Manche Geschäfte in der Innenstadt hatten versucht, sich mit rosa oder lila oder olivgrüner Farbe herauszuputzen, aber diese Farbe blätterte auf den alten Ziegelsteinen bereits ab, und einige standen leer. Dem Milady’s drohte nahezu mit Sicherheit dasselbe Schicksal.
Wenn Johanna die Frau da drin gewesen wäre, was hätte sie getan? Vor allem hätte sie nie so viele kostbare Abendkleider hereingenommen. Sondern was? Wenn man sich auf billigere Kleidung umstellte, geriet man unweigerlich in Konkurrenz zu Callaghans und dem Discountladen, und wahrscheinlich reichte die Nachfrage nicht für alle. Wie wäre es dann mit hübschen Babysachen, Kindersachen, um die Großmütter und Tanten zu ködern, die das Geld besaßen und für so etwas ausgeben würden? Die Mütter konnte man abschreiben, denn die würden zu Callaghans gehen, weil sie weniger Geld und mehr Verstand hatten.
Aber wenn sie – Johanna – das Geschäft zu führen hätte, würde es ihr nie gelingen, Kundschaft hereinzulocken. Sie konnte erkennen, was getan werden musste und in welcher Weise, und sie konnte andere dazu anstellen und beaufsichtigen, aber sie konnte beim besten Willen nicht schöntun und umgarnen. Entweder – oder, war ihre Haltung. Entweder Sie kaufen’s, oder Sie lassen’s. Ohne Zweifel würden die Leute es lassen.
Es kam nur selten vor, dass jemand sich zu ihr hingezogen fühlte, und sie war sich dessen seit langem bewusst. Sabitha hatte jedenfalls keine Tränen vergossen, als sie sich verabschiedete – obwohl man sagen konnte, dass Johanna für sie einer Mutter noch am nächsten kam, seit Sabithas eigene Mutter gestorben war. Mr McCauley würde außer sich sein, wenn sie ging, denn sie hatte ihre Arbeit ordentlich getan, und es würde nicht leicht sein, sie zu ersetzen, aber das war auch schon alles, was ihm durch den Kopf gehen würde. Er war genauso verwöhnt und ichbezogen wie seine Enkeltochter. Und die Nachbarn, die würden zweifellos jubeln. Johanna hatte auf beiden Seiten des Grundstücks Schwierigkeiten gehabt. Auf der einen Seite war es der Nachbarshund, der in ihrem Garten Löcher buddelte, seinen Vorrat an Knochen vergrub und bei Bedarf herausholte, was er besser zu Hause getan hätte. Und auf der anderen Seite war es der Süßkirschenbaum, der auf Mr McCauleys Grundstück stand, aber die meisten Kirschen an Zweigen trug, die in den Nebengarten hingen. In beiden Fällen hatte sie sich mit den Nachbarn angelegt und gewonnen. Der Hund wurde an die Leine gelegt, und gegenüber ließ man die Kirschen in Ruhe. Wenn sie auf die Leiter stieg, konnte sie gut hinüberlangen, aber die Nachbarn verscheuchten die Vögel nicht mehr aus den Zweigen, und die Ernte fiel deutlich geringer aus.
Mr McCauley hätte die Nachbarn die Kirschen pflücken lassen. Er hätte auch den Hund buddeln lassen. Er hätte sich ausnutzen lassen. Zum Teil, weil es neue Leute waren, die in neuen Häusern wohnten, und so zog er es vor, sie nicht zu beachten. Früher einmal hatten in der Exhibition Road nur
drei oder vier größere Häuser gestanden. Auf der anderen Straßenseite war das Ausstellungsgelände der Landwirtschaftsmesse im Herbst gewesen (die offiziell Agricultural Exhibition hieß, daher der Straßenname), und dazwischen hatten Obstgärten und Viehweiden gelegen. Vor etwa zwölf Jahren war dieses Land verkauft und in Baugrundstücke aufgeteilt worden, und Häuser waren darauf errichtet worden, kleine Häuser verschiedener Bauart, die einen mit Obergeschoss, die anderen ohne. Einige sahen bereits ziemlich heruntergekommen aus.
Es gab nur zwei Häuser, deren Bewohner Mr McCauley kannte und grüßte – die Lehrerin Miss Hood mit ihrer Mutter und das Ehepaar Shultz von der Schuhmacherei. Deren Tochter Edith war, zumindest bis dahin, Sabithas engste Freundin. Was nahe lag, da beide in dieselbe Klasse gingen – wenigstens im letzten Jahr, seit Sabitha sitzen geblieben war – und nicht weit voneinander wohnten. Mr McCauley hatte nichts dagegen gehabt – vielleicht schon aus der Vorahnung, dass Sabitha binnen kurzem fort sein würde, um in Toronto ein anderes Leben zu führen. Johanna hätte Edith nicht gewählt, obwohl das Mädchen nie ungezogen war, nie störte, wenn es ins Haus kam. Und Edith war nicht dumm. Vielleicht lag da das Problem – Edith war schlau, und Sabitha war nicht so schlau. Durch sie war Sabitha hinterhältig geworden.
Doch damit hatte es inzwischen ein Ende. Seit die Kusine Roxanne – Mrs Huber – aufgekreuzt war, gehörte die Shultz-Tochter zu Sabithas kindlicher Vergangenheit.
Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Möbel Ihnen mit der Bahn zugehen, sobald die den Auftrag annehmen kann, und zwar vorausbezahlt, sobald ich erfahren habe, was es kosten wird. Ich habe mir gedacht, Sie werden sie jetzt brauchen. Vielleicht wird es Sie gar nicht so sehr überraschen, dass ich mir gedacht habe, Sie werden nichts dagegen haben, wenn ich mitfahre, um Ihnen zur Hand zu gehen, was ich hoffentlich tun kann.
Das war der Brief, den sie auf die Post gebracht hatte, bevor sie zum Bahnhof ging, um die übrigen Vorkehrungen zu treffen. Es war der erste Brief, den sie ihm je direkt geschickt hatte. Die anderen hatte sie den Briefen beigefügt, die Sabitha unter ihrer Anleitung schreiben musste. Und seine Briefe an sie waren auf demselben Weg gekommen, säuberlich zusammengefaltet und mit ihrem Namen, Johanna, auf die Rückseite getippt, damit es keine Irrtümer gab. Dadurch bekam niemand im Postamt etwas mit, und außerdem konnte es nie schaden, Briefmarken zu sparen. Sabitha hätte das natürlich ihrem Großvater erzählen oder sogar vorlesen können, was an Johanna geschrieben wurde, aber Sabitha war ebenso wenig an Gesprächen mit dem alten Mann interessiert wie an Briefen – ob es nun galt, welche zu schreiben oder welche zu bekommen.
Die Möbel lagerten hinten in der Scheune, die nur ein städtischer Schuppen war, keine richtige Scheune mit Tieren und einem Kornspeicher. Als Johanna vor etwa einem Jahr zum ersten Mal einen Blick darauf geworfen hatte, fand sie die Sachen staubverkrustet und voller Taubenkot vor. Die Möbelstücke waren achtlos übereinander gestapelt worden, ohne etwas, um sie abzudecken. Sie hatte alles, was sie tragen konnte, in den Hof hinausgeschleppt und so in der Scheune Platz geschaffen, um an die großen Stücke heranzukommen, die sie nicht tragen konnte – das Sofa und das Büfett und die Vitrine und den Esstisch. Das Bett ließ sich auseinander nehmen. Sie bearbeitete das Holz mit weichen Staubtüchern, dann mit Zitronenöl, und als sie fertig war, glänzte es wie Kandis. Ahornkandis – die Möbel waren aus Vogelaugen-Ahorn. Sie fand, sie sahen wunderschön aus, wie Satinbettdecken und blondes Haar. Wunderschön und modern, so ganz anders als das dunkle Holz und das lästige Schnitzwerk der Möbel, die sie im Haus abstaubte. Zu der Zeit waren es für sie seine Möbel, und das waren sie auch noch, als sie sie an diesem Mittwoch herausholte. Sie hatte alte Decken auf die unterste Schicht gelegt, zum Schutz vor dem, was sich darauf stapelte, und Bettlaken auf die oberste Schicht, zum Schutz vor den Vögeln, und dementsprechend waren die Sachen nur leicht eingestaubt. Aber sie wischte trotzdem alle ab und rieb sie mit Zitronenöl ein, bevor sie sie zurückstellte, ebenso geschützt wie vorher, bis am Freitag der Lastwagen kam.
Lieber Mr McCauley,
ich reise heute (Freitag) Nachmittag mit dem Zug ab. Ich weiß, ich tue das, ohne Ihnen gekündigt zu haben, aber ich verzichte auf meinen letzten Lohn, der kommenden Montag für drei Wochen fällig wäre. Auf dem Herd steht in dem Wasserbadtopf ein Rindfleischgericht, das nur aufgewärmt werden muss. Reicht für drei Mahlzeiten und kann vielleicht für eine vierte verlängert werden. Sobald es heiß ist und Sie sich genug genommen haben, tun Sie den Deckel drauf und stellen es dann in den Kühlschrank. Vergessen Sie nicht, sofort den Deckel drauf zu tun, damit es nicht schlecht wird. Mit Gruß an Sie und an Sabitha, und werde mich wahrscheinlich melden, wenn ich Fuß gefasst habe. Johanna Parry.
P. S. Ich habe Mr Boudreau seine Möbel geschickt, da er sie vielleicht braucht. Vergessen Sie beim Aufwärmen nicht nachzuschauen, ob unten im Topf genug Wasser ist.
Mr McCauley hatte keine Schwierigkeiten herauszubekommen, dass Johanna eine Fahrkarte nach Gdynia in Saskatchewan gelöst hatte. Er rief nämlich den Stationsvorsteher an und fragte ihn. Er wusste nicht, wie er Johanna beschreiben sollte – sah sie alt oder jung aus, war sie schlank oder eher korpulent, welche Farbe hatte ihr Mantel? –, aber das war nicht mehr nötig, nachdem er die Möbel erwähnt hatte.
Als dieser Anruf kam, warteten gerade mehrere Leute auf den Abendzug. Der Stationsvorsteher versuchte anfangs, leise zu sprechen, aber als er von den gestohlenen Möbeln hörte (Mr McCauley sagte lediglich »und ich glaube, sie hat einige Möbel mitgenommen«), wurde er fuchtig. Er schwor, wenn er gewusst hätte, wer sie war und was sie im Schilde führte, hätte er sie nie in den Zug einsteigen lassen. Diese Beteuerung wurde mit angehört und weitererzählt und geglaubt, ohne dass sich jemand fragte, wie er eine erwachsene Frau mit gültiger Fahrkarte hätte festhalten sollen, ohne sofort beweisen zu können, dass sie eine Diebin war. Die meisten Leute, die seine Worte weitererzählten, glaubten, dass es in seiner Macht stand, sie festzuhalten – sie glaubten an die Autorität von Stationsvorstehern und von aufrecht gehenden vornehmen älteren Herren in dreiteiligen Anzügen wie Mr McCauley.
Das Rindfleischgericht war ausgezeichnet, wie alles, was Johanna kochte, aber Mr McCauley stellte fest, dass er es nicht herunterbrachte. Er missachtete die Anweisung hinsichtlich des Deckels und ließ den Topf offen auf dem Herd stehen und stellte nicht einmal die Flamme ab, bis das Wasser im unteren Teil des Topfes verkocht war und er vom Gestank qualmenden Metalls aufgescheucht wurde.
Dem Gestank des Verrats.
Er sagte sich, dass er immerhin dankbar sein konnte, Sabitha in guten Händen zu wissen und sich um sie keine Sorgen machen zu müssen. Seine Nichte Roxanne – eigentlich die Kusine seiner Frau – hatte ihm geschrieben, nach dem Eindruck, den sie von Sabitha während ihres Sommeraufenthalts am Lake Simcoe gewonnen habe, brauche das Mädchen eine feste Hand.
»Offen gestanden glaube ich nicht, dass Du allein mit der Frau, die Du eingestellt hast, der Lage gewachsen sein wirst, sobald erst die Jungen das Mädchen umschwärmen.«
Sie ging nicht so weit, ihn zu fragen, ob er eine weitere Marcelle am Hals haben wollte, aber genau das meinte sie. Sie schrieb, sie werde Sabitha in einer guten Schule unterbringen, wo man ihr wenigstens Manieren beibringen werde.
Er stellte den Fernseher an, um sich abzulenken, aber das half nichts.
Es waren die Möbel, die ihn in Harnisch brachten. Es war Ken Boudreau.
Tatsächlich hatte Mr McCauley vor drei Tagen – genau an dem Tag, an dem Johanna ihre Fahrkarte gekauft hatte, wie er inzwischen vom Stationsvorsteher wusste – einen Brief von Ken Boudreau erhalten mit der Bitte, ihm (a) etwas Geld auf die Möbel vorzustrecken, die ihm (Ken Boudreau) und seiner toten Frau Marcelle gehörten und in Mr McCauleys Scheune lagerten, oder (b), wenn er sich dazu nicht durchringen konnte, die Möbel so teuer wie möglich zu verkaufen und das Geld so rasch wie möglich nach Saskatchewan zu schicken. Es war keine Rede von den Darlehen, die der Schwiegervater dem Schwiegersohn bereits gewährt hatte, alle auf den Wert dieser Möbel hin und in der Summe mehr, als beim Verkauf je erzielt werden konnte. Sollte Ken Boudreau das völlig vergessen haben? Oder hoffte er einfach – was wahrscheinlicher war –, sein Schwiegervater habe sie vergessen?
Er war jetzt offenbar Besitzer eines Hotels. Aber sein Brief schäumte über von Anwürfen gegen den Vorbesitzer, der ihn in vielem hinters Licht geführt habe.
»Wenn es mir gelingt, diese Hürde zu nehmen«, schrieb er, »dann kann ich meiner festen Überzeugung nach noch etwas daraus machen.« Welche Hürde? Er brauchte dringend Geld, so viel war klar, aber er schrieb nicht, ob er dem Vorbesitzer etwas schuldete oder der Bank oder einem privaten Hypothekar oder sonst jemandem. Es war immer wieder dasselbe – flehentliche, verzweifelte Bitten, unterfuttert von Arroganz, einer Haltung, dass ihm etwas zustand, wegen der Verletzungen, die ihm zugefügt worden waren, der Schande, die über ihn gebracht worden war, durch Marcelle.
Trotz vieler Bedenken, aber mit Hinblick darauf, dass Ken Boudreau schließlich sein Schwiegersohn war, an der Front gekämpft und in seiner Ehe Gott weiß was durchgemacht hatte, setzte Mr McCauley sich hin und schrieb ihm einen Brief, des Inhalts, dass er keine Ahnung hatte, wie er den besten Preis für die Möbel erzielen sollte und sich damit sehr schwer tat, und dass er einen Scheck beifügte, den er als persönliches Darlehen betrachtete. Er ersuchte seinen Schwiegersohn, ihm das als solches zu quittieren und sich die Anzahl ähnlicher, in der Vergangenheit gewährter Darlehen in Erinnerung zu rufen – die nach seiner Überzeugung den Wert der Möbel bereits weit überstiegen. Er fügte ferner eine Liste der Daten und Beträge bei. Abgesehen von fünfzig Dollar, gezahlt vor nahezu zwei Jahren (mit dem Versprechen regelmäßig folgender Zahlungen), hatte er nichts zurückerhalten. Sein Schwiegersohn sah sicherlich ein, dass infolge dieser nicht zurückgezahlten zinsfreien Darlehen Mr McCauleys Einkommen gesunken war, denn dieses Geld hätte er sonst angelegt.
Er hatte erwogen hinzuzufügen: »Ich bin nicht so dumm, wie du anscheinend meinst«, entschied sich aber dagegen, denn das hätte seine Verärgerung und vielleicht seine Schwäche offenbart.
Und jetzt das. Der Kerl war ihm zuvorgekommen und hatte Johanna für seine Zwecke eingespannt – Frauen ließen sich von dem immer herumkriegen – und so die Möbel und dazu den Scheck ergattert. Laut Stationsvorsteher hatte sie die Frachtkosten aus eigener Tasche bezahlt. Das protzige moderne Ahorn-Zeug war bislang schon überbewertet worden, und sie würden nicht viel dafür kriegen, besonders wenn man mit einrechnete, was die Bahn verlangt hatte. Wenn sie schlauer gewesen wäre, hätte sie einfach etwas aus dem Haus genommen, einen der alten Kabinettschränke oder eines der Salonsofas, die zum Sitzen zu unbequem waren, aber dafür aus dem vorigen Jahrhundert stammten. Das wäre natürlich glatter Diebstahl gewesen. Aber was die beiden getan hatten, war nicht weit davon weg.
Er ging zu Bett mit dem Entschluss, dagegen gerichtlich vorzugehen.
Er wachte auf, ganz allein im Haus, ohne den Geruch von Kaffee oder Frühstück aus der Küche – stattdessen hing noch der Dunst vom angebrannten Topf in der Luft. Herbstkühle hatte sich in den hohen, verlassenen Zimmern eingenistet. Gestern Abend und an den Abenden zuvor war es behaglich gewesen – der Brenner für die Warmluftheizung war noch nicht an, und als Mr McCauley ihn anstellte, wurde die warme Luft von einem Schwall Kellerfeuchte begleitet, von dem Geruch nach Moder, Erde und Verfall. Er wusch sich und kleidete sich an, langsam, mit gedankenverlorenen Pausen, und zum Frühstück schmierte er sich Erdnussbutter auf eine Scheibe Brot. Er gehörte einer Generation an, von der es hieß, dass die Männer nicht einmal Wasser kochen konnten, und auf ihn traf das zu. Er blickte zu den Vorderfenstern hinaus und sah auf der anderen Straßenseite, wie die Bäume an der Pferderennbahn vom Morgennebel verschluckt wurden, der sich über das ganze Gelände auszubreiten schien, statt sich wie sonst um diese Stunde zurückzuziehen. Es kam ihm vor, als sähe er im Nebel die alten Ausstellungshallen ragen – schlichte, geräumige Gebäude wie riesige Scheunen. Sie hatten jahrelang leer gestanden, den ganzen Krieg hindurch, und er hatte vergessen, was am Ende mit ihnen geschehen war. Wurden sie abgerissen, oder waren sie eingestürzt? Er verabscheute die Pferderennen, die jetzt stattfanden, das Menschengewühl und den Lautsprecher und den verbotenen Alkoholkonsum und den verheerenden Radau der Sommersonntage. Wenn er daran dachte, musste er an seine arme Tochter Marcelle denken, wie sie auf den Verandastufen saß und die inzwischen erwachsenen Schulkameraden zu sich rief, die aus ihren geparkten Autos gestiegen waren und es eilig hatten, zu den Rennen zu kommen. Wie sie sich aufführte, sich freute, wieder hier zu sein, wie sie alle möglichen Leute umarmte und aufhielt und ohne Punkt und Komma auf sie einredete, von Kindertagen plapperte und davon, wie sehr sie alle vermisst hatte. Das einzig Unvollkommene am Leben, hatte sie gesagt, war, dass ihr Mann Ken ihr fehlte, der wegen seiner Arbeit draußen im Westen blieb.
In ihrem seidenen Pyjama ging sie vors Haus, mit strähnigen, ungekämmten, blond gefärbten Haaren. Ihre Arme und Beine waren dünn, aber ihr Gesicht war etwas aufgedunsen, und das, was sie ihre Sonnenbräune nannte, sah eher kränklich und vergilbt aus, eine Farbe, die nicht von der Sonne herrührte. Vielleicht von Gelbsucht.
Das Kind war im Haus geblieben und hatte ferngesehen – sonntägliche Zeichentrickfilme, für die es bestimmt zu alt war.
Er vermochte nicht zu sagen, was ihr fehlte oder ob ihr überhaupt etwas fehlte. Dann fuhr Marcelle nach London, um eine Frauensache machen zu lassen, und starb im Krankenhaus. Als er ihren Mann anrief, um es ihm mitzuteilen, sagte Ken Boudreau: »Was hat sie geschluckt?«
Wäre alles anders gekommen, wenn Marcelles Mutter noch gelebt hätte? Tatsächlich war ihre Mutter zu Lebzeiten ebenso hilflos gewesen wie er. Sie hatte weinend in der Küche gesessen, und gleichzeitig war die in ihr Zimmer eingesperrte, pubertierende Tochter aus dem Fenster geklettert und über das Verandadach heruntergerutscht, weil ganze Wagenladungen Jungs auf sie warteten.
Das Haus war erfüllt von einem Gefühl herzloser Treulosigkeit, arglistigen Betrugs. Er und seine Frau waren sicherlich liebevolle Eltern gewesen, von Marcelle an den Rand der Verzweiflung getrieben. Als sie mit einem Flieger durchgebrannt war, hatten sie gehofft, Marcelle wäre nun endlich gut aufgehoben. Sie waren großzügig zu den beiden gewesen, wie zu einem idealen jungen Paar. Aber es ging alles zu Bruch. Zu Johanna Parry war er ebenfalls großzügig gewesen, und siehe da, auch sie hatte ihm übel mitgespielt.
Er machte sich zu Fuß auf den Weg in die Stadt und ging ins Hotel, um zu frühstücken. Die Kellnerin sagte: »Heute sind Sie aber früh dran.«
Und noch während sie ihm Kaffee eingoss, erzählte er ihr von seiner Haushälterin, die ihn ohne Anlass, ohne Vorankündigung im Stich gelassen hatte, nicht nur ohne Kündigung ihren Dienst quittiert, sondern auch noch etliche Möbel mitgenommen hatte, ursprünglich Eigentum seiner Tochter, die jetzt angeblich seinem Schwiegersohn gehörten, aber nicht wirklich, denn sie waren von der Mitgift seiner Tochter gekauft worden. Er erzählte ihr, dass seine Tochter einen Flieger geheiratet hatte, einen ansehnlichen, sympathischen Burschen, dem man nicht von hier bis da trauen konnte.
»Entschuldigen Sie«, sagte die Kellnerin. »Ich würde gerne plaudern, aber ich habe Kunden, die auf ihr Frühstück warten. Entschuldigen Sie …«
Er ging die Treppe zu seinem Büro hinauf, und auf seinem Schreibtisch lagen noch die alten Karten, die er gestern studiert hatte, um auszumachen, wo genau sich der erste Friedhof des Landkreises befunden hatte (seiner Meinung nach seit 1839 aufgelassen). Er machte das Licht an und setzte sich hin, aber er merkte, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Nach der Zurechtweisung der Kellnerin – oder dem, was er für eine Zurechtweisung hielt – war es ihm unmöglich gewesen, sein Frühstück zu essen oder seinen Kaffee zu genießen. Er beschloss, einen Spaziergang zu machen, um sich zu beruhigen.
Aber statt in gewohnter Manier fürbass zu gehen, Leute zu grüßen und mit ihnen ein paar Worte zu wechseln, merkte er, dass die Worte nur so aus ihm heraussprudelten. Sobald jemand ihn fragte, wie es ihm an diesem Morgen ging, begann er in höchst uncharakteristischer, sogar beschämender Weise sein Leid zu klagen, und wie die Kellnerin hatten diese Leute etwas zu erledigen, und sie nickten und traten von einem Bein aufs andere und brachten Entschuldigungen vor, um wegzukommen. Der Morgen wollte nicht wärmer werden, wie es neblige Herbstmorgen sonst taten, sein Jackett war zu dünn, und er suchte Trost in den Geschäften.
Diejenigen, die ihn am längsten kannten, waren am stärksten befremdet. Sie hatten ihn nie anders als reserviert erlebt – ein Herr mit tadellosen Manieren, dessen Gedanken bei anderen Zeiten weilten und dessen Höflichkeit nichts war als eine gewandte Entschuldigung für seine privilegierte Stellung (was nicht unkomisch war, denn diese privilegierte Stellung existierte hauptsächlich in seinen Erinnerungen und war für andere nicht erkennbar), Er war der Letzte, von dem man erwartet hätte, dass er seinem Kummer Luft machte oder um Anteilnahme bat – er hatte es nicht getan, als seine Frau starb, und nicht einmal, als seine Tochter starb –, doch nun holte er irgendeinen Brief hervor und fragte, ob es nicht eine Schande sei, wie dieser Kerl ihm immer wieder das Geld aus der Tasche zog, und sogar jetzt, kaum dass er sich einmal mehr seiner erbarmt hätte, habe der Kerl mit seiner Haushälterin gemeinsame Sache gemacht, um die Möbel zu stehlen. Manche dachten, dass er von seinen eigenen Möbeln redete, und glaubten, der alte Mann stehe in seinem Haus ohne ein Bett oder einen Stuhl da. Sie rieten ihm, zur Polizei zu gehen.
»Das bringt nichts, das bringt nichts«, sagte er. »Wie soll man ein Herz aus Stein erweichen?«
Er ging in die Schuhmacherei und begrüßte Herman Shultz.
»Erinnern Sie sich noch an die Stiefel, die Sie mir neu besohlt haben, meine Stiefel, die ich in England gekauft habe? Sie haben sie vor vier oder fünf Jahren besohlt.«
Der Laden war wie eine Höhle, mit abgeschirmten Glühbirnen über verschiedenen Arbeitsplätzen. Er war entsetzlich schlecht belüftet, aber seine männlichen Gerüche – nach Leim und Leder und Schuhcreme und frisch zurechtgeschnittenen Filzsohlen und verschimmelten alten – waren für Mr McCauley tröstlich. Hier tat sein Nachbar Herman Shultz, ein bleicher, bebrillter, erfahrener Handwerker mit gebeugten Schultern, jahrein, jahraus seine Arbeit – schlug Eisennägel und Nietnägel ein und schnitt mit einem böse gekrümmten Messer aus dem Leder die gewünschten Formen aus. Der Filz wurde mit etwas geschnitten, was an eine winzige Kreissäge erinnerte. Die Poliermaschine machte ein scharrendes Geräusch, und das Schmirgelpapierrad schnarrte, und der Schleifstein sirrte wie ein mechanisches Insekt, und die Nähmaschine hämmerte auf das Leder mit ernstem Industrierhythmus ein. Alle Geräusche und Gerüche und exakten Tätigkeiten an diesem Ort waren Mr McCauley seit Jahren vertraut, aber von ihm noch nie im Einzelnen bemerkt oder gar bedacht worden. Jetzt richtete sich Herman in seiner altersschwarzen Lederschürze mit einem Schuh in der Hand auf, lächelte, nickte, und Mr McCauley sah das ganze Leben des Mannes in dieser Höhle. Er wollte ihm sein Mitgefühl ausdrücken oder seine Bewunderung oder etwas Höheres, das er nicht verstand.
»Doch, ich erinnere mich«, sagte Herman. »Das waren schöne Stiefel.«
»Gute Stiefel. Wissen Sie, ich habe sie auf meiner Hochzeitsreise gekauft. Ich habe sie in England gekauft. Ich komme nicht mehr drauf, wo, aber es war nicht in London.«
»Ja, das haben Sie mir damals erzählt.«
»Sie haben das hervorragend gemacht. Die Stiefel sind immer noch in Ordnung. Hervorragend, Herman. Sie tun hier gute Arbeit. Sie tun ehrliche Arbeit.«
»Schön.« Herman warf rasch einen Blick auf den Schuh in seiner Hand. Mr McCauley wusste, dass der Mann wieder an die Arbeit gehen wollte, aber er konnte ihn nicht loslassen.
»Mir sind gerade die Augen geöffnet worden. Ein richtiger Schock.«
»Ist wahr?«
Der alte Mann zog den Brief hervor und las Stellen daraus vor, unterbrach sich immer wieder mit grimmigem Gelächter.
»Bronchitis. Er sagt, er leidet an Bronchitis. Er weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Dabei weiß er immer, an wen er sich wenden soll. Wenn er alles andere ausgeschöpft hat, bin ich dran. Ein paar Hundert, nur bis ich wieder auf den Beinen bin. Fleht und bettelt mich an, und die ganze Zeit über macht er mit meiner Haushälterin gemeinsame Sache. Haben Sie das gewusst? Die beiden haben unter einer Decke gesteckt. Diesem Mann habe ich ein ums andere Mal aus der Klemme geholfen. Und nie einen Penny zurückbekommen. Nein, nein, ich muss bei der Wahrheit bleiben und sagen: fünfzig Dollar. Fünfzig von Hunderten und Aberhunderten. Von Tausenden. Er war im Krieg bei der Luftwaffe, wissen Sie. Diese klein geratenen Burschen, die waren oft bei der Luftwaffe. Stolzierten herum und bildeten sich ein, sie seien Kriegshelden. Ich sollte das wohl nicht sagen, aber ich glaube, der Krieg hat einige von diesen Burschen verdorben, sie konnten hinterher nicht mehr mit dem Leben zurechtkommen. Aber das ist keine ausreichende Entschuldigung. Oder? Nur wegen des Krieges kann ich ihm nicht ewig alles nachsehen.«
»Nein, das können Sie nicht.«
»Dabei wusste ich von Anfang an: Dem ist nicht zu trauen. Das ist ja das Merkwürdige. Ich habe es gewusst und mich trotzdem von ihm einseifen lassen. Es gibt solche Menschen. Man erbarmt sich ihrer, einfach weil sie nun mal Halunken sind. Ich habe ihm da draußen diese Versicherungsvertretung besorgt, ich hatte so meine Verbindungen. Natürlich hat er alles verpfuscht. Ein Nichtsnutz. So sind eben manche.«
»Da haben Sie Recht.«
Mrs Shultz war an dem Tag nicht im Geschäft. Stand nicht wie sonst hinter dem Ladentisch und nahm die Schuhe an, zeigte sie ihrem Mann und berichtete, was er gesagt hatte, stellte die Reparaturscheine aus und nahm das Geld entgegen, wenn die wiederhergestellten Schuhe zurückgegeben wurden. Mr McCauley fiel ein, dass sie im Sommer wegen irgendwas operiert worden war.
»Ihre Frau ist heute nicht da? Geht es ihr gut?«
»Sie meinte, besser, sie tritt heute mal kürzer. Ich habe meine Tochter hier.«
Herman Shultz nickte zu den Regalen rechts vom Ladentisch, wo die fertigen Schuhe standen. Mr McCauley wandte den Kopf um und sah Edith, die Tochter, die er beim Hereinkommen nicht bemerkt hatte. Ein kindhaft dünnes Mädchen mit glattem schwarzen Haar, das ihm beim Umordnen der Schuhe den Rücken zuwandte. Genauso, fiel ihm auf, war sie immer in sein Blickfeld geglitten und wieder verschwunden, wenn sie als Sabithas Freundin in sein Haus kam. Nie kriegte man ihr Gesicht richtig zu sehen.
»Du wirst jetzt deinem Vater aushelfen?«, sagte Mr McCauley. »Du bist mit der Schule fertig?«
»Heute ist Samstag«, sagte Edith und wandte sich dabei mit leisem Lächeln ein wenig um.
»Ach ja. Jedenfalls ist es gut, dass du deinem Vater hilfst. Du musst dich um deine Eltern kümmern. Sie haben schwer gearbeitet, und es sind gute Menschen.« Mit leicht entschuldigender Miene, als wüsste er, wie salbungsvoll er redete, sagte Mr McCauley: »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in …«
Edith sagte etwas, das nicht für seine Ohren bestimmt war. Sie sagte: »In der Schusterei.«
»Ich stehle Ihnen die Zeit, ich dränge mich auf«, sagte Mr McCauley traurig. »Sie haben zu tun.«
»Du brauchst gar nicht sarkastisch zu sein«, sagte Ediths Vater, als der alte Mann gegangen war.
Beim Abendessen erzählte er Ediths Mutter alles über Mr McCauley.
»Er ist wie verwandelt«, sagte er. »Er hat irgendwas.«
»Vielleicht einen kleinen Schlaganfall«, sagte sie. Seit ihrer Operation – Gallensteine – sprach sie sachkundig und mit sanfter Genugtuung von den Leiden anderer Leute.
Da nun Sabitha fort war, in ein anderes Leben entschwunden, das offenbar immer auf sie gewartet hatte, verwandelte Edith sich in die Person zurück, die sie vor Sabithas Aufenthalt in der Stadt gewesen war. Altklug, strebsam, naseweis. Nach drei Wochen in der High School wusste sie, dass sie in allen neuen Fächern – Latein, Algebra, englische Literatur – sehr gut sein würde. Sie war überzeugt, dass man ihre Klugheit erkennen und belobigen würde und dass eine bedeutende Zukunft vor ihr lag. Die Kindereien des letzten Jahres mit Sabitha gerieten langsam außer Sicht.
Doch wenn sie an Johanna und deren Aufbruch nach Westen dachte, dann spürte sie einen kalten Hauch aus ihrer Vergangenheit, eine wuchernde Furcht. Sie versuchte, dieses Gefühl zu unterdrücken, aber es wollte keine Ruhe geben.
Sobald sie mit dem Abwasch fertig war, ging sie auf ihr Zimmer und nahm das Buch für den Literaturunterricht mit, David Copperfield.
Sie war ein Kind, das von seinen Eltern nie Schlimmeres als sanfte Rügen erhalten hatte – ein Kind verhältnismäßig alter Eltern, was zur Erklärung ihres Wesens herangezogen wurde –, aber sie fühlte sich ganz im Einklang mit David in seiner unglückseligen Lage. Sie empfand, sie war wie er, könnte auch ein Waisenkind sein, denn sie würde wahrscheinlich weglaufen, sich verstecken, sich ganz allein durchschlagen müssen, sobald die Wahrheit ans Licht kam und ihre Vergangenheit ihr die Zukunft versperrte.
Alles hatte damit angefangen, dass Sabitha auf dem Weg zur Schule sagte: »Wir müssen beim Postamt vorbei. Ich muss einen Brief an meinen Vater aufgeben.«
Sie gingen den Schulweg jeden Tag gemeinsam. Manchmal mit geschlossenen Augen oder rückwärts. Manchmal, wenn ihnen Leute begegneten, schwatzten sie leise in einer erfundenen Sprache, um Verwirrung zu stiften. Die meisten ihrer guten Einfälle stammten von Edith. Der einzige Einfall, den Sabitha beisteuerte, war, den eigenen Namen und den eines Jungen aufzuschreiben, alle Buchstaben auszustreichen, die doppelt vorkamen, und die restlichen zu addieren. Die zählte man dann an den Fingern ab und sagte dabei Hasst er mich, mag er mich, liebt er mich, Hochzeit, bis man bei dem angelangt war, was einem mit diesem Jungen bevorstand.
»Das ist aber ein dicker Brief«, sagte Edith. Ihr fiel alles auf, und sie prägte sich alles ein, lernte ganze Seiten aus den Lehrbüchern so rasch auswendig, dass es den anderen Kindern unheimlich vorkam. »Hattest du deinem Vater so viel zu schreiben?«, fragte sie überrascht, denn sie konnte das nicht glauben – oder konnte zumindest nicht glauben, dass Sabitha es zu Papier bringen würde.
»Ich hab nur eine Seite geschrieben«, sagte Sabitha und befühlte den Brief.
»A-ha«, sagte Edith. »Ah. Ha.« »Was aha?«
»Ich wette, sie hat was dazugesteckt. Johanna, meine ich.« Es lief darauf hinaus, dass sie den Brief nicht gleich aufs Postamt brachten, sondern nach der Schule bei Edith zu Hause über Dampf öffneten. Solche Sachen konnten sie bei Edith zu Hause machen, weil ihre Mutter den ganzen Tag in der Schuhmacherei arbeitete.
Lieber Mr Ken Boudreau,
ich dachte einfach, ich schreibe Ihnen und bedanke mich bei Ihnen für die netten Worte, die Sie in Ihrem Brief an Ihre Tochter über mich geschrieben haben. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass ich weggehe. Sie schreiben, ich wäre jemand, dem Sie vertrauen können. So habe ich es wenigstens verstanden, und soweit ich weiß, stimmt das. Ich bin Ihnen dankbar für diese Worte, denn manche Leute meinen, jemand wie ich, dessen Herkunft sie nicht kennen, ist nicht hasenrein. Also dachte ich, am besten erzähle ich Ihnen was über mich. Ich wurde in Glasgow geboren, aber meine Mutter musste mich weggeben, als sie geheiratet hat. Ich kam mit fünf Jahren ins Heim. Ich habe so sehr gehofft, sie holt mich zurück, aber sie hat mich nicht geholt, und dann habe ich mich da eingewöhnt und es war gar nicht so schlimm. Aber mit elf Jahren wurde ich durch ein Programm nach Kanada geschickt und habe bei den Dixons gelebt und in ihrer Gemüsegärtnerei gearbeitet. Schule gehörte auch zu dem Programm, aber ich habe nicht viel davon gesehen. Im Winter habe ich im Haus für die Frau gearbeitet, aber Umstände veranlassten mich wegzugehen, und da ich für mein Alter groß und kräftig war, wurde ich bei einem Pflegeheim angenommen und habe alte Leute versorgt. Die Arbeit hat mir nichts ausgemacht, aber besserer Bezahlung halber bin ich gegangen und habe in einer Besenfabrik gearbeitet. Der Besitzer, Mr Willets, hatte eine alte Mutter, die vorbeikam, um nach dem Rechten zu sehen, und sie und ich, wir mochten uns irgendwie. Die Luft da machte mir Atembeschwerden, also sagte sie, ich sollte kommen und für sie arbeiten, und das habe ich getan. Ich war 12 Jahre bei ihr an einem See namens Mourning Dove Lake oben im Norden. Wir wohnten da ganz allein, nur sie und ich, aber ich durfte mich um alles drin und draußen kümmern, sogar mit dem Motorboot und mit dem Auto fahren. Ich lernte richtig lesen, denn ihre Augen ließen nach und sie hatte es gern, wenn ich ihr vorlas. Sie starb mit 96. Man könnte sagen, was für ein Leben für ein junges Mädchen, aber ich war glücklich. Wir haben immer zusammen gegessen, und die letzten anderthalb Jahre habe ich in ihrem Zimmer geschlafen. Aber nach ihrem Tod hat mir die Familie nur eine Woche Zeit gegeben, um meine Sachen zu packen. Sie hatte mir etwas Geld hinterlassen, und das gefiel denen wahrscheinlich nicht. Sie wollte, dass ich davon auf die Schule gehe, aber da wäre ich unter Kindern gewesen. Deshalb habe ich mich auf Mr McCauleys Anzeige im Globe beworben. Ich brauchte Arbeit, um über Mrs Willets’ Tod hinwegzukommen. Jetzt habe ich Sie wahrscheinlich lange genug mit meiner Vergangenheit gelangweilt, und Sie sind bestimmt erleichtert, dass ich in der Gegenwart angekommen bin. Vielen Dank für Ihre gute Meinung und für die Mitnahme zum Volksfest. Ich bin nicht so wild auf die Fahrten oder auf die Sachen, die es da zu essen gibt, aber es war trotzdem eine Freude, einbezogen zu sein.
Ihre Freundin
Johanna Parry
Edith las Johannas Worte vor, mit flehentlicher Stimme und schmerzbewegtem Ausdruck.
»Ich wurde in Glasgow geboren, aber meine Mutter musste mich weggeben, sobald sie mich sah …«
»Hör auf«, sagte Sabitha. »Ich muss so lachen, mir wird gleich schlecht.«
»Wie hat sie ihren Brief zu deinem tun können, ohne dass du es gemerkt hast?«
»Sie nimmt ihn mir einfach weg und steckt ihn in einen Umschlag und schreibt die Adresse drauf, weil sie meint, ich schreibe nicht schön genug.«
Edith musste Tesafilm auf die Lasche des Umschlags kleben, damit sie zu blieb, weil von dem Leim nicht mehr genug dran war. »Sie ist in ihn verliebt«, sagte sie.
»Ih, kotz-kotz«, sagte Sabitha und hielt sich den Bauch. »Unmöglich. Die alte Johanna.«
»Was hat er eigentlich über sie geschrieben?« »Nur, dass ich Respekt vor ihr haben soll, und dass es schade wäre, wenn sie weggeht, weil wir von Glück sagen können, sie zu haben, und dass er kein Zuhause für mich hat und Opa ein Mädchen nicht allein aufziehen kann und Blabla. Er hat geschrieben, sie wäre eine Dame. Er würde so was merken.« »Und daraufhin hat sie sich verliebt.«
Der Brief blieb über Nacht bei Edith, damit Johanna nicht entdeckte, dass er nicht abgeschickt und mit Tesafilm zugeklebt worden war. Sie brachten ihn am nächsten Morgen zur Post.
»Mal sehen, was er ihr zurückschreibt. Pass auf«, sagte Edith.
Lange Zeit kam kein Brief. Und als einer kam, war er eine Enttäuschung. Sie öffneten ihn bei Edith über Dampf, fanden aber nichts für Johanna drin.
Liebe Sabitha,
Weihnachten dieses Jahr trifft mich ein bisschen knapp bei Kasse an, tut mir leid, dass ich dir nicht mehr als einen Zwei-Dollar-Schein schicken kann. Aber ich hoffe, du bist gesund und hast fröhliche Weihnachten und machst weiter deine Schularbeiten. Mir selber ist es gar nicht gut gegangen, ich habe eine Bronchitis, wie offenbar jeden Winter, aber diese hat mich zum ersten Mal vor Weihnachten ans Bett gefesselt. Wie du am Absender sehen kannst, bin ich umgezogen. Die Wohnung war in einem sehr lärmigen Haus, und zu viele Leute schauten vorbei und hofften auf eine Party. Das hier ist eine Pension, was mir ganz recht ist, da ich es nie mit dem Einkaufen und dem Kochen hatte.
Fröhliche Weihnachten und alles Liebe
Dad
»Arme Johanna«, sagte Edith. »Ihr wird das Herz zerbrechen.«
Sabitha sagte: »Na und?«
»Es sei denn, wir tun’s«, sagte Edith.
»Was?«
»Ihr antworten.«
Sie mussten den Brief mit der Schreibmaschine schreiben, denn Johanna würde merken, dass die Handschrift nicht die von Sabithas Vater war. Aber das war nicht: schwierig. Bei Edith zu Hause stand eine auf einem Klapptisch im Vorderzimmer. Ihre Mutter hatte vor ihrer Heirat in einem Büro gearbeitet und verdiente sich manchmal immer noch ein bisschen Geld, indem sie für andere Leute Briefe schrieb, die amtlich aussehen sollten. Sie hatte Edith die Grundlagen des Tippens beigebracht, in der Hoffnung, auch Edith könnte eines Tages in einem Büro Arbeit finden.
»Liebe Johanna«, sagte Sabitha, »es tut mir leid, ich kann dich nicht lieben, weil du das ganze Gesicht voll hässlicher Pickel hast.«
»Ich meine es ernst«, sagte Edith. »Also halt den Mund.«
Sie tippte: »Ich war so froh, den Brief zu erhalten …«, sprach die Worte ihres Werkes laut, machte eine Pause, wenn sie nachdachte, und ihr Tonfall wurde immer feierlicher und zärtlicher. Sabitha räkelte sich auf dem Sofa und kicherte. Irgendwann stellte sie den Fernseher an, aber Edith sagte: »Also bitte! Wie soll ich mich bei dieser Kacke da auf meine Gefühle konzentrieren?«
Edith und Sabitha benutzten die Wörter »Kacke« und »Sau« und »Himmel Arsch«, wenn sie allein waren.
Liebe Johanna,