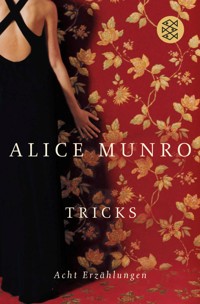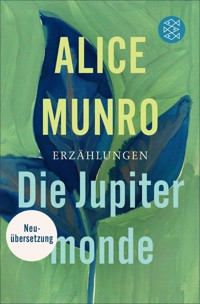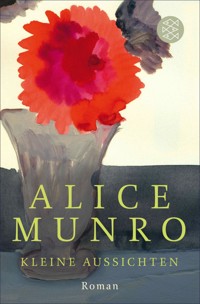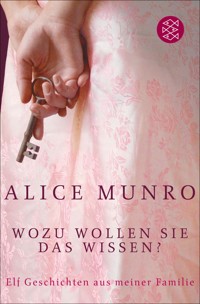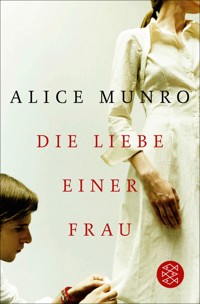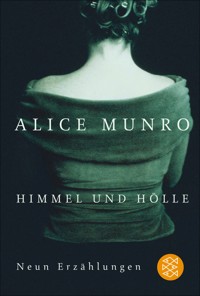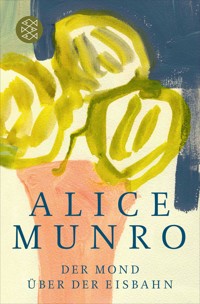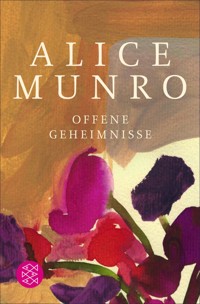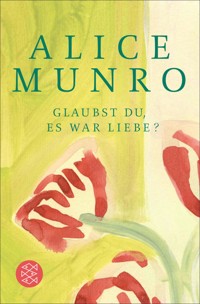8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nobelpreis für Literatur 2013 Zu viel oder zu wenig – für das Glück gibt es kein Maß, nie trifft man es richtig. Alice Munros Heldinnen und Helden geht es nicht anders, sie haben das Zuviel und Zuwenig erlebt: eine Balance ist nur schwer zu finden. Auf der Suche nach ihr macht Alice Munro ihre Leser zu Komplizen dieser spannenden Mission. »Ich bewundere Alice Munro. Ich bewundere die Direktheit ihres Erzählens, die Nüchternheit und Einfachheit ihrer Sprache. (…) Was für Geschichten, was für ein Werk!« Bernhard Schlink, Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alice Munro
Zu viel Glück
Zehn Erzählungen
Aus dem Englischen von Heidi Zerning
FISCHER E-Books
Inhalt
Für David Connelly
Dimensionen
Doree musste drei Busse nehmen – einen nach Kincardine, wo sie auf den Bus nach London wartete, und dort dann noch auf den Nahverkehrsbus zu der Anstalt. Sie begann die Fahrt an einem Sonntag um neun Uhr morgens. Wegen der Wartezeiten zwischen den Bussen brauchte sie bis gegen zwei Uhr nachmittags, um die etwas über einhundert Meilen zurückzulegen. Das viele Sitzen, entweder in den Bussen oder auf den Busbahnhöfen, war nichts, was ihr etwas ausgemacht hätte. Ihre tägliche Arbeit gehörte nicht zu den im Sitzen ausgeübten Tätigkeiten.
Sie war Zimmermädchen im Blue Spruce Inn. Sie machte Badezimmer sauber, bezog Betten frisch, staubsaugte Teppichböden und putzte Spiegel. Sie mochte diese Arbeit, die bis zu einem gewissen Grade ihre Gedanken in Anspruch nahm und sie ermüdete, so dass sie nachts schlafen konnte. Sie fand selten eine wirklich schlimme Schweinerei vor, obwohl einige der Frauen, mit denen sie arbeitete, Geschichten erzählen konnten, dass einem die Haare zu Berge standen. Diese Frauen waren älter als sie und vertraten alle die Ansicht, sie solle versuchen, sich hochzuarbeiten. Sie sagten ihr, sie solle sich für einen Job hinter dem Empfangstresen ausbilden lassen, solange sie noch jung und ansehnlich sei. Aber sie war zufrieden mit dem, was sie tat. Sie mochte nicht mit anderen Menschen reden müssen.
Niemand von den Leuten, mit denen sie arbeitete, wusste, was passiert war. Oder falls doch, so ließ es sich niemand anmerken. Ihr Foto hatte in der Zeitung gestanden – man hatte das Foto benutzt, das er von ihr mit allen drei Kindern aufgenommen hatte, in ihren Armen Dimitri, das neue Baby, links und rechts von ihr Barbara Ann und Sasha, die zum Baby schauten. Ihr Haar war damals lang und lockig und braun gewesen, in seiner natürlichen Form und Farbe, wie er es mochte, und ihr Gesicht zaghaft und weich – ein Abbild weniger der Frau, die sie zu der Zeit war, als der Frau, die er in ihr sehen wollte.
Inzwischen war ihr Haar kurz geschnitten und blondiert und zu Stacheln gegelt, und sie hatte eine Menge abgenommen. Und sie benutzte jetzt ihren zweiten Vornamen: Fleur. Außerdem befand sich der Arbeitsplatz, den man ihr besorgt hatte, in einer Stadt, die ein ganzes Stück weit weg war von dem Ort, an dem sie gelebt hatte.
Sie unternahm diese Fahrt nun zum dritten Mal. Bei den ersten beiden Malen hatte er sich geweigert, sie zu sehen. Wenn er das wieder tat, würde sie es aufgeben. Sogar wenn er diesmal kam, konnte es sein, dass sie eine Zeitlang nicht mehr hinfahren würde. Sie hatte nicht vor, weich zu werden. Doch eigentlich wusste sie nicht, was sie tun würde.
Im ersten Bus war sie nicht allzu unruhig. Saß nur da und schaute in die Landschaft. Sie war an der Küste aufgewachsen, wo es so etwas wie Frühling gab, aber hier ging der Winter fast direkt in den Sommer über. Vor einem Monat hatte noch Schnee gelegen, und jetzt war es heiß genug, um mit bloßen Armen zu gehen. Blendende Tücher aus Wasser lagen auf den Feldern, und das Sonnenlicht ergoss sich durch die kahlen Zweige.
Im zweiten Bus fing sie an, nervös zu werden, und konnte nicht anders, als zu überlegen, welche der Frauen um sie herum dasselbe Ziel haben könnten. Frauen, die allein fuhren und meistens mit einiger Sorgfalt gekleidet waren, vielleicht, damit sie aussahen, als ob sie in die Kirche gingen. Die älteren sahen aus, als gehörten sie strengen, altmodischen Kirchen an, wo man einen Rock und Strümpfe und eine Kopfbedeckung tragen musste, während die jüngeren in einer flotteren Gemeinde hätten sein können, die Hosenanzüge, leuchtend bunte Schals, Ohrringe und toupierte Frisuren zuließ.
Doree passte in keine der beiden Kategorien. In den ganzen anderthalb Jahren, seit sie arbeitete, hatte sie sich kein einziges neues Kleidungsstück gekauft. Bei der Arbeit trug sie ihre Uniform und sonst ihre Jeans. Sie hatte sich abgewöhnt, Make-up aufzulegen, denn er hatte es nicht erlaubt, und jetzt hätte sie es zwar tun können, tat es aber nicht. Die Stacheln aus maisfarbenem Haar passten nicht zu ihrem knochigen, ungeschminkten Gesicht, aber das machte ihr nichts aus.
Im dritten Bus bekam sie einen Fensterplatz und versuchte, ruhig zu bleiben, indem sie Schilder las – die Straßenschilder und auch die mit Reklame. Sie war auf einen Trick gestoßen, mit dem sie sich ablenken konnte. Sie nahm die Buchstaben von irgendeinem Wort, das ihr ins Auge fiel, und probierte, wie viele neue Wörter sie daraus bilden konnte. »Restaurant« zum Beispiel, das ergab »Rest« und »Stau« und dann »Star« und »Raute« und »Natur« und »Tante« und – Moment – »Trauer«. Wörter gab es auf dem Weg hinaus aus der Stadt mehr als genug, denn sie kamen an Reklametafeln, Großmärkten und Parkplätzen vorbei, sogar an Ballons, die auf den Dächern verankert waren und für Ausverkäufe warben.
Doree hatte Mrs Sands nichts von ihren ersten beiden Versuchen gesagt und würde ihr wahrscheinlich auch von diesem nichts sagen. Mrs Sands, zu der sie immer am Montagnachmittag ging, sprach davon, voranzukommen, obwohl sie immer betonte, dass es Zeit brauche, dass man nichts überstürzen solle. Sie sagte, dass Doree ihre Sache gut mache, dass sie nach und nach ihre eigene Stärke entdecke.
»Ich weiß, dass diese Worte totgeredet worden sind«, sagte sie. »Aber sie sind trotzdem wahr.«
Sie wurde rot, als sie sich das Wort »tot« sagen hörte, aber sie machte es nicht durch eine Entschuldigung schlimmer.
Als Doree sechzehn war – nämlich vor sieben Jahren –, ging sie jeden Tag nach der Schule zu ihrer Mutter ins Krankenhaus. Ihre Mutter lag dort nach einer Rückenoperation, von der es hieß, sie sei ernst, aber nicht lebensgefährlich gewesen. Lloyd war einer der Pfleger. Mit Dorees Mutter verband ihn, dass beide alte Hippies waren, auch wenn Lloyd einige Jahre jünger war, und wann immer er Zeit hatte, kam er und plauderte mit ihr über die Konzerte und die Protestmärsche, an denen sie beide teilgenommen hatten, über unmögliche Leute, die sie gekannt hatten, über Drogentrips, die ihnen das Hirn weggeblasen hatten, und solche Sachen.
Lloyd war bei den Patienten beliebt, wegen seiner Witze und seiner zupackenden Art. Er war untersetzt, breitschultrig und beeindruckend genug, um manchmal für einen Arzt gehalten zu werden. (Nicht, dass ihm das gefiel – er vertrat die Ansicht, dass vieles in der Medizin Betrug sei und dass viele Ärzte Volltrottel seien.) Er hatte empfindliche rötliche Haut, helle Haare und kühne Augen.
Er küsste Doree im Fahrstuhl und sagte ihr, sie sei eine Blume in der Wüste. Dann lachte er über sich selbst und sagte: »Ungeheuer originell, was?«
»Du bist ein Dichter und weißt es nicht«, sagte sie, um freundlich zu sein.
Eines Nachts starb plötzlich ihre Mutter an einer Embolie. Dorees Mutter hatte viele Freundinnen, die Doree bei sich aufgenommen hätten – und eine Zeitlang blieb sie auch bei einer von ihnen –, aber es war der neue Freund Lloyd, dem sie den Vorzug gab. Als ihr nächster Geburtstag kam, war sie schwanger, dann verheiratet. Lloyd war noch nie verheiratet gewesen, obwohl er mindestens zwei Kinder hatte, deren Aufenthaltsorte er nicht genau kannte. Außerdem waren sie inzwischen sowieso erwachsen. Seine Lebensphilosophie hatte sich mit zunehmendem Alter geändert. Er glaubte jetzt an die Ehe, an Beständigkeit und null Geburtenkontrolle. Und er fand, dass es auf der Sechelt-Halbinsel, wo er mit Doree lebte, mittlerweile zu viele Leute gab – alte Freunde, alte Lebensweisen, alte Geliebte. Bald zog er mit Doree quer durchs Land in eine Stadt, die sie sich auf der Karte wegen ihres Namens ausgesucht hatten: Mildmay. Sie wohnten nicht in der Stadt; sie mieteten etwas in der Umgebung. Lloyd fand Arbeit in einer Eiscremefabrik. Sie legten einen Garten an. Lloyd hatte viel Ahnung davon, ebenso wie vom Tischlern und davon, wie man mit einem Holzofen umging und ein altes Auto in Gang hielt.
Sasha wurde geboren.
»Vollkommen natürlich«, sagte Mrs Sands.
»Wirklich?«, fragte Doree.
Doree setzte sich immer auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, nicht auf das geblümte Sofa mit den Kissen. Mrs Sands rückte dann ihren eigenen Stuhl neben den Schreibtisch, damit sie ohne irgendeine Barriere dazwischen miteinander reden konnten.
»Irgendwie habe ich erwartet, dass Sie das tun würden«, sagte sie. »Ich meine, ich an Ihrer Stelle hätte das wahrscheinlich getan.«
Anfangs hätte Mrs Sands so etwas nicht gesagt. Sogar noch vor einem Jahr wäre sie vorsichtiger gewesen, da sie wusste, wie Doree gegen die Vorstellung revoltiert hätte, dass jemand anders, irgendein anderer Mensch, an ihrer Stelle sein könnte. Jetzt wusste sie, dass Doree es einfach als einen Versuch auffassen würde, sogar nur einen bescheidenen, sie zu verstehen.
Mrs Sands war nicht wie einige von denen. Sie war nicht forsch, nicht dünn, nicht hübsch. Auch nicht zu alt. Sie war etwa so alt, wie Dorees Mutter jetzt wäre, obwohl sie nicht so aussah, als sei sie je ein Hippie gewesen. Ihre ergrauenden Haare waren kurz geschnitten, und auf einem ihrer Backenknochen thronte ein Leberfleck. Sie trug flache Absätze und weite Hosen und geblümte Tops. Sogar wenn diese Tops himbeerrot oder türkisgrün waren, entstand nicht der Eindruck, dass ihr wichtig sei, was sie anzog – eher, als habe ihr jemand gesagt, sie müsse sich aufhübschen, und sie habe sich daraufhin gehorsam etwas gekauft, was das ihrer Meinung nach bewirkte. Ihre große, freundliche, unpersönliche Ernsthaftigkeit entzog diesen Sachen alle aggressive Fröhlichkeit, alle Frechheit.
»Die ersten beiden Male habe ich ihn gar nicht gesehen«, sagte Doree. »Er wollte nicht herunterkommen.«
»Aber diesmal doch? Er ist heruntergekommen?«
»Doch, ja. Aber ich hätte ihn fast nicht erkannt.«
»Er war gealtert?«
»Kann schon sein. Kann sein, dass er abgenommen hat. Und diese Sachen. Diese Uniform. In so was hab ich ihn noch nie gesehen.«
»Er sah für Sie wie jemand anders aus?«
»Nein.« Doree knabberte an ihrer Oberlippe und versuchte, sich über den Unterschied klarzuwerden. Er war so still gewesen. Sie hatte ihn noch nie so still erlebt. Er schien nicht einmal zu wissen, dass er ihr gegenüber Platz nehmen musste. Ihre ersten Worte zu ihm waren: »Willst du dich nicht hinsetzen?« Und er hatte geantwortet: »Darf ich denn?«
»Er sah irgendwie so abwesend aus«, sagte sie. »Ich hab mich gefragt, ob sie ihn unter Drogen gesetzt haben.«
»Vielleicht etwas, damit er im Lot bleibt. Doch ich weiß es nicht. Kamen Sie miteinander ins Gespräch?«
Doree überlegte, ob man es so nennen konnte. Sie hatte ihm irgendwelche blöden, ganz normalen Fragen gestellt. Wie fühlte er sich? (Geht so.) Bekam er genug zu essen? (Doch, schon.) Gab es einen Ort, wo er spazieren gehen konnte, wenn er wollte? (Unter Aufsicht, ja. Vielleicht konnte man’s einen Ort nennen. Vielleicht konnte man’s spazieren gehen nennen.)
Sie hatte gesagt: »Du brauchst frische Luft.«
Er hatte gesagt: »Stimmt.«
Sie hätte ihn beinahe gefragt, ob er schon Freunde gefunden habe. So, wie man sein Kind über die Schule ausfragt. Wenn man Kinder hätte, die zur Schule gingen.
»Ja, ja«, sagte Mrs Sands und schob ihr die bereitstehende Kleenex-Schachtel zu. Doree brauchte sie nicht: Ihre Augen waren trocken. Ihr Magen war das Problem. Der Brechreiz.
Mrs Sands wartete einfach, war klug genug, sich zurückzuhalten.
Und Lloyd, als habe er gespürt, was sie sagen wollte, erzählte ihr, dass es einen Psychiater gebe, der hin und wieder mit ihm spreche.
»Ich sag ihm, dass er seine Zeit verschwendet«, sagte Lloyd. »Ich weiß ebenso viel wie er.«
Das war das einzige Mal, dass er sich für Doree annähernd wie er selbst angehört hatte.
Während des gesamten Besuchs hämmerte ihr Herz. Sie meinte, gleich in Ohnmacht zu fallen oder zu sterben. So anstrengend war es für sie, ihn anzusehen, ihn zu erkennen in diesem dünnen und grauen, schüchternen, dabei kalten, sich mechanisch bewegenden, dabei unkoordinierten Mann.
Sie hatte Mrs Sands nichts davon gesagt. Sonst hätte Mrs Sands sie vielleicht – taktvoll – gefragt, vor wem sie Angst habe? Vor sich selbst oder vor ihm? Aber sie hatte keine Angst!
Als Sasha anderthalb war, wurde Barbara Ann geboren, und als Barbara Ann zwei war, bekamen sie Dimitri. Sasha hatten sie zusammen benannt, und dann hatten sie sich geeinigt, dass er den Jungen die Namen geben werde und sie den Mädchen.
Dimitri war der Erste, der Koliken kriegte. Doree dachte, dass er vielleicht nicht genug Milch bekam oder dass ihre Milch nicht reichhaltig genug war. Oder zu reichhaltig? Jedenfalls nicht das Richtige. Lloyd ließ eine Dame von der La Leche Liga kommen, die mit ihr redete. Was Sie auch tun, sagte die Dame, Sie dürfen ihm keine Zusatzflasche geben. Das sei der Anfang vom Ende, sagte sie, und schon bald werde er die Brust ganz zurückweisen. Sie sprach, als sei das eine schlimme Tragödie.
Sie hatte keine Ahnung, dass Doree ihm bereits Zusatznahrung gegeben hatte. Und es schien zu stimmen, dass er die vorzog – er sträubte sich mehr und mehr gegen die Brust. Mit drei Monaten nahm er nur noch die Flasche, und dann ließ es sich nicht mehr vor Lloyd verheimlichen. Sie sagte ihm, dass ihre Milch versiegt sei und sie angefangen habe, ihm Zusatznahrung zu geben. Lloyd nahm sich mit finsterer Entschlossenheit erst die eine, dann die andere Brust vor, und es gelang ihm, ein paar Tropfen dürftig aussehende Milch herauszuquetschen. Er nannte sie eine Lügnerin. Sie stritten sich. Er sagte, sie sei eine Hure wie ihre Mutter.
Alle diese Hippies waren Huren, sagte er.
Bald versöhnten sie sich. Aber jedes Mal, wenn Dimitri quengelig war, wenn er eine Erkältung hatte oder sich vor Sashas zahmem Kaninchen fürchtete oder sich in einem Alter, in dem sein Bruder und seine Schwester schon ohne Stütze gelaufen waren, immer noch an Stühlen festhielt, dann wurde an ihr Versagen erinnert, ihn zu stillen.
Bei Dorees erstem Besuch in Mrs Sands Büro hatte ihr eine der anderen Frauen dort eine Broschüre gegeben. Auf der Vorderseite waren ein goldenes Kreuz und Worte aus goldenen und violetten Buchstaben: »Wenn dein Verlust unerträglich scheint …« Innen drin war ein Bild von Jesus in sanften Farben und kleiner Gedrucktes, das Doree nicht las.
Auf ihrem Stuhl vor dem Schreibtisch umklammerte Doree immer noch die Broschüre und fing an zu zittern. Mrs Sands musste sie ihr aus den Händen winden.
»Hat Ihnen das jemand gegeben?«, fragte Mrs Sands.
»Die«, sagte Doree und nickte mit dem Kopf zur geschlossenen Tür.
»Sie wollen das nicht?«
»Wenn man am Boden ist, dann versuchen die, einen zu kriegen«, sagte Doree und merkte, so etwas hatte ihre Mutter gesagt, als mehrere Damen mit einer ähnlichen Botschaft sie im Krankenhaus aufsuchten. »Die glauben, man braucht nur auf die Knie zu fallen, und alles wird gut.«
Mrs Sands seufzte.
»Na ja«, sagte sie, »so einfach ist es bestimmt nicht.«
»Nicht mal annähernd«, sagte Doree.
»Vielleicht nicht.«
Sie sprachen zu jener Zeit nie über Lloyd. Doree dachte nie an ihn, nur, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, und auch dann nur, als sei er ein schrecklicher Unfall der Natur.
»Selbst wenn ich an das Zeugs glauben würde«, sagte sie und meinte das, was in der Broschüre stand, »wär’s nur so, dass …« Sie wollte sagen, dass solch ein Glaube bequem wäre, denn dann könnte sie sich vorstellen, dass Lloyd in der Hölle schmorte oder irgend so etwas, aber sie vermochte nicht fortzufahren, weil es einfach zu blöd war, darüber zu reden. Und wegen eines vertrauten Übels, das sie wie ein Hammerschlag in den Bauch traf.
Lloyd war der Meinung, dass die Kinder zu Hause unterrichtet werden sollten. Nicht aus religiösen Gründen – auf dem Kriegspfad gegen Dinosaurier, Höhlenmenschen, Affen und all das –, sondern weil er wollte, dass sie ihren Eltern naheblieben und langsam und behutsam in die Welt eingeführt wurden, statt plötzlich in sie geworfen zu werden. »Zufällig bin ich der Ansicht, dass es meine Kinder sind«, sagte er. »Ich meine, es sind unsere Kinder, nicht die vom Erziehungsministerium.«
Doree war sich nicht sicher, ob sie damit fertig werden konnte, aber es stellte sich heraus, dass es Richtlinien vom Erziehungsministerium gab und Stundenpläne, die man sich in der Bezirksschule abholen konnte. Sasha war ein aufgeweckter Junge, der sich das Lesen praktisch selber beibrachte, und die anderen beiden waren noch zu klein, um viel zu lernen. Abends und am Wochenende gab Lloyd Sasha Unterricht in Erdkunde, über das Sonnensystem, den Winterschlaf von Tieren oder die Funktionsweise von Autos, ganz danach, welche Fragen aufkamen. Schon bald war Sasha den Schulplänen voraus, aber Doree holte sie trotzdem ab und ließ ihn die Aufgaben zeitgerecht machen, damit dem Gesetz Genüge getan werde.
Es gab noch eine andere Mutter im Bezirk, die ihre Kinder zu Hause unterrichtete. Sie hieß Maggie und hatte einen Kleinbus. Lloyd brauchte sein Auto, um zur Arbeit zu fahren, und Doree hatte keinen Führerschein, also war sie froh, als Maggie ihr anbot, sie einmal in der Woche zur Schule mitzunehmen, um die erledigten Aufgaben abzugeben und die neuen abzuholen. Natürlich nahmen sie alle Kinder mit. Maggie hatte zwei Jungen. Der ältere hatte so viele Allergien, dass sie genau auf alles aufpassen musste, was er aß – weshalb sie ihn zu Hause unterrichtete. Und dann fand sie, dass sie den jüngeren besser auch dort behielt. Er wollte sowieso bei seinem Bruder bleiben und hatte mit Asthma zu kämpfen.
Wie dankbar Doree da sein konnte, wenn sie das mit ihren gesunden drei verglich. Lloyd sagte, das sei, weil sie ihre Kinder bekommen hatte, als sie noch jung war, während Maggie gewartet hatte, bis sie kurz vor den Wechseljahren stand. Er übertrieb Maggies Alter, aber es stimmte, sie hatte sich Zeit gelassen. Sie war Optikerin. Sie und ihr Mann waren Geschäftspartner gewesen, und sie hatten mit den Kindern gewartet, bis sie ein Haus auf dem Land besaßen und Maggie die Praxis verlassen konnte.
Maggies Haar hatte die Farbe von Pfeffer und Salz und war raspelkurz geschnitten. Sie war groß, flachbrüstig, fröhlich und rechthaberisch. Lloyd nannte sie die Lesbe. Natürlich nur hinter ihrem Rücken. Am Telefon blödelte er mit ihr herum, flüsterte aber Doree unhörbar zu: »Es ist die Lesbe.« Das beunruhigte Doree nicht weiter – er nannte viele Frauen Lesben. Aber sie hatte Angst, sein Geblödel könnte Maggie übertrieben freundlich vorkommen, aufdringlich oder zumindest wie Zeitverschwendung.
»Sie wollen meine Alte sprechen. Doch, die’s hier. Schrubbt gerade auf dem Waschbrett. Ich bin nämlich ein richtiger Sklaventreiber. Hat sie Ihnen das gesagt?«
Doree und Maggie gewöhnten sich an, zusammen Lebensmittel einzukaufen, nachdem sie die Unterlagen in der Schule abgeholt hatten. Danach holten sie sich manchmal im Tim Horton’s Kaffee und fuhren mit den Kindern zum Riverside Park. Sie saßen auf einer Bank, während Sasha und Maggies Jungen herumtollten oder im Kletternetz hangelten und Barbara Ann sich auf der Schaukel ins Zeug legte und Dimitri im Sandkasten spielte. Oder sie blieben im Bus sitzen, wenn es zu kalt war. Sie redeten hauptsächlich über die Kinder und das, was sie kochten, aber irgendwie fand Doree heraus, dass Maggie vor ihrer Ausbildung zur Optikerin durch Europa getrampt war, und Maggie fand heraus, wie jung Doree gewesen war, als sie heiratete. Auch, wie leicht sie anfangs schwanger geworden war und jetzt nicht mehr, was Lloyd misstrauisch machte, so dass er ihre Kommode nach Antibabypillen durchsuchte – überzeugt, sie müsse sie heimlich nehmen.
»Und tun Sie’s?«, fragte Maggie.
Doree war schockiert. Sie sagte, das würde sie nicht wagen.
»Ich meine, ich fände es schrecklich, das zu tun, ohne es ihm zu sagen. Wenn er danach sucht, dann ist das bloß so zum Scherz.«
»Ach, ja?«, sagte Maggie.
Und einmal fragte Maggie: »Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ich meine, in Ihrer Ehe? Sind Sie glücklich?«
Doree sagte ja, ohne zu zögern. Danach wurde sie vorsichtiger mit dem, was sie erzählte. Sie merkte, es gab Dinge, an die sie gewöhnt war, die aber jemand anders vielleicht nicht verstand. Lloyd hatte eine bestimmte Sichtweise auf alles; so war er eben. So war er schon, als sie ihn im Krankenhaus kennenlernte. Die Oberschwester war eine steife, unnahbare Person, also nannte er sie Mrs Eisblock statt bei ihrem richtigen Namen, Mrs Heslock. Er sagte es so undeutlich, dass man es fast nicht mitbekam. Er war der Ansicht, dass sie sich ihre Lieblinge aussuchte und dass er nicht dazu gehörte. Jetzt gab es jemanden in der Eiscremefabrik, den er verachtete, jemand, den er Schwanzlutscher-Louie nannte. Den richtigen Namen des Mannes kannte Doree nicht. Aber zumindest bewies es ihr, dass er sich nicht nur von Frauen provoziert fühlte.
Doree war sich ziemlich sicher, dass diese Leute nicht so schlimm waren, wie Lloyd dachte, aber es hatte keinen Zweck, ihm zu widersprechen. Vielleicht mussten Männer einfach Feinde haben, so, wie sie ihre Witze machen mussten. Und manchmal machte Lloyd die Feinde wirklich zu Witzen, geradeso, als lache er über sich selbst. Sie durfte sogar mitlachen, Hauptsache, sie lachte nicht als Erste.
Sie hoffte, er würde sich nicht so gegen Maggie wenden. Ab und zu geriet sie in Angst, weil sie so etwas kommen sah. Wenn er sie daran hinderte, mit Maggie zur Schule und zum Einkaufen zu fahren, dann wäre das ein großes Problem. Aber noch schlimmer wäre die Schande. Sie würde eine blöde Lüge erfinden müssen, um alles zu erklären. Aber Maggie würde Bescheid wissen – zumindest würde sie wissen, dass Doree log, und wahrscheinlich würde sie daraus schließen, dass Doree in einer schlimmeren Situation war als tatsächlich. Maggie hatte ihre eigene nüchterne Art, die Dinge zu sehen.
Dann wieder fragte sich Doree, warum sie überhaupt wichtig nehmen sollte, was Maggie denken könnte. Maggie war eine Außenstehende, nicht mal jemand, bei dem sich Doree besonders wohl fühlte. Lloyd und Doree und die Kinder, darauf kam es an. Das sagte Lloyd, und er hatte recht. Die Wahrheit der Dinge zwischen ihnen, das Verbindende, das konnte niemand anders verstehen, und das ging niemand anders etwas an. Wenn Doree nur unbeirrbar zu Lloyd stand, dann würde alles gut sein.
Nach und nach wurde es schlimmer. Keine direkten Verbote, aber mehr Kritik. Dann stellte Lloyd die Theorie auf, dass Maggie an den Allergien und dem Asthma ihrer Jungen schuld sei. Es lag oft an der Mutter, sagte er. Er hatte das ständig im Krankenhaus gesehen. Die überängstliche, meistens überschlaue Mutter.
»Manchmal werden Kinder eben einfach mit was geboren«, sagte Doree unklugerweise. »Du kannst nicht sagen, dass es jedes Mal an der Mutter liegt.«
»Ach? Und warum kann ich das nicht sagen?«
»Ich habe nicht dich gemeint. Ich meine, man kann das nicht sagen. Ich meine, sie können doch mit so was geboren werden?«
»Seit wann bist du solch eine medizinische Kapazität?«
»Hab ich doch gar nicht behauptet.«
»Nein. Bist du auch nicht.«
Dann noch schlimmer. Er wollte wissen, worüber sie beide redeten, sie und Maggie.
»Weiß ich nicht. Eigentlich über nichts.«
»Komisch. Zwei Frauen zusammen im Auto. Die über nichts reden. Hör ich zum ersten Mal. Sie ist darauf aus, uns auseinanderzubringen.«
»Wer? Maggie?«
»Ich habe Erfahrungen mit der Sorte Frauen.«
»Mit welcher Sorte?«
»Mit ihrer Sorte.«
»Sei nicht dumm.«
»Vorsicht. Nenn mich nicht dumm.«
»Warum sollte sie das tun?«
»Wie soll ich das wissen? Sie will es einfach. Wart’s ab. Du wirst sehen. Sie wird dich dazu bringen, dass du heulend rüberrennst und ihr vorjammerst, was für ein Mistkerl ich bin. Über kurz oder lang.«
Und tatsächlich kam es so, wie er gesagt hatte. Zumindest hätte es für Lloyd so ausgesehen. Sie fand sich wirklich eines Abends gegen zehn in Maggies Küche wieder, schniefend und Kräutertee trinkend. Maggies Mann hatte gesagt: »Verdammt, wer ist das denn?«, als sie klopfte – sie hörte ihn durch die Tür. Er wusste nicht, wer sie war. Sie hatte gesagt: »Tut mir wirklich leid, Sie zu stören …«, als er sie mit hochgezogenen Augenbrauen und verkniffenem Mund anstarrte. Doch dann war Maggie gekommen.
Doree war den ganzen Weg dorthin im Dunkeln gelaufen, anfangs entlang der Schotterstraße, an der sie mit Lloyd wohnte, dann auf dem Highway. Jedes Mal, wenn ein Auto kam, hockte sie sich in den Straßengraben, wodurch sie nur langsam vorankam. Vorsichtig warf sie einen Blick auf die vorbeifahrenden Autos, denn in einem davon konnte Lloyd sitzen. Sie wollte nicht, dass er sie fand, noch nicht, nicht, bevor er vor lauter Angst von seinem Irrsinn abgelassen hatte. Bisher war es ihr immer gelungen, ihm genug Angst einzujagen, indem sie heulte und kreischte und sogar den Kopf auf den Boden schlug und schrie: »Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr«, wieder und wieder. Schließlich hatte er dann klein beigegeben. Hatte gesagt: »Gut, gut, ich glaube dir, Schatz. Sei doch still. Denk an die Kinder. Ich glaube dir, ehrlich. Hör auf.«
Doch heute Abend hatte sie sich, gerade als sie mit dieser Vorstellung beginnen wollte, zusammengerissen. Sie hatte ihren Mantel angezogen und war zur Tür hinausspaziert, wobei er ihr nachrief: »Tu das nicht! Ich warne dich!«
Maggies Mann war zu Bett gegangen, immer noch deutlich angesäuert, während Doree ein ums andere Mal sagte: »Es tut mir leid, es tut mir so leid, Sie spät abends so zu überfallen.«
»Ach, halten Sie den Mund«, sagte Maggie freundlich und vernünftig. »Möchten Sie ein Glas Wein?«
»Ich trinke nicht.«
»Dann fangen Sie jetzt besser nicht damit an. Ich mache Ihnen einen Tee. Der ist sehr beruhigend. Himbeere mit Kamille. Es sind doch nicht die Kinder?«
»Nein.«
Maggie nahm ihr den Mantel ab und gab ihr eine Handvoll Kleenex für Augen und Nase: »Warten Sie mit dem Erzählen. Kommen Sie erst mal zur Ruhe.«
Aber auch, als sie halbwegs zur Ruhe gekommen war, mochte Doree nicht mit der ganzen Wahrheit herausrücken und Maggie gestehen, dass sie selbst der Kern des Problems war. Und noch weniger mochte sie Lloyd erklären müssen. Ganz egal, wie sehr sie sich mit ihm stritt, er war immer noch der Mensch, der ihr am nächsten stand, und sie hatte das Gefühl, dass alles zusammenbrechen würde, wenn sie sich dazu durchrang, jemandem in allen Einzelheiten zu erzählen, wie er war, wenn sie ihn verriet.
Sie sagte, sie sei mit Lloyd wieder mal über eine alte Sache in Streit geraten, und sie habe die Nase so voll gehabt, dass sie nur noch hinauswollte. Aber sie werde darüber hinwegkommen, sagte sie. Sie beide würden schon darüber hinwegkommen.
»Das kommt bei allen Paaren mal vor«, sagte Maggie.
Da klingelte das Telefon, und Maggie ging ran.
»Ja. Es geht ihr gut. Sie musste bloß ein Stück laufen, um etwas aus dem Kopf zu kriegen. Schön. In Ordnung, dann bringe ich sie morgen früh nach Hause. Nein, das macht keine Mühe. In Ordnung. Gute Nacht.«
»Das war er«, sagte sie. »Sie haben es ja wohl mitgekriegt.«
»Wie hat er sich angehört? Hat er sich normal angehört?«
Maggie lachte. »Ich weiß doch gar nicht, wie er sich anhört, wenn er normal ist. Er hat sich nicht betrunken angehört.«
»Er trinkt auch nicht. Wir haben nicht mal Kaffee im Haus.«
»Möchten Sie einen Toast?«
Früh am Morgen fuhr Maggie sie nach Hause. Maggies Mann war noch nicht zur Arbeit aufgebrochen und blieb bei den Jungen.
Maggie hatte es eilig, wieder nach Hause zu kommen, also sagte sie nur: »Dann tschüss. Rufen Sie mich an, wenn Sie reden wollen«, als sie mit dem Kleinbus auf dem Hof wendete.
Es war ein kalter Morgen im Vorfrühling, auf dem Boden lag noch Schnee, aber Lloyd saß ohne Jacke auf den Türstufen.
»Guten Morgen«, sagte er mit lauter, sarkastischer, höflicher Stimme. Und sie sagte auch guten Morgen, mit einer Stimme, die so tat, als habe sie seine nicht wahrgenommen.
Er rückte nicht zur Seite, um sie die Stufen hochzulassen.
»Du kannst da nicht rein«, sagte er.
Sie beschloss, das auf die leichte Schulter zu nehmen.
»Nicht mal, wenn ich bitte sage? Bitte.«
Er sah sie an, antwortete aber nicht. Er lächelte mit geschlossenem Mund.
»Lloyd?«, fragte sie. »Lloyd?«
»Geh lieber nicht rein.«
»Ich hab ihr nichts gesagt, Lloyd. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich brauchte wahrscheinlich einfach Luft zum Atmen.«
»Geh nicht rein.«
»Was ist denn mit dir los? Wo sind die Kinder?«
Er schüttelte den Kopf, wie er es tat, wenn sie etwas sagte, was er nicht gerne hörte. Etwas ein bisschen Ungehöriges wie »Scheißmist«.
»Lloyd! Wo sind die Kinder?«
Er rückte ein wenig, damit sie vorbeikonnte, wenn sie wollte.
Dimitri noch in seiner Wiege, auf der Seite liegend. Barbara Ann auf dem Boden neben ihrem Bett, als sei sie aufgestanden oder herausgeholt worden. Sasha an der Küchentür – er hatte versucht, wegzulaufen. Er war der einzige mit blauen Flecken an der Kehle. Für die anderen hatte ein Kissen genügt.
»Als ich gestern Abend anrief, ja?«, sagte Lloyd. »Als ich anrief, war es schon passiert.«
»Du hast dir das alles selbst zuzuschreiben«, sagte er.
Das Urteil lautete, dass er geisteskrank und nicht schuldfähig sei. Geisteskrank und gemeingefährlich – so dass er in einer geschlossenen Anstalt untergebracht werden musste.
Doree war aus dem Haus gerannt und im Hof herumgetaumelt, die Arme fest vor dem Bauch verschränkt, als sei sie aufgeschnitten worden und müsse alles zusammenhalten. Das war die Szene, die Maggie sah, als sie zurückkam. Sie hatte eine Vorahnung gehabt und auf der Straße kehrtgemacht. Ihr erster Gedanke war, dass Doree von ihrem Mann einen Schlag oder einen Fußtritt in den Bauch erhalten hatte. Mit den Lauten, die Doree von sich gab, konnte sie nichts anfangen. Aber Lloyd, der immer noch auf den Stufen saß, rückte höflich für sie beiseite, ohne ein Wort, und sie ging ins Haus und fand das, was sie inzwischen nicht anders erwartete. Sie rief die Polizei.
Eine Zeitlang stopfte sich Doree alles in den Mund, was sie zu fassen bekam. Nach der Erde und dem Gras waren es Laken oder Handtücher oder ihre eigene Kleidung. Als versuche sie, nicht nur die Schreie zu ersticken, die in ihr aufstiegen, sondern auch die Szene in ihrem Kopf. Sie bekam regelmäßig eine Spritze mit etwas, um sie ruhigzustellen, und das wirkte. Sie wurde sogar sehr ruhig, wenn auch nicht katatonisch. Es hieß, sie sei stabilisiert. Als sie aus der Klinik entlassen wurde, brachte eine Sozialarbeiterin sie an diesen neuen Ort, und dann übernahm Mrs Sands, besorgte ihr eine Wohnung, besorgte ihr einen Arbeitsplatz und machte es zur Regel, sich einmal in der Woche mit ihr zu unterhalten. Maggie wäre gekommen, um sie zu besuchen, aber sie war die einzige Person, deren Anblick Doree nicht ertragen konnte. Mrs Sands sagte, dieses Gefühl sei ganz natürlich – das sei die gedankliche Verbindung. Sie sagte, Maggie werde das verstehen.
Mrs Sands sagte, es sei Dorees Entscheidung, Lloyd weiterhin zu besuchen oder nicht. »Wissen Sie, ich bin nicht hier, um das zu billigen oder zu missbilligen. Haben Sie sich gut dabei gefühlt, ihn zu sehen? Oder schlecht?«
»Weiß ich nicht.«
Doree konnte nicht erklären, dass sie den Eindruck gehabt hatte, gar nicht ihn selbst zu sehen. Sondern eher ein Gespenst. Ganz ausgeblichen. Mit ausgeblichenen, zu weiten Sachen an, mit Schuhen an den Füßen, die kein Geräusch machten – wahrscheinlich Hausschuhe. Seine Haare kamen ihr viel dünner vor. Seine dichten, lockigen, honigfarbenen Haare. Die Schultern – gar nicht mehr so breit, keine Höhlung mehr am Schlüsselbein, an die sie früher den Kopf gelehnt hatte.
Was er hinterher der Polizei gesagt hatte – es wurde in den Zeitungen abgedruckt –, das war: »Ich habe es getan, um ihnen das Leid zu ersparen.«
»Welches Leid?«
»Das Leid, zu wissen, dass ihre Mutter sie verlassen hat«, sagte er.
Das hatte sich Doree ins Gehirn gebrannt, und als sie beschloss, ihn zu besuchen, geschah es vielleicht aus dem Gedanken heraus, ihn dazu zu bringen, dass er das zurücknahm. Dass er einsah und zugab, wie es wirklich gewesen war.
»Du hast zu mir gesagt, ich soll aufhören, dir zu widersprechen, oder ich soll das Haus verlassen. Also hab ich das Haus verlassen.«
»Ich bin nur für eine Nacht zu Maggie gegangen. Ich hatte die feste Absicht zurückzukommen. Ich habe niemanden im Stich gelassen.«
Sie erinnerte sich genau daran, wie der Streit angefangen hatte. Sie hatte eine Dose Spaghetti gekauft, die ganz leicht eingedellt war. Deswegen war sie billiger, und Doree hatte sich noch über ihre Sparsamkeit gefreut. Sie hatte gemeint, etwas Schlaues zu tun. Aber das sagte sie ihm nicht, als er anfing, sie deswegen auszufragen. Aus irgendeinem Grund hielt sie es für besser, so zu tun, als sei ihr die Delle gar nicht aufgefallen.
Die wäre jedem aufgefallen, sagte er. Das hätte sie alle vergiften können. Was war denn mit ihr los? Oder hatte sie genau das vorgehabt? Hatte sie geplant, das an den Kindern auszuprobieren oder an ihm?
Sie hatte erwidert, er sei ja verrückt.
Er hatte erwidert, nicht er sei verrückt. Wer außer einer verrückten Frau würde für seine Familie Gift kaufen?
Die Kinder hatten von der Wohnzimmertür aus zugeschaut. Das war das letzte Mal, dass sie die Kinder lebend sah.
War es das, was sie dachte – dass sie ihn dazu bringen konnte, schließlich einzusehen, wer eigentlich verrückt war?
Als ihr klarwurde, was ihr im Kopf herumging, hätte sie aus dem Bus aussteigen sollen. Sie hätte sogar noch am Tor kehrtmachen können, als sie mit den wenigen anderen Frauen ausstieg, die dann die Auffahrt hinaufstiefelten. Sie hätte über die Straße gehen und auf den Bus zurück in die Stadt warten können. Wahrscheinlich machten einige das auch. Nahmen sich vor, jemanden zu besuchen, und entschieden sich dann dagegen. Wahrscheinlich geschah so etwas andauernd.
Aber vielleicht war es besser, dass sie ihren Weg fortgesetzt und ihn so fremd und verfallen gesehen hatte. Kein Mensch, dem man alle Schuld geben konnte. Kein richtiger Mensch. Eher wie jemand in einem Traum.
Sie hatte wieder Träume. In einem war sie aus dem Haus gerannt, nachdem sie die Kinder gefunden hatte, und Lloyd hatte angefangen, auf seine alte, lockere Art zu lachen, dann hatte sie Sasha hinter sich lachen gehört, und dann hatte sie zum Glück erkannt, dass ihr alle nur einen Streich spielten.
»Sie haben mich gefragt, ob ich mich gut oder schlecht dabei gefühlt habe, ihn zu besuchen. Letztes Mal haben Sie mich danach gefragt.«
»Ja, stimmt«, sagte Mrs Sands.
»Ich musste darüber nachdenken.«
»Ja.«
»Ich finde inzwischen, ich habe mich schlecht dabei gefühlt. Also bin ich nicht wieder hingefahren.«
Bei Mrs Sands ließ sich das schwer sagen, aber ihr Kopfnicken schien Zustimmung anzudeuten.
Als Doree dann beschloss, doch wieder hinzufahren, fand sie daher, es sei besser, nichts davon zu erzählen. Und weil es ihr schwerfiel, nicht alles zu erzählen, was sich in ihrem Leben ereignete – da es meistens so wenig war –, rief sie an und sagte ihren Termin ab. Sie sagte, sie fahre in Urlaub. Es war inzwischen Sommer und Urlaub, also ganz normal. Mit einer Freundin, sagte sie.
»Du hast eine andere Jacke an als vorige Woche.«
»Das war nicht vorige Woche.«
»Nein?«
»Das war vor drei Wochen. Jetzt ist es draußen warm. Diese ist dünner, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Man braucht überhaupt keine Jacke.«
Er fragte sie nach der Fahrt, nach den Bussen, die sie von Mildmay aus hatte nehmen müssen.
Sie erzählte ihm, dass sie nicht mehr dort wohne. Sie erzählte ihm, wo sie jetzt wohnte, auch von den drei Bussen.
»Das ist ja eine ganz schön weite Fahrt für dich. Gefällt es dir, in einem größeren Ort zu wohnen?«
»Da findet man leichter Arbeit.«
»Du arbeitest also?«
Sie hatte ihm schon beim vorigen Besuch erzählt, wo sie wohnte, mit welchen Bussen sie fuhr, wo sie arbeitete.
»Ich mache die Zimmer in einem Motel sauber«, sagte sie. »Das hab ich dir schon erzählt.«
»Ach, ja. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Denkst du je daran, wieder zur Schule zu gehen? Zur Abendschule?«
Sie sagte, dass sie daran denke, aber nie ernsthaft genug, um etwas zu unternehmen. Sie sagte, dass diese Arbeit ihr nichts ausmache.
Dann schien es, als falle beiden nichts mehr ein.
Er seufzte. Er sagte: »Entschuldigung. Ich bin’s wohl nicht mehr gewohnt, mich mit jemandem zu unterhalten.«
»Was machst du so die ganze Zeit?«
»Na ja, ich lese eine Menge. Und meditiere. So formlos.«
»Ach.«
»Ich weiß es zu schätzen, dass du herkommst. Das bedeutet mir viel. Aber du sollst nicht denken, dass du damit weitermachen musst. Ich meine, nur, wenn du Lust hast. Komm einfach, wenn du Lust hast. Wenn irgendwas dazwischenkommt, oder wenn dir nicht danach ist … Ich will sagen, allein die Tatsache, dass du überhaupt gekommen bist, dass du auch nur einmal gekommen bist, das ist für mich ein Geschenk. Verstehst du, was ich meine?«
Sie sagte, ja, sie glaube schon.
Er sagte, dass er sich nicht in ihr Leben einmischen wolle.
»Das tust du nicht«, sagte sie.
»Wolltest du genau das sagen? Ich dachte, du wolltest etwas anderes sagen.«
Tatsächlich hätte sie beinahe gefragt: »In welches Leben?«
»Nein,« sagte sie, »Eigentlich nicht, nichts anderes.«
»Gut.«
Drei Wochen später erhielt sie einen Anruf. Es war Mrs Sands, sie war selbst am Apparat, nicht eine der Frauen in ihrem Büro.
»Ach, Doree. Ich dachte, vielleicht sind Sie noch gar nicht zurück. Von Ihrem Urlaub. Sie sind also wieder da?«
»Ja«, sagte Doree und überlegte, was sie sagen könne, wo sie gewesen sei.
»Aber Sie sind noch nicht dazu gekommen, einen neuen Termin zu vereinbaren?«
»Nein. Noch nicht.«
»Schon gut. Ich wollte nur sichergehen. Geht es Ihnen gut?«
»Ja.«
»Schön. Sie wissen ja, wo ich bin, wenn Sie mich je brauchen. Je mal reden wollen.«
»Ja.«
»Also passen Sie auf sich auf.«
Sie hatte Lloyd nicht erwähnt, hatte nicht gefragt, ob die Besuche weitergegangen waren. Sicher, Doree hatte ihr ja gesagt, dass sie nicht weitergehen würden. Aber Mrs Sands konnte meistens ziemlich gut spüren, was wirklich vorging. Und sich auch ziemlich gut zurückhalten, wenn sie merkte, dass eine Frage sie nicht weiterbringen würde. Doree wusste nicht, was sie gesagt hätte, wenn sie gefragt worden wäre – ob sie ihr eine Lüge aufgetischt hätte oder mit der Wahrheit herausgerückt wäre. Tatsächlich war sie gleich am nächsten Sonntag wieder hingefahren, nachdem er ihr mehr oder weniger gesagt hatte, dass es nicht wichtig war, ob sie kam oder nicht.
Er hatte eine Erkältung. Er wusste nicht, wie er sich die geholt hatte.
Vielleicht hatte die bei ihrem letzten Besuch schon in ihm gesteckt, sagte er, und deshalb war er neulich so verdrossen.
»Verdrossen.« Sie hatte inzwischen selten mit jemandem zu tun, der solch ein Wort benutzte, und es klang für sie fremd. Aber er hatte schon immer die Gewohnheit gehabt, solche Wörter zu benutzen, und es hatte eine Zeit gegeben, da waren sie für sie nicht so gewesen wie jetzt.
»Komme ich dir wie ein anderer Mensch vor?«, fragte er.
»Na ja, du siehst anders aus«, sagte sie vorsichtig. »Ich nicht auch?«
»Du siehst schön aus«, sagte er traurig.
Etwas in ihr wurde weich. Aber sie kämpfte dagegen an.
»Fühlst du dich anders?«, fragte er. »Fühlst du dich wie ein anderer Mensch?«
Sie sagte: »Weiß nicht. Und du?«
Er sagte: »Völlig.«
Ein paar Tage später wurde ihr bei der Arbeit ein großer Umschlag übergeben. Er war an sie adressiert, mit der Anschrift des Motels. Er enthielt mehrere Bögen Briefpapier, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Anfangs kam sie gar nicht auf die Idee, dass er von ihm war – irgendwie hatte sie die Vorstellung, dass Leute im Gefängnis keine Briefe schreiben durften. Aber er war natürlich eine andere Sorte Häftling. Er war kein Verbrecher; nur ein gemeingefährlicher Geisteskranker.
Das Schriftstück trug kein Datum und nicht einmal ein »Liebe Doree«. Es fing einfach an, zu ihr zu sprechen, und zwar derart, dass sie dachte, es müsse sich um eine Art religiöse Einladung handeln:
Die Menschen suchen überall nach der Lösung. Ihre Gehirne sind wund (vom Suchen). So viele Dinge, die drängeln und ihnen weh tun. Man kann in ihren Gesichtern ihre Prellungen und ihre Schmerzen sehen. Sie sind voller Sorgen. Sie hasten umher. Sie müssen einkaufen gehen und in den Waschsalon und sich die Haare schneiden lassen und ihren Lebensunterhalt verdienen oder sich ihren Sozialhilfescheck abholen. Die Armen müssen das tun, und die Reichen müssen sorgfältig nach den besten Möglichkeiten suchen, ihr Geld auszugeben. Das ist auch Arbeit. Sie müssen die besten Häuser bauen mit goldenen Wasserhähnen für ihr warmes und kaltes Wasser. Und ihre Audis und elektrischen Zahnbürsten und alle möglichen Geräte und dann Alarmanlagen gegen Mord und Totschlag, und ringsum hat niemand, ob reich oder arm, irgend Frieden in der Seele. Ich wollte »Nachbar« statt »niemand« schreiben, warum nur? Ich habe hier keinen Nachbarn. Da, wo ich bin, haben die Menschen wenigstens schon viel Verwirrung hinter sich gelassen. Sie wissen, welches ihre Besitztümer sind und immer sein werden, und sie müssen sich nicht mal ihr eigenes Essen kaufen oder kochen. Oder auswählen. Auswahl gibt es hier nicht.
Alles, was wir, die wir hier sind, bekommen können, ist das, was wir aus unserem eigenen Geist bekommen können.
Am Anfang war alles in meinem Kopf Tohuwabohu. Es herrschte unablässig Sturm, und ich schlug immer wieder den Kopf gegen Zement in der Hoffnung, ihn loszuwerden. Meiner Qual und meinem Leben ein Ende zu machen. So wurden Strafen zugemessen. Ich wurde mit kaltem Wasser abgespritzt und gefesselt und bekam Drogen in die Blutbahn. Ich beklage mich auch gar nicht, denn ich musste lernen, dass darin kein Nutzen liegt. Es unterscheidet sich auch gar nicht von der sogenannten wirklichen Welt, in der die Menschen trinken und es treiben und Verbrechen begehen, um ihre Gedanken, die schmerzhaft sind, auszuschalten. Und oft werden sie gefangen und eingekerkert, aber nicht lange genug, damit sie auf der anderen Seite herauskommen. Und die ist? Entweder völliger Wahnsinn oder Frieden.
Frieden. Ich bin zu Frieden gelangt und immer noch bei Verstand. Ich vermute, wenn Du das jetzt liest, denkst Du, dass ich etwas über Jesus Christus oder auf jeden Fall Buddha sagen werde, als hätte ich mich zu irgendeinem Glauben bekehrt. Nein. Ich schließe nicht die Augen und werde dann von einer bestimmten Höheren Macht emporgetragen. Ich weiß wirklich nicht, was mit all dem gemeint ist. Alles, was ich tue, ist: Erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst ist irgendein Gebot von irgendwoher, wahrscheinlich aus der Bibel, also bin ich vielleicht wenigstens darin dem Christentum gefolgt. Auch: Sei dir selber treu – auch das habe ich versucht, falls es in der Bibel steht. Es besagt nicht, welchen Teilen – den bösen oder den guten – man treu bleiben soll, es ist also nicht als Richtschnur für die Moral gemeint. Erkenne dich selbst bezieht sich ebenfalls nicht auf die Moral, wie wir sie im Verhalten kennen. Aber das Verhalten ist eigentlich nicht mein Anliegen, denn ich bin völlig zu Recht als Person verurteilt worden, die nicht richtig beurteilen kann, wie sie sich verhalten muss, und deshalb bin ich hier.
Zurück zum Erkennen in Erkenne dich selbst. Ich kann völlig ernsthaft behaupten, dass ich mich selbst kenne, und ich kenne sogar das Schlimmste, dessen ich fähig bin, und ich weiß, ich habe es getan. Ich werde von der Welt als Ungeheuer verurteilt, und ich hadere nicht damit, obwohl ich nebenbei sagen könnte, dass Männer, die Bomben abwerfen oder Städte niederbrennen oder Hunderttausende von Menschen aushungern und ermorden, nicht allgemein für Ungeheuer gehalten werden, sondern mit Medaillen und Ehrungen überhäuft werden, nur Taten gegen einige wenige werden für schockierend und böse gehalten. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Beobachtung.
Was ich in mir selbst erkenne, ist mein eigenes Böses. Das ist das Geheimnis meiner Ruhe. Ich meine, ich kenne mein Schlimmstes. Es mag schlimmer sein als das Schlimmste anderer Menschen, aber darüber brauche ich mir nicht den Kopf zu zerbrechen. Keine Entschuldigungen. Ich habe Frieden gefunden. Bin ich ein Ungeheuer? Die Welt sagt es, und wenn alle das sagen, dann stimme ich zu. Aber dann sage ich, die Welt hat für mich eigentlich keine Bedeutung. Ich bin ich selbst und habe keine Möglichkeit, ein anderes Selbst zu sein. Ich könnte sagen, dass ich damals verrückt war, aber was bedeutet das? Verrückt. Normal. Ich bin ich. Ich konnte mein Ich damals nicht ändern, und ich kann es heute nicht ändern.
Doree, falls Du bis hierher gelesen hast, es gibt eine besondere Sache, von der ich Dir erzählen möchte, die ich aber nicht niederschreiben kann. Wenn Du je daran denkst, wieder herzukommen, kann ich es Dir sagen. Halte mich nicht für herzlos. Nicht, dass ich die Dinge nicht ändern würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht.
Ich schicke das an Deinen Arbeitsplatz, denn an den und den Namen der Stadt erinnere ich mich, mein Gehirn funktioniert also in mancher Hinsicht gut.
Sie dachte, sie würde bei ihrem nächsten Besuch über dieses Schreiben mit ihm reden müssen, und las es sich mehrmals durch, aber ihr fiel nichts dazu ein. Worüber sie eigentlich reden wollte, das war das, was sich angeblich nicht niederschreiben ließ. Doch als sie ihn dann wiedersah, benahm er sich, als hätte er ihr überhaupt nicht geschrieben. Sie suchte nach einem Gesprächsthema und erzählte ihm von dem früher mal berühmten Folk-Sänger, der in dieser Woche im Motel übernachtet hatte. Überraschenderweise wusste er über die Karriere dieses Sängers mehr als sie. Es stellte sich heraus, dass er einen Fernseher hatte oder zumindest Zugang zu einem und sich einige Shows ansah und natürlich regelmäßig die Nachrichten. Das gab ihnen ein bisschen Gesprächsstoff, bis sie nicht mehr anders konnte.
»Was ist nun die Sache, die du mir nur persönlich sagen kannst?«
Er sagte, es sei ihm lieber, sie hätte ihn nicht gefragt. Er wisse nicht, ob sie schon so weit seien, darüber zu reden.
Da bekam sie Angst, es sei etwas, womit sie nicht fertig werden konnte, etwas Unerträgliches, wie dass er sie immer noch liebte. »Liebe« war ein Wort, das sie absolut nicht hören konnte.
»Gut«, sagte sie. »Vielleicht sind wir ja noch nicht so weit.«
Dann sagte sie: »Trotzdem, besser, du sagst es mir. Wenn ich heute hier rausgehe und von einem Auto überfahren werde, dann werd ich’s nie erfahren, und du wirst keine Gelegenheit mehr haben, es mir zu sagen.«
»Stimmt«, sagte er.
»Also was ist es?«
»Nächstes Mal. Nächstes Mal. Manchmal kann ich nicht mehr reden. Ich möchte schon, aber mir gehen einfach die Worte aus.«
Ich habe ständig an Dich gedacht, seitdem Du mich verlassen hast, Doree, und es tut mir leid, dass ich Dich enttäuscht habe. Wenn Du mir gegenübersitzt, überkommen mich mehr Gefühle, als ich vielleicht zeige. Ich habe kein Recht, vor Dir Gefühle zu zeigen, da Du bestimmt mehr Recht darauf hast als ich, und Du bist immer sehr beherrscht. Also werde ich widerrufen, was ich geschrieben habe, denn ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich Dir besser schreiben als mit Dir reden kann.
Wo fange ich also an?
Den Himmel gibt es wirklich.
Das ist eine Möglichkeit, aber nicht richtig, denn ich habe nie an Himmel und Hölle usw. geglaubt. Für mich war das immer ein Haufen dummes Zeug. Also muss es sich ziemlich komisch anhören, wenn ich jetzt davon anfange.
So werde ich nur sagen: Ich habe die Kinder gesehen.
Ich habe sie gesehen und mit ihnen gesprochen.
So. Was denkst Du jetzt? Du denkst, jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Oder, es ist ein Traum, und er merkt nicht, dass es ein Traum ist, er erkennt nicht den Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit. Aber ich möchte dir sagen, ich kenne den Unterschied, und was ich weiß, ist, sie existieren. Ich sage, sie existieren, nicht, sie leben, denn leben heißt, in unserer speziellen Dimension, und ich sage nicht, dass sie darin sind. Ich denke sogar, sie sind es nicht. Aber sie existieren wirklich, und es muss so sein, dass es noch eine andere Dimension gibt oder vielleicht unzählige Dimensionen, aber was ich weiß, ist, dass ich zu derjenigen, in der sie sind, Zugang erlangt habe. Vielleicht bin ich dazu gekommen, weil ich so viel allein bin und immer nachdenken muss, mit so viel zum Nachdenken. Es gibt also eine Gnade, die nach so viel Leiden und Einsamkeit einen Weg gefunden hat, mir diese Belohnung zu geben. Ausgerechnet mir, der dies nach Meinung der Welt am wenigsten verdient.
Wenn Du das bis hierher gelesen und noch nicht zerrissen hast, wirst Du bestimmt etwas wissen wollen. Zum Beispiel, wie es ihnen geht.
Es geht ihnen gut. Sie sind wirklich glücklich und vergnügt. Sie scheinen keine Erinnerung an irgendetwas Schlimmes zu haben. Sie sind vielleicht ein bisschen älter, als sie waren, aber das lässt sich schwer sagen. Sie scheinen auf verschiedenem Niveau zu verstehen. Ja. Man kann bei Dimitri merken, dass er sprechen gelernt hat, was er noch nicht konnte. Sie sind in einem Zimmer, das ich teilweise erkennen kann. Es ist wie unser Haus, nur geräumiger und schöner. Ich habe sie gefragt, wie sie versorgt werden, und sie haben mich nur ausgelacht und so in etwa gesagt, sie könnten sich selbst versorgen. Ich glaube, es war Sasha, der das gesagt hat. Manchmal reden sie durcheinander, oder wenigstens kann ich ihre Stimmen nicht voneinander trennen, aber ihre Wesen sind ganz deutlich und, muss ich sagen, fröhlich.
Bitte schließ daraus nicht, dass ich verrückt bin. Aus Angst davor wollte ich Dir nichts davon sagen. Ich war früher mal verrückt, aber glaube mir, ich habe meinen alten Wahnsinn abgeworfen, wie der Bär sein Winterfell abwirft. Oder vielleicht sollte ich sagen, wie eine Schlange ihre alte Haut abwirft. Ich weiß, wenn ich das nicht getan hätte, wäre mir nie diese Fähigkeit verliehen worden, mit Sasha und Barbara Ann und Dimitri wieder in Verbindung zu treten. Jetzt wünsche ich, dass auch Du die Gelegenheit dazu erhältst, denn Du verdienst es weitaus mehr als ich. Es mag Dir schwerer fallen, weil Du viel mehr als ich in der Welt lebst, aber wenigstens kann ich Dir dies mitteilen – die Wahrheit – und Dir sagen, ich habe sie gesehen, in der Hoffnung, dass es Dir das Herz leichter macht.
Doree überlegte, was Mrs Sands wohl sagen oder denken würde, wenn sie diesen Brief las. Mrs Sands würde natürlich vorsichtig sein. Sie würde sich hüten, ihn rundheraus für verrückt zu erklären, aber sie würde Doree behutsam und freundlich in diese Richtung lenken.
Oder man könnte auch sagen, nicht in diese Richtung lenken, sondern einfach die Unklarheit beseitigen, so dass Doree schließlich mit etwas dastehen würde, dass so aussah, als sei es von Anfang an ihre eigene Überzeugung gewesen. Sie würde den ganzen gefährlichen Unsinn – hier sprach Mrs Sands – aus ihrem Kopf verbannen müssen.
Deshalb machte Doree einen weiten Bogen um sie.
Dabei war Doree selbst der Meinung, dass er verrückt war. Und in dem, was er geschrieben hatte, fand sie einen Rest von der alten Prahlerei. Sie antwortete ihm nicht. Tage vergingen. Wochen. Sie änderte ihre Meinung nicht, aber sie hielt an dem, was er geschrieben hatte, immer fest, wie an einem Geheimnis. Und von Zeit zu Zeit, wenn sie gerade dabei war, einen Badezimmerspiegel einzusprühen oder ein Laken glattzuziehen, überkam sie ein Gefühl. Fast zwei Jahre lang hatte sie keinerlei Notiz von den Dingen genommen, die Menschen im Allgemeinen glücklich machen, wie schönes Wetter oder blühende Blumen oder der Geruch einer Bäckerei. Sie verspürte immer noch nicht dieses spontane Glücksgefühl, aber doch eine leise Erinnerung daran. Es hatte nichts mit dem Wetter oder mit Blumen zu tun. Es war die Vorstellung von den Kindern in dem, was er ihre Dimension genannt hatte, die in ihr aufkam und sie zum ersten Mal ein wenig aufrichtete, statt ihr weh zu tun.
In der ganzen Zeit seit dem Geschehnis war jeder Gedanke an die Kinder etwas gewesen, das sie sofort entfernen, herausreißen musste, wie ein Messer in der Kehle. Sie konnte ihre Namen nicht denken, und wenn sie einen Namen hörte, der wie einer der ihren klang, dann musste sie auch den herausreißen. Sogar Kinderstimmen, ihre Schreie und das Patschen ihrer Füße, wenn sie zum Swimmingpool des Motels rannten, mussten von einer Art Tür verbannt werden, die sie hinter ihren Ohren zuschlagen konnte. Doch anders als bisher hatte sie jetzt eine Zuflucht, in die sie sich retten konnte, wenn solche Gefahren irgendwo um sie herum auftraten.
Und wer hatte ihr die gegeben? Nicht Mrs Sands – soviel war sicher. Nicht in all den Stunden, in denen sie neben ihren Schreibtisch gerückt war, immer mit den Kleenex diskret zur Hand.
Lloyd hatte sie ihr gegeben. Lloyd, dieser schreckliche Mensch, dieser isolierte und wahnsinnige Mensch.
Wahnsinnig, wenn man es so nennen wollte. Aber war es nicht möglich, dass stimmte, was er sagte – dass er tatsächlich auf der anderen Seite herausgekommen war? Und wer wollte sagen, dass die Visionen eines Menschen, der so etwas getan und solch eine Reise zurückgelegt hatte, nicht etwas bedeuten konnten?
Dieser Gedanke schlängelte sich in ihren Kopf und blieb dort.
Zusammen mit der Überlegung, dass von allen Menschen Lloyd der eine sein könnte, mit dem sie jetzt zusammen sein sollte. Wie anders konnte sie auf der Welt von Nutzen sein – sie schien das zu jemandem zu sagen, wahrscheinlich zu Mrs Sands –, wozu war sie sonst da, wenn nicht, um ihm wenigstens zuzuhören?
Ich habe nicht gesagt, »um ihm zu verzeihen«, sagte sie im Kopf zu Mrs Sands. Das würde ich nie sagen. Das würde ich nie tun.
Doch andererseits. Bin ich durch das, was geschehen ist, nicht ebenso von allem abgeschnitten wie er? Niemand, der davon weiß, würde mich um sich haben wollen. Was ich auch tue, es erinnert andere an etwas, woran niemand erinnert werden will.
Eine Maskierung war eigentlich gar nicht möglich. Diese gelbe Dornenkrone war zu nichts zu gebrauchen.
Also saß sie wieder im Bus und war auf dem Highway unterwegs. Sie erinnerte sich an die Nächte unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter, als sie sich hinausstahl, um sich mit Lloyd zu treffen, und der Freundin ihrer Mutter, der Frau, bei der sie wohnte, etwas vorlog, wo sie hingehe. Sie erinnerte sich an den Namen der Freundin, der Freundin ihrer Mutter. Laurie.
Wer außer Lloyd konnte sich inzwischen an die Namen der Kinder erinnern oder an die Farbe ihrer Augen? Mrs Sands nannte sie, wenn sie sie erwähnen musste, nicht einmal »die Kinder«, sondern »Ihre Familie«, und warf sie alle zusammen in einen Topf.
Als sie sich damals mit Lloyd treffen wollte und Laurie belog, hatte sie kein Schuldgefühl gehabt, nur ein Gefühl von Bestimmung, Unterwerfung. Als sei sie zu keinem anderen Zweck auf die Welt gekommen, als mit ihm zusammen zu sein und ihn zu verstehen.
So war es jetzt nicht mehr. Es war nicht dasselbe.
Sie saß auf dem vordersten Sitz rechts vom Fahrer. Sie hatte klare Sicht durch die Windschutzscheibe. Und deshalb war sie der einzige Fahrgast im Bus, die einzige Person außer dem Fahrer, die sah, wie ein Pick-up, ohne zu verlangsamen, aus einer Nebenstraße kam, vor ihnen über den leeren Sonntagmorgen-Highway donnerte und in den Straßengraben stürzte. Und die noch etwas Seltsameres sah: Der Fahrer des Pritschenwagens segelte durch die Luft, er flog schnell und langsam zugleich, absurd und trotzdem elegant. Er landete in dem Kies am Rand der Fahrbahn.
Die anderen Fahrgäste wussten nicht, warum der Fahrer auf die Bremse getreten war und so abrupt und unangenehm gehalten hatte. Und anfangs dachte Doree nur: Wie ist er rausgekommen? Dieser junge Mann oder Junge, der am Steuer eingeschlafen sein musste. Wie war es ihm gelungen, aus der Kabine zu fliegen und sich so graziös in die Luft zu werfen?
»Ein Kerl direkt vor uns«, sagte der Fahrer zu seinen Fahrgästen. Er versuchte, laut und ruhig zu sprechen, aber in seiner Stimme lag ein Zittern vor Schreck, etwas wie Ehrfurcht. »Ist eben über die Straße gepflügt und in den Graben. Wir fahren so bald wie möglich weiter, und in der Zwischenzeit steigen Sie bitte nicht aus dem Bus.«
Als habe sie das nicht gehört oder als habe sie ein besonderes Recht, sich nützlich zu machen, stieg Doree hinter ihm aus. Er tadelte sie nicht.
»Verdammtes Arschloch«, sagte er, als sie die Straße überquerten, und in seiner Stimme lagen jetzt nur Verärgerung und Wut. »Verdammter Scheißbengel, ist das zu fassen?«
Der Junge lag auf dem Rücken, Arme und Beine ausgestreckt, wie jemand, der einen Engel im Schnee macht. Nur, dass Kies um ihn lag, nicht Schnee. Seine Augen waren nicht ganz geschlossen. Ein junges Bürschchen, das hoch aufgeschossen war, noch bevor es sich rasieren musste. Wahrscheinlich ohne Führerschein.
Der Fahrer sprach jetzt in sein Telefon.
»Etwa eine Meile südlich von Bayfield, auf der östlichen Seite vom Highway 21.«
Ein Rinnsal aus rosa Schaum lief unter dem Kopf des Jungen hervor, dicht bei seinem Ohr. Es sah gar nicht wie Blut aus, sondern wie der Schaum, den man von Erdbeeren beim Marmeladekochen abschöpft.
Doree hockte sich neben ihn. Sie legte die Hand auf seine Brust. Die sich nicht regte. Sie beugte das Ohr hinunter. Jemand hatte vor kurzem sein Hemd gebügelt – es hatte diesen Geruch.
Keine Atmung.
Aber ihre Finger auf seinem glatten Hals fanden einen Puls.
Ihr fiel etwas ein, was jemand ihr gesagt hatte. Lloyd hatte es ihr gesagt, falls eines der Kinder einen Unfall hatte und er nicht da war. Die Zunge. Die Zunge kann die Atmung blockieren, wenn sie in den Gaumen zurückgerutscht ist. Sie legte eine Hand auf die Stirn des Jungen und die andere unter sein Kinn. Drück die Stirn runter und das Kinn hoch, um den Luftweg frei zu machen. Ein kurzer, fester Ruck.
Wenn er dann immer noch nicht atmete, musste sie ihn beatmen.
Sie hält sich die Nase zu, holt tief Luft, drückt ihre Lippen auf seinen Mund und pustet. Zweimal pusten und Pause. Zweimal pusten und Pause.
Eine andere Männerstimme, nicht die des Busfahrers. Ein Autofahrer musste angehalten haben. »Wollen Sie ihm die Decke unter den Kopf legen?« Sie schüttelte kurz den Kopf. Ihr war noch etwas eingefallen, nämlich, das Opfer nicht zu bewegen, damit man die Wirbelsäule nicht verletzte. Sie stülpte ihren Mund über seinen. Drückte ihn auf seine warme, frische Haut. Sie pustete und wartete. Pustete und wartete wieder. Und ein Hauch von Feuchtigkeit schien ihr ins Gesicht zu steigen.
Der Busfahrer sagte etwas, aber sie konnte nicht hochsehen. Dann spürte sie es deutlich. Ein Atemzug aus dem Mund des Jungen. Sie legte ihre gespreizte Hand auf seine Brust, und anfangs merkte sie nicht, ob sie sich hob und senkte, weil sie selbst so zitterte.
Doch. Doch.
Es war ein richtiger Atemzug. Der Luftweg war frei. Er atmete selbständig. Er atmete.
»Legen Sie ihm die einfach über«, sagte sie zu dem Mann mit der Decke. »Um ihn zu wärmen.«
»Lebt er?«, fragte der Busfahrer, über sie gebeugt.
Sie nickte. Ihre Finger fanden wieder den Puls. Der schreckliche rosa Schaum floss nicht mehr. Vielleicht war es nichts Schlimmes. Nichts aus seinem Gehirn.