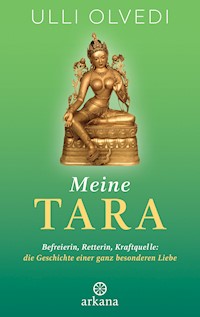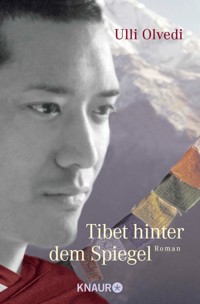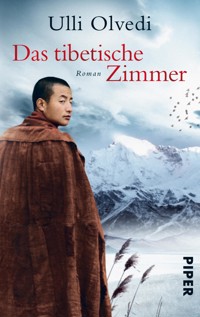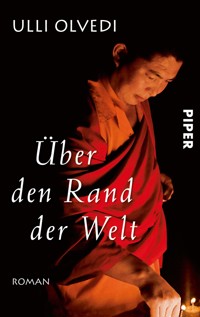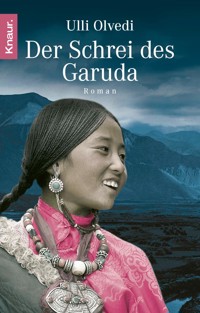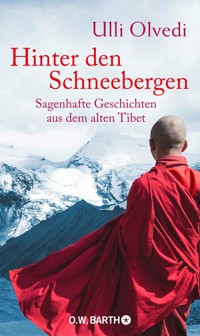
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Bestsellerautorin Ulli Olvedi erzählt außergewöhnliche Geschichten, Märchen und Fabeln aus dem alten Tibet. Manche der Kapitel mögen an die Gebrüder Grimm, andere wiederum an Äsops Fabeln erinnern, und andere wieder können es an Frechheit mit dem Decamerone aufnehmen. Doch ob sie zauberisch, drastisch oder unverschämt sind, man findet vor allem den Schalk der Tibeter darin. Dieser begleitet den Leser nicht nur in die exotische Vergangenheit Tibets, sondern führt auch in das fröhliche Herz dieser alten Nomaden-Kultur. Als profunde Kennerin der tibetischen Kultur verwebt Ulli Olvedi die Erzählungen nicht nur thematisch ineinander, sie lässt eigene Erfahrungen und Erkenntnisse einfließen und zeigt uns ihr ganz persönliches Tibet. Die enthaltenen Geschichten eignen sich zum Selber- und zum Vorlesen. Sie bringen uns dem Dach der Welt ein Stückchen näher und lassen uns einsinken in die wundersame Erzähltradition Tibets.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulli Olvedi
Hinter den Schneebergen
Wundersame Geschichten vom Dach der Welt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ulli Olvedi erzählt zahlreiche Märchen, Legenden, Fabeln und Schwänke aus dem tibetischen Kulturraum, vor allem auch aus der alten Zeit vor dem Buddhismus, die im Westen wenig bekannt sind. Manche mögen an die Gebrüder Grimm, andere wiederum an Äsops Fabeln erinnern, und andere wieder können es an Frechheit mit dem Decamerone aufnehmen. Doch ob sie zauberisch, drastisch oder unverschämt sind, man findet vor allem den Schalk der Tibeter darin, und dieser begleitet den Leser nicht nur in die exotische Vergangenheit Tibets, sondern führt auch in das fröhliche Herz dieser alten Nomadenkultur.
Inhaltsübersicht
Prolog
Das alte Tibet
Geschichten aus sehr alter Zeit
Die ersten Tibeter
Pferd und Yak
Gesar von Lings Kindheit
Von Magiern und Untoten
Der Bauernjunge und der Untote
Der Prinz und die sieben Magier
Der Prinz und der Untote
Die drei Schwestern
Wie Prinz und Prinzessin zusammenkamen
Von Dämonen, Naturgeistern und Hexen
Die verführerische Dämonin
Die Mutter, die eine Hexe war
Die zweite Frau
Die böse Stiefmutter
Der mitleidige Musikant
Der Drachentöter
Schlaumeiergeschichten
Der Dummling und die Kluge
Der falsche Lama und der Zimmermann
Der gestohlene Schatz
Tiergeschichten
Der Tiger und der Hase
Das Leck
Der Froschbräutigam
Die Hundebraut
Freche Geschichten
Aku Tompa macht ein gutes Geschäft
Aku Tompa verlangt es nach einer Prinzessin
Aku Tompa zahlt es dem König heim
Künga Legpas gute Absicht
Künga Legpa bringt zu Ende, was er begonnen hat
Lehrgeschichten
Der rote Fürst
Der heilige Zahn
Die Esel-Wiedergeburt
Eule und Fischotter
Glück oder Unglück
Geschichten der Tara
Ursprungsgeschichte der Arya Tara
Tara schickt Schnee
Prolog
Der alte Pemba drückte seine Zigarette aus und schenkte sich Chang, das Bier des alten Tibets, aus einer Plastikflasche nach. Hinter dem Balkon des Mietshauses, in dem er mit seiner Frau lebte, erhoben sich die Vorberge des Himalaja, die das weite Kathmandu-Tal einschließen.
»Es waren die Geschichten, die uns gerettet haben«, sagte er und bekräftigte diese Aussage mit einem tiefen Schluck. Über sein verwittertes Nomadengesicht zog kurz der Schatten eines nie völlig vergangenen Schmerzes. »Die Flucht damals war so lang und so schwer.«
Dreizehn Jahre war er alt, als seine Familie 1959 mit Onkeln und Tanten und mehreren Kindern über den verschneiten Himalaja nach Nepal floh, immer in Angst vor chinesischen Patrouillen und in großer Gefahr, im Schnee oder in Eisstürmen zu erfrieren.
»Wenn wir Glück hatten, fanden wir eine geschützte Stelle zum Übernachten«, erzählte er in seiner langsamen Art. »Am besten unter einem Felsüberhang. Dort rückten wir mit unseren Schlaffellen ganz eng zusammen und bauten uns ein Nest, und dann erzählte unser Papa eine der alten Geschichten. So voller Angst, erschöpft und immer hungrig inmitten dieser wilden Berge, schufen die Geschichten eine andere Welt, die ebenso wichtig zum Überleben war wie unsere Schlaffelle.«
Ein kleines Lächeln erschien in Pembas Augen, die nach innen blickten, zurück in dieses lang vergangene Nest fragiler Geborgenheit.
»Unser Papa war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Er wusste immer, welche Art von Geschichte gerade die richtige war. Manchmal war es eine lange Geschichte, in der viel Aufregendes passierte, manchmal eine kurze, lustige. Wenn es hieß, die Chinesen seien uns auf der Spur, oder wenn uns ein Schneesturm überfiel, hatte er immer eine Geschichte bereit, die uns allen Hoffnung gab. Natürlich war er nicht der Einzige, der Geschichten erzählen konnte, aber er war der Beste. Er erzählte spannend, machte die richtigen Pausen und er konnte die Farben der Geschichten mit seiner Stimme malen.«
Wieder folgte ein sinnendes Schweigen, dann erhellte ein heiteres Schmunzeln sein Gesicht.
»Wir hatten nicht nur Geschichten, die erzählt wurden, manche Geschichten konnte man singen. Beim Wandern, wenn der Weg nicht steil war und keine Gefahr drohte, fing unsere Mama oder eine der Tanten mit einer Liedgeschichte an. Der folgte ein Vers, den alle mitsangen. Wieder trug sie ein Stück der Geschichte vor, und dann sangen wir erneut zusammen den gemeinsamen Vers. Diese Verse kannten alle, auch die Kleinen. Das machte uns fröhlich, selbst dann, wenn es gar keine lustige Geschichte war.«
Er trank sein Glas aus und füllte es erneut aus der Plastikflasche.
»Mmmh, Chang«, sagte er. »Das schmeckt nach Zuhause, nach der Jurte, nach Schaffell und Ziegenkäse und Rauch. Am schönsten war es, wenn ein wandernder Geschichtenerzähler vorbeikam. Dann gab es herrliche dicke Suppen mit viel Trockenfleisch und die Kinder durften tief in den Beutel mit getrockneten Aprikosen greifen. Und wenn es dunkel wurde, kamen Verwandte aus den umliegenden Jurten dazu, denn der Besuch eines Geschichtenerzählers war etwas ganz Besonderes. Da saßen wir alle zusammen, die Gesichter vom Herdfeuer beleuchtet, auf dem Schrein brannte eine Butterlampe und in die erwartungsvollen Stille hinein begann der Geschichtenerzähler: ›Es war einmal vor langer, langer Zeit …‹ Wenn er aber anfing: ›Onkel Tompa war einmal auf Reisen …‹, fingen alle an zu lachen und zu prusten, denn dann wusste jeder, jetzt kommt eine richtig freche Geschichte. Aber Geschichten von Onkel Tompa wurden meistens am Schluss erzählt, wenn die Kinder schon eingeschlafen waren.
Es kam auch vor, dass der Besucher eine Geschichte erzählte, die wir schon kannten, die aber doch ein wenig anders war. Die Geschichten veränderten sich, so, wie Menschen sich mit der Zeit verändern, vor allem wenn sie in weit entfernte Gegenden wandern. Es gefiel uns, wenn die Geschichte ein neues Gewand hatte.
Wenn der Geschichtenerzähler weitergezogen war, war es das Vorrecht unseres Großvaters, am Abend die neuen Geschichten zu erzählen, in derselben Form wie die des Geschichtenerzählers. Und die Frauen sangen beim Kochen und beim Waschen am Fluss die neu gelernten Liedgeschichten. Wenn ich zurückdenke … das war ein wichtiger Teil unseres Lebens.«
Pemba schüttelte eine Zigarette aus seiner Marlboro-Schachtel.
»Ja, so war es«, sagte er nachdenklich. »Der Mensch braucht Geschichten.«
Das alte Tibet
Mit Tibet verbindet man im Allgemeinen – zumindest bis zur Annexion durch die Chinesen – die tibetisch-buddhistische Kultur in einem Land mit festen Landesgrenzen, regiert von buddhistischen »Gottkönigen«, den Dalai Lamas. Doch erst im siebten Jahrhundert wurde Tibet ein von kämpferischen Königen beherrschtes mächtiges Königreich. Bis dahin war das wilde Bergvolk dieses extremen Hochlands lediglich in Clans zusammengeschlossen, aus denen sich die kleinen autonomen Freistaaten in Kham im Osten und Amdo im Nordosten entwickelten. Die Clanführer wurden Gyalpo, Herrscher, genannt und entsprachen etwa den Königen in den europäischen Märchen. Diese Klein-Könige spielen in vielen tibetischen Geschichten eine Rolle.
Die Tibeter lebten vor allem als Nomaden, denn selbst wenn sie in den fruchtbaren Tälern des Südens und Ostens Landwirtschaft betrieben, waren doch die Nutztiere – Yaks, Ziegen und Schafe – ihr wichtigstes Gut, und die brauchten wechselnde Weiden. Die nomadische Lebensform hat die größtmögliche Nähe zur Natur, und so sind sich die Menschen der Macht, der Wohltaten und der Gefahren der Natur bewusst, die sowohl verehrt als auch gefürchtet wird. Wie in allen alten Gesellschaften üblich, haben die tibetischen Nomaden die Natur als mächtiges Du erlebt, mit dem sie eine Beziehung aufnahmen und diese pflegten. Die Kräfte der Natur wurden nicht als abstrakt erlebt, sondern als lebendig, und damit war eine Kommunikation möglich, die wir heute als »Magie« bezeichnen.
In dieser magischen, animistischen Welt des vorbuddhistischen Tibets entstanden viele Geschichten, die noch heute erzählt werden. Es war eine Welt voller Naturgeister und Dämonen, freundlichen und gefährlichen Wesenheiten, die ins alltägliche Leben miteinbezogen werden mussten. Diese Art, der Umwelt zu begegnen, wurde vom Buddhismus, der sich ab dem achten Jahrhundert in Tibet zu verbreiten begann, vor allem von der ältesten Traditionslinie des tibetischen Buddhismus zu einem gewissen Grad integriert und hatte bis zur chinesischen Okkupation Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ihren natürlichen Anteil am tibetischen Alltagsleben.
So ist zum Beispiel der Potala in Lhasa, der im siebzehnten Jahrhundert auf einem Hügel inmitten eines ausgedehnten Flusstals erbaut wurde, eng mit dieser rücksichtsvollen Beziehung zur Natur verknüpft. Für diesen riesigen, burgartigen Palast wurde immens viel Baumaterial gebraucht, das man dem weiten Gelände hinter dem Hügel entnahm. Dadurch entstand ein See, in dessen Mitte man eine Insel aufschüttete und darauf einen wunderschön ausgestatteten kleinen Tempel für die Nagas, die mächtigen Wasser- und Erdgeister, errichtete. Jedes Neujahr mussten die vier Minister der tibetischen Regierung in diesem Tempel den Nagas Opfergaben darbringen und sich für die Beschädigung der Erde entschuldigen. Dies war nicht nur ein Ausdruck der Achtung, sondern auch eines tiefen, überlieferten Wissens um die Verbindung und Interaktion der universellen Elemente mit den individuellen Elementen, aus denen der Mensch besteht.
Unter Tibet wird meist nur das zentrale Tibet mit seiner Hauptstadt Lhasa verstanden, aber Tibet, das »Dach der Welt«, besteht aus vielen verschiedenen Kulturregionen und umfasst ein riesiges Gebiet von zweieinhalb Millionen Quadratkilometern, das durchschnittlich über viertausendfünfhundert Meter hoch liegt. Der tibetische Kulturraum reicht weit über die aktuellen Landesgrenzen hinaus und umfasst den gesamten gebirgigen Rand, der das Hochplateau teilweise umschließt – Himalaja, Karakorum und Kunlun Shan. Da das Hochplateau von mächtigen Gebirgsketten durchzogen ist, deren bis zu mehr als sechstausend Meter hohe Pässe man nur reitend oder gar nur zu Fuß überqueren konnte, entwickelten sich in einzelnen Regionen eigene Dialekte und Bräuche, die sich von West nach Ost stark voneinander unterschieden. Deshalb finden sich in den alten Geschichten viele verschiedene Einflüsse aus angrenzenden Kulturen, und gerade diese Mischung macht den tibetischen Geschichtenschatz so attraktiv.
Tibet ist ein überwältigend schönes und zugleich klimatisch extremes Land. Zentraltibet und der westliche Teil sind trocken, da der Himalaja den Monsunregen aus dem Süden weitgehend abschirmt. Es heißt, dass sich innerhalb von vierundzwanzig Stunden in Tibet alle vier Jahreszeiten abspielen können. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es sehr heiß werden, aber die dünne Luft in diesen Höhen vermag die Wärme nicht zu halten. Kaum ist die Sonne weg, fallen die Temperaturen bis zu minus vierzig Grad. Flüsse mit wenig Tiefe frieren in der Nacht zu und beginnen morgens wieder aufzutauen. Wer sie überqueren will, muss bis zur späten Nacht warten, und wer morgens Wasser holen will, muss Löcher ins Eis schlagen oder die starke Sonne ihr Werk tun lassen. Mitten im Sommer muss man in den Bergen mit Schneeschauern rechnen, während im trockenen Zentraltibet Sandstürme nicht selten sind, und es heißt, dass die Sonne einen von vorn verbrennt, während man gleichzeitig hinten Frostbeulen bekommt. Im Osten Tibets hingegen, in dem sich die großen Flüsse teilen, ist das Klima feuchter. Früher, vor der Okkupation durch die Chinesen, gab es in bis zu viertausend Meter Höhe ausgedehnte Wälder, dazu einen Reichtum an Wildtieren und weite, trotz der Höhe fruchtbare Täler mit blühender Landwirtschaft.
Die geeignete Bekleidung der Nomaden im alten Tibet für Männer wie Frauen war die Chuba, ein Schaffell oder Stoff aus Schafwolle in der Form eines Mantels, der vorn übereinandergeschlagen und mit einem Strick um die Mitte festgebunden wurde, wobei oberhalb des Stricks diverse Gegenstände in den Mantel gesteckt werden konnten. Arme Leute besaßen oft nur diesen Mantel, ohne Hose und Schuhe. Die Ärmel dieses niemals gewaschenen Kleidungsstücks reichten weit über die Hände und konnten so auch als Handschuhe dienen. Wenn es zu warm wurde, schlüpfte man aus einem Ärmel heraus. Bauern bei der Feldarbeit ließen gelegentlich den zweiten Ärmel fallen und arbeiteten mit freiem Oberkörper. Auch die Frauen machten es so, da unbedeckte Brüste nicht als unsittlich galten.
Mit der Zunahme bäuerlichen, mehr sesshaften Lebens veränderte sich auch der Kleidungsstil. Es wurde gesponnen und gewebt, gefärbt und genäht und manche Anregung kam mit Karawanen aus China und Indien. Dennoch spielte Kleidung nie eine besonders gewichtige Rolle. War Reichtum vorhanden, wurde er durch kostbaren Schmuck aus Silber, Türkisen, Bernstein und aus Indien importierten Korallen zur Schau gestellt. Es war die große Freude der Frauen, bei festlichen Gelegenheiten ihr gesamtes bewegliches Hab und Gut am Körper zu tragen – als Gürtel, Halsketten, Ohrgehänge und aufwendigen Kopfschmuck. Die verschiedenen Schmucksteine hatten auch magische Bedeutungen; vor allem der Türkis sollte verhindern, dass man als Esel wiedergeboren wurde.
Viele Jahrhunderte lang hat sich in der Lebensweise der tibetischen Nomaden und Bauern nichts verändert. Sie war nach westlicher Vorstellung mittelalterlich, urbanes Leben gab es nicht. Entwicklung und Kultivierung kam mit dem Buddhismus, fand aber nur auf der geistigen Ebene statt. Dies geschah in den vielen Klöstern, die ab dem achten Jahrhundert in Tibet entstanden, oder auch in der Stille von Einsiedeleien und Höhlen. Doch parallel dazu gab es den Volksglauben voller Geistwesen und Dämonen, und dass große spirituelle Meister auch über schamanische Fähigkeiten verfügten, galt keineswegs als Widerspruch.
Dieser sehr lebendigen Welt entstammen die hier nacherzählten Geschichten in aller Vielfalt, und sie spiegeln, wie das bei Geschichten so ist, das spezielle Lebensgefühl des tibetischen Volkes. Mögen auch in manchen Geschichten Details auf Ursprünge außerhalb Tibets hinweisen, so wurden sie doch durch häufiges Wiedererzählen immer tibetischer eingefärbt und gehören zum bunten Schatz der wundersamen Geschichten des Landes auf dem Dach der Welt.
Geschichten aus sehr alter Zeit
Die ältesten Geschichten entstammen dem frühen oder »primitiven« Bön, der vorbuddhistischen Kultur Tibets. Die ursprünglichen Mythen und Legenden wurden in Liedern und Erzählungen überliefert und viele davon wurden auch nach Einführung der Schrift nur mündlich weitergegeben. Erst in neuer Zeit tauchten sie teilweise in historischen Texten der noch heute lebendigen Tradition des Bön in der Form des Bön-Buddhismus und der tibetisch-buddhistischen Traditionen auf.
In diesen Überlieferungen entfaltet sich eine reiche mythische Welt vor dem Beginn der Menschheit, in der Götter, Halbgötter und Geistwesen aller Art lebten, die zwar sterblich waren, aber viel größere Lebensspannen hatten als das neue Menschengeschlecht.
Die Entstehungsgeschichte dieser reichhaltigen Welt reicht zurück bis in die Zeit, »bevor nichts war«. Kurz zusammengefasst: Aus dem Nichts entstand das Sein, aus dem Sein entstanden Vater und Mutter und aus deren Vereinigung entstand ein Ei. Aus dem Ei kamen zwei Vögelchen, und dieses Ereignis liegt einer ganzen Reihe von Fabeln zugrunde, die als »Die Geschichten des Sperlings« überliefert wurden. Deshalb spielen Vögel in diversen Märchen eine wichtige Rolle.
Unter den nicht menschlichen Wesen gibt es eine besondere Klasse von Halbgöttern, deren Geschichten in den »Legenden der Masang« zusammengefasst sind. Diese Masang herrschten in Tibet, bis Menschen sich dort anzusiedeln begannen und Beziehungen aller Art zwischen den Menschen und den Masang entstanden. Manche Masang-Geschichten machen deutlich, dass die Masang mehr waren als »Dämonen« im allgemeinen Sinn. Eher waren sie Wesen zwischen Göttern und Menschen, manchmal Bedrohung, manchmal helfende Macht. Auch die ersten – legendären – Könige Tibets gehörten zu ihnen.
Viele Themen der tibetischen Märchen und Fabeln haben ihre Wurzeln im fruchtbaren geistigen Boden der alten, vorbuddhistischen Kultur.
Die ersten Tibeter
Die ersten Tibeter entstanden aus der Verbindung von einem Affen mit einer Bergdämonin.
Das kam so:
Am Anfang war gar nichts.
Daraus entstand das ursprüngliche Sein.
Daraus entstanden Licht, der Vater, und Strahl, die Mutter.
Daraus entstanden Dunkelheit und Helligkeit.
Ein Ei entstand und daraus kamen zwei Vögelchen hervor, ein schwarzes und ein weißes, Lichtvögelchen und Dunkelheitsvögelchen.
Durch sie entstanden weitere Eier.
Es war ein großes Entstehen und immer weiteres Entstehen.
Es entstand vieles … zauberische Wesen, götterartig, dämonenartig, menschenartig, tierartig, in Welten, die noch nicht materiell waren.
Aus einer der großen Abstammungslinien ging ein magisch inkarnierter Affe hervor. Und mit diesem beginnt unsere Geschichte.
Der Affe, so wird erzählt, legte vor dem erhabenen Herrn des Vollkommenen Mitgefühls das Gelübde ab, die Lehre des Buddhas zu verwirklichen und erleuchtet zu werden. Um die Lehre verwirklichen zu können, musste er meditieren, und zu diesem Zweck schickte ihn der erhabene Herr des Mitgefühls in das Schneeland Tibet. Also ging der Affe nach Tibet, setzte sich in eine Höhle und meditierte über die erhabene Lehre vom Vollkommenen Mitgefühl.
In Tibet lebten viele Dämonen und so erfuhr eines Tages eine Bergdämonin von dem meditierenden Affen. Das beeindruckte sie sehr. Im Geist sah sie den Affen und verliebte sich augenblicklich in ihn, und dies in der Art der Dämonen, also besonders heftig. Sie dachte voller Leidenschaft an ihn, morgens, mittags und abends. Doch auf die Dauer genügte das nicht. Darum nahm sie die äußere Form einer begehrenswerten Äffin an und stellte sich vor die Höhle, in deren Eingang der Affe meditierte.
»Du kennst mich«, sagte sie, »und du willst mich. Hier bin ich.«
»O nein, nein! Ich will dich nicht wollen«, sagte der Affe entsetzt. »Wie könnte ich mein Gelübde brechen! Das ist unmöglich.«
Die Dämonin warf sich vor ihm nieder. »Ich bitte dich, rette mich«, sagte sie und vergoss große Dämonentränen. »Ach, ich habe das Leidenschaftskarma einer Dämonin. Wenn du mich nicht zur Frau nimmst, muss ich die Frau eines Dämonen werden, und wir werden unzählige Lebewesen töten und fressen und unzählige Dämonenkinder bekommen, die alle Lebewesen dieses Landes töten und fressen und das ganze Schneeland beherrschen werden. So ist das Karma, so wird es geschehen, wenn du es nicht verhinderst. Also bitte, erlöse mich und nimm mich zur Frau.«
Das brachte den braven Affen in große Gewissensnöte. Er hatte die Gelübde abgelegt, allen Maras zu widerstehen – dem Mara der Begierde, dem Mara der Aggression und dem Mara der Ignoranz. Wenn er die Gelübde brach, indem er sich mit einer Frau ergötzte, was schlechtes Karma bedeutete, würde er nicht erleuchtet werden. Wenn er die Gelübde einhielt, was gutes Karma bedeutete, würde er jedoch damit den Tod unzähliger Wesen verursachen, und das bedeutete wiederum furchtbar schlechtes Karma.
Was sollte er tun?
Da er trotz allen Nachdenkens zu keiner Lösung fand, wandte er sich mit seinem Dilemma schließlich an den erhabenen Herrn des Mitgefühls. Der Erhabene sagte: »Nimm sie zur Frau!«, und gab seine gewaltige Segenskraft dazu.
Aus der Verbindung des Affen und der Dämonin entstanden sechs Kinder, die je aus einem der sechs Bereiche kamen. Das Affenkind aus dem Höllenbereich war freudlos, das Affenkind aus dem Hungergeisterbereich war ein hässlicher Vielfraß, das Affenkind aus dem Tierbereich war dumm, das Affenkind aus dem Halbgötterbereich war bösartig, das Affenkind aus dem Menschenbereich hatte viel Intelligenz, aber wenig Selbstvertrauen, und das Affenkind aus dem Götterbereich war brav.
Der Affe auf dem Tugendpfad brachte seine Kinder in ein schönes Land voller Früchte, das sie gut ernährte. Aber es dauerte nicht lange, da hatten sich die Affen durch die Macht des Karmas so sehr vermehrt, dass das Land sie nicht mehr ernähren konnte, und sie begannen zu hungern. Vater Affe begab sich zum erhabenen Herrn des Mitgefühls und jammerte, viel Ungemach sei über ihn gekommen, weil er sein Gelübde nicht gehalten habe auf Geheiß des erhabenen Herrn des Mitgefühls. Und weil er nun schon mal dabei war, einen Schuldigen zu suchen, klagte er auch seine Frau, die Bergdämonin, an und sagte, eine Ehefrau sei »der Kerker des Samsara«, ihretwegen sei er in den Sumpf des Leidens geraten. Nun solle sich bitte der Erhabene um die ganze Affenbande kümmern.
Der Erhabene streute Feldfrüchte aus, und alles wuchs ohne jegliche Arbeit, sodass die vielen Affenkinder satt wurden. Weil es ihnen so gut ging, schrumpften ihre Schwänze und sie verloren ihr Fell. Schließlich lernten sie sprechen und wurden zu Menschen. Von ihnen stammen die Menschen Tibets ab.
In den Menschen Tibets leben die Anlagen von Vater und Mutter weiter. Es heißt, dass diejenigen, in denen sich der Affenvater durchsetzt, sanftmütig, gläubig, mitfühlend und redegewandt seien, während diejenigen, in denen die Bergdämonin stärker ist, einen geilen und gierigen Charakter hätten, und zu streitlustigen, leichtsinnigen und zum Zorn neigenden Leuten werden.
So sind die Tibeter entstanden.
Pferd und Yak
Diese Geschichte, so wird gesagt, begab sich zur Zeit des Gestern von gestern von neunundneunzig, des Morgens von morgen. Damals lebten eine Stute und ein Hengst, die wohnten in der Himmelwelt. Es war ein gutes Leben dort, es gab saftiges Gras und reichlich Erbsen, auch Reis und Zuckerpflanzen. Aber plötzlich kam eine große Trockenheit, weit und breit war kein Wasser zu finden und das zuvor so fruchtbare Land gab keine Nahrung mehr. Da blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich nach einer neuen Heimat umzusehen.
»Lass uns hinunter ins Tal gehen«, sagte der Hengst.
Im Tal fanden sie reichlich Wasser, und die Erde gab alles her, was sie brauchten. Sie waren sehr glücklich, freuten sich ihres Lebens und vergnügten sich miteinander, sodass sie bald einen Sohn bekamen. Dem folgte ein weiterer Sohn und dann auch noch ein jüngster. Sie waren eine glückliche Familie.
Aber wie es nun mal so ist mit dem Glück, es ist unbeständig. Die Kinder wurden groß und das Wasser und das Gras des Tals reichten nicht mehr für alle. Also beschlossen die drei Söhne, eine neue Heimat zu suchen.
Der Älteste ging zur Hochebene des Nordens, der Mittlere zum Hochland der Mitte und der Jüngste zu den Höhen der Wildnis. Überall dort auf dem hohen Land gab es zwar alles, was ein Pferdeherz begehrte, aber leider waren schon andere da – die Yaks. Und da die Yaks ebenso Wasser und Gras brauchten wie die Pferde, dauerte es nicht lange, bis es zum Streit kam zwischen Yak und Pferd.
Der Vater Yak und der älteste Pferdesohn beschlossen, der Streiterei ein Ende zu setzen, und trafen sich zum gütlichen Verhandeln. Der Vater Yak berief sich auf eine Anordnung vom höchsten Gipfel des Himmels, den sechs höchsten Väterlichen Herrschern, dass die Steppe des Flachlands das Gebiet der Pferde sei und das Hochland das Gebiet der Yaks. So sei es und so müsse es bleiben.
Der älteste Pferdesohn sah das nicht ein. »Gut und schön«, sagte er, »du sprichst von der Weisheit der sechs höchsten Väterlichen Herrscher. Es mag ja sein, dass das Pferd zuerst in der Steppe war und der Yak zuerst auf dem Hochland. Aber auf längere Sicht sollte man sich doch einigen können. Wasser und Gras können für beide Seiten reichen. Frisst der eine Gras, trinkt der andere Wasser. Trinkt der eine Wasser, frisst der andere Gras. Das lässt sich doch machen.«
Vater Yak war damit keinesfalls einverstanden und es kam zum Kampf. Vater Yak senkte seine Hörner und ging auf den Pferdesohn los, dieser wiederum schlug kräftig und geschickt mit seinen Hufen zu. Sie kämpften und kämpften bis zur völligen Erschöpfung. Schließlich siegte der Vater Yak und der Pferdesohn blieb tot auf dem Platz des Kampfes liegen.
Als die jüngeren Pferdebrüder wieder einmal ihr Wiehern nach dem Ältesten zur Ebene des Nordens schickten, bekamen sie keine Antwort. Beunruhigt machten sie sich auf den Weg, um ihn zu suchen. Aber alles, was sie auf der Nordebene von ihm fanden, waren die Reste seiner Knochen. Ein paar Yaks, denen sie begegneten, berichteten vom Kampf und dem Tod des Pferdesohnes. Obwohl sich die Brüder einig waren, dass sie ihren ältesten Bruder rächen müssten, war ihnen doch klar, dass sie dem starken Vater Yak unterlegen sein würden.
»Es hat keinen Sinn, weiterhin an Rache zu denken«, sagte der mittlere Bruder. »Lass uns lieber einen Ort finden, wo wir in Ruhe und Frieden leben können.«
Der Jüngste schlug vor, sie sollten ins Menschenland gehen, wo es keinen Streit zwischen Pferd und Yak gab, und dort heimisch werden. Sein Bruder hatte jedoch schon einiges vom Menschenland gehört und gewiss nicht das Beste.
»Keine gute Idee«, sagte er. »Dort legen sie dir Zaumzeug an, an dem du dir den Mund wund scheuerst, und sie setzen sich auf dich und packen dir Lasten auf, die du über lange, beschwerliche Wege schleppen musst. Du musst dauernd dienen und darfst nie laufen, wohin du willst. Was soll das für ein Leben sein?«
»Aber wohin könnten wir denn sonst gehen?«, wandte der Jüngste ein. »In den Steppen der Wildnis wächst nur hartes Zeug, das man kaum essen kann. Da will ich nicht hin. Es muss doch irgendeinen Ort geben, wo es sich gut leben lässt.«
Der mittlere Bruder ließ sich nicht überreden, mit ihm zu kommen, und so machte der Jüngste sich schließlich allein auf den Weg ins Menschenland. Dort traf er einen Mann, mit dem er handelseinig werden konnte. Es wurde genau abgemacht, wie viel Futter er bekommen sollte, und auch, dass er nur als Reittier würde dienen müssen. Lasten sollten die Maulesel tragen. Es war ein guter Handel, der Mann hielt sich daran und der Jüngste war mit seinem Leben zufrieden. Er wurde immer satt, musste nicht übermäßig viel arbeiten und sein Herr war zufrieden mit ihm. Bald wurde der Jüngste stolz auf seine gute Stellung. Er trug den Kopf hoch und schüttelte hoheitsvoll seine Mähne.
Eines Tages ritt der Mann über Berge und durch Täler und erreichte schließlich die Steppenwildnis, wo der mittlere Bruder lebte. Das war dem stolzen Jüngsten gar nicht recht. Er hoffte sehr, dass sie ihm nicht begegnen würden, denn er schämte sich, kein freies Pferd mehr zu sein. Der Mann zeigte glücklicherweise keine Neigung, sich in der Steppenwildnis aufzuhalten, sondern durchquerte sie zügig und erreichte bald das Hochland im Norden.
Es konnte nicht ausbleiben, dass ihnen dort der Vater Yak begegnete. Darauf hatte der Mann nur gewartet. Er hielt die Schlinge bereit und fing den Vater Yak ein. Jetzt konnte der Jüngste seine Kraft und seine Schnelligkeit einsetzen, denn der Mann wollte den Vater Yak so lange ermüden, bis er ihn mit seinem Speer töten könnte. Der Vater Yak raste hin und her, Schweiß troff an ihm herunter, aber er konnte dem Mann nicht entkommen.
So starb Vater Yak. Der jüngste Bruder jubelte und rief hinaus in die Weite, dass alle es hörten und weitererzählten: »Vater Yak ist besiegt! Der älteste Bruder ist gerächt!«
Die Pferde hörten es.
Die Yaks hörten es.
Und es entstand Einigkeit.
Gesar von Lings Kindheit
In einer einfachen Hütte wurde ein Kind geboren, das so hässlich war, dass seine Mutter sich ganz schrecklich schämte. O nein, dachte sie, was für ein armseliger kleiner Wicht das ist, mit diesem riesigen Mund und Augen so schwarz wie die finsterste Nacht.
Aber dass dieses Kind die Wiedergeburt eines Göttersohns, des Königs von Ling, war und ein großer Kriegerkönig werden sollte, konnte die Mutter natürlich nicht ahnen, und auch nicht, dass der Göttersohn zuerst als Hagel vom Himmel gefallen war, bevor er sich in ihr niedergelassen hatte. Das war ungewöhnlich, konnte aber vorkommen.
Die Mutter nahm einen Sack, schnitt ein Loch hinein für den Kopf, zog ihn über das hässliche Kind und versteckte es, denn niemand sollte es sehen. Ach, wie sehr schämte sie sich!
Doch es konnte nicht ausbleiben, dass eine neugierige Nachbarin den Kopf zur Türe hereinstreckte und fragte: »Wo ist denn das Kind? Du hast doch ein Kind bekommen.«
Die Mutter druckste ein wenig herum und sagte schließlich: »Ja, schon. Aber es ist so hässlich, da schämt man sich halt.«
Es war jedoch eine Göttin, die in der Gestalt der Nachbarin nach dem Kind gefragt hatte, und die war mit der Antwort der Mutter alles andere als zufrieden.
»Einen Sohn kann man doch nicht so behandeln«, sagte sie. Ohne weitere Umstände nahm sie ihm den Sack ab, wickelte ihn in ein Tuch und fütterte ihn mit warmem Brei.
»Genauso wirst du es von jetzt an machen«, erklärte sie der Mutter nachdrücklich, »denn du hast ein ganz besonderes Kind bekommen.«
Die Mutter beugte sich der Macht, die von der Nachbarin ausging, und widersprach nicht. Ich habe also ein besonderes Kind, dachte sie. Wie auch immer, besonders hässlich ist es auf jeden Fall.
Nach dem Tod des Göttersohnes hatte sich ein Clanführer, der Agu, zum Herrscher von Ling erhoben. Als dem Agu zu Ohren kam, dass der Göttersohn in einer einfachen Hütte wieder in die Welt gekommen war und als der wahre Herrscher in Zukunft eine Gefahr für ihn sein würde, befahl er sieben Priestern der alten Götter, das Kind zu töten. Da er nicht sicher war, ob sie seinem Befehl gehorchen würden, versprach er ihnen als Lohn die Hälfte vom Königreich Ling – das ihm, genau genommen, ja gar nicht gehörte.
Die Priester waren gierig und machten sich augenblicklich auf den Weg. Schnell hatten sie die Hütte gefunden und verlangten, das Kind zu sehen. Bei seinem Anblick nickten sie heftig mit den Köpfen und sagten zur Mutter: »Ja, ein wahrlich besonderes Kind hast du geboren. Wir werden es mitnehmen, damit es die Religion erlernen kann. Du weißt hoffentlich, dass es nichts Großartigeres für ein Kind gibt, als die Religion zu erlernen.«
Die Mutter fühlte sich sehr geschmeichelt, dass ihr Sohn, obwohl so schauderhaft hässlich, zu etwas Großartigem auserkoren war, und hatte nichts dagegen, dass die Priester ihn mitnahmen.
Wenig später öffnete die Göttin in der Gestalt der Nachbarin die Türe. »Wie geht es deinem Kind?«, fragte sie.
»Ich hab es nicht mehr. Männer nahmen es mit, damit es die Religion erlernen kann«, berichtete die Mutter stolz. »Weil er doch etwas Besonderes ist.«