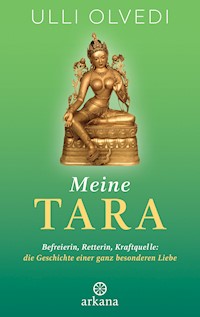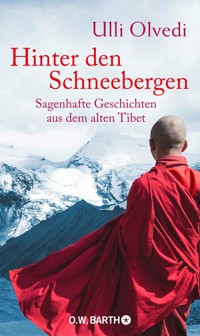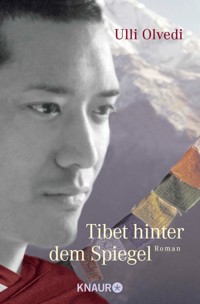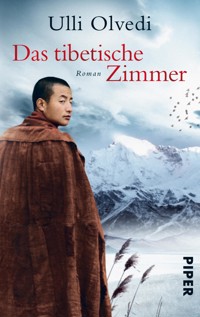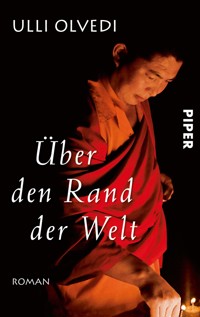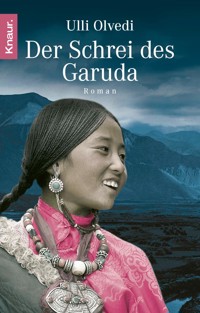
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Claudia und Dawa sind zwei grundverschiedene Frauen - doch beide können nicht anders, als sich in Tibet auf die abenteuerliche Suche nach der wahren Freiheit zu begeben. Dawa tat dies vor vielen Jahrhunderten - und in unserer modernen Zeit folgt Claudia ihren Spuren ... Virtuos spielt Ulli Olvedi nach ihren Bestsellern Wie in einem Traum und Die Stimme des Zwielichts mit den verschiedenen Ebenen von Traum und Realität. Ein spiritueller Entwicklungsroman, wie ihn sonst niemand zu schreiben vermag!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulli Olvedi
Der Schrei des Garuda
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Claudia und Dawa sind zwei grundverschiedene Frauen – doch beide können nicht anders, als sich in Tibet auf die abenteuerliche Suche nach der wahren Freiheit zu begeben. Dawa tat dies vor vielen Jahrhunderten – und in unserer modernen Zeit folgt Claudia ihren Spuren … Virtuos spielt Ulli Olvedi nach ihren Bestsellern Wie in einem Traum und Die Stimme des Zwielichts mit den verschiedenen Ebenen von Traum und Realität. Ein spiritueller Entwicklungsroman, wie ihn sonst niemand zu schreiben vermag!
Inhaltsübersicht
Die Dinge sind nicht [...]
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
KATHMANDU
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
TIBET
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Dawa
Miriam
Miriam
Glossar
Ich habe Texte verwendet [...]
Die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen.
Aber anders sind sie auch nicht.
Lankavatara Sutra
Miriam
Es tut mir leid«, sagte er.
Doch da war nichts Weiches an ihm, das seine Worte bestätigt hätte. Er stand steif da, die Hände in den Manteltaschen, und sein Blick war eingefroren.
Die Frau. Die Kinder. Der Beruf. Die Kollegen. Ganz am Rand des Bildes die Geliebte. Man kann dieses Stückchen Rand wegschneiden, ohne das Bild zu stören. Ich bin eine Randerscheinung, dachte Miriam. Nur die Geliebte. Nicht genug, um ein Bild zu füllen, nichts, das bleibt, weniger als der Geruch in einer leeren Parfümflasche.
Sie wünschte, ihr fiele etwas Bedeutendes, Abrundendes ein, das sie sagen könnte, etwas, das dem Jahr dieser Affäre irgendeine Festigkeit geben konnte, doch es fiel bereits auseinander, als sei es nie gewesen, und der Rest Hoffnung tropfte heraus. Es fiel ihr nichts ein und so wartete sie, bis er ging, schloss die Tür hinter ihm und ließ die Schultern fallen. Im Zimmer blieb eine schwere, kalte Leere zurück. Kurz kam ihr der Gedanke, es könnte befreiend sein, laut zu heulen, ohne Scham wie ein Tier, aus dem tiefen Dunkel des Schmerzes heraus. Natürlich tat sie es nicht. Man tut das nicht.
War es der Verlust des Wartens, der sie so sehr traf? Denn das Warten hatte dem Bedeutungslosen Bedeutung verliehen. Sie sah unzählige öde Tage vor sich. Nackte, unverblümte Bedeutungslosigkeit. Ein Rand ohne Bild.
Entschlossen, sich zu betrinken, füllte sie ein Wasserglas mit Whisky und trank es in kleinen, schnellen Schlucken aus. Das wässrige Licht des grauen, lang gezogenen Tages hüllte sie ein und ihr Blick tauchte in das matte Grün der unruhigen Birke vor dem Fenster. Stell dir vor, jetzt sei ein anderes Jetzt, zehn Jahre später. Du denkst zehn Jahre zurück – es ist so lange her. Ein Mann hat dich verlassen, na und? Solch eine alte, blasse Erinnerung mit ihrem kleinen, scharfen Restgeruch von Verletzung ist keine Bedrohung. Lang vorbei, lang vorbei, jetzt ist jetzt, das Grün draußen und das Grau im Zimmer und das Goldgelb im Glas.
Das Grün war so tröstlich, wenn es nach dem langen Winter endlich wieder hervorkam wie ein Wunder. In jedem Frühling war es ein Wunder. Sie hatte damals im Frühling geheiratet, in einem altrosa Kostüm und sehr hohen Schuhen, und der Mann neben ihr trug einen hellen Anzug. Wie nett sie aussahen zwischen dem Grün das neuen Jahres. Doch da hing diese vage Ungewissheit über ihr, ob dies wirklich das Glück war. Immerhin, ihr Leben hatte eine Richtung, das Leben musste eine Richtung haben, ihr Vater nickte gewichtig und zufrieden. Vielleicht wollte sie nicht so viel Richtung. Aber man stellte sich diese Frage nicht, wie viel vom Glück solcher Richtung man wünschte. Verheiratet. Ärztin. Ein Leben, an das man sich anlehnen konnte, anlehnen musste. Sie sagten: Ach, Miriam, was soll das, in die Dritte Welt gehen und kranke Kinder retten, man braucht eine Existenz. Sie hatte die Dritte Welt eingetauscht gegen ein Röntgenlabor.
War es das zweite Glas oder schon das dritte? Vor dem Fenster gab es kein Grün mehr, es war dunkel geworden. Die Einsamkeit quoll ins Zimmer, nicht mehr aufgehalten vom Bollwerk des Wartens.
Sie leerte das Glas, stellte es langsam vor sich auf den Tisch und goss nach. Der Whisky ließ den Schmerz weniger scharfkantig erscheinen, doch die Bilder, die hochdrängten, reihten sich erbarmungslos aneinander. Das Kind. Helle Zöpfchen mit breiten blauen Schleifen und das kleine Gesicht engelweiß im Tod.
So lange hatte sie Gott beschimpft, bis sie fast so weit war, an ihn zu glauben. Doch sie schreckte zurück, konnte sich nicht einlassen auf diesen übermächtigen Mann in seinem unvorstellbaren Himmel. Sie hätte gern geglaubt, dass Gott die Liebe ist, doch wie hätte Liebe ihr das antun können? Zutiefst unglaubwürdig machte es ihn. Dann war da noch die Jungfrau Maria, so machtlos; auch ihr wurde das Kind genommen und sie konnte nichts anderes tun als weinen.
Miriam stellte das leere Glas vorsichtig auf den Tisch, goss nach und trank aufmerksam den Salzgeschmack mit, den ihre Tränen im Whisky hinterließen. Sie war müde, doch sie wollte nicht schlafen gehen. Der Traum könnte wieder kommen: Sie ist in einem Zimmer mit einer Tür und sie geht durch die Tür und ist wieder in demselben Zimmer mit der Tür und sie geht wieder durch die Tür in dasselbe Zimmer und es gibt keine Tür nach draußen.
»Ich bin unglücklich«, sagte sie laut. Sie wünschte, es würde jemand hören. Das Unglücklichsein war wie ein Tunnel und sie war in diesen Tunnel hineingegangen und jetzt gab es keinen anderen Weg mehr, nur weiter im Tunnel. Niemand würde da mitgehen wollen. Sie war allein. Man war immer allein.
Keine Frage, was nun kommen würde: die vertraute, bis ins Innerste schmerzende Erstarrung; morgens aufwachen mit dem Grauen, einen Tag durchstehen zu müssen; das entsetzliche Funktionieren; die Angst vor dem Abend mit seiner lauernden Dunkelheit, die den Rest der inneren Substanz aufzulösen drohte; die Nächte mit kleinen Tümpeln von Schlaf und dazwischen unerbittliche, schmerzende Wachheit. Eine Woche, zwei Wochen lang der Kampf, dann die Niederlage, die Tabletten, das chemische Gängelband, um weiterkriechen zu können durch die Tage und Nächte, halbherziges Überleben.
Sie lehnte die Stirn an die Wand und begann, langsam und rhythmisch dagegen zu schlagen, bis der Schmerz der Erschütterung in ihrem Kopf ein wenig Erleichterung brachte. Hier steht jemand und schlägt mit dem Kopf an die Wand, dachte sie erschöpft. Wer tut das? Niemand ist da. Ich bin nicht wirklich da. Nicht – da – nicht – da. Sie wollte nicht aufhören. Der Schmerz und die Sinnlosigkeit dieses Tuns gaben eine gewisse Befriedigung. Nicht – da.
Es war noch Whisky in der Flasche. Keinen Rest lassen – keinen Rest von Gedanken, keinen Rest von Gefühlen. Es müsste möglich sein. Der Griff nach der Fernbedienung erschien ihr als Bankrotterklärung, Aufgabe der Hoffnung auf Freiheit.
Auf dem Bildschirm erschien eine karge, weiträumige Landschaft. Ein alter Mann sprach Unverständliches, darüber die Übersetzung: »… der Yamdrok Tso, der heilige Türkissee. Man weiß, dass Padmasambhava seinen Handabdruck im Wasser des Sees hinterließ. Damals, bei meiner ersten Pilgerreise, ritten wir zehn Tage lang …« Klare Linien nackter Berge vor dem tiefblauen Himmel. Masken wirbeln, ein Auge auf der Stirn, Totenköpfe und Bänder, die Füße stampfen, tanzen, rundherum, rundherum. Wie hinterlässt man einen Handabdruck im Wasser?
Das Glas fiel mit einem dumpfen, bedächtigen Laut zu Boden.
Dawa
Eine Treppenbohle knackt in der Dunkelheit. Die steilen Stufen sind kaum zu sehen im matten Mondlicht, das auf den Balkon und auf die steile Treppe zum Innenhof fällt. Dawa hält inne. Aus der Tür zum Zimmer ihres Vaters dringt der sanfte Schein der Butterlampen; er sitzt mit seinem Bruder, dem Mönch, zusammen. Immer reden sie abends, wenn der Onkel da ist, bis tief in die Nacht hinein. Auch aus dem Schlafraum der Stallknechte dringen noch Stimmen, vermischt mit dem Klappern der Würfelbecher.
Vorsichtig klettert sie weiter hinunter, tritt ganz am Rand auf, wo das Holz nicht nachgibt. Die Hunde unter der Treppe heben nicht einmal den Kopf von den Pfoten. Sie hält sich im Mondschatten, der den größten Teil des Hofs in Dunkel hüllt, huscht vorbei am Brunnen und zu dem kleinen Tor seitlich in der Mauer. Da ist Dölma, sie kichert und schiebt den Riegel zurück. Dawa hat kein Geheimnis vor Dölma, denn Dölma gehört zu ihr wie der Rauch zum Feuer, ist ihr näher als jeder andere Mensch. Dawa kann sich erinnern, wie die siebenjährige Dölma sie vor das Tor trug und fast zusammenbrach unter der Last, als der neue kleine Rinpoche mit seinem golden glänzenden Hut auf seinem geschmückten Pferdchen durch das Dorf und zum Kloster weit jenseits des Tals geführt wurde.
Dölma ist die Tochter des Aufsehers, ein einziges Kind wie Dawa selbst. So viele tote Babys, denkt sie, doch meines wird leben; wäre es nur schon in meinem Bauch, dann würden sie Lobsang nicht mehr zurückweisen, dann würde die Armut seiner Familie vergessen sein. Und sie lacht Dölma zu, siegesgewiss.
Ihr Schritt ist sicher, auch dort, wo sie kaum etwas sieht, so vertraut ist ihr der nächtliche Weg zwischen den ummauerten Höfen hindurch. Der halbe Mond genügt, um scharfe Schatten zu werfen. Niemand treibt sich um diese Zeit im Dorf herum. Ihre Freundin Nangsa liegt vielleicht noch wach und betet das Mantra der Arya Tara, der gütigen Muttergottheit, für Dawa und ihre Liebe. Dawa lächelt. Der Vater wird schließlich nachgeben. Väter sind wie Felsen. Stürme und Gewitter sind machtlos. Nur das sanfte, mächtige Wasser kann sie untergraben, Rinnen ausspülen, so dass sie sich neigen, ohne es zu bemerken, und wenn sie stürzen, ist ihr Halt längst verloren, gibt es kein Besinnen mehr. Und dann sagen sie: Ja, ja, mein Kind, es sei, es sei, und sie denken vielleicht: Ich bin ein lieber Vater, ich bin ein guter Vater, mein Kind gehorcht meinem Nein und Ja.
Es ist nicht kalt in dieser Nacht. Sie ist entschlossen, nicht länger zu warten. Gleich wird sie es ihm sagen und sie wird sein schnell schlagendes Herz spüren, wild vor Freude. Dann werden sie zu den sommersatten Weiden reiten, wo sie eine unbenützte Steinhütte kennt, und die ganze Nacht lang dort bleiben.
Schnell hat sie den Steinwall erreicht, der das Dorf vor den kalten Winden schützt.
»Hier bin ich, Dawa!« Ein großer Schatten folgt der Flüsterstimme. Sie kann den kleinen, jauchzenden Schrei nicht festhalten, er will aus ihr heraus und aller Welt verkünden: Lobsang ist da und wir gehören zusammen! Sie drückt ihre Nase in seine Chuba, die nach seinem Pferd riecht und nach dem Räucherwerk vom Hausschrein und nach der Erde der Felder, die zwischen ihrem und seinem Dorf liegen. Wenn sie an Lobsang denkt, ist es als Erstes dieser Duft, der in ihrem Geist aufblüht.
»Komm«, flüstert sie, »gehen wir zu den Weiden hinauf. Es ist nicht kalt heute Nacht.«
Mit einer ungeschickten, zärtlichen Geste windet er einen ihrer hundertundacht Zöpfe um seine Hand. Er hat den Kopf zurückgeworfen, so dass sie sein Gesicht nicht sehen kann. Ohne es zu bemerken, hält sie den Atem an und tritt einen Schritt zurück. Er zieht sie wieder an sich.
»Hör zu, es ist etwas geschehen. Es hat sich alles verändert.« Seine Stimme ist dünn und fremd. »Meine Eltern haben eine Frau für mich gefunden.«
»Nein!«, sagt Dawa, zieht das Nein mit ihrem Atem hinein in ihren Kopf und dort ist es so laut, dass es die Sterne übertönt. Doch Lobsang achtet nicht darauf.
»Deine Eltern werden niemals Ja sagen. Du weißt es. Alle wissen es. Dein Vater wird dir einen reichen Mann geben.«
»Ich will keinen reichen Mann. Warte ab! Mein Vater wird seine Meinung ändern. Ich bekomme von ihm immer, was ich will.«
Lobsang schweigt.
Sie presst ihre Hände beschwörend gegen seinen Fellmantel. »Wir gehen weg. Wir gehen zu den Nomaden.«
Seine Hand gibt den Zopf wieder frei, streicht ihn glatt.
»Es geht nicht. Das Leben bei den Nomaden ist viel zu hart. Das bist du nicht gewohnt. Du hast es immer gut gehabt.«
»Ich habe es nicht gut ohne dich.« Fest ergreift sie die Ärmel seiner Chuba und schüttelt ihn mit aller Kraft. »Sie dürfen das nicht mit uns machen. Sie dürfen das nicht.«
»Sie haben es schon getan«, sagt Lobsang in ihr Haar. »Deine Eltern wollen mich nicht haben. Ich bin nicht gut genug für ihre Prinzessin.«
»Komm«, sagt Dawa entschlossen, »mach mir ein Kind. Dann können sie nicht mehr Nein sagen.«
Lobsang schweigt. Sein Pferd schnaubt hinter dem Steinwall. Dawa möchte mit den Fäusten auf die feste junge Brust trommeln, möchte schreien, dass der Himmel dröhnt und ihn aufweckt aus seiner traurigen Ergebenheit. Doch sie erkennt, dass nichts ihn umstimmen kann. Er ist ein guter Sohn. Die Familien haben längst entschieden. Nur in alten Geschichten laufen die Liebenden davon.
Eine riesige, dunkle Endgültigkeit türmt sich um sie auf. Mit einem Mal ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Als ginge ein riesiger Riss quer durch die Welt.
Lobsang lässt sie los, schiebt sie von sich. »Leb wohl, Dawa«, sagt er, fremd schon, und geht zu seinem Pferd.
Ein leises, freundliches Schnauben, Lobsangs sanfte Stimme, so sanft mit seinem Pferd. Sie möchte ihm nachrufen: Es tut so weh! Tu mir nicht so weh!
Der Klang der Hufe verliert sich in der kühlen, erbarmungslosen Stille der Nacht.
Miriam
Das Erwachen war ein zäher Kampf. Sie wollte nicht wissen. Sie wollte nicht denken. Doch nichts konnte die Flut von Schmerz aufhalten. Noch hatte der Schmerz keinen Namen, doch sie wusste um ihn; einen Augenblick lang drängte sie ihn noch zurück, dann brach die Welle und zerstob in Worte.
Verloren. Allein. Sie hatte Lobsang verloren. Oder ging es nicht um Lobsang, der auf seinem kleinen, schnellen Pferd durch die Nacht davonritt? Es tut mir leid, hatte er gesagt, die versteinerte Figur, die bereits gesichtslos wurde, weil die Züge eines anderen Verlusts sich in ihrem Gefühl einzunisten begannen.
Miriam setzte sich auf. Irritiert suchte ihr Blick das Fenster, wo sich keines befand. Sie war auf der Couch eingeschlafen, zusammengerollt in der Kühle der Nacht. Ein wuchtiges, schmerzendes Pochen in ihrem Kopf brachte die Erinnerung an den Whisky mit sich. Im dünnen Licht des beginnenden Morgens ging sie in die Küche und trank hastig ein Glas Wasser. Ihr Spiegelbild zeigte einen Bluterguss auf ihrer Stirn von den Schlägen gegen die Wand.
Ins Bett sinken, die Decke bis zum Hals ziehen. Eine kleine Erleichterung. Eine Ahnung zaghafter Zufriedenheit stieg aus tiefer Erinnerung empor – das Geborgenheit verheißende Gefühl, krank zu sein, nicht zur Schule gehen zu müssen, in die Bettdecke gehüllt auf dem Wohnzimmersofa zu liegen, einen Teller mit Früchten auf dem niedrigen Couchtisch. Man konnte lesen oder die Vorhänge zuziehen und sich der anderen Wirklichkeit auf dem kleinen Bildschirm überlassen, in der daunenwarmen Gewissheit, keine Verantwortung für den Tag übernehmen zu müssen. Unbekümmert konnte man sich treiben lassen im Zeit-Ozean. Das Fieber war ein Verbündeter. Die Grenzen zu den Träumen lösten sich auf und die Träume wucherten in den Tag hinein, grell wie der Tod. Dass der Tod nicht nur Licht und Dunkel, sondern auch Farben und Bilder hatte, dessen war das Kind Miriam gewiss.
Nach und nach quoll ein mattes Regengrau zwischen den Vorhängen hindurch. Eingehüllt in den einsamen Schutz des Schlafzimmers tauchte sie zurück in den Schlaf, in die unverwundbare Bewusstlosigkeit, die keine Lösung bietet.
»Du solltest endlich zu einem Psychotherapeuten gehen«, sagte Greta. »Ich weiß nicht, was du dagegen hast.«
»Mir geht’s gut«, wehrte Miriam kraftlos ab.
Greta seufzte. »Es geht einem nicht gut, wenn man wie ein Zombie herumläuft und sich in Träumen versteckt.«
Miriam zog ihre Jacke fester um sich. Der tagelange Regen hatte den Sommer abgekühlt und verdunkelt.
»Ich laufe nicht herum. Ich habe die Tage hier auf der Couch verbracht. Ich lese viele wunderbare Bücher über Dawas geistige Welt. Und ich verstecke mich nicht in Träumen. Es zieht mich einfach hinein, verstehst du? Diese Traumwelt ist so lebendig. Heute Morgen habe ich geträumt, dass ich auf einem dieser kleinen Pferde ritt. Neben meinem Vater – neben Dawas Vater. Dawa liebt ihren Vater. Ich kann es spüren, jetzt, in diesem Augenblick. Ich bin das einzige Kind. Er liebt mich. Wir beten täglich zusammen, mein Vater, meine Mutter und ich – ich meine, Dawa.«
»Midlife«, sagte Greta mit Nachdruck. »Du hast eine Identitätskrise. Das hat man in unserem Alter. Du brauchst Hilfe.«
Miriam schüttelte den Kopf. »Das Recht des Menschen auf ein verpfuschtes Leben ist unantastbar.«
Greta lachte.
»Das ist nicht komisch, Greta. Was ist aus meinem Leben geworden? Wozu lebe ich es? Lauwarm, grau, mittelmäßig. Ein mittelmäßiger Mann beendet eine mittelmäßige Beziehung mit mir, einer mittelmäßigen Ehe wegen, und ich breche zusammen, als sei es mein Tod. Wenn ich jetzt sterben müsste … Hast du einmal darüber nachgedacht, wie die Summe deines Lebens aussehen würde, wenn du jetzt sterben müsstest? Du gehst zur Haustür hinaus auf die Straße, du wirst überfahren und da liegst du und spürst, dass du stirbst, und du fragst dich, ob das alles für irgendwas gut war. Oder du bekommst Krebs. Das kann so schnell gehen; in ein paar Wochen bist du tot. Oder Herzinfarkt. Schlaganfall. Unglaublich viele Leute sterben einfach so, ganz schnell.«
Greta setzte sich zu Miriam auf die Couch und legte den Arm um ihre Schultern. »Das ist morbide. Du wirst noch lange nicht sterben.«
»Verstehst du nicht? Dieser Gedanke an den Tod tut mir gut. Er weckt mich auf. Ich habe den Gedanken an den Tod gehasst – das totale Versagen, schuldig gesprochen, das Ende des Tunnels ohne Ausgang. Aber es könnte anders sein.« Sie hob die Hand mit einer beschwichtigenden Geste. »Vergiss es. Vielleicht ist es die Vierzigerkrise. Vielleicht liegt es an den Hormonen. Morgen bin ich wieder fit. Oder übermorgen. Auf jeden Fall geh ich nicht mehr ins Labor. Ich möchte nie mehr am Montagmorgen hören müssen, wen mein Ex am Sonntag im Tennis besiegt hat.«
Greta kicherte beruhigt und überredete sie, am Wochenende zu einer Party zu kommen. Sie müsse aus ihren vier Wänden heraus und andere Leute sehen, dann würde sie auch auf andere Gedanken kommen. Miram seufzte, als die Tür hinter der Freundin ins Schloss fiel. Plötzlich erkannte sie, wie sehr Greta das fürchtete, was sie Miriams »Zustände« nannte. Du musst positiv denken, sagte Greta, du darfst dich nicht gehen lassen. Sie war eine gute Freundin, voller guter Ratschläge. Auf dem Kampfplatz ihrer Freundschaft fochten sie seit Jahren mit den ungleichen Waffen der Depression und der guten Ratschläge. Gretas Siege waren Miriams Einsamkeit. Einsamkeit, das ist das Einzige, was von mir da ist, dachte Miriam. Ich lebte schon immer wie hinter einer Tür, die offen steht und durch die viele Leute aus und ein gehen und nicht bemerken, dass dahinter jemand ist.
Mit einem Gefühl verzweifelter Entschlossenheit legte sie sich auf die Couch und überließ sich Dawas Erinnerungen an den sanften Jungen aus dem Nachbardorf, den sie nicht haben durfte, an Zärtlichkeit ohne Hast und eine Liebe, so offen wie ein weiter, weiter See.
Dawa
Der Klang der Becken und der großen Trommeln lässt die Erde erzittern – oder sind es die unzähligen Füße der Besucher im Klosterhof oder die Wucht, mit der die Tänzer in den Kostümen der zornvollen Gottheiten aus dem Eingang des Lhakang stürmen? Dawa zwängt sich in die erste Reihe der Zuschauer und hält den Atem an. Seit ihrer Kindheit erlebt sie bei jedem Klostertanz erneut das zugleich erschreckte und beglückte Herzklopfen, wenn die brokatfunkelnden, Schwerter schwingenden, gekrönten Riesen in den Klosterhof tanzen, mit gewaltigen, ausgreifenden Schritten. Beschützer, Befreier, wilde Väter der höheren Welt. Sie drehen sich mit ausgebreiteten Armen und in Dawa steigt das Bild der Geier auf, die über einer Himmelsbestattung kreisen. Einmal ist sie mit Dölma und Nangsa vor Beginn der Morgendämmerung zum Bestattungsplatz des Klosters hinaufgeschlichen. Hinter Felsen verborgen haben sie dem Zerhacken der Leichen zugeschaut, während die Geier auf den großen, flachen Steinen landeten, ungeduldig mit den Flügeln schlugen und auf ihr Festmahl warteten.
Unversehens begegnet ihr Blick dem Auge eines Tänzers zwischen den Fangzähnen seiner Maske. Erschreckt drückt sie sich zurück in die Menge. Es sind Menschen unter den Masken, Mönche, das weiß sie, doch zugleich sind auch die Gottheiten da, die durch den Tanz herbeigerufen werden. Es wäre unklug, sich auf das eine oder das andere festzulegen, hat der junge Rinpoche des Klosters einmal gesagt. Sie hat es nicht verstanden, aber den Satz nicht vergessen können.
Sie hält nach ihren Eltern Ausschau, die im Gedränge verschwunden sind. Nicht weit entfernt sieht sie eine kleine Gruppe stehen, ein paar nichts sagende Rücken, doch dazwischen – ihr Herz beginnt zu rasen und ihre Wahrnehmung verengt sich auf diesen einen Ausschnitt im Klosterhof, so dass sie nichts mehr hört und spürt, nur noch ausgeliefertes Sehen ist – steht Lobsang und neben ihm ein scheues Mädchen mit den roten, erfrorenen Wangen der Nomaden.
So schnell sie auch in eine andere Richtung schaut, das Bild bleibt. Ganz nah steht sie bei ihm, diese Fremde, hat ihn schon eingehüllt in ein schweigendes, unbeirrbares Besitzrecht. Dawa richtet sich auf und hebt nachdrücklich den Kopf, bis die Halsmuskeln schmerzen. Natürlich wussten alle im Dorf von ihren Treffen mit Lobsang. Tuscheln die Leute über sie? Lacht man schon über sie?
»Dawa, da bist du ja, komm schnell!« Die aufgeregte Stimme ihrer Mutter prallt gegen die scharfen Klänge der großen Becken. Ein Mann, den sie nicht kennt, steht bei ihren Eltern und Verwandten. Er begrüßt Dawa mit einem leichten Neigen des Kopfes.
»Du sollst dem Fürsten vorgestellt werden.« Die Mutter zupft atemlos an Dawas Zöpfen, der Vater berührt aufmunternd ihre Schulter. Mit höflich gesenktem Kopf folgen die beiden dem Mann zu den Ehrenplätzen auf der breiten Klostertreppe. Nur Dawa lässt ihren Kopf, wo er ist, aufgerichtet mit mühsamem Stolz.
»Warum?«, versucht Dawa zu fragen, doch der Mann geht mit schnellen Schritten voran und die Leute weichen vor ihm zurück; ihre Stimme verliert sich im aufgeregten Ziehen und Schieben ihrer Eltern. Es ist eine außergewöhnliche Ehre, dem Fürsten vorgestellt zu werden. Alle werden es sehen. Niemand wird über sie lachen. Sie reckt den Hals noch ein wenig mehr. Gegen den Schmerz hilft es nicht.
»Hier ist das Mädchen, Hoheit«, sagt der Mann, und Dawa und ihre Eltern verbeugen sich tief. Dawa bleibt gebückt stehen, wie es sich gehört. Sie kann nur einen flüchtigen Eindruck vom Gesicht des Fürsten erhaschen: den scharfen, prüfenden Blick, der sie klein macht, große Lippen, ein an den Mundwinkeln herunterhängender Schnurrbart, breite, schwere Hände.
Warum will der Fürst ihr Alter wissen? Warum sagt ihre Mutter die Unwahrheit, erklärt sie für ein Jahr jünger, als sie tatsächlich ist? Warum soll sie nicht achtzehn Jahre alt sein, siebzehn und eines dazu im Mutterleib? Warum sagt der Vater, ihre Gesundheit sei empfindlich? Stark und klug wie ein erwachsener Mann sei seine groß gewachsene Tochter, hat er zu den anderen Männern gesagt, als sie das letzte Mal den weiten, beschwerlichen Weg zu Lama Pema, dem Einsiedler in der kleinen Gompa auf dem Berg, hinaufgegangen sind.
»Sie sieht gesund aus«, sagt der Fürst und streicht über seine schwarzen Schnurrbartenden. Mit einer beiläufigen Geste entlässt er die Familie. Viele Gesichter sind ihnen zugewandt, als sie die Treppe wieder hinuntersteigen. Der Zeitpunkt war gut gewählt, man hat uns gesehen, stellt Dawa befriedigt fest, denn im nächsten Augenblick hüpfen die Schneelöwentänzer in den Kreis und lenken mit ihren närrischen Sprüngen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Die Sorge im Gesicht der Mutter sieht sie nicht.
Der Vater und die Verwandten haben auf der Wiese vor dem Kloster das große, schön verzierte Zelt aus Yakhaar aufgestellt, in dem sie die Nacht verbringen werden. Die leichten, aber dennoch wasserdichten Zeltwände lassen das Licht der Lagerfeuer durchscheinen. Es wird warm, als sich nach und nach alle Verwandten versammeln, die darin schlafen werden. Das Zelt ruft Erinnerungen an die vielen mehrtägigen Ausflüge der Familie wach, bei denen es als Behausung diente.
»Sagt mir endlich, was das heute bedeuten sollte mit dem Fürsten«, fragt Dawa und bringt damit alle zum Schweigen. Niemand antwortet ihr. Dann reden sie plötzlich von anderen Dingen und Dölma flüstert ihr zu: »Nicht jetzt!«
»Warum hat Pala wegen meiner Gesundheit gelogen?«, flüstert Dawa zurück.
Dölma hebt abwehrend die Hände. »Was weiß ich. Es hat sicher nichts zu bedeuten.«
Kaum zu Hause, sieht Dawa am Morgen fremde Männer kommen und am Mittag wieder gehen. Sie sehen nicht aus wie die Kaufleute, mit denen der Vater auf Handelsreisen geht. Diese fremden Besucher sind aufwändig gekleidet, ihre Mäntel haben breite Brokatränder und in ihrer Haltung liegt die gezügelte Ungeduld derer, die es gewohnt sind zu befehlen.
»Die kamen vom Fürsten«, sagt Dawa. Und Dölma, ihre Vertraute, ihr Schatten, verzieht das Gesicht und schweigt. Sie darf nichts verraten, die zukünftige Braut darf nichts wissen, das bringt Unglück. Doch das ganze Haus summt und zittert vor Wissen.
Dawa stürmt in das Empfangszimmer, in dem die Eltern und die Großeltern und die nächsten Verwandten aufgeregt schwatzend zusammensitzen.
»Das waren die Männer des Fürsten, ist es nicht so?«, fragt sie fast flüsternd. Doch jeder hat sie gehört. Das Schweigen fällt wie ein Stein vor ihre Füße.
Die Mutter zieht ärgerlich die Brauen zusammen. Der Vater sitzt da mit gesenktem Blick. Alle schweigen. Dawas Blick sucht die Großmutter, die unbeteiligt ihre Gebetstrommel dreht.
»Sie ist nicht blöd«, bellt die Großmutter mit ihrer heiseren Stimme.
»Stimmt, ich bin nicht blöd«, sagt Dawa und wendet sich Hilfe suchend an ihren Vater. »Pala, bitte – was ist los?«
Der Vater räuspert sich. »Nun ja …« Er wirft einen unsicheren Blick auf seine Frau. »Der Fürst sucht eine neue Frau. Seine frühere Frau ist gestorben. Alle Kinder starben – ich glaube, es waren fünf – außer einem, und dieser Sohn ist kränklich. Man hat ihn in ein Kloster gegeben. Jetzt will der Fürst eine junge, gesunde Frau …«
»Aber er ist alt«, entfährt es Dawa. Eine junge Cousine kichert.
Die Mutter legt die Hand auf Dawas Arm. »Aber Kind …«
»Er ist nicht älter als ich«, erklärt der Vater ruhig, »und er ist der Fürst.«
»Er ist ein alter, unfreundlicher Sack.« In der hohen, brüchigen Stimme der Großmutter schwingt eine Mischung aus Lachen und Ärger mit. »Und er ist ein alter, reicher Sack.«
Der Großvater stößt seine Frau unsanft in die Seite und schüttelt den Kopf. Seit einiger Zeit sagt sie Dinge, die man nicht ausspricht. Doch sie ist ein altes Weib und hat das Recht, verrückt zu sein.
»Alter Sack«, murmelt die Großmutter noch einmal und schmatzt laut. Die junge Cousine kichert wild.
Dawa schüttelt die Hand ihrer Mutter ab. »Ich will keinen Fürsten. Ihr wisst genau, wen ich will.«
»Er wollte dich nur sehen«, sagt der Vater. »Es ist ja noch nichts fest entschieden.«
Die Großmutter räuspert sich laut und gründlich. »Glaub ihm nicht«, sagt sie. »Er hat nichts zu entscheiden.«
»Ich will das nicht«, presst Dawa hervor, »das könnt ihr mir nicht antun.«
Der Vater wendet gequält den Blick ab. »Es muss sein. Niemand widerspricht dem Fürsten. Du solltest an deine Familie denken.«
»Es ist doch eine so große Ehre«, sagt die Mutter. »Und du wirst reich sein. Denk an all die schönen Kleider und den Schmuck. Es ist ein großes Glück für uns alle.«
»Aber ich fürchte mich vor ihm.« Dawa sieht den herunterhängenden Schnurrbart und die großen Hände vor sich. Lobsangs Hände sind lang und schmal und an seiner Nase sieht man keine großen Poren und herausragenden Haarbüschel wie beim Fürsten.
»Sei kein dummes Kind«, sagt der Vater und steht auf.
»Sie ist kein dummes Kind«, schimpft die Großmutter. »Sie fürchtet sich, hörst du nicht?«
»Amala, misch dich nicht ein.« Das Gesicht des Vaters rötet sich zornig. Die alte Frau kichert und hustet Schleim. Dazwischen hört man halblaute Wortfetzen wie »alter Sack« und »Dummkopf«, vermischt mit den Silben des Mani-Mantras, OM MANI PEME HUM. Der Vater legt seinen Arm um Dawa und zieht sie an sich. »Der Fürst ist mächtig«, sagt er, »alle müssen ihm gehorchen. Wenn wir uns weigern, wird er uns vernichten. Er wird uns das Land wegnehmen und das Haus und meine Waren und alles, was wir besitzen.«
Dawa wirft der Großmutter einen Blick zu. Doch die alte Frau ist still geworden und nickt vor sich hin. »OM MANI PEME HUM«, murmelt sie und lässt ihre Mantra-Kette durch die Finger gleiten.
»Du wirst es gut haben«, mischt sich die Mutter ein, »du wirst die Fürstin sein. Und du kannst uns besuchen kommen und wir besuchen dich.«
Dawa hebt in hilfloser Beschwörung die Hände. »Warum durfte ich Lobsang nicht haben? Dann wäre ich jetzt seine Frau und der Fürst könnte gar nichts machen. Aber er war euch nicht gut genug. Immer denkt ihr nur an euch.«
»Du hast dieser Tochter zu viel durchgehen lassen«, sagt die Mutter zum Vater gewandt. Dawa bohrt den Blick in den Boden. Plötzlich hat sich ein Netz der Missbilligung über sie gelegt, als sei sie nicht das Opfer, sondern schuldig gesprochen, eine Übeltäterin im Kreis einer Familie, die bereit ist, sie auszustoßen, um sich selbst zu retten. Die Hilflosigkeit macht sie stumm.
»Wir haben keine Wahl«, sagt der Vater und reibt mit einer Hand den Rücken der anderen, wie er es immer tut, wenn ihm die Herrschaft über den Augenblick entgleitet. »Mit einem Nein würde ich die ganze Familie ins Unglück stürzen. Das kannst du doch nicht wollen.«
Dawa läuft hinaus in den Flur und fast fällt sie über die hohe Schwelle in ihrer Hast. Dölma, die sich mit der Zofe der Mutter und den beiden Dienern an der offenen Tür herumgedrückt hat, folgt ihr und ruft: »Dawa, Kindchen, warte doch!«
In dem Zimmer, das Dawa mit Dölma und ihren beiden Cousinen teilt, wirft sie sich auf ihr Schlafpolster. Sie möchte weinen, doch ihre Augen sind trocken und heiß.
»Sie haben gesagt, dass ich mit dir gehen darf. Du wirst nicht allein sein.« Dölma ist ihr gefolgt und hat sich neben sie gesetzt. »Und es ist ja noch nicht so weit.«
Dölma hat Recht. Es wird noch lange dauern. Zuerst muss ein Astrologe befragt werden, ob die vorgesehene Braut für den Fürsten geeignet ist, aber jeder Astrologe wird selbstverständlich eine gute Konstellation bestätigen, denn die Stimme des Fürsten wiegt mehr als der Stand der Sterne. Dann muss ein günstiges Datum für das Abschließen des Ehevertrags gefunden werden. Die Unterhändler werden kommen und die Eltern werden sagen: Unsere einzige Tochter ist so jung, wir wollen sie noch ein wenig behalten, ein paar Monate wenigstens oder ein Jahr.
Dawas Gedanken kreisen und beginnen sich damit zu befassen, was sie alles mitnehmen möchte, wenn sie zum Dzong des Fürsten gebracht wird: ihr Pferd und ihren Lieblingshund und den schönen Wandteppich, an dem sie ein ganzes Jahr lang gearbeitet hat, die Statue der Arya Tara auf ihrem Schrein und die kostbare Vase, die ihr Vater einem chinesischen Händler abgekauft hat.
Als sie am Nachmittag bei der Großmutter auf dem Dach sitzt, legt sie den Kopf in den Schoß der alten Frau und kann endlich weinen.
»Frauen haben nun einmal das schlechtere Ende des Stricks«, sagt die Großmutter und tastet mit den Händen nach Nissen in Dawas Haaren. »Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist eben so. In China ist es noch viel schlimmer, sagen sie. Dort binden sie den kleinen Mädchen die Füße ein, damit sie kleine Klumpfüße bekommen und nur trippeln können. Was müssen sie leiden, die armen Dinger. Schau nur deine schönen, großen Füße an.« Kichernd stößt sie mit ihrem nackten Fuß gegen Dawas Bein.
»Viel zu groß«, schnieft Dawa und zieht halb lachend die Füße unter ihr Kleid. Diese Füße sind zu groß, das kann jeder sehen. Ob sie im Dzong des Fürsten Schuhe tragen muss? Wahrscheinlich erwartet man das von ihr, wenn sie erst Chemkusho ist, die edle Dame.
»Mola«, sagt sie leise, »wie ist das, wie oft muss eine Ehefrau, ich meine, wie oft muss sie …«
Die Großmutter kichert. »Du meinst, wie oft muss sie den Hintern hinhalten?«
Dawa wischt ihre Tränen ab und kichert mit. »Tante Döndup macht immer Andeutungen, jetzt sei der Monat bald um, jetzt müsse sie ja wohl mal wieder, sonst bekäme der Onkel schlechte Laune.«
»Oh-oh, Loten ist nicht mehr, was er mal war, der alte Furz mit seinen stinkenden Zähnen. Na ja, meine stinken auch. Viele sind es ja nicht.«
Sie lachen zusammen, die alte Mola und Dawa, und die Cousinen schauen von ihren Webstühlen herüber und grinsen ein bisschen mit.
»Du hättest Döndup sehen sollen, als man sie mit Loten verheiratet hat«, plappert die Großmutter vor sich hin, »so ein junger Gockel, ein gutes Stück Mannsbild. Gerade dass sie sich nicht auf dem Boden gerollt hat, ha! Na, ich war auch nicht anders, zum Platzen reif wie eine Erbsenschote.«
Dawa sieht Lobsang vor sich, Lobsang, der die Arme für sie öffnet. Doch nein, nicht sie ist die Erbsenschote, das ist die andere, die mit den roten Backen, die neben ihm stand.
»… und mein Bräutigam war so betrunken, dass sie ihn ins Bett tragen mussten«, hört sie die Großmutter sagen. »Erst zwei Nächte später bediente er mich. Ah la la, er konnte feiern, dein Großvater.«
Während Molas Erzählung weiterplätschert, überlässt sich Dawa ihrem bevorzugten Tagtraum, den sie in den vergangenen Wochen vielfältig ausgestattet hat – ihre Flucht mit Lobsang zu den Nomaden. Sie schlagen sich durch ins Grasland, wo es keine Bäume gibt und die Nomaden in ihren Zeltdörfern leben, und sie finden eine Familie, die den ältesten Sohn verloren hat und dringend Hilfe braucht. Dort werden sie aufgenommen, Lobsang kümmert sich mit den anderen Söhnen um die Herde und die Mädchen sind begeistert, wie schön Dawa weben kann. Sie bekommen ein eigenes Zelt, wie es Brauch ist für die Jungvermählten, und jede Nacht liegen sie glücklich beisammen zwischen den warmen Fellen und lauschen dem Heulen der Hunde und dem sanften Schnauben der Pferde hinter der Zeltwand, durch die der Mond scheint wie eine himmlische Butterlampe.
»OM MANI PEME HUM«, murmelt die Mola und streicht sanft über Dawas Haar. »Es wird schon für was gut sein. Alles kann für etwas gut sein. Man muss nur dafür sorgen, dass es so ist.«
Miriam
In dem Augenblick, in dem sie das Gartentor öffnete und in das Gebrodel von Stimmen und Musik eintauchte, erkannte sie, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatte. Viermal hatte sie die Kleider gewechselt, um sich schließlich für einen Tarnanzug aus schwarzer Hose und Hemdbluse mit dunkelvioletter Weste zu entscheiden, das Haar zurückgebunden, die Finger- und Fußnägel farblos lackiert. Das Sichunsichtbarmachen war eine besondere Kunst. Sie hatte sich darin vertieft, sie verfeinert, Meisterschaft angestrebt. Die Kleidung spielte eine bedeutende Rolle. So unauffällig musste sie sein, dass später niemand würde sagen können, was sie getragen hatte. Dazu ein kaum merklicher Hauch eines Parfüms, das gerade in Mode ist. Ein Allerweltsgeruch, in dem man sich verbergen konnte. Außerdem musste man die persönliche Energie, diesen psychischen Geruch, gut bei sich behalten. Die Haltung nicht zu sehr aufgerichtet, eine ganz leichte Beugung, die ausdrückte, dass keine großen Forderungen an das Leben gestellt wurden. Wer den Kopf zu weit oben trug, wurde sichtbar. Möglichst wenig Augenkontakt. Wenn er unumgänglich war, konnte man ein halbes Lächeln ohne Farbe zwischen sich und den anderen stellen.
Über all dies musste Miriam nicht nachdenken. Ihr Körper wusste es. Ihr Geist wusste es. Sie hatte es früh gelernt.
»Wie schön, du bist wieder unter den Lebenden!«, rief Greta mit aufrichtiger Freude.
Aber ich denke nicht die Gedanken, die du haben möchtest, dachte Miriam ohne Bedauern. Sie erwiderte die Umarmung mit einer kraftlosen Geste, doch es gelang ihr ein beruhigendes Lächeln. »Ich war noch nicht tot, Greta.« Natürlich war es der falsche Scherz.
»Hier, das ist gut für dich«, erklärte Greta und drückte ihr ein Glas Sekt in die Hand. Gretas aufrichtige Freundlichkeit war ein unwillkommenes Geschenk. Miriam machte sich klein und ließ die Schultern nach vorn hängen. Ihre Unsichtbarkeit bekam Risse. Sie nickte mit dem letzten Rest des Lächelns, bevor sie sich umwandte und sich fragte, in welcher Rolle sie sich verbergen könnte.
Der größte Teil der Gäste tanzte. Sie war spät genug gekommen, um dem lauten Ritual der gegenseitigen Begrüßung zu entgehen. Warum war sie hier? Warum waren alle diese Leute hier? Sie sollte sich vergnügen, es wurde von ihr erwartet. Doch es war so anstrengend, sich zu vergnügen. Wie sehr sie sich immer angestrengt hatte! Und danach, spätestens am nächsten Morgen, hatte sich fast immer dieses schale Gefühl eingestellt: Wozu das alles? Langweilerin, hatte sie sich selbst gerügt, alle vergnügen sich, nur du nicht. Als fehle ihr etwas, das andere hatten, ein Lustsinn, ein Vergnügungsenzym, oder reichte ihre Fantasie nicht aus für die nötigen Erwartungen, die man mitbringen und mit köstlichen Illusionen füllen musste?
Sie leerte ihr Glas, nahm ein weiteres von einem Tablett, trank es schnell aus und drückte sich an den Tanzenden vorbei zur offenen Terrassentür. Draußen war es feucht und kühl. Im Schutz der Hauswand setzte sie sich auf einen Gartenstuhl. Das Licht aus dem Fenster fiel auf eine verlassene Spinnwebe am Rahmen, ein feines, klares Muster aus silbern glitzernden Fäden, ein Stückchen Welt voller Ordnung. So sah einst das Kind Miriam die Welt, so nah. Eine Mücke im Limonadeglas, vorsichtiges Hantieren mit dem Strohhalm, halt dich fest, kleine Mücke, deine Zeit ist noch nicht gekommen, deine Flügel werden trocknen und du wirst davonfliegen in die weite Welt, auf ein Marmeladebrot oder in den Spalt, den der Deckel des Mülleimers offen gelassen hat. Und dann sagten sie: Lass das, Kind, mach sie tot! Mücken retten, was für ein Unfug!
Ein Hauch von Rosenduft aus einem Nachbargarten zog sanft über die Terrasse. Die Stimmen im Haus zerflossen mit der Musik, trugen Miriam davon, an den Rand der Schwärze, in die zu stürzen sie bereit war, so sehr bereit.
Dawa
Die Sonne beginnt bereits ein wenig zu wärmen, doch im Schatten der niedrigen Bäume ist es noch eiskalt. Dawa hat schon ein gutes Stück Weg zur kleinen Gompa auf dem Berg zurückgelegt. Nur Dölma hat sie ins Vertrauen gezogen, als sie am Tag zuvor heimlich ein Säckchen Tsampa, Ziegeltee, einen Beutel voll getrockneter Erbsen und einige Streifen Trockenfleisch zusammentrug und in ein Bündel packte, um Lama Pema eine angemessene Gabe mitzubringen. Noch bevor das Haus zu geschäftiger Unruhe erwacht ist, hat sie sich durch das kleine Tor davongemacht, nur von ihrem Lieblingshund Dorje begleitet. Erst später, wenn ihre Abwesenheit auffällt, wird Dölma preisgeben, wohin die Tochter des Hauses gegangen ist. Denn die Eltern hätten sie nicht allein gehen lassen, obwohl sich keine Räuberbanden in der Gegend herumtreiben; dafür hat der Fürst gesorgt. Die Räuber fürchten den Fürsten mehr als böse Geister und Dämonen, sagen die Leute.
Ein kleiner Wald drückt sich an die weit geschwungenen Hänge, über die der kaum sichtbare Pfad aus dem Tal hinauf in die Berge führt. Nicht die kleinste Wolke stört den unendlichen Raum des Himmels. Dawa seufzt. Ohne Zweifel, der Himmel ist blau, die Bäume sind grün, doch in Dawas Geist sind sie grau, denn in Dawas Geist gibt es heute keine Farbe. Sie kann sich erinnern, dass es ein Blau voller Freude und ein satt lebendiges Grün gegeben hat, vielleicht auch wieder geben wird, doch jetzt durchdringt Farblosigkeit alles, was ist.
Augenblicke mit den Cousinen auf dem Dach fallen ihr ein. Wird sie jemals wieder so lachen können wie mit den Mädchen an den Webrahmen und den Dienern, die in der sanften Nachmittagssonne Sättel flicken und die schweren Chubas zusammensticheln? Niemand sagt ihr, wie das Leben im Dzong sein wird, und sie kann nicht fragen, denn es ist ja unschicklich, dass ein junges Mädchen weiß, wen es heiraten wird. Selbst wenn alle wissen, dass sie es weiß, gehört es sich, den Schein zu wahren. Alle reden um Dawas Leben herum, freundlich – unnatürlich freundlich. Als sei sie eine Fremde im Haus. Das leise Würgen im Hals will gar nicht mehr aufhören.
Die Sonne steht halb am Himmel, als sie den felsigen Steilhang erreicht, an dem die kleine, ockerfarbene Gompa klebt wie das Nest eines riesigen Vogels, nicht mehr als eine Erweiterung der dahinter liegenden engen Höhle. Dort oben wohnt Lama Pema in einer Kammer neben dem winzigen Tempelraum, zündet täglich die Butterlampen auf dem Schrein an und lässt die seltenen Besucher ein, die ihm Lebensmittel bringen und ihre Niederwerfungen vor der kleinen Statue der Senge Döngma, der löwenköpfigen Dakini, machen wollen.
Eine Yogini, eine große Verwirklichte, habe vor langer Zeit in dieser Höhle gelebt und meditiert, heißt es, und eines Tages erschien die rote Senge Döngma und sie kam immer wieder und mancher Besucher konnte sie sehen. Als die Yogini starb, hinterließ sie nur Haare und Nägel und Zähne.
Viele Male, seitdem sie in ihrem zehnten Lebensjahr zum ersten Mal dabei war, ist Dawa mit ihrem Vater und seinen Freunden an Vollmondtagen zu Lama Pema hinaufgestiegen.
»Sie kommt mit«, erklärte damals der Vater seinen Freunden, »sie ist gescheiter als alle eure Jungs zusammen.« Die Männer lachten und drückten ihr zwei große Teeziegel in die Hand, damit auch sie Verdienste erwerben konnte, indem sie einen Teil der Versorgung des heiligen Mannes zur kleinen Gompa hinauftrug. Dann setzten sie sich um Lama Pema herum und mit höflicher Atemlosigkeit stellten sie ihm Fragen über das Leben und den Tod, wie man Sorgen loswerden könne, was man tun solle, wenn die Wunde am Fuß eines guten Yaks nicht heilte, oder wie man sich nachts gegen böse Geister schützen könne. Dawa pflegte nur wenig von Lama Pema zu erzählen, wenn ihre Freundin Nangsa und die Töchter der Nachbarn etwas über ihre Ausflüge in die Einsiedelei hören wollten. Ach, er hat sich über den Tee gefreut, der arme Alte, sagte sie, oder: Der Weg ist ganz schön weit, vielleicht bleibe ich nächstes Mal daheim. Nie hat sie verraten, wie sehr sie stets darauf wartete, dass ihr Vater am Abend erklärte: Stell deine guten Stiefel bereit, morgen gehen wir früh los. Keines der Mädchen sollte auf den Gedanken kommen, auch mitgehen zu wollen. Lama Pema und sein dunkler, geheimnisvoller Tempel waren Dawas heimliche Freude. Sie würden es bald nicht mehr sein.
Auf den schmalen, in den Fels gehauenen Stufen, die zu dem einsamen Heiligtum hinaufführen, tastet Dawa sich vorsichtig nach oben. Sie hat diese Stufen noch nie leiden können. Nur die vordere Hälfte ihres Fußes hat darauf Platz, und wäre da nicht das dicke Seil, an dem man sich festhalten kann, wäre sie wohl nie hinaufgestiegen. Der Hund hält sich hinter ihr, als wache er über ihre Schritte.
Lama Pema singt. Noch nie zuvor hat sie Lama Pema singen hören. Sie hält inne, überwältigt von der plötzlichen Flut von Farbe, die allen Dingen wieder Leben gibt. Die tiefe, zärtliche Stimme füllt den blauen Himmel, so sanft und mächtig, dass man zugleich lächeln und weinen muss und überall ganz weich wird, im Herzen und in den Knien. Als wäre Lama Pema sehr, sehr glücklich und sehr, sehr traurig; doch wie kann man glücklich und traurig zugleich sein? Dawa wischt die Träne ab, die über ihre Wange rinnt, und lacht ein bisschen. Ist dies doch gerade ihr eigenes Gefühl, so seltsam glücklich und traurig, weil Lama Pemas Stimme und der Himmel und die Berge so schmerzhaft schön sind.
Als sie den breiten Felssims am Ende der Treppe erreicht, nähert sie sich dem Lama gebückt und mit zum Gruß gefalteten Händen. Der alte Mann sitzt auf einer dünnen Matte in der Sonne und tätschelt mit der Handfläche den Boden, sie möge sich zu ihm setzen. Mit sanfter Aufmerksamkeit wendet er ein Blatt des Textes in seinem Schoß und singt weiter. Dawa lässt sich in respektvoller Entfernung nieder, den Blick nur leicht gesenkt, so dass sie ihn am Rand ihres Blickfelds gut sehen kann. Und sie sieht ihn, als begegne sie ihm zum ersten Mal.
Nie zuvor hat sie sich gefragt, wie alt er wohl sei, wie lang er schon als Hüter des Heiligtums hier leben möge. Lama Pema ist einfach da, ist immer schon da gewesen, solange sie sich erinnern kann, alterslos in seinem bräunlich grauen Gewand, das die ursprüngliche Farbe kaum mehr ahnen lässt. Einmal haben die Männer ihm ein dickes wollenes Tuch mitgebracht, tiefrot, wie es die Mönche tragen. Lama Pema lächelte und rollte es auf dem Schoß zusammen, und beim nächsten Besuch sahen sie, dass er es der zierlichen Statue in der Höhle umgehängt hatte, so dass nur noch ihr wildes, lachendes Löwengesicht zu sehen war.
Die Filzmütze auf Lama Pemas großem Kopf, oben spitz zulaufend und an beiden Seiten mit je einem langen Stofflappen versehen, ist ausgebleicht wie ein alter Knochen. Nie hat Dawa ihn ohne seine Mütze zu Gesicht bekommen. Ob er sie nachts ablegt? Und die Knötchen, die er in seinen dünnen, glatten, grau durchzogenen Bart geknüpft hat – löst er sie jemals?
Der Hund hat sich neben sie gelegt, er winselt ein wenig im Schlaf und zuckt mit den Beinen. Lama Pema beendet seinen Gesang, häufelt die Blätter seines Buchs zusammen, packt sie zwischen die hölzernen, geschnitzten Deckel und wickelt sorgfältig das ausgeblichene Tuch in seinem Schoß darum. Dawa zieht das Bündel mit den Geschenken aus ihrem weiten Mantel und hält es dem Lama schicklich mit beiden Händen hin.
»Du kommst ganz allein?«, fragt Lama Pema. Nun sollte sie sich nach seinem Befinden erkundigen und berichten, wie es ihrem Vater und ihrer Mutter geht, so verlangt es die Höflichkeit; doch sie kann ihre schmerzliche Nachricht nicht aufhalten, die Worte fallen wie Steine aus ihr heraus, zusammen mit dem Schluchzen und den Tränen.
»Ich muss den Fürsten heiraten. Sie sagen, es muss sein. Aber er ist alt und ich fürchte mich vor ihm. Ich will zu Hause bleiben, Lama-la. Ich will zu Hause bleiben.«
Lama Pemas freundlicher Blick liegt lang auf ihr. Sie fällt in diesen Blick hinein, bis sie ganz darin aufgehoben ist.
»Es war einmal ein Bauer«, sagt der Lama schließlich, »der hatte einen einzigen Sohn. Sie waren arme Leute und ihr einziger Besitz war ein Pferd. Eines Tages lief das Pferd weg. Da kamen die Nachbarn herbei und bedauerten den Bauern und sagten: Ach, du Armer, nun hast du nicht mal mehr ein Pferd, was für ein Unglück. Doch der Bauer wiegte nur den Kopf und sagte: Ist es ein Unglück? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Kurze Zeit später kam das Pferd zurück und mit ihm eine ganze Reihe von Wildpferden. Da kamen die Nachbarn herbei und beglückwünschten den Bauern und sagten: Ach, du Glückspilz, nun hast du eine ganze Pferdeherde, was für ein Glück. Doch der Bauer wiegte nur den Kopf und sagte: Ist es ein Glück? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Dann begann der Sohn des Bauern die Wildpferde zuzureiten. Ein Pferd warf ihn ab und er brach sich den Arm. Da kamen die Nachbarn herbei und bedauerten den Bauern und sagten: Ach du Armer, nun hast du nicht mal mehr deinen einzigen Sohn als Hilfe, was für ein Unglück. Doch der Bauer wiegte nur den Kopf und sagte: Ist es ein Unglück? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da brach ein Krieg aus und alle jungen Männer mussten in den Krieg ziehen, nur der Sohn des Bauern nicht, denn mit seinem gebrochenen Arm taugte er nicht für den Krieg. Weißt du, was die Nachbarn sagten? Und weißt du, was der Bauer sagte?«
»Man weiß es nicht, man weiß es nicht«, antwortet Dawa erheitert.
In erzählendem Singsang fährt Lama Pema fort: »Es war einmal ein junges Mädchen, das sollte einen Fürsten heiraten …«
»Ich hab es schon verstanden.« Dawa schüttelt ein wenig verwirrt den Kopf. Es spielt keine Rolle, was geschehen wird! Hat Lama Pema dies gesagt oder ihr eigener Geist? Sie fürchtet sich nicht mehr. Alles Mögliche kann geschehen. Alles Mögliche geschieht.
»Komm mit«, sagt Lama Pema schließlich und steht auf. Dawa folgt ihm in die Gompa und wird aufgesogen von einem überwältigenden Dunkel, das die schwachen Lichtpunkte der Butterlämpchen kaum zu durchdringen vermögen. Blind tastet sie sich voran, geführt vom schweren Geräusch des Tuchs um Lama Pemas Schultern. Bald beginnt sich der Druck der Dunkelheit auf ihren Augen zu lösen und die Gestalt der löwenköpfigen Gottheit taucht auf, eine Ahnung von tiefem Rot, schimmernde Flecken der vergoldeten Flammenaureole, ein Aufblitzen der Reißzähne. Dawa begrüßt die Gottheit mit drei Niederwerfungen und setzt sich dann neben den Lama auf eine Matte vor den Schrein, auf dem die Statue steht. Das schöne rote Tuch liegt zu ihren Füßen und bedeckt halb die Leiche, auf der sie tanzt – die Leiche der schlechten geistigen Gewohnheiten, wie Lama Pema erklärt hat. Gier, Wut, Verblendung.
»Wenn du Senge Döngma rufst«, sagt Lama Pema, »wird sie kommen und dich beschützen.«
Er erklärt ihr, wie sie die Weisheits-Dakini mit dem ihr zugehörigen Mantra rufen kann, und lässt sie mehrmals die Sätze der Liturgie wiederholen; die man vor und nach der Anrufung spricht.
»Sie ist die herrliche, reine, tanzende Weisheit deines ursprünglichen Geistes«, sagt Lama Pema, »verstehst du das? Nein? Macht nichts. Du wirst es verstehen lernen. Denke nur daran, dass sie nicht von dir getrennt ist. Sie beschützt deinen Geist. Sobald du dich an sie wendest, ist sie bei dir. Wenn du sie jedoch vergisst, kann sie dir nicht helfen. Also vergiss sie nicht. Begrüße sie am Morgen und bitte sie um Schutz in den Träumen am Abend. Und denke daran: Bitte sie um Schutz für dich selbst und alle fühlenden Wesen.«
Der alte Mann holt eine Teekanne und füllt zwei Holzschalen und dann spricht er zu ihr, viele wieder und wieder gefüllte Schalen lang. Dawa drückt die gefalteten Hände gegen ihre Brust. Niemals wird sie Senge Döngma vergessen, auch wenn sie vieles nicht begreift, was Lama Pema sagt. Doch wie er es sagt, ist es ein Versprechen und gibt ihr Gewissheit. Sie lässt jedes Wort, jeden Satz in sich einsinken, hüllt sie in ihre Aufmerksamkeit ein wie in kostbaren Brokat, bewahrt sie auf in ihrem Geist: dass Senge Döngma, Königin der Dakinis, die Kraft der Einsicht ist, die aus dem Raum hervorbricht, dass sie ein Ausdruck jener vollkommenen Energie ist, die man die Mutter aller Buddhas nennt, mitleidsvolle Furchtlosigkeit des erwachten Herzens, durch nichts zu verletzende Würde des reinen Geistes. Das klingt schwierig, doch Dawa spürt die Wahrheit darin und sie wird das alles verstehen lernen. Senge Döngma selbst wird es sie lehren, dessen ist sie ganz sicher.
»Was auch immer geschieht, mein Kind«, sagt der Lama, »glaube dem äußeren Anschein nicht. Äußerer Anschein ist Träumen. Wach auf! Dein Leben ist wichtig. Du wirst Verwirrung in Weisheit verwandeln. Alle Buddhas und Bodhisattvas zählen auf dich.« Er kichert leise. »Sie haben ihre Würfel auf dich gesetzt.« Das Kichern kollert lauter aus seiner Kehle und steigert sich schließlich zu einem fröhlichen Gelächter, lauthals und unbekümmert; es muss ein wundervoller Witz sein. Dawa lacht mit, wenn auch nicht so laut wie der Lama. Vielleicht ist das ganze Leben nichts anderes als ein Riesenwitz, über den man sich wälzen könnte vor Lachen, wenn man ihn nur verstünde. Sie kann es nicht in Worte fassen, aber ein Gefühl ist da, eine Ahnung, warum das Löwengesicht über ihr so zornig wild ist und dabei ausgelassen lacht. Und warum Lama Pema sagt, sie seien nicht getrennt, die kleine Dawa aus dem Marktflecken im Tal und die gewaltige, feuerumtoste Gottheit.
Miriam
Sie ist aufgewacht!«
Wie lange hatte ihr Blick schon den glatten, schmalen Rahmen des Bildes an der Wand nachgezogen? Das Licht war so schwach; vielleicht waren Blumen auf dem Bild oder eher Berge? Oder ein Gewand, zu dem das Rascheln von Stoff gehörte, das die Worte begleitete? Jemand hatte etwas gesagt. Wer war aufgewacht?
Ein Gesicht erschien. Ein Schmerz streifte sie, denn es war nicht Lama Pemas Gesicht. Sie hätte so gern Lama Pemas Gesicht gesehen. Ihr Handgelenk wurde ergriffen, der Puls gefühlt. »Lama Pema hat gesagt, ich muss aufwachen«, murmelte sie.
Das Gesicht über ihr lächelte. »Jetzt sind Sie ja wach.«
Miriam versuchte, die Bruchstücke, die sie sah – aufmerksame, blaugraue Augen hinter Brillengläsern, ein kleiner, empfindsamer Mund, Flächen mit feinen Bartstoppeln –, in einen beruhigenden Zusammenhang zu bringen. Ein fremdes Gesicht. Ein freundliches Gesicht.
»Ich glaube nicht, dass ich wach bin.«
»Sie sind im Rotkreuzkrankenhaus. Es ist drei Uhr morgens. Ich bin der Dienst habende Arzt. Wie fühlen Sie sich?«
Miriam setzte sich auf und sah sich um. Das Bett neben ihr war leer. In einem dritten Bett schlief jemand mit leisen Schnarchgeräuschen.
»Ich war auf einer Party. Dann war ich bei Lama Pema. Oder nein, das war Dawa. Bei Lama Pema war ich Dawa.«
»Erinnern Sie sich an die Party?«
Der junge Arzt zog einen Stuhl heran. Er setzte sich, schlug die Beine übereinander, stützte die Ellenbogen auf die Knie und verschränkte die Hände. Miriam zog die Bettdecke hoch bis zum Hals. Einen Augenblick lang dachte sie daran, dass die Kühle an ihrem Rücken sie stören müsse. Doch sie brauchte den Schutz nur vorn, für das nackte, zitternde, flügellose Herz.
»Ich erinnere mich an viele Leute – viel zu viele Leute. Die meisten kannte ich nicht. Sie waren alle so beschäftigt. Ich wundere mich immer, wie sie es fertig bringen, so beschäftigt zu sein.«
Warum sagte sie das? Sie wollte nicht reden und dennoch fielen die Worte aus ihr heraus, als habe man sie umgestoßen. »Kennen Sie das: Sie gehen auf eine Party und haben das Gefühl, als seien Sie vom Mond gefallen oder ein Möbelstück oder ein Stein in der Landschaft. Niemand redet mit Ihnen. Sie möchten, dass jemand den Kreis öffnet und Ihre Hand nimmt und sagt: Du gehörst dazu. Sie möchten nicht nur einen Film anschauen von Leuten, die miteinander beschäftigt sind. Oder vielleicht geht es nur mir so. Vielleicht bin ich eine so langweilige Person.«
»Ist Ihnen klar, dass man Sie nicht aufwecken konnte?«
Miriam ließ sich wieder zurückfallen. »Wie soll ich das wissen, wenn ich nicht wach war?«
»Ihr letztes Bild?«
»Die Terrasse.«
»Und dann?«
»Dann kam wieder so ein Traum.«
»Was für ein Traum?«
»Ach – dass ich den alten Fürsten heiraten soll. Das heißt, dass Dawa ihn heiraten soll. Im Traum bin ich Dawa. Irgendwo in Tibet. Meine Träume sind eine fortlaufende Geschichte. Normalerweise träumt man nicht so. Meinen Sie, ich bin nicht normal?«
»Ihre Absencen sind nicht normal«, sagte der Arzt. »Sie sind während der Untersuchungen nicht aufgewacht.«
Miriam schloss die Augen und seufzte. »Ich wollte mein ganzes Leben lang nichts anderes als normal sein. Warum passiert mir das? Ich meine, ich wollte gar nicht zu dieser Party. Man sollte mich einfach in Ruhe lassen. Zu Hause komme ich gut zurecht. Ich bin Miriam und dann bin ich Dawa und gehe hin und her zwischen Miriams und Dawas Welt. Wer hat gesagt, dass wir immer nur in einer Welt leben sollen? Miriams Welt ist nichts wert. Miriam hat keine Bedeutung, überhaupt keine Bedeutung. Sie wartet nicht einmal, verstehen Sie? Wie ein Stein, der in der Wüste herumliegt, mit einem Steinbewusstsein, einem versteinerten Bewusstsein. Und dann leidet man und weiß es nicht.«
»Jetzt wissen Sie es?«, fragte der Arzt.
»Jetzt weiß ich es«, flüsterte Miriam. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, dachte sie, ich darf nicht so schnell und viel sprechen, das könnte als Indiz bewertet werden. Er sieht freundlich aus, aber ich traue ihm nicht, er gehört zu den weißkalten Krankenhausgöttern. Ich kenne sie. Wie gut ich sie kenne. Sie bildeten eine weiße Mauer und sagten, ich könne mein Kind nicht mehr sehen. Sie dachten: Das ist ja sowieso hin, da kann man nicht mehr daran rumdoktern, das braucht man doch nicht mehr. Oh, wie war sie vorsichtig gewesen, hatte leise gesprochen, mit Anwälten gedroht, bis sich die weiße Mauer öffnete.
Danach kam die schreckliche Ruhe, Steinbewusstsein, jahrelang. Unter der Ruhe lag die Schuld, versuchte sich aufzurichten, zu schreien, doch die Ruhe drückte sie nieder und hielt ihr den Mund zu. Schrei doch, sagte Greta, heule, tobe. Greta weiß immer, was man tun soll. Miriam weiß immer, was man nicht tun darf. Das greift ineinander wie Zahnräder – tun sollen, nicht tun dürfen.
Der Stationsarzt war anders. Er war der Frager. Vielleicht war fragen besser?
»Sie wissen, dass Sie leiden?«, fragte er.
Sie sah seine Müdigkeit. Er presste nicht die Lippen zusammen und zog die Mundwinkel herunter und spannte den Kiefer an wie Rudolf am Abend nach einem langen Tag im Röntgenlabor. Die Müdigkeit dieses Arztes war wie etwas, das nicht ganz zu ihm gehörte, ein geliehenes Gesicht. Darunter Trauer. Sanftheit. Vielleicht konnte man ihm doch vertrauen?
»Wissen Sie es denn – dass Sie leiden?«, fragte sie zurück.
Der junge Arzt lächelte hinter seinen Brillengläsern. »Wenn ich wach genug bin, ja. Oft bin ich nicht wach und mach mir etwas vor.«
Miriam nickte. »Ja, das hat Lama Pema gemeint. Wach sein, damit man sich nicht selbst betrügt.«
»Solche Absencen – haben Sie die häufig?«
»Manchmal.« Miriam hüllte sich wieder in Vorsicht. »Ich weiß nicht … Ich träume einfach …«
»Haben Sie Erfahrung mit Hypnose? Wurden Sie einmal hypnotisiert?«
Es hatte keinen Sinn. Sie sollte ihm nicht vertrauen. Er verstand es nicht.
»Natürlich nicht«, wehrte sie ungeduldig ab. »Das hat doch damit nichts zu tun.«
In dem Gesicht neben ihr war keine Bewegung, nur dieser müde und doch aufmerksame Blick. Er machte sie traurig, dieser Blick, ging ihr ans Herz, überrumpelte ihre Abwehr. Traurig und glücklich zugleich, wie Lama Pemas Gesang; seine Stimme reichte bis in dieses Krankenzimmer, so stark und sanft. Sie hätte dem freundlichen Mann ihr gegenüber gern von Lama Pemas Stimme erzählt, doch ein Versuch wäre allzu waghalsig gewesen. Sie wäre im leisesten Wolkenschatten des Unverständnisses erfroren. Wer würde Tanzschritte am Abgrund machen? Nicht Miriam, nein, Miriam nicht.
Der Arzt erhob sich. »Vielleicht können Sie noch ein wenig schlafen.«
O nein, er durfte jetzt nicht gehen. Er durfte sie nicht allein lassen mit ihrer Angst vor der Angst. Unwillkürlich streckte sie die Hand aus.
»Was soll ich tun?«
»Wenn Sie mich privat fragen« – er senkte die Stimme fast zu einem Flüstern –, »sprechen Sie mit einem tibetischen Lama. Alles Gute.«
Er hatte das Zimmer verlassen, bevor sie fragen konnte, wie man einen Lama findet.
Der Himmel hing auf die lange, graue Häuserzeile einer fremden Stadt herab. Den Lama fragen, den Lama fragen, tickte es in Miriams Kopf, tickte es seit Tagen gegen alle Sabotageversuche ihres Denkens an. Mit Schlafmitteln hatte sie nachts die Träume zurückgedrängt und sich tags mit Fernsehen abgelenkt, während die Panik hinter ihr stand und ihren Schatten über sie warf.
Das bezeichnete Haus in der Häuserzeile verschwamm mit den anderen, ein zugiger Durchgang führte in einen Hinterhof und zu einer weiteren grauen Hausfront mit einem mageren Spaliergewächs, in ein breites Treppenhaus mit spiegelnd gewachsten Holztreppen, zu einer massiven, hohen Tür mit fleckigem Messingschild.
»Ich möchte zum Lama«, sagte Miriam zu der Frau, die ihr öffnete, und vergaß das Gesicht sogleich wieder. In einem Wohnzimmer drängten sich weitere Gesichter, an die sie sich nicht erinnern würde, Blicke, die sie kaum streiften, um auch sie sofort wieder zu vergessen. Sie gehörte nicht dazu. Sie hatte nie dazugehört, schon in der Grundschule nicht. Sie kannte die Regeln nicht, verstand den Code nicht, sagte die falschen Worte, machte die falschen Bewegungen. Miriam-Bim-Bam, sagten die Jungen in der Schule und knufften sie hart in die Seite und in den Rücken. Dann kam der große Tag des Zorns. Miriam-Bim-Bam – es war der Frechste, der ihr auf der Treppe im Vorbeigehen den Schlag versetzte. Ihr Fuß schoss vor, der Peiniger fiel, fiel, überschlug sich, die Treppe hinunter bis ganz unten.
Man brachte ihn ins Krankenhaus. Niemand hatte es gesehen. Nur Gott. Gott sieht alles, sagte Oma Haller, die im Parterre wohnte. Der Geruch nach Holunderblüten strich durch Miriams Gedanken, Holunderblüten, die Oma Haller in Pfannkuchenteig ausgebacken servierte, wenn Miriam in der verwohnten Küche saß und Hausaufgaben machte, bis ihr Vater heimkam und sie mit nach oben nahm. Es konnte keinen Zweifel an Oma Hallers Behauptung geben, denn Miriam spürte Gottes Augen im Genick. Der Junge sagte, Miriam habe es mit Absicht getan, aber niemand glaubte ihm – doch nicht die kleine, ängstliche Miriam. Die nicht.