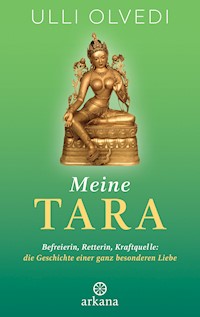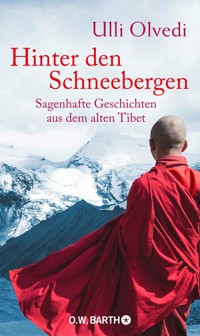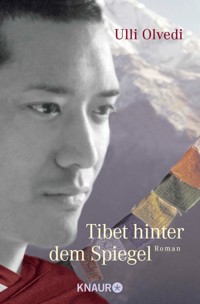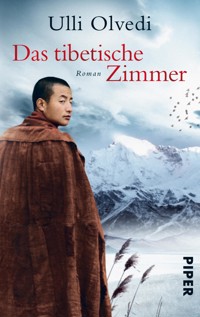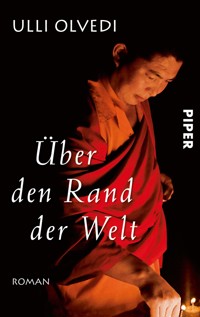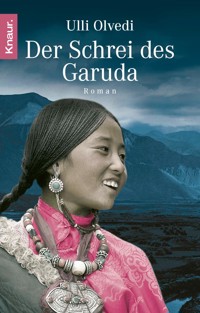9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Tibetromans Wie in einem Traum Maili ist fasziniert von der westlichen Welt, doch es gibt so vieles, das sie nicht versteht: Warum lachen die Menschen so wenig? Warum sind sie immer in Eile und voller Ungeduld? Warum denken sie so viel und glauben so sehr an das, was sie denken? Fern von ihrem Kloster bei Kathmandu muss sie in einem buddhistischen Zentrum in England westliche Suchende unterrichten, die im tibetischen Buddhismus Erkenntnis und inneren Frieden finden wollen. Sarah, die Leiterin des Zentrums, hilft Maili dabei über so manchen "Kulturschock" hinweg. Die laszive Nadine, die Gefährtin des faszinierenden Shonbo Rinpoche, weiß Rat, wenn es Probleme mit Sönam gibt. Er muss wie seine junge Frau erst lernen, was es heißt, eine tantrische Ehe zu führen. Eines Tages versucht einer ihrer Schüler, sich das Leben zu nehmen. Von Schuldgefühlen gequält, flieht Maili zurück in ihr Kloster und wählt nun den radikalen Weg der Klausur in völliger Dunkelheit, um die "Stimme des Zwielichts", die Stimme der innersten Weisheit, zu hören. In diesem spirituellen Roman bringt uns die Tibet-Kennerin und Bestsellerautorin Ulli Olvedi nicht nur den Buddhismus näher, sondern schafft mit ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Sachkenntnis eine unvergleichliche Atmosphäre, die den Leser sich in jeder der Welten zu Hause fühlen lässt, in die er Maili begleitet. »Die Mutter der Buddhas sagt: Sorge dich nicht, ihr seid für immer vereint. Doch mein dummes Herz weint und singt sein Lied von Liebe und Hoffnung und Furcht.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulli Olvedi
Die Stimme des Zwielichts
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Fortsetzung des Tibetromans Wie in einem Traum
Maili ist fasziniert von der westlichen Welt, doch es gibt so vieles, das sie nicht versteht: Warum lachen die Menschen so wenig? Warum sind sie immer in Eile und voller Ungeduld? Warum denken sie so viel und glauben so sehr an das, was sie denken?
Fern von ihrem Kloster bei Kathmandu muss sie in einem buddhistischen Zentrum in England westliche Suchende unterrichten, die im tibetischen Buddhismus Erkenntnis und inneren Frieden finden wollen. Sarah, die Leiterin des Zentrums, hilft Maili dabei über so manchen "Kulturschock" hinweg. Die laszive Nadine, die Gefährtin des faszinierenden Shonbo Rinpoche, weiß Rat, wenn es Probleme mit Sönam gibt. Er muss wie seine junge Frau erst lernen, was es heißt, eine tantrische Ehe zu führen. Eines Tages versucht einer ihrer Schüler, sich das Leben zu nehmen. Von Schuldgefühlen gequält, flieht Maili zurück in ihr Kloster und wählt nun den radikalen Weg der Klausur in völliger Dunkelheit, um die „Stimme des Zwielichts“, die Stimme der innersten Weisheit, zu hören.
In diesem spirituellen Roman bringt uns die Tibet-Kennerin und Bestsellerautorin Ulli Olvedi nicht nur den Buddhismus näher, sondern schafft mit ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Sachkenntnis eine unvergleichliche Atmosphäre, die den Leser sich in jeder der Welten zu Hause fühlen lässt, in die er Maili begleitet.
»Die Mutter der Buddhas sagt: Sorge dich nicht, ihr seid für immer vereint. Doch mein dummes Herz weint und singt sein Lied von Liebe und Hoffnung und Furcht.«
Inhaltsübersicht
Ein Nonnenkloster auf einem [...]
TEIL I
1 Kein Tag wie jeder andere
Sarah
Der erste Traum
Ein Tod
2 Panchas Tanz
Eine Liebe von Sarah
Eine Frage des Gehorsams
3 Mailis Wand
Sönam
4 Sarahs Reise
5 Die Trompete
Ein Tanz für den Rinpoche
Drei Jahre Freude
TEIL II
6 Sönams Brief
Der zweite Traum
Veränderung
7 Ein neues Leben
Der dritte Traum
Lama-la
8 Nadine
Shonbo Rinpoche
Die Geliebte
9 Powa
10 Die Frucht der Sünde
Der vierte Traum
Verschlüsselte Botschaften
Der Schatten des Kreuzes
11 Mona
Yeshe
Der Tiger in der Vordertür
Der alte Meister
12 Abschied
Der fünfte Traum
Der Himmel ist grün
Viel Glück, viel Verantwortung
13 Mailis Wut
Der sechste Traum
Der siebte Traum
Der Dämon
14 Der gläserne Heinrich
Die Stunde des Löwen
TEIL III
15 Zufluchten
Das Gelübde der Kriegerin
16 In der Welt des Dunkels
Um seliges Glück zu finden
Glossar
Der gemeinnützige Verein TASHI [...]
Ein Nonnenkloster auf einem Berg am Rand des Kathmandu-Tals existiert in der beschriebenen äußeren Form, die Akteure sind jedoch fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig.
TEIL I
1Kein Tag wie jeder andere
Es war, als habe die Erde die Faust geballt und gegen das Bett gestoßen. Das rohe Holzgestell wurde hochgeworfen, und klirrend stießen die Kupferschalen auf dem Schrein gegeneinander.
»Ich bin ja wach, Ani-la«, murmelte Maili, während ihr Geist sich aus der Tiefe des Schlafs emporkämpfte. Ani Rinpoche benützte merkwürdige Mittel, um sie daran zu erinnern, dass ihr Geist wach zu sein hatte. Wach sein im Schlaf. Wach sein im Traum. Wach sein im täglichen Traum der Gedanken und Gefühle.
»Erdbeben!«, dachte Maili, doch dieser Gedanke wurde ihr erst mit einiger Verzögerung bewusst. Ihr Geist formte keine Bewertung. Ein Erdbeben bedeutete nichts. Nur die Aufforderung ihrer Lehrerin, wach zu sein, war von Bedeutung. Wach auf, Maili, wach auf, sonst verträumst du dein kostbares Leben!
Ein tiefes Donnern drang aus dem Berg. Wieder erhielt das Bett einen Stoß. Das Gebälk des kleinen Hauses stöhnte. Mailis Körper lauschte reglos den Zuckungen der Erde. Unwillkürlich stimmte sie leise das Mantra des Mitgefühls an, OM MANI PADME HUM, für all jene, die das Beben schlimm getroffen haben mochte. Unversehens hüllte der Schlaf sie wieder ein.
Der durchdringende Klang der Muschelhörner erfüllte den leeren Raum in Mailis Geist. Er drang in ihr erwachendes Bewusstsein, das noch ohne Inhalt war. Erst als sich der erste Gedanke – das Mantra, mit dem sie den Tag zu beginnen pflegte – daruntermischte, formte sich in ihrem Geist das Bild der zwei großen, weißen Muscheln, denen man nur mit großer Geschicklichkeit diese außerirdischen Töne entlocken konnte.
Maili kroch unter den Decken hervor zum Lichtschalter und zündete dann die Butterlampen auf dem Schrein und ein Räucherstäbchen an. Es war nicht nötig, die Rezitationen zur Morgenmeditation aufzuschlagen. Sie stiegen von selbst auf, halb aus dem Schlaf noch, im Rhythmus des Atems. Gegen die winterliche Kälte bis zum Hals in die Decken gehüllt, wiegte Maili sich im Takt des Sprechgesangs, glücklich auf eine stille, kaum merkliche Weise.
Mit dem Gedanken an mögliche Erdbebenopfer sang sie den abschließenden Text: »Mögen sie ihr Leiden in Weisheit verwandeln, mögen sie einen befreienden Tod erleben, möge ich durch die Verdienste meines spirituellen Wegs alle Wesen aus dem Meer des Samsara befreien.«
Erneut rollte der Klang der Muschelhörner über die Bergkuppe, auf der sich die Häuser des Klosters ausbreiteten. Die Sonne war aufgegangen, ohne dass Maili das Hereinsickern des grauen Morgenlichts durch das Fenster bemerkt hätte. Nach einer eiligen Wäsche zog sie den gelben Unterrock und den dunkelroten Rock der klösterlichen Robe über eine blaue Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite. Zwei T-Shirts übereinander, das gelbe zuoberst, ein brauner Pullover aus der Kiste mit den Kleiderspenden, das große, dunkelrote Umschlagtuch und eine gelbe Wollmütze vervollständigten ihre Bekleidung.
Die lange Treppe, die den Berghang mit den verstreuten Häusern der Klosteranlage teilte, verlor sich im Morgennebel dem Tempelgebäude auf der Spitze der Bergkuppe zu. Verschwimmende rote Kleckse schwebten bergauf, frierende Nonnen, die es eilig hatten, sich im Lhakang zusammenzudrängen. Maili zog die Ärmel ihres Pullovers über die Finger. Bald war Losar, das Neujahrsfest, und mit ihm kam die Wärme der Sonne. Doch die Nächte würden noch lange beißend kalt sein.
»Hattest du Angst heute Nacht, Ani-la?«, hörte sie eine der Gestalten die andere fragen.
»Ich mach mir nicht mehr in die Röcke, wenn die Erde bebt«, antwortete in trockenem Ton die Stimme einer älteren Nonne. »Ist ja nicht das erste Mal. Man gewöhnt sich daran.«
»Aber bei uns unten im alten Lhakang geht ein großer Riss durch die Zimmerwand«, klagte die junge Stimme.
»Im alten Lhakang sollte niemand mehr wohnen«, sagte die Ältere und keuchte beim Treppensteigen. »Lauter Holzwürmer. Er könnte schon beim nächsten Sturm zusammenbrechen.«
Maili überholte die beiden. »Wenn irgendjemand den alten Lhakang noch aufrechterhält, ist es Arya Tara«, rief sie ihnen im Vorbeigehen zu und ließ ihre Plastikschlappen auf der Treppe klatschen. Ihre Füße waren kalt. Sie hatte vergessen, ein zweites Paar Socken anzuziehen. Das Kleiderkomitee hatte kein Geld mehr, die Spenden ausländischer Besucher waren ausgeblieben. Also würde sie in die Stadt gehen müssen, ein Stück ihres Schmucks verkaufen und neue Schuhe besorgen. Natürlich könnte sie auch mit anderen Nonnen schlecht bezahlte Pujas bei Gönnern des Klosters zelebrieren. Doch ihre Zeit war kostbar, viel zu kostbar für solche Bettelgänge. Sie wollte studieren. Sie wollte meditieren. Sie wollte ihr Tibetisch feilen und noch viel besser Englisch lernen. Es gab so viel zu tun neben den gemeinsamen Ritualen der Nonnen im Lhakang.
Mailis Gedanken eilten voraus zum neuen Tempel, den der alte Rinpoche, das Oberhaupt des Klosters, vor seinem Tod hatte ausbauen lassen. Der alte Lhakang ist wie ein dunkler Bauch, dachte sie. Der neue ist eher wie eine Stirn, so licht mit den vielen Fenstern und den himmelblauen Wänden mit den zarten Wandmalereien.
Zu beiden Seiten des Mittelgangs lagen eng aneinandergereiht die roten Sitzmatten hinter den langen, niedrigen Kästen, auf die man die Texte und Instrumente legte. Vorn ragte der Schrein auf mit seinen großen, vergoldeten Statuen des Buddha, des Karmapa und des »zweiten Buddha«, Padmasambhava. In den Fächern der Kästen vor den Sitzmatten lagen in Stoff eingewickelte Texte, Teetassen, Handschuhe, Mützen, Reiskörner – was immer sich an Nötigem und Vergessenem zusammenfand.
Mit dem wohligen Gefühl, ihren Platz wie inmitten ihrer Familie einzunehmen, setzte sich Maili zur Orchestergruppe. Sie legte die Kurztrompete bereit, zu der sie in dieser Woche eingeteilt war. Alle sagten, sie spiele sie besonders gut. Wie schön war es, wenn der helle Ton der Trompete in ihrem Körper mitschwang, klingende Sprache der feinen Energie einer tieferen Wirklichkeit.
Ihre Gedanken wanderten, während sie die vertrauten Gesänge sang und die heiligen Texte rezitierte. Keine ihrer Freundinnen war mehr da, keine, mit der sie offen plaudern und diskutieren konnte, und ihr neugieriger, abenteuerlustiger Geist litt darunter. Wäre wenigstens Ani Pema, in deren gemütlichem Häuschen sie wohnen durfte, öfter im Kloster. Der Vater hatte es für die Tochter gebaut, als sie sich entschloss, ins Kloster zu gehen. In Ani Pemas Khampa-Familie aus Tibets Osten war man stolz, die älteste Tochter im Kloster zu wissen. Eine gute Schülerin war sie gewesen, man hätte sie sogar studieren lassen, doch sie wollte Nonne werden. »Wie in meinem früheren Leben«, hatte Ani Pema erklärt. »Das wusste ich schon als Kind.«
Seit dem Tod des Vaters musste Ani Pema seine Geschäfte weiterführen. Du hast Schulbildung, hatte die Mutter sie bedrängt, nur dir kann ich vertrauen.
Während Maili auf den Einsatz ihrer Trompete wartete, sah sie Ani Pemas kantiges, kluges Gesicht vor sich. »Dissidenten sind das Salz in der Suppe eines jeden Systems. Wir sind das Salz in der Tukpa-Suppe des Klosters«, hörte sie Ani Pema sagen. Ani Pema konnte man vertrauen. Sie war schon im fernen Land Amerika gewesen, mit einem jener fliegenden Fahrzeuge, die man vom Kloster aus auf dem Flugplatz tief unten im Tal kommen und gehen sehen konnte. Wenn sie mit Ani Pema diskutierte, hüpfte ihr Geist.
Doch jetzt bin ich wie ein Ball, den niemand wirft, dachte sie und seufzte unwillkürlich, so laut, dass Ani Sherab neben ihr kicherte. Lach du nur, dachte Maili ärgerlich. Du bist kein Ball, du bist ein matschiges Klümpchen Tsampa. Sie warf einen misslaunigen Blick auf die kleine, stämmige Nonne. Ani Sherab schlug die Hand vor den Mund. Maili Ani konnte mit Worten beißen, jede wusste das. Es war nicht gut, sie zu reizen.
Die Kinder kamen mit den großen Teekannen, und alle Nonnen holten ihre Schalen hervor. Maili stellte fest, dass sie schon geraume Zeit vergessen hatte, dem Ritual zu folgen. Glühend stieg Scham in ihre Ohren. Ani Rinpoche mag noch so viele Erdbeben schicken, dachte sie unglücklich, die dumme Maili träumt weiterhin unfreundliche Träume und wacht nicht auf.
Nach der Pause bemühte sie sich, ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Puja zu richten. Als die großen Trommeln mit schnellem, heftigem Pochen einsetzten, sah sie plötzlich vor sich aufbrechende Erde, einstürzende Häuser, Flüsse, die ihren Lauf änderten und über ungeschützte Dörfer hereinbrachen. Menschen, die unter Trümmern begraben wurden. Berstende Straßen. Zerbrechende Brücken. Stromleitungen, die Funken sprühend zusammenbrachen. Feuer, Schreie. Nicht enden wollende Hilfeschreie.
Maili riss die Augen auf, doch die schrecklichen Bilder wollten nicht weichen. Panisch wiederholte sie im Stillen das Mantra des Mitgefühls. Immer wieder geschah es, dass ihr Geist von fremdartigen, qualvollen Bildern überschwemmt wurde. »Das ist innerer Widerstand«, hatte Ani Rinpoche, ihre Lehrerin, gesagt. »Wenn dein Herz ganz offen ist, gibt es keinen Widerstand mehr.«
»Aber warum habe ich solche Bilder, Rinpoche-la?«, hatte Maili gefragt. »Die anderen haben sie nicht.«
»Manche haben sie.« Ani Rinpoches scharfer Blick stieß auf Maili herab. »Du brauchst dich nicht zu schützen, Maili. Wach auf!«
Die Becken klirrten. Die langen Tuben dröhnten. Für ein paar Augenblicke jenseits der Zeit war Maili nicht Maili, sondern Arya Tara, die mütterliche Gottheit, und es gab keinen Grund mehr, sich auf Mitgefühl zu besinnen. Sie war Mitgefühl. Sie war das Tor, durch das der reine Geist des Mitgefühls in die Welt strömte. Es war nicht mehr Mailis Angelegenheit. Es war Arya Taras Angelegenheit, und deshalb verwandelte sich die Welt.
Nach der Puja trat die große, knochige Gestalt der Klosterleiterin vor den Schrein.
»Hört alle her!«, rief Ani Tsültrim laut, um die aufgeregten Gespräche der Nonnen über das nächtliche Beben zu übertönen. »Wir müssen feststellen, welche Gebäude heute Nacht beschädigt wurden. Hat jemand von euch schon einen Schaden festgestellt?«
Eine junge Nonne rief: »Unser Zimmer im alten Lhakang hat einen riesigen Riss. Und in der Decke kracht es.«
Die Klosterleiterin nickte. »Gut, ihr werdet zu zwei der älteren Nonnen umziehen.« Ihr Blick wanderte über die geschorenen Köpfe. »In eure Zimmer passt noch ein zweites Bett«, rief sie zwei Nonnen zu.
»Nicht zu mir«, knurrte eine der beiden und verzog das Gesicht. Ani Tsültrim warf ihr einen scharfen Blick zu und sagte mit gezügeltem Grimm: »Wir haben nicht genügend Zimmer, und wir haben kein Geld, um zu bauen. Wir sind eine Familie. Verhalten wir uns also auch so.«
Sie gebot den beiden älteren Nonnen, das größere Zimmer miteinander zu teilen, und hob die Hand, um deutlich zu machen, dass jeder weitere Einwand zwecklos war.
Ani Tsültrim ist ein Besen, dachte Maili, aber ein Besen, der gut kehrt. Wer sonst könnte diese Meute derart in Zaum halten?
Die Klosterleiterin teilte die Nonnen in fünf Gruppen ein, angeführt von je einer älteren Nonne. Jedes der planlos auf dem Berghang verstreuten Häuser sollte genau untersucht und so sollten Schäden festgestellt werden. Einige der Häuser waren sehr hastig und ohne große Sorgfalt gebaut worden, abhängig davon, wie weit die mageren Mittel gereicht hatten.
Inzwischen war es Mittag geworden, und die Sonne hatte den Nebel aufgelöst. Mächtig ragte der von dichtem Hochdschungel überwucherte Berg hinter dem Kloster in den milchig blauen, wolkenlosen Himmel. Im Kathmandu-Tal lag immer noch dichter Dunst auf der großen Stadt. Über dem Lhakang kreisten zwei große Greifvögel, so tief, dass man ihre hellen Bäuche sehen konnte.
Die Schäden, die das Erdbeben angerichtet hatte, waren nicht allzu groß. Der alte Lhakang duckte sich mehr denn je, doch stand sein Abriss ohnehin bevor. Eines der Klohäuschen war mitsamt seinem Sockel ein Stück bergab gerutscht. Am Rand des Osthangs hatte sich ein Felsbrocken gelöst und war durch das Dach eines Holzschuppens gefallen. Nach dem Mittagessen dachte kaum mehr jemand im Kloster an das Erdbeben. Nur die beiden älteren Nonnen murrten, die nun keine Einzelzimmer mehr hatten.
Sarah
Mailis innere Unruhe drehte sich nicht um das Erdbeben. Immer wieder lief sie in der sanft wärmenden Mittagssonne zum Trampelpfad unterhalb der langen Treppe, der zur Schotterstraße hinunterführte. Von dort aus konnte sie einen Teil der Straße mit ihren scharfen Haarnadelkurven überblicken, bleiche Narben im trockenen Mattgrün des Bergdschungels. Bei jedem Monsunregen wurde die Straße ausgespült, bis sie einem Bachbett glich, doch jetzt, nach dem Winter, war sie noch in gutem Zustand, und Ani Pemas Jeep würde keine Schwierigkeiten haben heraufzukommen.
Wie oft schon hatte sie, seitdem sie im Kloster lebte, hier gestanden und die Straße beobachtet. Wartend auf Sönam. Sönam mit den langgezogenen Augen und dem fein gezeichneten Mund. »Sönam«, sagte Maili leise und kostete den zarten Geschmack seines Namens in ihrem Herzen. Ersehnte Gestalt im roten Gewand. Mailis Hoffnung. Mailis Furcht.
Maili Ani, befiel deinem Geist zu schweigen!, mahnte eine sanfte innere Stimme. Nicht an Sönam denken!
Gehorsam löste sich Maili von dem Bild des jungen Mönchs. Sie löste sich von der vollkommenen Linie seines Schlüsselbeins. Sie löste sich vom herzschmerzenden Anblick der feinen Haare auf seiner Oberlippe. Alle Bilder löste sie auf, an denen ihr Geist haften wollte, um dennoch Sönams Atem an ihrer Stirn und den festen Griff seiner feinknochigen Hand zu spüren.
Der plötzliche Schmerz der Erinnerung trieb ihr Tränen in die Augen. Sie ballte die Fäuste. Nicht kämpfen!, sagte die sanfte Stimme. Kämpfen macht es schlimmer. Er ist nicht da. Noch nicht. Noch sind die drei Jahre seines Retreats nicht um. Und selbst wenn er kommt, musst du ihn gehen lassen.
Die beiden Kulis des Klosters tauchten schwer beladen zwischen den Büschen des Trampelpfads auf. Sie setzten ihre Last am Beginn der langen Treppe ab und wischten sich den Schweiß von der Stirn.
»Wer kommt?«, fragte Maili.
»Ani Pema und eine Langnasenfrau«, antwortete einer der Kulis.
Endlich war sie da, Sarah, die sehnlich erwartete Fremde, Botin aus der anderen Welt, in der Frauen nicht heiraten mussten und wie Männer leben durften, frei und uneingeschränkt, wie die Yogis und Yoginis früherer Zeiten.
Seit Wochen hatte Maili sich Sarah vorgestellt, ein Bild geschaffen aus den wenigen Hinweisen, die Ani Pema ihr hatte geben können. »Nun ja, sie ist eben eine richtige Inchi«, hatte Ani Pema lachend auf ihre Frage geantwortet, »mit heller Haut und kleinen braunen Flecken um die Nase. Ich habe gehört, sie sei eine gute Leiterin des Zentrums.« Sie erzählte von einem Dharma-Zentrum in einem kalten Land namens England, wo Frauen und Männer die Lehren des Buddha studieren konnten und dies mit einem weltlichen Leben verbanden. »Die Leute im Westen machen Pausen in ihrem arbeitsamen Leben«, hatte Ani Pema erklärt. »Dann fahren sie in die Berge oder ans Meer, und die Dharma-Leute kommen stattdessen ins Zentrum.«
Die Kulis waren schon weitergegangen, als Ani Pema in der letzten Kehre des Ziegenpfads erschien, hinter ihr die Inchi, die Engländerin. Ein gerötetes, langes Gesicht, tiefliegende Augen von der Farbe des Regens, die hellen Haare zum langen Zopf geflochten. Ani Pema winkte, eine klein erscheinende Ani Pema neben der großen, fremden Frau.
Maili hörte englische Wörter, doch sie war gefangen vom Schauen und vom Spüren der seltsam vertrauten Botschaften, die von der fremden Frau ausgingen. Schließlich streckte sie die Hand zum Händeschütteln aus, wie sie es bei westlichen Besuchern gesehen hatte. Im selben Augenblick faltete Sarah die Hände zum asiatischen Gruß, und Ani Pema lachte schallend. Maili zog ihre Hand zurück. Sie erkannte die Geste der Umarmung, noch bevor Sarah die Arme hob, und neigte sich Sarah entgegen. Eine Strähne, die sich aus Sarahs Zopf gelöst hatte, kitzelte Maili an der Nase. Unwillkürlich rieb sie ihr Gesicht an Sarahs Hals. Sie wurde des feinen, ekstatischen Geruchs frei fließender Kommunikation gewahr. O ja, sie würden einander verstehen.
Die beiden Nonnen geleiteten die Fremde zu Ani Pemas Häuschen. Sarah wollte lange bleiben, vielleicht Monate. Es war ein Geschenk, erklärte sie, das sie sich schon seit langem hatte machen wollen, mit den Nonnen leben, in einer anderen Zeit, so ruhig und frei.
Frei?, fragte sich Maili. Wer ist frei? Die Frauen im Inchi-Land oder wir Nonnen auf dem Berg?
Sarah packte ihre große Reisetasche in Ani Pemas Zimmer, in dem sie wohnen würde, aus. Sie bot Schokolade aus dem Westen an, Nahrung der Götter, und dazu tranken sie köstliches Cola aus Dosen, das Ani Pema aus der Stadt mitgebracht hatte.
Plötzlich bemerkte Maili, dass sie sich sowohl innerhalb der Runde als auch außerhalb befand. Sie sah Ani Pema mit dem Rücken zum Fenster sitzen, das rote Umhängetuch beiseite gelegt, über der gelben Bluse eine hübsche rote Weste. Neben ihr Sarah, die Fremde und doch Vertraute, älter als Ani Pema. Wie würde sie mit ihrem bleichen Gesicht und der langen Nase im roten Nonnengewand aussehen anstatt im schwarzen Hemd und der feldgrünen Armeehose? Auch sich selbst sah sie dabeisitzen, die zierliche Maili mit dem herzförmigen Gesicht und den weit auseinanderstehenden Augen. Maili Ani, Sönams Freude.
Nicht an Sönam denken!, warnte die sanfte Stimme. Folgsam stürzte sich Maili wieder in den Fluss der fremden Sprache mit seinen Windungen, Wirbeln und Stromschnellen.
»Maili ist unser Wunderkind«, sagte Ani Pema. »Als sie zu uns ins Kloster kam, verstand sie kein Wort Nepali und Tibetisch. Jetzt spricht sie beides und Englisch noch dazu.«
»Nicht sehr gut«, wehrte Maili ab. Sarahs regenfarbener Blick ruhte forschend auf ihr. »So viele Wörter – wie Säcke. Leere Säcke ohne Bedeutung, meine ich. Ani Yeshe aus Amerika war ein Jahr lang hier. Ihre Mutter ist Tibeterin. Sie konnte mir viel erklären.« Maili lachte. »Aber noch immer sind viele leere Säcke in meinem Kopf.«
»Vier Sprachen«, sagte Sarah nachdenklich. »Ich kann nur meine Muttersprache. Und ein bisschen Latein, aber das ist eine tote Sprache, wie Sanskrit.«
Der erste Traum
Es ist früher Morgen und kühl. Sie trägt einen schweren, hölzernen Wasserkübel an einem Fenster vorbei, aus dem seltsame Laute dringen. Ein Schnalzen, ein Winseln, ein unterdrücktes Heulen. Sie setzt den Eimer ab und rückt einen Stein näher heran, um daraufsteigen zu können. Im Spalt zwischen den Fensterläden sieht sie im Kerzenlicht eine kniende, halb entblößte Gestalt, die sich mit einer Peitsche auf den eigenen Rücken schlägt, erbarmungslos, immer wieder.
»Vergib mir!«, heult die Gestalt. »O Herr, befreie mich von ihr! Vergib mir!« Von den Striemen auf dem weißen Rücken tropft Blut. »Mir kann nicht vergeben werden. Ich bin verdammt. Ein Sünder bin ich, ein Sünder, ein Sünder!« Bei jedem »Sünder« zischt die Peitsche.
Sie presst ihr Gesicht fest an die Holzlatten, um besser sehen zu können. Plötzlich hebt die Gestalt den Kopf. Das verzerrte Gesicht macht ihr Angst. Sie folgt dem Blick des Mannes nach oben. Dort sieht sie an der Wand zwei gekreuzte Balken, daran hängt die Skulptur eines toten, fast nackten Mannes.
»Ich bin verdammt! Ich bin verloren!«, faucht und winselt der Mann mit dem schrecklichen Gesicht und schlägt erneut zu. »Ein Sünder, ein Wurm, Abschaum.«
Zitternd vor ungewisser Furcht wendet sie sich vom Fenster ab und nimmt den Kübel wieder auf. Sie sieht ihre Hände – sie sind klein, rissig und schmutzig. Es sind die Hände eines Jungen, vielleicht zehn, elf Jahre alt.
Maili erwachte schweißnass, eng zusammengerollt, als läge sie in einem Versteck oder einem engen Verlies. Die wilden Schläge ihres Herzens erfüllten das ganze Zimmer. Ein über alle Maßen bedrohliches Gefühl hing der Traumszene nach, mit nichts zu vergleichen. Sie hatte Schmerz erlebt, tiefen, atemlosen, lähmenden Schmerz, damals, als Räuber ihre Eltern in den Bergen ermordet hatten. Und als ihr kleiner Bruder, der Zeuge der Morde gewesen war, an seinem Kummer starb, war es gewesen, als könnte sie selbst nicht mehr weiterleben. Doch dieser scharfe, klare Schmerz war ganz anders gewesen als das Entsetzen dieser Nacht, als das erstickende Grauen, das allen Dingen die Farbe zu rauben schien.
Früh am Morgen, noch vor dem Beginn der Vormittags-Puja, stieg sie hinauf zu den Räumen über dem Lhakang. Vorsichtig drückte sie sich an der Küche und am Zimmer der Klosterleiterin vorbei. Ani Tsültrim, die Leiterin, würde schimpfen, wenn sie Maili ertappte. Es gehörte sich nicht, unangemeldet beim Oberhaupt des Klosters einzudringen. Mag sie schimpfen, dachte Maili mit gekrauster Nase. Schimpfen tut nicht weh.
Die Tür hinter dem dicken Vorhang war offen. Die Nonne, die Ani Rinpoche bediente, war nicht zu sehen. Damit niemand sie im Zimmer der Yogini vermuten sollte, verbarg Maili ihre Plastikschlappen unter der Besucherbank. Dann schlug sie den Vorhang ein wenig zur Seite und schlüpfte in das Empfangszimmer.
»Rinpoche-la, darf ich hereinkommen?«
Die alte Yogini saß auf einem brokatbezogenen Polster neben dem erhöhten Sitz mit einem großen Bild des verstorbenen alten Rinpoche. Ihre zierliche Gestalt, eingehüllt in einen seidenen, mit Fell gefütterten Umhang, verschmolz mit den kunstvollen Wandmalereien hinter ihr.
»Komm nur, komm«, sagte Ani Rinpoche und winkte Maili herein.
Maili ließ sich dreimal hintereinander auf die Knie nieder und berührte den Boden mit der Stirn. Dabei rezitierte sie im Stillen die Formel der Zuflucht: »Namo Gurubya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya«, doch ihre Aufmerksamkeit galt mehr dem sanft schmerzenden Glücksgefühl, das die Gegenwart der alten Yogini stets in ihr auslöste. Mit einer kleinen Geste wies Ani Rinpoche auf die Matte, die vor ihr lag.
»Rinpoche-la«, sagte Maili in unziemlicher Hast, noch bevor sie saß, »ich hab etwas Grauenhaftes geträumt.«
Sie hatte gelernt, Ani Rinpoches langen, ruhigen Blick ohne Furcht entgegenzunehmen. Es war ein Blick ohne Festlegung, ohne Urteil, wie helles, scharfes Sonnenlicht. Doch selbst jetzt löste dieser Blick noch ein untergründiges Gefühl der Beunruhigung aus, als sei irgendetwas an ihr nicht in Ordnung.
»Ist es eine Erinnerung?«, fragte Maili, als sie ihren Traum berichtet hatte. »Ich wusste, dass der Mann ein Mönch war. Er sah aber nicht wie einer unserer Mönche aus. Woher weiß ich so etwas? Kann es sein, dass ich das einmal erlebt habe?«
Ani Rinpoche wiegte kaum merklich den Kopf. »Ich glaube nicht. Frag die Engländerin, ob es in dem Gebäude, in dem sie ihr Zentrum eingerichtet haben, in früheren Zeiten einmal Mönche gab. Es soll ein sehr altes Gebäude sein.«
»Der Traum macht mir Angst«, sagte Maili.
»Du hast die Chöd-Praxis gelernt«, erwiderte die Yogini. »Schneide die Angst durch. Und außerdem«, fügte sie hinzu, »praktiziere die Meditation des Mitgefühls für den verwirrten Mann mit der Geißel.«
Sarah wusste nichts von Mönchen. Ein Teil des Gebäudes sei recht alt, so viel ließe sich sagen, doch seine Geschichte kenne sie nicht. Sie leite das Zentrum, seitdem es vor ein paar Jahren in dieses Anwesen außerhalb der Stadt verlegt worden war, erklärte sie. Sie habe sich nie um die Vergangenheit des Ortes gekümmert. »Bis jetzt ist noch niemand von uns einem Geist begegnet«, sagte sie mit halbem Lachen.
Doch damit war das Rätsel des Traums nicht gelöst. Hatte Sarah, ohne es zu wissen, einen lokalen Geist mitgebracht, der sich nun in Mailis Kopf herumtrieb? Andererseits blieben Geister wohl eher zu Hause. Von weltreisenden Geistern hatte sie noch nie gehört.
Maili war mit Geistern aufgewachsen. Die Berge, Täler, Flüsse und Höhlen waren die Wohnstätten lokaler Gottheiten, und es war selbstverständlich, ihnen Respekt zu erweisen. Manchmal blieb der Geist eines Verstorbenen an der Welt hängen und irrte herum, bis jemand ihn erlöste. Das war Aufgabe der Lamas und vor allem der Chödpas. In Mailis Dorf hatte es eine weise Frau gegeben, die den Geist eines Menschen zurückholen konnte, wenn Dämonen ihn gestohlen hatten. Maili wusste, wie das vor sich ging. Und von Ani Rinpoche hatte sie gelernt, wie man Dämonen auflöste. Nur die Unwissenden fürchteten sich vor Geistern und Dämonen. Sie würde nicht mehr darüber nachdenken. Es war nur ein Traum.
In den folgenden Tagen befasste sich Maili nur noch selten mit Gedanken an den seltsamen Mönch. Einmal bat sie Sarah, ihr die Bedeutung des Kreuzes mit dem toten Mann daran zu erklären. Nachdem sie eine Weile zugehört hatte, sagte sie: »Eine traurige Geschichte. Aber ich verstehe nicht – warum haben sie das mit ihm gemacht? Was hat er getan?«
»Nichts«, antwortete Sarah.
Maili seufzte. »Ah ja. Wie in Tibet.«
Sarah war nah. Sarah war Freude. Die Lust, mit Sarah zu sprechen, verdoppelte Mailis Lerneifer. Ihr Gedächtnis behielt jede Redewendung, jedes neue Wort. Von Ani Yeshe, der jungen Nonne aus Amerika, hatte sie gelernt, die fremde Sprache zu gebrauchen. Von Sarah lernte sie, in ihr zu träumen.
Die verspielten Tage des Losar-Fests gingen vorüber. Mit der zunehmenden Wärme der Sonne wuchs die Vertrautheit zwischen Maili und Sarah, und sie begannen einander anzuvertrauen, was man nur mit nahen Menschen teilt. An einem sternenhellen Abend, an dem sie in Decken gehüllt vor dem Häuschen saßen und süßen Tee tranken, begann Sarah zum ersten Mal von ihrer Tochter Mona zu sprechen.
»Als mein Mann sich von mir trennte, wollte Mona bei ihm leben. Sie war noch fast ein Kind. Ich kämpfte nicht um sie. Ich ließ sie einfach gehen. Es schien richtig zu sein. Doch jetzt quält mich immer öfter der Gedanke, dass ich keine gute Mutter war und dass sie deshalb nicht bei mir bleiben wollte.«
Eine Träne rollte langsam über Sarahs Wange. »Aber ich weiß heute noch nicht, was ich hätte tun sollen, damit sie mich liebt.«
»Sie wollte den Vater, als sie dich zur Mutter wählte«, sagte Maili und legte ihre Hand auf Sarahs Arm. »Das steht in den alten Schriften. Nach dem Tod, im Zwischenzustand, wird man ein Bardo-Wesen. Will dieses Wesen unbedingt wiedergeboren werden, fühlt es sich von seinen zukünftigen Eltern angezogen, wenn sie miteinander schlafen. Es wird ein Mädchen, wenn es den zukünftigen Vater begehrt und eifersüchtig auf die Mutter ist. Wenn es die zukünftige Mutter begehrt, wird es ein Junge.«
Sarah nickte nachdenklich. »Sie hing von Anfang an sehr an ihm. Aber vielleicht lag es auch an mir.«
Mailis Gedanken wanderten. War meine Mutter eine gute Mutter? Sie verstand mich nicht. Sie wollte, dass ich so war wie sie, oder so, wie sie meinte, dass junge Mädchen sein müssten. Sie glaubte, genau zu wissen, wie ich zu sein hatte. Sie wollte mein Bestes. Sie dachte, ihre Vorstellungen seien mein Bestes. War das Liebe? Unwissende Liebe. Bedingte Liebe. Sie pflegte mich hingebungsvoll, wenn ich krank war. Sie tröstete mich, als meine Lieblingsziege starb. Doch mein Anderssein verstand sie nicht.
»Wie, meinst du, ist eine gute Mutter?«, fragte sie nach einer Weile.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Sarah. »Ich hatte wohl immer das Gefühl, ich müsse meinem Kind ein Paradies bieten. Ich müsse alles vollkommen richtig machen.«
Maili pustete einen Laut heiterer Abwehr durch die Lippen. »Wie soll das gehen?«
Über Sarahs Gesicht huschte ein schiefes Lächeln. »Ja, wie soll das gehen? Gefühle sind nicht vernünftig. Ich glaube, ich wurde schon mit Schuldgefühlen geboren. Es ist wie eine lange, tiefe Wurzel. Du denkst, du hast sie beseitigt, aber sie treibt immer wieder von neuem.«
Sie schwiegen und schauten in den dunstigen Himmel über dem weiten Tal.
»Ich schicke ihr jeden Tag meine guten Wünsche«, sagte Sarah. »Wenigstens das kann ich tun.«
»Ja. Das ist gut.« Maili lächelte und fügte sinnend hinzu: »So mache ich es auch.«
»Oh – hast du denn ein Kind?«
»Nein, nein, kein Kind. Jemand – jemand anderen.« Maili begann ihre Hände zu kneten. Der Wunsch, sich Sarah anzuvertrauen, war ebenso mächtig wie ihre Scheu. »Ein Mönch«, sagte sie schließlich, »ich habe mich einmal in einen jungen Mönch verliebt. Sönam. Sein Lächeln ist so schön. Ein Zahn steht ein bisschen schief, das macht es noch schöner.«
Sarah schwieg auf eine sanfte, beruhigende Weise.
»Ich liebe ihn noch immer«, fügte Maili leise hinzu. Ihr Herz begann wild zu pochen. Dies auszusprechen hieß, die geheimen Träume in die Wirklichkeit zu holen. Bald würde er kommen und er würde die bittersüße Nähe mitbringen, Mailis Hoffnung, Mailis Furcht. »Niemand weiß es außer Ani Pema.«
Sarah legte ihre Hand auf Mailis ineinander verkrampfte Finger. Ihr freundliches Schweigen öffnete eine Weite, in die Maili ihre Worte entlassen konnte, wie Schmetterlinge, frei und flüchtig.
»Wir waren einander so nah«, flüsterte sie, »hier.« Dabei legte sie ihre Fingerspitzen auf die Mitte der Brust. »Wir haben unsere Gelübde nicht gebrochen. Das nicht.«
Was dann?, fragte Sarahs Blick. Mailis Körper und Geist wiederholten die Erfahrung der Auflösung aller Grenzen, der Verwandlung dessen, was fest war und Widerstand bot, in eine reine Sphäre von Zärtlichkeit, geborgen in einem unbegrenzten Augenblick.
»Wir wollten beide im Kloster bleiben. Wir lieben unser Leben, so wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, anders zu leben. Hier habe ich Ani Rinpoche und die Pujas und das Studium und die Zeit für Meditation.«
In Mailis Stimme lag ein Anflug von Endgültigkeit, der sowohl ihren Worten Gewicht verlieh, als auch zu verstehen gab, dass über ihr Geheimnis genug gesagt sei.
»Erzähle mir von Ani Rinpoche«, bat Sarah nach einer Pause. »Ich weiß gar nichts von ihr.«
Mit großer Bereitwilligkeit gab Maili Auskunft über ihre Lehrerin, die einen großen Teil ihres Lebens als Yogini in der ausgebauten Höhle über dem Kloster verbracht hatte. Einst eine Gefährtin des alten Rinpoche, hatte dieser sie vor seinem Tod zu seiner Nachfolgerin ernannt und ihr den Titel Rinpoche, die Kostbare, verliehen.
»Früher nannten wir sie Ani Nyima, obwohl sie in ihrem ganzen Leben nie eine Nonne war«, sagte Maili lächelnd. »Und jetzt heißt sie einfach Ani Rinpoche. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat.«
»Ich hörte eine Nonne sagen, sie sei zum Fürchten, aber ich fand sie sehr freundlich.«
Maili lachte. »O ja, sie ist schon zum Fürchten. Man weiß nie, wie sie sich verhalten wird.«
»Erzähle – was macht sie?«
»Sie macht nichts. Das ist es. Sie lässt dich machen. Weil sie nichts macht, siehst du, was du machst. Zum Beispiel wenn du unsicher bist oder nicht völlig aufrichtig, wenn du eine Rolle spielst, ohne es zu wissen oder nur halb wissend. Du spielst, du drehst dich um dich selbst, und sie lässt dich, und du drehst dich noch mehr, und niemand hält dich auf, bis du abgelaufen bist wie eine Uhr. Dann weißt du, was los ist. Und dadurch bringt sich das selbst in Ordnung.«
Sarah lachte ebenfalls. »Ich glaube, das verstehe ich.«
»Sie lässt dich gegen deine eigene Wand laufen«, erklärte Maili fröhlich und schlug ihre Faust gegen die offene Fläche der anderen Hand, »und dann wachst du auf. Das ist gut.«
Sarah spitzte den Mund. »Meinst du – Schluss mit guter Mutter – schlechter Mutter?«
Maili sprang auf und warf die Arme hoch: »Wer ist Sarah? Wer ist Sarah?«, sang sie und drehte sich, so dass ihr Rock eine Glocke bildete »Wer ist Sarah? Sagt mir, ihr Sterne, wer ist Sarah?«
Immer schneller drehte sie sich im Lichtkegel, der durch die offene Tür des Häuschens fiel. Schließlich ließ sie sich neben Sarah auf den ausgetrockneten Boden fallen und rief außer Atem: »Sarah braucht keine Flügel, um am Himmel zu tanzen. Ah lala ho, Dakini! Ah lala ho!«
Ein Tod
Seit Tagen stand das große Kalb an derselben Stelle auf der verdorrten Wiese neben dem Lhakang. Manchmal legte es sich nieder, doch es fiel ihm schwer, wieder aufzustehen. Die Haut hing lose über den Knochen. Aus seinem Maul tropfte unablässig Speichel.
»Es ist krank, man muss etwas tun«, sagte Sarah.
»Man kann nichts tun«, erwiderte Maili. »Es ist schon lange krank.«
»Es hungert«, sagte Sarah und blieb unschlüssig stehen. »Es gibt hier ja nirgends Gras.«
»Der Winter war sehr trocken. Da wächst kein Gras.«
Sarah schüttelte den Kopf. Sie hob die große Holzschale auf, die auf der Wiese lag, füllte sie am Brunnen neben dem Lhakang mit frischem Wasser und trug sie zu dem regungslosen Tier. Das Kalb tauchte kurz die Schnauze hinein, ohne zu trinken. Dann stand es wieder in statuenhafter Starre.
»Könnte man nicht Heu besorgen?«, fragte Sarah und streichelte das harte, stumpfe Fell.
»Es bekommt Gemüseabfälle. Die Kuh und ihr Sohn klettern auf den Hängen herum und fressen Blätter von Büschen und alles Mögliche. Aber diese Kleine war schon immer sehr schwach, von Anfang an.«
Sarah zog ungeduldig die Brauen zusammen. »Man müsste einen Arzt holen.«
»Wir haben nicht einmal genug Geld für unsere Nonnen«, erklärte Maili ruhig. »Wir können uns keinen Arzt für die Tiere leisten, die zu uns kommen und hier leben wollen. Sie kommen einfach. Niemand lädt sie ein und niemand schickt sie fort.«
Sarah wandte sich ab und ging weiter. »Es wird sterben«, sagte sie und presste dann die Lippen aufeinander.
Mit einer beschwichtigenden Geste hob Maili die Hände. »Dann stirbt es an einem guten Ort.«
Mit großen Schritten strebte Sarah dem weit ausladenden Baum neben dem Lhakang zu, eingehüllt in eine Wolke zorniger Trauer. Maili beeilte sich nicht, ihr zu folgen. Lass dich nicht zornig machen von der Vergänglichkeit, wollte sie ihr sagen, es ist doch alles stets ein Werden und Vergehen. Aber es war nicht der rechte Zeitpunkt. Es war Sarahs Augenblick, und es galt, Sarahs Augenblick zu achten und zu schützen.
»Entschuldige«, sagte Sarah, als Maili sich neben sie unter den Baum setzte. »Ich bin es nicht gewöhnt, dass der Tod so öffentlich ist.«
Maili verstand nicht, was dies bedeuten sollte, und sie versuchte nicht, es zu verstehen. Es war nicht wichtig. Sarahs Schmerz war wichtig, ihre Trauer, ihre Hilflosigkeit. Maili atmete den Schmerz und die Trauer und die Hilflosigkeit ein und sie atmete Gelassenheit und Gleichmut und liebevolle Ruhe aus.
Sarah hatte ihr Haar gelöst und begonnen, ihren Zopf mit schnellen, nervösen Bewegungen neu zu flechten.
»Ich weiß, dass ich sterben werde und dass du sterben wirst und alle sterben, aber wenn ich dieses arme Tier sterben sehe … Ich möchte alles tun, um seinen Tod zu verhindern.«
»Das ist in Ordnung«, sagte Maili leise.
»Im Westen sieht man den Tod nicht. Du siehst zertrümmerte Autos im Fernsehen und bedeckte Bündel daneben, und du weißt, das ist ein toter Mensch. Oder Reihen von Leichen, Opfer der Kriege und Aufstände. Aber das ist so weit weg. Es sind nur Bilder, nicht anders als in irgendeinem Spielfilm.«
»Warst du beim Tempel von Pashupatinath, wo die Hindus ihre Toten am Baghmati-Fluss verbrennen?«, fragte Maili und wies auf den Ostteil der hell erleuchteten Stadt im Tal. »Dorthin gehen die Armen zum Sterben. Sie legen sich neben den Tempel und warten auf den Tod. Es ist ein sehr heiliger Ort. Sie denken, es ist gut, dort zu sterben.«
Sarah nickte nachdenklich. »Als Kuh würde ich wohl auch lieber hier als im Schlachthof sterben.«
Maili fragte nicht, was das Wort »Schlachthof« bedeutete. Es war nicht nötig, es zu wissen. Sie wollte eine wahre Vertraute sein, sie wollte der Raum sein, den die Freundin brauchte, um ihre Einsicht entfalten zu können.
»Vielleicht«, fuhr Sarah fort, »ist es ja gut, dass das Kalb nicht länger in diesem kranken Körper eingesperrt ist. Heißt es nicht, dass die Klosterhunde wiedergeborene Mönche sind, die ihre Gelübde gebrochen haben? Vielleicht steckt in dem Kalb eine Nonne.«
Schließlich gingen sie in das Küchenhaus, um nach Futter für das Kalb zu suchen. Doch die Küche war leer und sauber gefegt. Die Abfälle waren längst verteilt. Maili suchte ein wenig Unkraut im Garten neben der Küche zusammen. Das Kalb warf keinen Blick darauf. Aus seinen Augen floss trübes Sekret.
Am Nachmittag lag das Kalb auf der Seite, und die Klosterleiterin saß auf der Erde neben ihm und hielt seinen Kopf auf dem Schoß, ohne auf den Speichel zu achten, der ihren Rock beschmutzte. Maili kauerte neben ihr nieder.
»Es dauert wohl nicht mehr lange«, sagte Ani Tsültrim und fuhr fort, über die Stirn des kranken Tieres zu streichen.
»Morgen früh«, sagte Maili, ohne nachzudenken. Sie wusste es mit Sicherheit, so, wie man in der Dämmerung weiß, dass es bald dunkel sein wird.
Ani Tsültrim sah sie lange fragend an.
Maili wiegte den Kopf. »Wenn die Sonne aufgegangen ist.«
»Gut.« Die Klosterleiterin hob vorsichtig den Kopf des Kalbs von ihrem Schoß. Das Kalb versuchte aufzustehen. Es wälzte seinen mageren, aufgetriebenen Körper auf die Knie, doch weiter reichten seine Kräfte nicht. Ergeben ließ es sich wieder zur Seite sinken.
»Ich bleibe noch«, sagte Maili.
Ani Tsültrim erhob sich mit steifen Bewegungen und legte ihr kurz die Hand auf die Schulter. Ihre knochige Gestalt war manchmal gebeugt, als habe sie Schmerzen. »Was ist, Ani-la«, fragte Maili manchmal, »sind Sie krank?« Doch Ani Tsültrim pflegte darauf nur mit einer kleinen, wegwerfenden Geste zu antworten.
Die Zeit der Rebellion war lange vorbei. Ani Tsültrims Entscheidungen waren stets weitsichtiger gewesen als Mailis hitzige Einwände. Mailis Intelligenz ließ nicht zu, dass sie die Augen davor verschloss. Und Ani Tsültrim hatte Humor, einen trockenen, leisen Humor, den man nur wahrnehmen konnte, wenn man aufmerksam war.
Mit einem angefeuchteten Taschentuch reinigte Sarah die Augen und das verklebte Maul des kranken Tiers. Maili setzte sich und flüsterte dem Kalb das Mantra der Arya Tara ins Ohr. Augenblicklich erschien die Gottheit über dem Kalb und hüllte es ein in ihr Licht, smaragdgrün, klar und heilend, wie das Blätterdach eines Waldes nach dem Regen. Die Meditation der Arya Tara war Mailis erste meditative Praxis gewesen, und in allen Notlagen wandte sie sich, ohne nachzudenken, unwillkürlich an die mütterliche Gottheit des Mitgefühls, so selbstverständlich, wie ein Kind nach der Mutter ruft, wenn es Hilfe braucht.
Ich helfe, sagten die Strahlen der Gottheit, ich bin da, und alles ist in Ordnung. Die Buddha-Natur ist da, unzerstörbar, darauf kann man vertrauen, jenseits von Hoffnung und Furcht. Du bist in guten Händen, kleines Kalb, dachte Maili, während sie aufstand. Sie würde vor dem Schlafengehen wiederkommen und noch einmal vor dem Morgengrauen, wenn das Muschelhorn zur Morgenmeditation rief.
Das Kalb starb am Morgen, während der Gesang der Nonnen aus dem Lhakang wehte. Ani Tsültrim, Maili und Sarah saßen bei ihm und begleiteten es mit ihrer Meditation der Befreiung. Die Mutter des Kalbs und der kleine Stier standen in einiger Entfernung und schauten zu der kleinen Gruppe herüber. Sie hielten ganz still, auch ihre Kiefer bewegten sich nicht. Die natürliche, schlichte Würde des Todes legte sich über der Wiese. Selbst die geschwätzigen Raben saßen schweigend in ihrem Lieblingsbaum.
»Ich glaube, ich möchte auch hier sterben«, sagte Sarah auf dem Weg zum Lhakang.
»Wiederhole den Wunsch, immer wieder, dann wird es so geschehen«, entgegnete Maili.
Über ihnen schrie ein kreisender Falke. Es klang wie »Svaha! Svaha!«
»Ich verstehe immer weniger, je länger ich hier bin«, sagte Sarah am Abend. »Ich meditiere den ganzen Tag, und gegen alles bessere Wissen denke ich, das müsse mich immer weiser machen. Aber ich verstehe gar nichts mehr.«
»Das ist gut«, sagte Maili und schaute von ihrem Rocksaum auf, den sie vorher schon unzählige Male aufgetrennt und neu genäht hatte, um ausgefranste Stellen zu verdecken.
»Was soll daran gut sein?«
»Wo Verstehen ist, ist auch Verwirrung. Wo Verwirrung ist, ist auch Verstehen.«
»Und wo ist der Ausweg?«
Maili schnippte mit den Fingern. »Wozu? Die Natur deines Geistes ist Raum. Wo willst du raus – oder rein?«
»Oh«, sagte Sarah. »Hm, ja.« Plötzlich begann sie zu kichern. Es begann mit einem kleinen Glucksen und steigerte sich schließlich zu einem so unbändigen, stöhnenden Gelächter, dass es Maili mitriss, bis beide sich schließlich auf dem Boden krümmten und die Hände auf das Zwerchfell pressten.
»Endlich weiß ich, was eine mystische Erfahrung ist«, keuchte Sarah und wischte Lachtränen von ihren Wangen.
2Panchas Tanz
Trockene Zweige knackten laut unter Mailis Füßen. Seit langem hatte sie ihr Versteck nicht mehr aufgesucht. Der geheime Platz, den sie sich an einer abgelegenen Stelle zwischen Bäumen und Büschen des Bergdschungels eingerichtet hatte, war jahrelang ihr einziger Zufluchtsort gewesen, an dem sie allein sein konnte, um zu weinen oder zu träumen. Und um Sönam zu treffen. Ein flacher Fels bildete eine natürliche Bank inmitten der kleinen Lichtung, überschattet von einem niedrigen Bäumchen. Ein wenig Buschwerk hatte sie beseitigen müssen, um freien Blick über das Tal und die gegenüberliegenden Berge zu haben.
Der kaum sichtbare Pfad war fast zugewachsen. Behutsam bog Maili die Zweige zurück, die ihr den Weg versperrten. Bald war Sönam wieder da. Niemand sollte ihr Versteck entdecken. Sie würde es brauchen.
Plötzlich erstarrte sie. Zwischen den Büschen bewegte sich etwas, und sie hörte Bruchstücke einer leise gesungenen Melodie. Eine Flamme des Ärgers schoss in ihr hoch. Jemand hatte sich ihres kostbaren Verstecks bemächtigt. Dies war ihr Platz, der Schrein ihrer Erinnerungen. Niemand außer ihr hatte das Recht, sich hier aufzuhalten.
Ihr wütendes Herzklopfen weckte sie aus ihren bösen Gedanken. O nein, dachte sie beschämt, Maili ist unter die Hunde gegangen. Gleich wird sie knurren, die Zähne fletschen und ein Bein heben. Im Geist verneigte sie sich vor der Yogini und flüsterte: »Verzeihung, Rinpoche-la, ich bin wieder wach, ich bin wieder wach!«
Vorsichtig schlich sie näher, bis sie den Eindringling sehen konnte. Es war das Newar-Mädchen Pancha, eine neue Anwärterin auf die Novizenschaft. Der lange, blauschwarze Zopf reichte ihr bis auf die Hüften. Man hatte noch nicht entschieden, ob sie bleiben durfte.
Pancha tanzte, entzückend anzusehen in ihrem türkisfarbenen newarischen Gewand, einem langen, schmalen Hemd und an den Knöcheln geschlossener Hose. In der rechten Hand hielt sie einen kleinen Plastikteller, der die Schädelschale ersetzte, in der linken ein Stück Holz anstatt des Ritualmessers, und mit anmutigen Gesten tanzte sie Variationen des Tanzschritts der roten Dakini, deren Bild im Lhakang hing.
Atemlos sah Maili zu. Innerhalb weniger Augenblicke war ihr Ärger vergessen. Solch einen Tanz hatte sie noch nie gesehen. Es waren wundervoll fließende und zugleich außerordentlich disziplinierte Bewegungen, anmutig und weich, aber zugleich auch voller Kraft und Stolz. Jede Phase des Tanzes ergab ein vollkommenes Bild. Mit leidenschaftlicher Genauigkeit achtete die Tänzerin auf jede Augenbewegung, jede Fingerhaltung, bis sie schließlich in der Position des tantrischen Tanzschritts innehielt, wie eingefroren in vollendetem Gleichgewicht.
Maili presste die Hände gegen die Brust. So wollte sie auch tanzen. Sie ahnte den Fluss der köstlichen Bewegungen in ihrem Körper, der um die Ekstase dieses Tanzes zu wissen schien. Als habe sie einst selbst so getanzt, in einer anderen Zeit.
Maili trat zwischen den Büschen hervor. »Ah lala!«, rief sie und klatschte in die Hände. Das Mädchen erschrak und griff hastig nach dem Tuch, das auf der Felsplatte lag.
»Huhu, ich bin ein Leopard!«, rief Maili. »Siehst du das nicht? So sehen Leoparden aus.«
Das Mädchen lächelte unsicher. »Bitte, verrate mich nicht«, sagte sie scheu, »sonst schicken sie mich wieder weg.«
»Du tanzt sehr schön«, sagte Maili.
»Ich habe zu wenig Übung«, erwiderte Pancha. »Ich weiß, man darf nicht tanzen. Aber es ist ein heiliger Newar-Tanz. Ich habe nichts Schlechtes getan.«
Sie wollte hastig weglaufen, doch Maili trat ihr in den Weg. »Keine Angst, Pancha, ich verrate dich nicht. Komm, setz dich zu mir.«
Maili legte beruhigend den Arm um das Mädchen und zog sie sanft mit sich zur Felsplatte. Zögernd setzte sich Pancha neben sie.
»Wo hast du tanzen gelernt?«, fragte Maili.
Pancha zog ihr Tuch fest um sich und hielt den Kopf gesenkt, so dass Maili nur das glatte, dichte Haar sehen konnte.
»Beim Putzen«, antwortete Pancha.
»Aha, beim Putzen«, wiederholte Maili und kicherte.
Panchas schüchternes Lächeln erhellte sich ein wenig. »Ich habe in der Tanzschule geputzt.«
»Und du hast durch Zuschauen tanzen gelernt?«
Das Mädchen nickte.
»Warum bist du hier im Kloster?«
Pancha senkte den Kopf noch ein wenig tiefer. »Ein Tänzer. Er sagte, er würde mich heiraten. Er war einer der Lehrer. Einmal sah er mich heimlich mittanzen. Er sagte, ich sei begabt. Ich durfte bei jedem Unterricht dabei sein. Er sagte, wenn ich fleißig sei, dann könnten wir bald zusammen in Hotels auftreten und viel Geld verdienen. Und ich hab für ihn geputzt und gekocht. Ich kann gut kochen. Wir sind modern, hat er gesagt, da muss man nicht sofort heiraten. Dann lernte er eine Inchi-Frau kennen, und sie erlaubte nicht, dass er mich behielt.«
Unvermittelt hob sie den Kopf und stieß hervor: »Wo sollte ich denn hingehen? Mein Eltern nehmen mich nicht mehr auf. Ich stand auf der Straße. Aber ich bin nicht dumm. Ich bin in die Schule gegangen. In dieselbe Schule wie Ani Palmo.«
Sie sank wieder in sich zusammen und begann zu weinen, leise, verstohlen, ein kleines Mädchen, das gern unsichtbar gewesen wäre.
Maili drückte sie an sich und sang mit sanftem Wiegen das Mantra der Arya Tara. OM TARA TUTTARE TURE SVAHA. Schöne Mutter Tara, Mutter aller Buddhas, unbegrenzter Raum des Mitgefühls, löse den Schmerz auf, löse die Verwirrung auf, verwandle Unwissenheit in Weisheit.
Als Pancha nicht mehr weinte, stand Maili auf. Sie legte ihr Tuch ab und sagte nachdrücklich: »So, und jetzt zeig mir, wie das geht. Ich möchte deinen Tanz lernen.«
Pancha sah sie mit offenen Mund an.
»Zeig es mir«, sagte Maili ungeduldig.
»Es ist doch verboten.« Panchas Stimme war dünn vor Unbehagen.
Maili warf den Kopf zurück. »Es ist ein heiliger Tanz. Daran ist nichts Schlechtes. Ich will ihn lernen.«
Pancha stand auf und nahm umständlich ihr Tuch ab. »Ich weiß nicht …«
»Fang an«, sagte Maili, »ganz langsam.«
Sie übten lange und vergaßen die Zeit. Erst der entfernte Klang der Glocke, die zum Mittagessen rief, holte sie in die Welt des Klosters zurück. Der vormittägliche Studienkurs war zu Ende. Maili bedauerte nicht, dass sie ihn versäumt hatte.
»Essenszeit«, seufzte sie. »Denk dir irgendeine Entschuldigung aus.«
Sie verabredeten sich für die Mittagspause am folgenden Tag.
»Du wirst diesen Platz hier vergessen«, sagte Maili mit Nachdruck, »er gehört mir. Nur mir. Ich kenne eine Lichtung, die ist größer und besser geeignet. Dort werden wir üben.«
Das Tanzen half Maili ein wenig über ihre wachsende Unruhe hinweg. Sönams Drei-Jahres-Retreat war zu Ende, doch er kam nicht auf den Berg. Der Bruder einer der Nonnen, der ebenfalls in diesem Retreat gewesen war, besuchte seine Schwester im Kloster. Maili wagte nicht, nach Sönam zu fragen.
Der innere Druck wurde so übermächtig, dass sie sich eines Abends Sarah anvertraute.
»Vor drei Jahren trennten wir uns mit so viel Leichtigkeit«, sagte sie. »Wir waren ganz ruhig. Fast weise. Wir wussten, dass es keine Trennung gibt – nur außen. Alles war richtig. Alles stimmte.«
»Warum, meinst du, kommt er nicht?«, fragte Sarah.
Maili knetete ihre Hände. »Wahrscheinlich, weil er Angst hat. Er hatte so oft Angst.«
»Wovor?«
Maili verzog das Gesicht zu einem resignierten Lächeln. »Vor sich selbst. Vor Schmerz. Was weiß ich. Er erlebt es anders als ich.«
Sarah nickte sinnend.
Jetzt ist der richtige Augenblick, dachte Maili, jetzt muss ich sie fragen. Sie ist meine Freundin. Sie wird es mir erlauben. Ohne weiter zu überlegen, stürzte sie sich in die Frage und ihre Stimme klang flach und ein wenig atemlos.
»Sarah, du hattest einen Mann. Wie war es mit ihm?«
Sarah lachte. »Nicht ideal. Sonst wären wir jetzt nicht geschieden.«
»Ich meine, wie war es … mit eurer … Liebe …«
»Wir waren ziemlich jung, Studenten, und wir waren sehr verliebt. Mindestens ein Jahr lang.«
Maili drehte den Zipfel ihres Tuchs um einen Finger. Es lag nicht an der fremden Sprache, dass sie nicht die richtigen Worte fand. Keine der Sprachen, die sie kannte, schien die richtigen Worte zu bieten.
»Was möchtest du wissen?«, fragte Sarah sanft.
Maili befreite ihren Finger aus dem Tuch und legte mit einer unbewussten Geste die Hände aneinander.
»Wart ihr Freunde – gute Freunde, so wie du und ich?«
Sarah dachte nach. »Weißt du«, sagte sie schließlich, »es gibt bei uns ein Sprichwort: Das Einzige, was es in einer Liebesbeziehung nicht gibt, ist Liebe. Meine Erfahrungen haben das bestätigt. Irgendwann dachte ich: Bestenfalls ein Rinpoche wird mir das bieten können, was ich von einem Mann erwarte. Eine gesunde männliche Energie. Ich hatte genug von gewöhnlichen Männern.«
Maili kicherte. »Einmal wollte mich ein Rinpoche nach Indien mitnehmen. Ich kannte ihn nicht und er kannte mich nicht. Rinpoches sind manchmal … wie heißt das Wort? … seltsam.«
Sarah griff nach der Thermoskanne und goss gesalzenen tibetischen Tee in ihre Tassen.
»Aber du bist noch da.«
Maili ließ sich heiter in die Erinnerung gleiten. Sarahs Stimme zog sie wieder heraus, und sie schämte sich für ihre Geistesabwesenheit.
»Ich erzähle dir eine Rinpoche-Geschichte, wenn du magst«, sagte Sarah und ordnete ein Kissen hinter ihrem Rücken.
Maili klatschte in die Hände. »Erzähle, erzähle.«
Eines der seltenen Frühlingsgewitter hatte ein wenig Regen gebracht, und der köstliche Geruch kühler, nasser Erde zog durch das Häuschen.
»Im vergangenen Jahr besuchte ich Nordindien. Ein befreundetes Paar nahm mich zu einem tibetischen Kloster mit, dessen Rinpoche einmal in unserem Zentrum zu Gast war. Ich ließ die beiden in Ruhe und ging meiner eigenen Wege. Einmal fuhr ich zu einem zwei Autostunden entfernten, als besonders schön gerühmten Bergdorf, und auf der Rückfahrt brach das Taxi zusammen. Es war ein glühend heißer Nachmittag. Wir standen auf einer einsamen Straße, der Fahrer wühlte unter der Motorhaube herum, und ich hoffte, dass endlich mal irgendjemand vorbeikommen würde. Aber diese Straße lag am Ende der Welt, da kam niemand vorbei.«
Eine Liebe von Sarah
Sarah saß auf der Schattenseite des Taxis in der offenen Tür. Die Luft stand still wie eine lauernde Katze. Ihr Hemd und ihre Hose klebten an der Haut, und über ihrem Gesicht und Hals lag eine mit Staub vermischte Schweißschicht.
Ihr Blick glitt an den sie umgebenden steilen Berghängen ab, die alle gleich aussahen. Seit mehr als einer halben Stunde standen sie bereits hier, und es sah nicht so aus, als würde der Taxifahrer mit seinen Bemühungen unter der Motorhaube den geringsten Erfolg haben. Sie mochten vielleicht noch zwanzig Minuten Fahrt von der Stadt entfernt sein – zu weit, um zu Fuß zurückzulaufen. Sarah seufzte und bedauerte sich. Schließlich zog sie ihre Mala hervor und ließ sich vom Rhythmus des Mantras beruhigen. OM MANI PADMe HUM OM MANI PADME HUM. Wie viele Flüchtlinge mochten unterwegs sein auf den Straßen dieser Welt, unter schlimmeren Bedingungen, als im Schatten eines Taxis sitzend, auf Straßen, die in bedrohliche Ungewissheit führten, anstatt in die Geborgenheit eines tibetischen Gästehauses.
Die Sonne rückte weiter. Der Fahrer richtete sich schließlich auf und zündete eine Zigarette an. Sarah mochte ihn nicht. Die Wasserflasche, die sie fürsorglich mitgenommen hatte, war fast leer. Zögernd bot sie den letzten Rest dem Fahrer an. Mit einem dankbaren kleinen Lächeln nahm er die Flasche entgegen. Sarahs Abneigung verminderte sich ein wenig.
Fernes Motorengeräusch ließ sie aufspringen. In der Haarnadelkurve vor ihnen erschien ein großer, funkelnder, komfortabler Geländewagen. Mit Erleichterung stellte Sarah fest, dass seine beiden Insassen rote Klostergewänder trugen.
Der Wagen hielt an, und der Beifahrer, ein schlanker, großer Mönch, sprang heraus, mit einem Schwung, der verriet, wie sehr sich sein in klösterliche Gemessenheit gezwängter Körper nach freier Bewegung sehnte.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte er.
»O ja, bitte«, rief Sarah, »ich will hier weg. Wir stehen hier schon ewig.«
Er könne sie zu seinem Kloster mitnehmen, schlug der Mönch in passablem Englisch vor, und dann könne er ihr sein Auto zur Fahrt in die Stadt zur Verfügung stellen. Sein Lächeln gab sehr weiße Zähne zwischen vollen, wohlgeformten Lippen frei. Trotz der Hitze wirkte er kühl.
Bevor der Fahrer Sarah beim Einsteigen behilflich sein konnte, hatte der Mönch bereits ihren Ellenbogen ergriffen und nahm ihre Hand in die seine. Erleichtert kletterte sie auf den Rücksitz des Fahrzeugs und lehnte sich leise seufzend zurück. Es erschien ihr, als würde der Mönch ihre Hand ein wenig länger festhalten als nötig. Ihr Herz schlug fröhliche, kleine Trommelwirbel.
Nach kurzer Zeit erreichten sie ein abgelegenes kleines Kloster, neu und überaus sauber.
»Hier bin ich zu Hause«, sagte ihr Begleiter und führte sie ins obere Stockwerk. »Ich bin der Rinpoche dieses Klosters.«
Sarah überlegte verwirrt, wie sich verhalten sollte. Sie hatte wenig Erfahrung im Umgang mit Rinpoches. Sie waren hohe Würdenträger, man ließ ihnen den Vortritt, hielt ihnen die Tür und den Wagenschlag auf und näherte sich stets gebückt mit gefalteten Händen. So hatte sie es gesehen und folgsam nachgeahmt. Doch war es nun zu spät für solche Formen, und dieser Rinpoche schien keinen Wert darauf zu legen. Sarah rettete sich in die umständlichen Maßnahmen, die das Ausziehen ihrer gut verschnürten Wanderschuhe erforderte. Aus den Augenwinkeln sah sie die Füße des Rinpoche, der in bequeme Ledersandalen geschlüpft war, schmale Füße, klein für seine Größe.
Als sie sich aufrichtete, legte der Rinpoche, der sie um weniges überragte, leicht seine Hand auf ihren Rücken und schob sie an einem dicken Vorhang vorbei in ein Zimmer mit Sitzcouch und tiefen Sesseln. Er wies ihr einen Sessel zu und setzte sich auf die Couch. Keine Brokatdecke bezeichnete seinen Sitzplatz, wie es üblich war, und er schlug die Beine übereinander, anstatt sie nach östlicher Weise zu kreuzen.
Ein alter Mönch war ihnen gefolgt und stellte ein kostbares Trinkgefäß vor seinen Herrn. Auf ein paar Worte des Rinpoche verschwand er und kam mit einem Glas und einer eisgekühlten Dose Cola zurück. Der Alte ging seinen Pflichten mit würdevoller Aufmerksamkeit nach. War er die männliche Amme, die den kleinen Rinpoche in der Männergesellschaft eines Klosters aufgezogen hatte? Er mochte es sein. Die unaufdringliche Verlässlichkeit tiefer Hingabe ging von ihm aus.
Der leichte Plauderton des Rinpoche ließ Sarah bald ihre Unbefangenheit wiederfinden. Sie sprachen über London, wo der Rinpoche einmal gewesen war, über das Zentrum, das Sarah leitete, über die Veränderungen der tibetischen Tradition unter dem Einfluss westlicher Zivilisation.