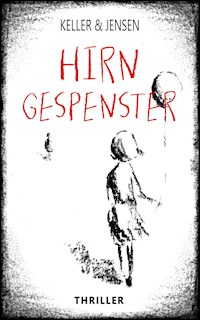
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sótano
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Unfall. Eine lange Dunkelheit. Und dann das böse Erwachen.
Als Silvie nach einem Sturz zu sich kommt, ist die einst so lebenslustige Frau gefangen in ihrem eigenen Körper. Zwar lebt sie mit ihrem Mann und ihren Söhnen in ihrem früheren Zuhause. Doch die Frau, die sie so liebevoll pflegt, hat Silvie über Jahre als gefährliche Rivalin gesehen. Wie konnte es dazu kommen? Und wo steckt eigentlich Anna? Silvies Schwester, die seit Jahren kurz vor einem Zusammenbruch stand, scheint verschwunden. Ist sie etwa im Gefängnis? Oder in der Psychiatrie? Erst allmählich erlangt Silvie ihre alten Fähigkeiten zurück und hegt bald einen schrecklichen Verdacht.
Neuauflage! Dieser Roman ist bereits im Knaur Verlag unter demselben Titel erschienen.
Auch von Keller & Jensen: Vater, Mutter, Kind; Klirrende Stille
Die Levke-Sönkamp-Reihe: Möwentrauer; Möwenschuld; Möwenzorn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hirngespenster
Keller & Jensen
Sótano
Inhalt
Neuauflage
Das Buch
Keller & Jensen
Vorwort
Prolog
1. Silvie
2. Anna
3. Silvie
4. Sabina
5. Silvie
6. Sabina
7. Silvie
8. Anna
9. Silvie
10. Anna
11. Silvie
12. Anna
13. Silvie
14. Sabina
15. Silvie
16. Sabina
17. Silvie
18. Anna
19. Silvie
20. Sabina
21. Silvie
22. Anna
23. Silvie
24. Anna
25. Sabina
26. Silvie
27. Sabina
28. Silvie
29. Anna
30. Sabina
31. Silvie
32. Sabina
33. Silvie
34. Sabina
35. Silvie
36. Anna
37. Silvie
38. Anna
39. Silvie
40. Sabina
41. Silvie
42. Sabina
43. Silvie
44. Sabina
45. Silvie
46. Sabina
47. Silvie
48. Sabina
49. Silvie
50. Sabina
51. Silvie
52. Anna
53. Silvie
54. Silvie
Epilog
Weitere Romane von Keller & Jensen
Vater, Mutter, Kind †
Klirrende Stille
Neuauflage
Bei diesem Roman handelt es sich um eine Neuauflage des bereits im Knaur Verlag erschienenen und inzwischen vergriffenen Titels »Hirngespenster«. Sollten Sie dieses eBook versehentlich gekauft haben, wenden Sie sich unter [email protected] an die Autorin.
Das Buch
Ein Unfall. Eine lange Dunkelheit. Und dann das böse Erwachen.
Als Silvie nach einem Sturz zu sich kommt, ist die einst so lebenslustige Frau gefangen in ihrem eigenen Körper. Zwar lebt sie mit ihrem Mann und ihren Söhnen in ihrem früheren Zuhause. Doch die Frau, die sie so liebevoll pflegt, hat Silvie über Jahre als gefährliche Rivalin gesehen.
Wie konnte es dazu kommen? Und wo steckt eigentlich Anna? Silvies Schwester, die seit Jahren kurz vor einem Zusammenbruch stand, scheint verschwunden. Ist sie etwa im Gefängnis? Oder in der Psychiatrie?
Erst allmählich erlangt Silvie ihre alten Fähigkeiten zurück und hegt bald einen schrecklichen Verdacht.
Keller & Jensen
Die aus Hessen stammende Krimiautorin Ivonne Keller verfasst unter dem Pseudonym Stina Jensen Inselromane und -krimis – da bot es sich an, die beiden Namen für ihre Thriller miteinander zu verbinden.
Schon seit ihrer Kindheit liebt die Autorin das Spiel mit der Sprache. Bereits in der Schule begeisterte sie sich für englischsprachige Literatur und lernte später während eines Auslandsstudiums im andalusischen Granada Spanisch. Die Faszination für Sprache, gekoppelt mit dem Interesse für alles Menschliche, führte sie neben ihrer früheren Tätigkeit als Personalerin zum Schreiben. Dabei interessiert es sie besonders, was mit Menschen passiert, die kurz davor sind, auszuflippen: Wenn das Leben so anstrengend wird, dass die Fassade bröckelt und man auf das schauen kann, was dahinterliegt.
Nach Zwischenstopps in Granada und Offenbach lebt sie mit ihrer Familie seit vielen Jahren in der Wetterau.
www.ivonne-keller.dewww.stina-jensen.de
Familie kann man sich nicht aussuchen.
Vorwort
Die Namen der im Text erwähnten Medikamente sind frei erfunden.
Die Wirkungsweisen jedoch nicht.
Bei einigen der im Roman genannten realen Örtlichkeiten hat sich die Autorin die schriftstellerische Freiheit genommen, sie ihren Bedürfnissen anzupassen. Sollten Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen bestehen, so wären diese rein zufällig. Die Handlung ist fiktiv.
Prolog
In dem Moment, als ich mit dem Kopf auf den Beton aufschlug, bereute ich, Anna niemals gesagt zu haben, wie sehr ich sie bewunderte. Hätte ich es mal getan, befände ich mich jetzt vielleicht gar nicht in dieser vertrackten Situation. Dann hätte ich eventuell einfach abtreten können.
Mit einer Hand fummle ich am Verschluss meines Sicherheitsstuhls, in der anderen halte ich einen Becher mit Auslaufschutz. Damit ich hier am Küchentisch nicht umkippe, haben sie mir ein Stützkissen hinter den Rücken geklemmt. Nie hätte ich gedacht, dass ich so was noch mal erleben muss! In der einen Minute ist man noch im Vollbesitz seiner körperlichen Fähigkeiten, und in der nächsten findet man sich um Jahrzehnte zurückgeworfen wieder, bringt nicht mal mehr ein deutliches Wort über die Lippen!
Allein wenn ich mich in der Küche umschaue, könnte ich schreien. Auf meinem Sideboard steht eine chinesische Vase. Früher stand die dort nicht. Und überhaupt, alles hier ist vollkommen verändert. Inklusive meine Wenigkeit. Die Wände sind farbig gestrichen. Die Küche ist neu. Im Wohnzimmer liegt ein grüner Teppich.
Mir läuft der Sabber aus dem Mund, aber das ist auch schon egal – ich habe ohnehin keine Kontrolle darüber. Es ist mir auch niemand böse, sie lächeln und wischen mir das Kinn ab, von Anfang an. Mit meiner Körperbeherrschung steht es nun mal nicht zum Besten, genauso wenig wie mit meinen Gedanken, aber von denen ahnt ja sowieso keiner was. In meinen Tagträumen verfolge ich Sabinas Hausarbeit oder Nils’ und Oles Spiel, ohne dass ich merke, wie die Zeit vergeht. Und wenn ich dann mal den Mund aufmache, um auch etwas zu einer Unterhaltung beizutragen oder Nils und Ole eine Anweisung zuzurufen, lalle ich nur. Statt »Macht mit eurem Ball bloß nicht diese hässliche Vase kaputt!«, kommt mir ein solch abscheuliches Kauderwelsch über die Lippen, dass es mir sofort wieder die Sprache verschlägt. Peinlich ist das, so peinlich, dass ich manchmal vor Verzweiflung weine. Oder schreie. Keiner versteht, warum ich schreie; sie glauben, ich hätte Wutanfälle oder Krämpfe – keiner begreift, was wirklich mit mir los ist. Und dann wird wieder der Arzt konsultiert, man mache sich Sorgen wegen dieser Schreierei. Der weiß natürlich auch keine Lösung; das werde sich sicher geben, sagt er.
Vor ein paar Monaten, als ich zu mir kam, fand ich mich in einem gesicherten Bett wieder und begriff nicht, was mit mir passiert war. Ich war eine vollkommen andere. Keine Silvie Jakobi, berufstätige Mutter zweier Söhne, nein, ein hilfloses Geschöpf. Dass ich sogar Windeln trug, muss ich sicher nicht extra erwähnen. Johannes saß stundenlang bei mir und streichelte meine Hand – genauso wie Sabina. Ausgerechnet sie! Ich habe sie fast nicht erkannt. Auf den Fotos war sie natürlich viel jünger.
Am Ende hat er also doch noch bekommen, was er immer wollte.
Ich schielte die beiden aus halbgeschlossenen Lidern an, sah zu, wie sie sich küssten und in den Arm nahmen, und hatte ansonsten keine Chance, mich bemerkbar zu machen: Schläuche traten aus meiner Nase, und Medikamente flossen durch eine Kanüle in meinem Körper. Abgesehen davon, dass ich mich sowieso nicht gerade wie neugeboren fühlte.
Im Gegensatz dazu ist meine jetzige Situation das Paradies.
Wenn ich mich wenigstens besser bewegen könnte! Den Verschluss meines Stuhls kriege ich auch mit beiden Händen nicht auf. Allerdings, selbst wenn es mir gelänge, würde ich sowieso nur auf den Boden knallen. Da sehe ich mir lieber meinen Trinkbecher genauer an und versuche, ihn zu öffnen. Aber es gelingt mir nicht, selbst wenn ich die Zähne zu Hilfe nehme. Meine Finger weigern sich, die einfachsten Tätigkeiten auszuführen. Sabina ist das egal; sie lässt mich Ewigkeiten hier herumsitzen, während sie die Küche in Ordnung bringt. Immer schön arbeiten, fleißig wie eine Biene. Anna würde mit jemandem in meiner Situation bestimmt anders umgehen, wobei – sie wüsste ja genauso wenig, was mit mir los ist. Aber sie ist sowieso nicht da, und ich frage mich, was aus ihr geworden ist. Wieso kommt sie niemals hier vorbei? Wenigstens wegen Nils und Ole, immerhin ist sie ihre Tante.
Jetzt will Sabina mich schlafen legen, wie jeden Mittag um diese Zeit. Sie hat die Spülmaschine fertig eingeräumt, nimmt mir den Becher aus der Hand und macht den Verschluss meines Stuhls auf. Und egal, ob ich mit den Armen rudere oder nicht, sie bringt mich ins Bett, deckt mich zu und macht das Licht in meinem Zimmer aus. Sie schert sich nicht um meine Meinung, und auch sonst keiner.
Das Zimmer, in dem ich untergebracht bin, war früher mein Arbeitszimmer. Johannes und Sabina haben es in trauter Zweisamkeit für mich hergerichtet, dieses alberne Bett hineingeschoben und den Schreibtisch rausgetragen. So ändern sich die Zeiten. Und nun liege ich hier und versuche einzuschlafen – was bleibt mir anderes übrig? – und ich wünschte, Anna wäre bei mir. Ach, Anna!
Silvie
Anna pflegte zu sagen, ich sei gebildet. Ich weiß, was sie meinte. In Wirklichkeit meinte sie eingebildet, aber sie sagte es nicht. Anna ist »nur« Hausfrau, und sie sagte das immer so, als wären es meine Worte, dabei hätte ich solch eine Unachtsamkeit nie in den Mund genommen. Im Gegenteil, ich bewundere Frauen wie Anna, die sich voll und ganz der Familie widmen, denn ich denke, für Kinder ist das schön. Doch nur weil es nichts für mich war, dachte sie, ich sähe auf sie hinab.
Dabei habe ich meine große Schwester immer bewundert. Als Kind sah ich neben ihr aus wie ein verstrubbeltes Pony neben einem glänzenden Stallpferd – aber sie nahm es nicht wahr, ich war die Kleine. Anna entschied, dass sie Querflöte lernte und ich Geige. Ich war begeistert, wie von allem, was Anna vorschlug. Wir übten nachmittags gemeinsam auf unseren Instrumenten. Oft genug spielte unser Vater dazu auf dem Klavier, und Anna rief strahlend: »Wir gründen mal eine Band!«
Das wollte ich auch! Auch wenn die Geige mir gar nicht lag, ich gab mir alle Mühe mit dem Instrument, konnte ihm aber kaum einen sauberen Ton entlocken. In einer Band mit meiner Schwester, zwei Brüder wären unsere Ehemänner, und zu viert wären wir wie ABBA!
Nach einigen Wochen schlug unser Vater vor, dass ich mich besser an der Gitarre versuchte, sie entspräche vielleicht mehr meinem Charakter. Anna hörte es nicht gern. »Gitarre passt nicht zu Querflöte«, stellte sie fest und machte ein enttäuschtes Gesicht. Fortan übten wir getrennt, aber ich durfte weiterhin abends ihr dunkles Haar bürsten, mich danach zu ihr ins Bett kuscheln und stundenlang mit ihr flüstern und kichern. Sie erzählte die schönsten Gruselgeschichten, die man sich denken konnte.
Wir dachten, das Leben ginge immer so weiter. Wir wuchsen miteinander auf, eine Selbstverständlichkeit in unseren Augen, wir würden größer werden und älter, das Geheimnis der Erwachsenenwelt in weiter Ferne. Als Anna sich schwach fühlte und nicht am Sportunterricht teilnehmen konnte, schob man es auf die Pubertät, auf die hormonelle Veränderung. Dass sie blass aussah und keinen Appetit hatte ebenso. Die Blutuntersuchung war reine Routine, eine Pflichterfüllung von Hausarzt und Eltern – man wollte sich nichts vorwerfen müssen. Dann der Anruf des Arztes, das erschrockene Gesicht meiner Mutter, das Knibbeln an den Fingernägeln während des Telefonats und die geflüsterten Worte: »Uniklinik. Noch heute? In Ordnung.«
Dass Anna an Leukämie erkrankt war, war für mich kein Grund, nicht weiter zu ihr aufzuschauen. Ganz im Gegenteil. Doch für sie änderte sich alles.
Ich begriff zuerst nicht, was für eine Krankheit das war, die meine strahlende Anna in ein dünnes, glatzköpfiges Mädchen verwandelte, das nicht mehr lächelte. Einmal wagte ich, meine Eltern ängstlich zu fragen, ob auch »etwas ganz Schlimmes« passieren könnte. Sie blinzelten stumm, waren den ganzen Tag über nicht mehr ansprechbar. Da konnte ich mir den Rest schon denken. Ich gewöhnte mir ab, zu fragen, und versuchte, Anna bei meinen Besuchen in der Klinik aufzuheitern, indem ich ihr erzählte, dass eine ihrer Freundinnen in Hausschuhen in die Schule gekommen war, doch sie sah durch mich hindurch. Abends in meinem Zimmer legte ich ABBA auf und grübelte stundenlang. Der Gedanke, dass das Schicksal ein frühes Ende für meine Schwester vorgesehen haben könnte, grub sich täglich tiefer in mir ein, machte es sich dort bequem wie eine Katze im Heuhaufen. Ein Leben ohne Anna konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich hatte keinen Appetit mehr, genauso wenig wie sie. Ich dagegen kotzte nicht.
Als man sie nach fast einem Jahr Klinikaufenthalt als vorerst geheilt, aber glatzköpfig und wimpernlos entließ, stand ich an der Schwelle zur Pubertät und war so groß wie sie. Sie sah sich in meinem Zimmer um, betrachtete schweigend die Poster von The Police und fragte: »Wo sind denn die ABBA-Poster hingekommen?«
Ich schluckte. »Weg. Ich … ähm … höre jetzt was anderes.«
Wortlos verließ sie mein Zimmer, und ich eilte ihr hinterher. »Soll ich dir mal eine Platte von denen vorspielen? Die sind super!«
Sie blieb stehen und blickte mich unter ihrer braunen Perücke böse an. »Hättest du nicht auf mich warten können? Ich bin älter als du und kann nichts dafür, dass ich Leukämie hatte. Nicht nur, dass du jetzt andere Musik hörst. Du bekommst auch noch einen Busen!«
»Entschuldigung«, flüsterte ich.
Spätestens ab diesem Moment ahnte ich, dass es zwischen uns nie mehr so werden würde wie früher. Ein Stück meiner alten Anna war mit der Chemo zerstört worden, unwiederbringlich.
Während Anna nach ihrem Realschulabschluss in einer Schneiderlehre aufging, und es so aussah, als hätte sie endlich wieder ein wenig Spaß am Leben, wechselte ich zum Ende ihrer Ausbildung auf die Oberstufe und lernte dort ein Jahr später Johannes kennen. Ich stand auf Pink Floyd und trug selbstgestrickte Pullover und Camelboots, während Anna Ballerinas und filigranen Silberschmuck trug. Ich konnte viele Beatles-Songs auf der Gitarre spielen und war deshalb auf jeder Spontanparty am Ufer eines der umliegenden Seen gern gesehen; selbst die Jungs sangen lauthals mit, wenn sie gekifft hatten. Johannes hatte die elfte Klasse in den USA verbracht – in seinen Kapuzenpullis und mit seiner Baseballkappe passte er überhaupt nicht zu unserem Trupp aus Jutetaschenträgern. Die Jungs, mit denen ich auf Partys knutschte und die mir beibrachten, wie man eine Bierflasche mit dem Feuerzeug öffnet, trugen speckige Jeans und löchrige T-Shirts und jobbten an Tankstellen. Er schloss sich uns an, indem er sich in den Pausen zu uns in die Raucherecke gesellte. Die Arme verschränkt, lauschte er unseren Gesprächsthemen, die wir für intellektuell hielten: Politik, Umweltschutz, Emanzipation. Ich fragte mich, warum er unsere Nähe suchte, wo wir doch seine tollen Erfahrungen, die er in Amerika gemacht hatte, nicht teilten. Er hatte die große weite Welt gesehen, wir nur die kleine Welt zwischen Hanau und Büdingen. Ich dachte, er wird sich bald seinesgleichen suchen.
Aber er wusste gar nicht, wer seinesgleichen war.
Eines Sommerabends auf einer Party am Seeufer rief er plötzlich über die Köpfe aller hinweg: »Hey, Silvie!«
Ich sah von der Gitarre auf und strich mir eine blonde Haarsträhne aus der Stirn. »Kannst du Wish you were here von Pink Floyd spielen?«, fragte er hoffnungsvoll, aber es klang für mich dennoch von oben herab, so nach dem Motto: Kannst du doch eh nicht!
Ich bedachte ihn mit einem Zucken der Augenbraue und antwortete: »Aber nur, wenn du mitsingst.«
Dann begann ich mein Spiel. Es lag mit Sicherheit am Haschisch, dass mir kein einziger Patzer unterlief. Besonders das Intro hat es in sich; ich hatte es ewig üben müssen und war oftmals daran verzweifelt. An diesem Abend konnte ich den Song von vorn bis hinten ohne einen einzigen Fehler durchspielen. Johannes sang nicht mit. Er wischte sich verstohlen die Augen, aber ich war nicht so borniert zu glauben, mein Spiel rührte ihn.
An diesem Abend gewann er mein Herz; ich wusste, wie sich Verlust anfühlt.
Er sprach mich an diesem Abend nicht noch einmal an; um genau zu sein, verschwand er grußlos, nachdem ich fertig war. Doch ich hatte bei ihm einen Stein im Brett, er grüßte mich nun in den Pausen. Er kam jetzt öfter zu unseren Partys, ohne jedoch nochmals einen Musikwunsch zu äußern.
Eines Abends, als wir im Wagen meiner Mutter unterwegs zu einer Disco waren, saß er vorn neben mir. Zwar hatte ich keine Gitarre dabei, ich fuhr ja auch, aber wir sangen alle lauthals zu The beautiful Souths Song for whoever. Aus einer Laune heraus beugte ich mich zu ihm hinüber und fragte: »Sag mal, wie hieß eigentlich deine Freundin in Amerika?«
Johannes schaute stur geradeaus. Hatte er mich überhaupt gehört?
»Sabina«, verriet er schließlich.
Ich steuerte weiter und summte bei den anderen mit. Sabina. Ich fragte mich, wie sie aussah. Blond, wie ich? Brünett? »Das hört sich gar nicht amerikanisch an«, bemerkte ich.
Er nickte. »Ihre Mutter ist Deutsche. Spricht auch perfekt Deutsch.« Dann schwieg er wieder. Plötzlich tippte er mir auf den Arm. Erstaunt drehte ich den Kopf zur Seite.
»Wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich kann dir Bilder zeigen.«
»Gern«, nickte ich und lächelte zaghaft.
An diesem Abend sah ich ihn zum ersten Mal tanzen.
Ein paar Tage später fuhr ich zu ihm nach Hause. Er wohnte in einer Villa im nobelsten Stadtteil von Hanau.
Mit offenem Mund stieg ich aus dem Auto. Das Haus stand zurückgesetzt auf einem leicht ansteigenden Grundstück. Vorn zur Straße hin gab es ein schweres, gusseisernes Tor, und ich legte zaghaft den Finger auf die Klingel. Fast erwartete ich einen Butler, der mir das Tor öffnen würde – es ertönte jedoch lediglich ein Summer. Ich erinnere mich noch daran, wie Johannes mir die Tür öffnete und mich seiner Mutter vorstellte, die im Wohnzimmer Blumen goss. Ich betrachtete sie verstohlen, sie sah aus wie eine Schauspielerin, eine Berühmtheit aus einer Zeitschrift, und nicht wie eine ganz normale Mutter. Alles an ihr wirkte gepflegt und edel, genauso wie das Innere des Hauses. Ich hatte noch nie solch edle Vorhänge gesehen. Sie streckte mir die Hand entgegen.
»Du bist also Silvie? Freut mich.«
Ich schüttelte ihre Hand und brachte gerade mal ein schüchternes »Hallo« zustande, bevor Johannes mich weiter in sein Zimmer führte.
Da es keine andere Sitzgelegenheit gab, ließ ich mich auf einer Ecke seines Bettes nieder und schaute mich um. Der Raum war nicht besonders groß, aber wie sich herausstellte, gehörten ihm auch ein angrenzendes kleines Badezimmer sowie ein Raum mit Schreibtisch und braunem Ledersessel. Die Möbel waren alt – ich hätte sie als Antiquitäten eingestuft.
Er folgte meinem Blick und sagte: »Das Zeug ist von meinem Vater. Ist gestorben, als ich klein war.«
»Oh«, sagte ich und nickte, schob das Bettzeug beiseite, damit ich besser sitzen konnte, und fragte mich, was wohl mit seinem Vater passiert war.
Offenbar spiegelten sich meine Gedanken auf meinem Gesicht wider, oder aber er war es gewohnt, diese Fragen früher oder später zu hören. Er sagte: »Er war zwanzig Jahre älter als meine Mutter. Sie waren nur fünf Jahre verheiratet. Meine Mutter machte eine große Erbschaft, und die restlichen Verwandten redeten nicht mehr mit uns.«
Oha, dachte ich und fragte: »Kannst du dich noch an ihn erinnern?«
Er schüttelte den Kopf. »Nö. Ist halt so. Hab ich eben nur eine Mutter, ist auch okay.«
Ich nickte und sah mich weiter um. An der dem Bett gegenüberliegenden Wand standen zwei große, ebenfalls alte Regale, auf denen alles kreuz und quer lag, darunter etliche Baseballkappen. Er hatte ja immer diese Sportklamotten an, Nike größtenteils, von Kopf bis Fuß, die obligatorische Baseballkappe fehlte nie. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn gut finden sollte, rein äußerlich.
Er griff neben seinem Bett nach einem Fotoalbum und schlug es auf. Ein Mädchen mit glänzenden schokobraunen Haaren und hellbraunen Augen strahlte mich an. Ihr Gesicht war mit Sommersprossen übersät, die Zähne blitzten weiß, sie riss die Arme in die Höhe, als riefe sie »Tadaaa!« Johannes blätterte weiter. Auf den folgenden Seiten vollführte das Mädchen anmutige Turnübungen auf einer grünen Wiese, sie schlug Rad, machte einen Handstand. Dazu stets dieses sympathische Lachen, der schlanke Körper verrenkte sich anmutig, und ich sank mit jedem weiteren Foto mehr in mich zusammen. Auf der letzten Seite des Albums gab es ein Bild von ihm und ihr, sie strahlten um die Wette. Johannes lugte mit seinen braunen Augen schelmisch unter dem Schirm der Baseballkappe hervor, sie lachte lauthals, die kinnlangen Haare umrahmten ihr Gesicht. Sie sahen aus wie zwei Werbeamerikaner – den beiden hätte man alles abgekauft. Dass sie Cheerleaderin war, ahnte ich nicht, ich hielt das für ein Klischee aus amerikanischen Filmen. Er sah geradezu so aus, als könne auch er lauthals lachen – was ich persönlich noch nie erlebt hatte.
»Danke, dass du mir die Bilder gezeigt hast«, sagte ich und sah ihn mitfühlend an. Ihm kullerte eine Träne über die Wange, und er schloss die Augen.
»He, Johannes«, sagte ich und strich ihm mit meiner Hand über die Wange. Da schluchzte er, und seine Unterlippe zitterte. Es sah nicht hübsch aus, aber so verletzlich, so rührend. Ich konnte nicht anders, als ihn in den Arm zu nehmen – jeder hätte das getan. Und während ich seinen Kopf streichelte, wollte ich nichts anderes, als ihn zu trösten. Ich wischte mit dem Daumen seine Tränen weg, eine nach der anderen, doch ich kam nicht nach, er weinte immer mehr, bis es schließlich seinen ganzen Körper schüttelte.
So lagen wir eine halbe Stunde beisammen, ein Freund und eine Freundin. Mehr war nicht, wobei das natürlich schon eine Menge ist. Er war noch nicht mal mein Typ – ein langhaariger Motorradfahrer hätte weitaus besser zu mir gepasst als dieses Söhnchen aus gutem Hause. Ich hätte mich auch mit ihm geschämt, auf keinen Fall wollte ich meinen Eltern und Anna einen Freund vorstellen, der ihnen gefiel. Nie im Leben! Dass er sich an meiner Schulter ausheulte – für mich war das so etwas wie eine Ehre und eine Bestätigung meines besonders ausgeprägten Einfühlungsvermögens. Mit neunzehn genügte mir das.
So ging es bis zu den darauffolgenden Sommerferien. Ich wusste mittlerweile alles über Sabina. Sie war neben zwei Brüdern das Nesthäkchen seiner deutsch-amerikanischen Austauschfamilie und hatte den Auftrag, von dem netten Jungen aus Deutschland ein bisschen das »Deutsch der heutigen Jugend« zu lernen. Johannes hatte dadurch jede Menge Gründe, viel Zeit in Sabinas Zimmer zu verbringen. Jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag lagen sie sich in den Armen, bis die Mutter von der Arbeit nach Hause kam. So lange, bis seine Lippen schmerzten und Sabinas Kinn rot leuchtete. Und beide wund waren zwischen den Beinen, das brauchte er mir nicht zu sagen. Nachdem er ein halbes Jahr in den USA war, verunglückte einer von Sabinas Brüdern tödlich. Für Sabina brach eine Welt zusammen, doch Johannes fing sie auf. Ich konnte mir vorstellen, wie sie das zusammengeschweißt hatte und dass er noch immer an sie dachte. Doch eines Tages überraschte er mich mit der Aussage, er wolle Sabina endlich vergessen. Er hatte erfahren, dass sie einen neuen Freund hatte, einen Typen aus der Footballmannschaft. Doch obwohl er sie angeblich vergessen wollte, hing ihr Foto weiterhin neben seinem Bett. Was mich nicht störte, wir waren nur Freunde. Darüber hinaus hatten wir kein Interesse aneinander.
Dies änderte sich schlagartig, als ich meinen Schlabberpulli ab- und mir einen Jeansrock und ein enges Oberteil zulegte. Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren.
»Was ist denn mit dir los?«, fragte er, als ich auf einer Party eintrudelte. »Warst du beim Zahnarzt?«
Ich tippte mir an die Stirn. »Johannes, ich glaube, es ist alles neu an mir – alles, bis auf meine Zähne«, antwortete ich und gesellte mich zu meinen Freundinnen, die mein Outfit bewunderten. Die meisten hatten längst ihre Ökophase hinter sich. Johannes kam mir hinterher und berührte mich an der Schulter.
»Sorry, Silvie. Keine Ahnung, wie ich auf Zahnarzt gekommen bin!« Er grinste verlegen. »Du siehst gut aus, wirklich. Gefallen mir, deine neuen Klamotten.«
Ich hob die Schultern. »Ist schon gut.«
Trotzdem fixierte er mich noch den ganzen Abend, und obwohl ich es nicht wollte, fühlte ich, wie mir die Röte in die Wangen stieg. Hallo? Ich war noch die Gleiche wie vorher!
Allerdings scharwenzelten auch die anderen Jungs an diesem Abend auffällig um mich herum. Wahrscheinlich lag ich – aus heutiger Sicht – doch recht aufreizend in der Gegend herum, mit meinem kurzen Jeansrock und dem darunter hervorblitzenden schwarzen Slip.
Johannes ließ mich nicht aus den Augen. Egal, in welchen Raum der Party ich wechselte, ich konnte sicher sein, dass er kurz darauf folgte.
»Hallo Patrouille«, sagte ich, als er erneut hinter mir stand. Er drehte mich zu sich herum und hielt meinen Blick fest. Ich blinzelte und sah zuerst weg. Mir war noch nie aufgefallen, dass er so schöne braune Augen hatte. Manchmal reicht das, um mit jemandem nach Hause zu gehen.
Am nächsten Morgen fiel mein Blick durch meine zerzausten Haare auf Sabinas Bild an der Wand. Sie strahlte mich mit ihren weißen Zähnen an; ihr schokoladenfarbenes Haar glänzte in der Sonne, und ich fühlte mich wie ein Straßenköter. Johannes war schon wach. Er stützte sich auf den Ellbogen und folgte meinem Blick.
»Denkst du noch oft an sie?«, fragte ich.
Er hielt unwillkürlich die Luft an und hob schließlich die Schultern. Es folgte ein langer Seufzer.
Dann fuhr er mich nach Hause.
Tagelang dachte ich an diese Nacht zurück. An seine Hände, wie sie mich gestreichelt hatten, und an seine Lippen, die mich geküsst hatten. An den Sex. Aber ich konnte unmöglich zu ihm gehen, ihn anrufen – wir waren Freunde, und was passiert war, musste ein Versehen gewesen sein. Er schien es auch so zu sehen, er rief mich ebenfalls nicht an.
Als wir uns schließlich in unserer Stammdisco trafen, gab es mir einen Stich, der mir zunächst ins Herz fuhr, anschließend in den Bauch und dann zwischen die Beine. Wir grüßten kurz, er mit einem Nicken, ich hob meine Bierflasche. Unauffällig verfolgte ich jeden seiner Schritte. Er quatschte an diesem Abend mit vielen Mädchen und lachte oft. Er, der sonst nie lachte, scherzte und schäkerte mit einem Mädchen aus dem Deutsch-Leistungskurs, wie ich es noch nie bei ihm erlebt hatte. Dann wandte er sich Nicole zu, die ich noch nie hatte leiden können, und kitzelte sie unterm Kinn. Trank ein Bier. Er – der sonst nie etwas anrührte! Schließlich legte er seine Hand zwischen ihre Schulterblätter und schob sie wie selbstverständlich zur Bar, bestellte etwas. Ich hatte einen Kloß im Hals. Gleichzeitig regte sich Trotz in mir. Umständlich bahnte ich mir den Weg durch die tanzende Menge und tippte ihm auf die Schulter. »Hi, Johannes.«
Er schien überrascht, dass ich zu ihm gekommen war. »Ach, Silvie! Na, alles klar?«
Ich schüttelte den Kopf. »Irgendwie nicht. Ich meine …« – ich deutete auf Nicole – »… was ist denn mit Sabina?«
Er blickte mich überrascht an. »Was soll mit ihr sein?«
»Pff!«, machte ich, ließ ihn stehen und stürmte aus der stickigen Diskothek ins Freie – es war warm draußen, die Nächte waren nicht mehr so kühl wie noch zwei Wochen vorher. Vor dem Gebäude steckte ich mir eine Zigarette an und kramte nach meinem Autoschlüssel – ich hatte genug gehört. Im selben Moment trat er aus der Tür, schaute sich suchend um und kam dann zu mir rüber. »Sag mal – bist du noch ganz dicht?«
Ich gab keinen Ton von mir.
»Also weißt du!«, schnauzte er. »Was ist denn los mit dir? Erst meldest du dich nicht, und kaum siehst du mich, stellst du mich stasimäßig zur Rede. Was sollte die Frage nach Sabina? Ich bin nicht mehr mit ihr zusammen, fast schon ein Jahr nicht mehr, das weißt du doch!«
»Aber du denkst noch an sie!«, rief ich.
Er sah kurz zu Boden, dann fuhr er sich mit der Zunge über die Lippen. »Silvie, das Leben muss doch weitergehen. Sie ist mit diesem Footballtypen zusammen – ich lebe hier in Deutschland. Ich muss mich schließlich auch weiterentwickeln.«
»Na dann. Viel Spaß beim Entwickeln«, wünschte ich und lief los zu meinem Auto.
Er eilte mir hinterher und hielt mich am Arm fest. »Ich weiß nicht, was du willst!«, rief er. »Du machst ständig mit allen möglichen Typen rum. Wieso soll ich leben wie ein Mönch, nur weil ich vielleicht manchmal noch an Sabina denke?«
Ich konnte nur den Kopf schütteln und versuchte, mich von ihm loszumachen – aber er hielt mich fest, zwang mich, ihn anzusehen. »Hatte es nur mit Sabina zu tun, dass du mich nicht angerufen hast?«
Ich sagte noch immer nichts, blickte ihn nur herausfordernd an. Er hätte mich doch auch anrufen können!
»Sag doch mal was, Mensch! Was sollte die Aktion eben? Du hast dich aufgeführt, als wärst du eifersüchtig, und jetzt kriegst du die Klappe nicht auf und rennst weg!« Ich stand da und konnte nichts sagen. Ich wollte ihn küssen und ihn in mir haben, sehnte mich nach seinen Händen, wollte ihn riechen und schmecken – aber mich anbiedern, nein, das wollte ich nicht. Er hob die Schultern, ließ mich stehen und ging wieder hinein. Ich blickte ihm hinterher, nahm seinen federnden Gang wahr, den festen Hintern. Eine Weile lang atmete ich schwer die stehende Luft der lauen Sommernacht in mich ein, zog an meiner Zigarette und hatte Flugzeuge in meinem Bauch. Er sah so süß aus, seitdem er die Baseballkappe nicht mehr trug.
Vielleicht würde er Sabina ja vergessen. Das Leben musste weitergehen, er hatte es selbst gesagt.
Drinnen sah ich mich suchend um, stromerte durch den ganzen Laden – aber er war nirgends zu entdecken. Nur diese Nicole stand an der Bar mit ihrem Gin Tonic und hob die Augenbrauen. »Suchst du den Johannes?«, fragte sie.
»Nö«, sagte ich, »ich hab was vergessen.«
Sie grinste. »Ja, klar.«
Ich sah zu, dass ich wieder zum Ausgang kam, und genau dort stand er. Mit verschränkten Armen lehnte er an der Wand neben der Ausgangstür und legte den Kopf schräg. »Du bist ja immer noch hier.«
Ich trat vor ihn hin. »Bitte komm mit. Bitte«, sagte ich.
Er nickte.
Ich fuhr einhändig. Meine rechte Hand lag auf dem Schritt seiner Jeans, und ich genoss es, wie er unter mir hart wurde.
Am nächsten Morgen betrachtete ich wieder Sabinas Foto an der Wand und fasste mir ein Herz. »Meinst du, du könntest es abhängen?«, fragte ich. »Es vielleicht woanders aufstellen?«
Johannes antwortete mit einem Kuss.
Mein Alltag besteht aus Essen und Schlafen. Zwischendurch werde ich gewaschen und gekämmt – das hasse ich. Mit dem Kamm zerren sie so forsch an meiner Kopfhaut, dass ich laut protestiere. Dabei könnte ich es selbst tun. Man belächelt mich. Ich soll mich nicht so anstellen, sagt man, und macht munter weiter. Anschließend schieben mich Johannes oder Sabina raus an die frische Luft, das soll mir angeblich guttun. Vorher geht’s die Treppe hinunter, zuerst mein fahrbarer Untersatz, danach ich. Sabina ist immer völlig aus dem Häuschen, wenn wir draußen unterwegs sind. Alles Mögliche will sie mir zeigen. »Guck mal, ein Baum; wie schön die Blätter im Wind wackeln«, flötet sie. Und ständig fummelt sie an mir herum. Zupft an meiner Kleidung und an meiner Decke, richtet mich auf, wenn ich in mich zusammensinke. Ich kann es nicht leiden, wenn sie das tut. Ich habe es lieber, wenn Johannes sich um mich kümmert – von ihm lasse ich mir alles gefallen, auch, dass er mich in den Arm nimmt und wiegt, wenn es mir nicht gutgeht und ich über meine Lage verzweifelt bin. Dass ich hier mit den beiden zusammenleben muss, hätte ich mir in meinen schlimmsten Alpträumen nicht ausgemalt. Sabina sagte neulich, sie sei ja so glücklich, dass sie uns alle habe. Unglaublich ist das. Dabei hätte ich auch ein bisschen Glück verdient. Noch dazu war ich so kurz davor. Manchmal gehen wir zu einer Gruppe von Leuten, die in der gleichen Situation sind wie ich. Alle dort fangen wieder bei Adam und Eva an – alles, was wir jemals beherrscht haben, ist aus unseren Köpfen und Körpern ausgelöscht. Uns eint das gleiche Schicksal, zumindest vermute ich das. Keiner merkt, was wirklich mit uns los ist und dass wir alles mitkriegen, was um uns herum passiert, auch wenn wir lallen oder sabbern. Sabina beklagt in dieser Runde häufig, dass ich zu viel schreie. Beifälliges Nicken begleitet ihre Schilderungen, was mich mitunter so zornig macht, dass ich mich erneut in Rage bringe. Davon wird Sabina ganz nervös, streichelt mir über den Rücken und über den Kopf, doch das beruhigt mich keineswegs. Im Gegenteil. Und zu Hause beklagt sie sich dann bei Johannes, dass ich offensichtlich keine ihrer Zuwendungen ertrage, wo sie doch alles für mich tue. Das wurmt sie natürlich. Wenn ich wieder sprechen kann, werde ich die Sache aufklären. Wenn, denn bisher bin ich meilenweit davon entfernt. Genauso weit wie von einer einzigen motorischen Glanzleistung. Aber ich arbeite daran. Die Ärzte sagen, ich sei möglicherweise etwas bequem. Bequem? Das ist wirklich unverschämt. Wie gern würde ich einmal allen hier die Meinung geigen!
Stattdessen hänge ich meinen Erinnerungen nach und denke darüber nach, was geschehen ist, seit ich Anna das letzte Mal sah. Und wann es begann, dass sie mir zusehends entglitt.
Anna
Anna fuhr mit den Kindern zum Einkaufen in den Supermarkt, wie jeden zweiten Tag. Sie parkte immer in der ersten Reihe links vom Eingang in der Tiefgarage. Wenn dort nichts frei war, wartete sie ab, bis jemand wegfuhr. Das konnte manchmal eine Weile dauern, aber es war wichtig, auf einem dieser Plätze zu stehen. Kein anderer Platz kam in Frage. Heute hatte sie Glück, es war einer in ihrer Reihe frei, als sie in die Garage kam. Sie fuhr in die Parklücke und schaltete den Motor aus – eins – legte den ersten Gang ein – zwei – und zog den Schlüssel ab – drei – Dann atmete sie tief durch, wandte sich zu den Kindern um und erkundigte sich betont gut gelaunt: »Fertig, Mädels?«
»Ja!«, riefen Emma und Clara, Luna nickte zustimmend.
Während sie die Mädchen abschnallte, zählte sie wieder: Bei eins drückte sie den Gurtöffner, bei zwei nahm sie die Gurte von den Schultern und bei drei half sie Clara aus dem Sitz. Luna und Emma kletterten schon selbstständig heraus, aber für das Klettern zählte Anna auch eine Drei. Innerlich, selbstverständlich. Es war das Einzige, was sie zur Ruhe brachte, das Zählen. Egal, welche Tätigkeit sie ausführte: Alles ließ sich in drei Schritte aufteilen. Und wenn es mal mehr Schritte waren, dann teilte sie sie durch drei: Duschen zum Beispiel, das hatte insgesamt siebenundzwanzig Schritte, neun mal drei. In die Duschwanne steigen – eins – Wasser andrehen – zwei – Temperatur prüfen – drei. Unter dem laufenden Wasser stehen – eins – Wasser abstellen – zwei – Shampoo auf die Handfläche geben – drei. Shampoo ins Haar reiben – eins – Brause anstellen – zwei – Shampoo auswaschen – drei – und so weiter. Sie hatte längst aufgegeben, sich das abzugewöhnen. Eine Zeitlang hatte sie es versucht, aber wofür? Immerhin kam sie dadurch zur Ruhe. Und dann mal ehrlich: andere rauchten. Was war wohl das schlimmere Laster? Oder tranken, konnten nicht damit aufhören. Sie selbst rührte weder Zigaretten noch Alkohol an. Das Einzige, was sie sich hin und wieder gönnte, war eine Beruhigungstablette. Tablettenstreifen nehmen – eins – Tablette rausdrücken – zwei – Tablette in den Mund legen – drei. Schranktür öffnen, Glas rausnehmen, Schranktür schließen. Wasserflasche greifen, aufdrehen, eingießen. Flasche abstellen, Glas zum Mund führen, schlucken. Glas hinstellen, zum Stuhl gehen, sich hinsetzen. Warten, bis sie wirkte.
Meist ging es sehr schnell; der Nebel setzte sich auf die Gedanken, und die Nerven beruhigten sich. Sie trank viel, es war gesund. Wasser reinigte und beschleunigte den Blutkreislauf. Diese Vorstellung gefiel ihr.
Anna öffnete den Kofferraum – eins – lud den Buggy aus – zwei – und setzte Clara, die laut protestierte, hinein – drei.
Silvie behauptete, Nils protestiere nie, wenn man ihn in den Kinderwagen lege; er werde gern gefahren. Er war ja auch noch ein Baby. Außerdem hatte Silvie keine Ahnung, sah alles locker. Schon als Kind hatte sie sich nicht um die Meinung anderer geschert, hatte den Lehrern Hefte mit Eselsohren präsentiert und Mama und Papa zerrissene Hosen. Ihre Art, lauthals zu singen, wo sie ging und stand, später ihre Hemmungslosigkeit den Jungs gegenüber, die sie ansprach und anfasste, als sei nichts dabei. Manchmal hatte Silvie sogar versucht, sie bloßzustellen, sagte »Das ist meine Schwester Anna« und hatte die Lacher auf ihrer Seite gehabt, weil keiner sich vorstellen konnte, dass sie aus demselben Stall kamen. Die Rockerin und das Mauerblümchen.
Heutzutage war es nicht anders. Silvie meinte, sie sei etwas Besonderes mit ihrem Job bei der Frankfurter Rundschau, wo sie vermutlich nichts weiter tat, als anderen mit ihrer Besserwisserei auf die Nerven zu gehen. Dabei hatte sie den Job nur über Papa bekommen. Da Nils den ganzen Tag in der Krippe war, führte sie ein ruhiges Leben. Hatte eine Putzfrau, die die Hausarbeit für sie erledigte. Bekam keine Anrufe von Ärzten, die um Rückruf baten.
Anna strich mit beiden Händen ihr dunkles Haar hinter die Ohren – eins – straffte die Schultern – zwei – betrat mit einem Schritt den Supermarkt – drei – und zählte weiter jeden ihrer Schritte. Clara war als Vierjährige an sich schon zu groß für den Buggy, aber ohne war an einen normalen Einkauf nicht zu denken. Überhaupt stellte ein normaler Einkauf eine immer größere Herausforderung dar. Allein die viele Zeit, die sie dafür benötigte! Erst einmal das Parken. Unter Umständen wartete sie eine halbe Stunde auf den freien Platz. Dann irrte sie durch die Gänge, so wie jetzt, um irgendwelche Produkte zu suchen. Auf das Zählen musste sie sich hierbei besonders konzentrieren. Zuerst alle Gänge auf der rechten Seite und danach die auf der linken. Oft vergaß sie das ein oder andere, dann ging es mit der ganzen Bande wieder auf die andere Seite, hin und her, bis sie endlich alles beisammen hatte. Luna war mit ihren sechs Jahren auch keine große Hilfe, sie krallte sich ängstlich am Buggy fest, so dass Anna nicht nur diesen, sondern auch Luna schieben musste. Manchmal konnte sie nicht anders, als das Kind anzufahren, es solle endlich einmal loslassen. Trotzdem griffen die kleinen Fingerchen immer wieder nach dem Wagen, bis sie daraufschlug. Dann unterließ Luna es wenigstens. Und Emma, die bei allen Artikeln fragte: »Wofür ist das hier? Wie viel kostet das? Darf ich das ins Netz legen?« Und gleichzeitig Clara, die permanent versuchte, aus ihrem Kinderwagen auszusteigen, sobald Anna an einem Regal stehen blieb – es war eine Tortur. Und dann die Kasse. O Gott, die Kasse! Schlangen überall. Manchmal lähmte es sie regelrecht, wenn sie sich für die richtige Kasse entscheiden musste. Es musste die schnellste sein, allein schon wegen Clara. Doch für welche Kasse sie sich auch entschied, es war immer die langsamste. So auch heute. Kaum hatte sie sich für eine entschieden – die Kassiererin kannte sie, sie arbeitete zügig, nicht so wie manch andere Trantüte, die im Zeitlupentempo die Artikel über den Scanner zog – ging auch hier wieder alles schief. Anna legte ihre Waren aufs Band – eins – zwei – drei – und dann war es schon so weit: Die Papierrolle war alle. Unmöglich konnte sie den Vorgang des Bandwechselns abwarten; mit zusammengebissenen Zähnen räumte sie alles wieder ein und hastete unter neugierigen Blicken zur Nachbarkasse, an der weniger Betrieb zu herrschen schien. Doch kaum hatte sie dort ihren Einkauf aufs Band gelegt, ging es an der vorherigen auch schon weiter, während an ihrer die Kassiererin zum Mikro griff: »Fünf acht drei. Artikelnummer fehlt.«
War sie verflucht?
Emma zupfte an ihrem Arm. »Ich muss mal!«
»Du siehst doch, dass ich erst noch bezahlen muss!«, zischte sie und versuchte, die Beherrschung zu bewahren.
»Ich muss aber ganz dringend!«, rief Emma.
Annas Handy klingelte. Sie warf einen hektischen Blick aufs Display; wie befürchtet, war es Matthias. Er hasste es, wenn sie nicht ranging. Doch sie konnte jetzt unmöglich telefonieren! Die Kassiererin blickte sie erwartungsvoll an, die Artikelnummer war längst eingegeben, am Ende der Kasse türmten sich ihre Einkäufe, und das Handy bimmelte weiter. Die Leute hinter ihr begannen die Köpfe nach ihr zu recken, weil sie bewegungsunfähig auf den Boden starrte.
»Geh doch mal zur Seite!«, schrie sie schließlich Luna an, die beständig an ihrer Jacke herumfummelte – warum das Kind sie stets befingern musste und so nah an sie heranrückte, wusste kein Mensch! Sie schwitzte. Oh, verdammt noch mal, und wie sie schwitzte. Geldbeutel rausholen, Karte rausholen, der Kassiererin geben. Anna versuchte, sich zu beruhigen. Gleich war alles überstanden, sie musste nur noch einpacken.
»Was ist mit dem Zeug da?«, fragte die Kassiererin und deutete auf den Buggy. Anna beugte sich nach vorn und stieß einen Schrei aus. »Clara!« Im Schoß ihrer Tochter lagen Schokoriegel und Kaugummipäckchen, dazwischen ein Flachmann Chantré. Ich kann nicht mehr, dachte Anna und atmete hektisch. Und dann wieder Lunas Finger, die nach ihr griffen, und Emma, die weinte: »Ich hab Pipi gemacht!« Ein Rinnsal wand sich zu Emmas Füßen, sie weinte, und Clara schrie: »Isss will raaaauuus!«
Plötzlich legte jemand von hinten eine Hand auf Annas Schulter, und die Stimme einer älteren Dame raunte: »Ganz ruhig, junge Frau, sie hyperventilieren ja!« An die Kassiererin gewandt rief die alte Dame: »Geben Sie mir eine Plastiktüte, schnell!«
Die Kassiererin tat wie geheißen und beobachtete erschrocken, wie die alte Dame Anna routiniert die Plastiktüte vors Gesicht hielt und beruhigend auf sie einredete: » Eeeein – aaaaus – eeeeein – aaaaaus. Atmen Sie weiter. Ich räume Ihre Einkäufe ein und kümmere mich um die Mädchen. Du« – sie deutete auf Luna – »hilfst mir bitte beim Einpacken. Und du« – sie zeigte auf Emma – »hörst auf zu weinen, das ist nicht so schlimm und kann jedem mal passieren. Und Sie«, wandte sie sich an die Kassiererin, »besorgen jemanden, der das hier wegwischt.« Die Kassiererin nickte und rief über das Mikro: »Fünf acht drei, bitte einen Wischmopp an die Kasse.«
Die Dame schob Anna mitsamt dem Buggy beiseite und legte gemeinsam mit Luna die Waren in das Kinderwagennetz. Anna lief mit der Tüte vor dem Mund in Richtung Ausgang. Dass die ältere Dame selbst noch Einkäufe auf dem Band hatte, bedachte sie nicht – kopflos rannte sie aus dem Gebäude und lief zu einer Bushaltestelle, die sich gegenüber der Einfahrt zum Supermarkt befand. Unter den neugierigen Blicken der Fahrgäste setzte sie sich mit ihrer Einkaufstüte vor dem Mund auf einen freien Platz und atmete. – Ein – aus – ein – aus – ein – aus. Schließlich öffnete sie mit zittrigen Fingern die Handtasche und nahm verstohlen eine ihrer Pillen heraus, die sie ebenfalls unter neugierigen Blicken hinunterwürgte. Drei Busse hielten und fuhren wieder ab. Dann erst fielen ihr die Mädchen wieder ein. O Gott, dachte sie und sprang auf. Um ein Haar erfasste sie ein herannahender Bus. Ein Herr ergriff ihren Arm und rief: »Hoppla, junge Frau!« Anna stürzte auf die andere Straßenseite und lief in den Supermarkt zurück. Die ältere Dame wartete mit den dreien an einem elektrischen Rennauto und sah Anna besorgt entgegen.
»Entschuldigen Sie bitte, ich brauchte dringend frische Luft! Ich … es tut mir wirklich furchtbar leid, und, also, vielen Dank auch, dass Sie auf meine Kinder achtgegeben haben!«
Die Dame reichte Anna ihr Portemonnaie und sagte: »Keine Ursache. Zum Glück hatten Sie genügend Bargeld.« Sie blickte Anna fragend an. »Denken Sie, Sie kommen zurecht?«
Anna rang sich ein Lächeln ab. »Die Nerven«, sagte sie. »Ich weiß auch nicht, was mit mir los war! Das ist mir noch nie passiert, das können Sie mir glauben. Ist nicht mein Tag heute!«
»Vielleicht gehen Sie doch besser zum Arzt, wissen Sie … Vielleicht bekommen Sie eine Kur verschrieben. Mit den drei Kindern sind Sie ja wirklich einer großen Belastung ausgesetzt.«
Anna nickte, nahm Clara unter Protestgeheul aus dem Rennwagen – eins – setzte sie gewaltsam in den Buggy – zwei – und schnallte sie fest – drei.
»Ich rufe meinen Arzt an, sobald ich zu Hause bin, das ist wirklich mal ein guter Tipp«, antwortete sie. Dann nahm sie Emma an die Hand, die weinend und in noch immer nasser Hose neben dem Rennwagen saß.
»Wir gehen«, sagte sie. »Und vielen Dank noch mal.«
Luna trottete hinter ihr her.
Es war ein Tag wie jeder andere. Wenn sie nur die Rückrufbitte des Arztes ausblendete. Und wofür bitte brauchte sie eine Kur? Alles war in Ordnung. Ab und zu eine kleine Pille, und alles war wieder im Lot. Ganz einfach. Es gab lediglich hin und wieder Situationen wie diese, die sie kaum zu handhaben vermochte. Morgens zum Beispiel, wenn sie die Mädchen für den Kindergarten fertig machen musste. Matthias war der Morgen heilig, er wollte nicht gestört werden. Er hatte einen harten Tag vor sich und einen Kaffee im Bett verdient, den er sich selbst machte, ohne sie jemals zu fragen, ob sie vielleicht auch einen wollte. Erst nachdem er diesen getrunken hatte, setzte er sich an den gedeckten Frühstückstisch und warf einen Blick in die Tageszeitung. Dass er dabei gern seine Ruhe haben wollte, war verständlich. Aber die Situation so zu gestalten, dass sie Matthias’ Anerkennung fand, verlangte Anna alles ab. Es war kaum möglich. Zu irgendeinem Moment des Frühstücks – meistens wenn Anna versuchte, die Brote für Schule und Kindergarten zuzubereiten – donnerte er los: »Sit down, Clara! Luna, stop humming!And Emma, eat your toast!« Immer dieses Englisch. Fast schämte sie sich für ihn, wenn er so sprach. Dabei hatte sie es früher bewundert. Mehr als einmal war es geschehen, dass sie, ohne die Brote fertig zu haben, fluchtartig mit den Mädchen das Haus verließ – nur weg von Matthias. Sie konnte auf dem Weg zum Kindergarten etwas für die Kinder kaufen. Doch unterwegs vergaß sie es, zu hektisch waren der morgendliche Berufsverkehr und die Parkplatzsituation, und wenn sie die Kinder abholte, hieß es von der Erzieherin: »Emma und Clara hatten heute wieder kein Frühstück dabei, Frau Ziegler. Könnten Sie bitte in Zukunft darauf achten?«
Sie versprach es jedes Mal. Einmal sagte die Erzieherin: »Clara hat erzählt, sie konnte heute auch zu Hause nichts frühstücken.«
»Ach?«
»Ja. Sie hat gesagt, sie hatte keine Zeit. Und sie hatte auch nichts dabei.«
»Das ist ja schade«, war alles, was Anna dazu hatte sagen können.
»Ja. Das ist schade. Besonders für die Kinder, Frau Ziegler.«
Seitdem schaffte sie es kaum mehr, die Kinder ohne Angst vom Kindergarten abzuholen. Besonders, wenn es mit dem Frühstück nicht geklappt hatte. Aber ohnehin war die Abholsituation unerträglich. Alle starrten sie an. Buchstäblich. Sobald sie das Foyer betrat, verstummte jedes Gespräch. Die Kinder gehorchten nicht. Wie eindringlich auch immer sie Emma und Clara bat, bitte ihre Schuhe anzuziehen und sich fertig zu machen: Sie zeigten keinerlei Reaktion. Kaum hatte sie schließlich eine der beiden am Arm zur Bank gezerrt, um ihr zu helfen, balgte sich die andere mit einem anderen Kind oder schrie, sie müsse aufs Klo. Und so viele Augenpaare schauten zu. Meist kam sie ohnehin auf den allerletzten Drücker, weil sie oft zuvor eine halbe Stunde lang zu Hause am Tisch saß, unfähig, sich zu rühren. Dabei wollte sie nur ein paar Momente lang die Ruhe im Haus genießen, die Ordnung – um dann den Nachmittag mit den Kindern hinter sich zu bringen. Oft genug war sie versucht, den Mädchen bereits nach ihrer Ankunft zu Hause die erste Tablette zu geben, aber meist half es schon, wenn sie zwischendurch selbst eine nahm. Wenn sie selbst ruhiger war, erschienen ihr auch die Mädchen ruhiger.
Mit Unbehagen erinnerte sie sich an einen Abend noch vor Nils’ Geburt, als sie Silvie angerufen hatte. Sie hatte hören wollen, wie es um die Schwangerschaft stand – spontan und ohne nachzudenken, hatte sie sie auf ihre Terrasse eingeladen, hatte gedacht, sie könne sich mit ihr unterhalten wie mit einer ganz normalen Schwester. Erst nach Silvies überraschender Zusage sah sie sich im Haus um und stellte mit Schrecken fest, dass Emma und Clara wieder alles unordentlich gemacht hatten. Unmöglich hätte sie Silvie das Haus in diesem Zustand präsentieren können. Sie brachte die Kinder zu Bett und räumte dann in Windeseile das ganze Haus auf, alles Herumliegende stopfte sie in die Schränke, selbst die Sofakissen rückte sie noch zurecht, wienerte Spüle und Anrichte. Silvie sollte bloß nicht denken, sie hätte ihren Alltag nicht im Griff. Doch dafür zu sorgen, dass niemand merkte, was sie durchmachte, war fast nicht zu schaffen.
Eigentlich hatte sie die Tabletten nur nehmen wollen, solange die Kinder klein und unverständig waren und alles ausräumten. Nicht im Traum hätte sie gedacht, dass sie mit dem Älterwerden noch anstrengender wurden! Ohne ihre Pillen ging es gar nicht mehr. Und ausgerechnet an jenem Abend, als Silvie zu Besuch gekommen war, waren ihr die Tabletten ausgegangen. Dabei hätte sie schwören können, dass noch eine ganze Schachtel in ihrem Nachtschränkchen lag; sie wollte niemals ohne Reserveschachtel sein, schon aus Prinzip nicht. Aber an dem Abend, kurz bevor Silvie klingelte, waren keine Tabletten zu finden gewesen. Immer wieder war sie von der Terrasse ins Haus gelaufen, hatte nachgesehen, ob sie nicht doch noch irgendwo eine fand. Doch es war keine da gewesen, und die Angst vor einer Nacht ohne Tabletten war ihr ins Herz gekrochen, sie war kaum mehr in der Lage gewesen, der Unterhaltung mit Silvie zu folgen, die sie über Matthias und ihr Verhältnis zu den Nachbarn ausgequetscht hatte und irgendwann endlich gegangen war. Und dann hatte Anna doch noch eine Tablette in ihrem Portemonnaie entdeckt. Gott sei Dank, denn es war ja gerade auch die Angst vor dem Gerede der Nachbarn, die sie so unter Strom setzte. Allen voran Christine Brückner, von der sie wusste, dass sie sie verabscheute – bereits beim Einzug hatte sie Matthias gegen Anna aufbringen wollen, indem sie gegen deren Wunsch wetterte, einen kleinen Teich in ihrer Gartenhälfte anzulegen. Verantwortungslos sei das, in Anbetracht dessen, dass die Kinder im Garten umherliefen und es keinen Zaun gab, der sie vorm Ertrinken schützte. Und ihr Mann Thomas, der Bauunternehmer war oder Gartenpfleger und seit eh und je die Gestaltung des Gartens verantwortete, hatte mit einer Handbewegung das Thema Teich einfach weggewischt.
Inzwischen war sie froh darüber, denn die Lebhaftigkeit der Kinder hatte sie tatsächlich unterschätzt. Und Matthias – er war im Laufe der Jahre immer später nach Hause gekommen, dann, wenn er sicher sein konnte, dass die Kinder im Bett waren.
»Das mache ich nicht mehr mit, Anna«, hatte er eines Tages gesagt, als eine der drei eine Hand voll Rührei in die Loombank geschmiert hatte. Er legte seine Serviette beiseite, stand auf und sagte: »Wenn alles weg ist und die drei Teufel im Bett sind, kannst du mich anrufen.« Seitdem kam er nicht vor 21 Uhr nach Hause, meistens später. Allerdings – wenn er nicht da war, war die Lage sowieso besser. Sie stand dann nicht so unter Strom – wer konnte ihr das verdenken? Früher war er weiß Gott besserer Laune gewesen als in letzter Zeit, seit die Geschäfte schlecht liefen. Seit drei Monaten war es ihm nicht gelungen, auch nur ein einziges Objekt zu verkaufen, und das war schlichtweg eine Katastrophe. Für alles. Für alle. Aber darüber wollte und konnte sie nicht nachdenken. Sie hatte ihm helfen wollen, über Silvie. Silvie brauchte doch ein Haus! Aber nein, sie war sich für Bad Homburg zu schade. Zu spießig! Dabei hätte es ihr gutgetan, ihre Schwester in der Nähe zu haben, auch wenn Silvie auf sie herabsah, weil sie nicht so gebildet war wie sie. Genauso wie Christine Brückner, die ihr scheinheilig das Du angeboten hatte. Glaubte wohl, Anna merke nicht, wie sie jeden Morgen, wenn Matthias das Haus verließ, rein zufällig mit ihren beiden Töchtern auch aus dem Haus ging. Wollte demonstrieren, dass sie die taffere Mutter war, im doppelten Sinne: schicker und schneller. War jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt, wohingegen Anna es kaum schaffte, sich das Haar zu kämmen. Jede Minute, die sie zu lange im Bad verbrachte, nutzten Emma und Clara, um das blanke Chaos anzurichten, aber es ging nicht, dass sie ihnen schon am Morgen eine halbe Tablette gab. Einmal hatte sie das getan, und prompt hatte die Erzieherin im Kindergarten sie darauf angesprochen. »Frau Ziegler«, hatte sie beim Abholen geschmunzelt, »die beiden wirkten heute wie sediert!«
Anna hatte nur gelacht und mit dem Zeigefinger gewedelt. »Keine schlechte Idee, die zwei sind manchmal ganz schön lebhaft.« Und prompt kam der Tipp der Erzieherin: »Lassen Sie sie doch mal auf ADHS testen.«
Gar nichts ließ sie testen, es reichte schon, dass sie selbst zum Arzt musste. Dass Emma und Clara nicht ganz normal waren, wusste sie auch so. Schon als Babys waren sie nicht zu beruhigen gewesen, Clara noch weniger als Emma. Und immerzu Matthias’ Blicke: Du hast die Kinder nicht im Griff. Dabei war er es gewesen, der darauf gedrängt hatte, drei Kinder zu bekommen. Sie hatte nur zwei gewollt! Aber nein, in den Bad Homburger Maklerkreisen machte es sich gut, wenn man sich ein drittes Kind anschaffte.
»Ich habe drei zu Hause«, pflegte er zu sagen und hatte stets die anerkennenden Blicke auf seiner Seite. Eigenheim, Frau, drei Kinder.
Sie selbst war ja auch stolz auf das, was sie sich geschaffen hatten, aber die ständige Sorge! Keiner hatte sie vorgewarnt, was für entsetzliche Sorgen man sich um Kinder machte. Es verging kein Tag, an dem sie nicht darüber nachdachte, dass eine der drei sterben könnte. Immer wieder malte sie sich das Szenario aus: Sie kam in die Diele, und Emma lag in einer Blutlache am Fuß der Treppe. Oder Clara baumelte von der Zimmerdecke, ein umgefallener Stuhl zu ihren Füßen. Und dann gab es die Stimmen, die ihr sagten, es wäre das Beste, Emma und Clara wären nie geboren worden. Es wäre alles so viel leichter, so viel besser zu ertragen. Luna als Einzelkind – wie gern wäre sie dann Mutter. Auch wenn Luna dumm war, aber das waren sie alle drei. Egal, wie sehr Anna sich den Mund fusselig redete und die Kleinen beschwor, sie sollten nicht alle Spiele aus den Regalen oder alle Kleider aus dem Kleiderschrank räumen, nicht alle Shampooflaschen in den Ausguss ausleeren oder ihre Stifte und Malbücher in die volle Badewanne werfen – sie machten, was sie wollten. Lachten! Und immer wieder Matthias’ verbissenes Gesicht. Wie er, den Mund zu einer geraden Linie zusammengepresst, im Türrahmen lehnte und sie von oben bis unten betrachtete, wie sie dastand, mit zerzaustem Haar und den schreienden Kindern. Sie selbst schrie auch manchmal so laut, dass sie meinte, ihr versage die Stimme.
»Du bist wie eine Furie«, hatte er einmal festgestellt, und ihr geraten, sie solle etwas einnehmen. Fast hätte sie gelacht. Das tat sie doch!
Schließlich hatte sie sich etwas Stärkeres besorgt. Und seitdem, zugegebenermaßen, lief es besser. Nicht nur bei ihr, nein, auch bei den Mädchen. Die einzige Nebenwirkung waren die Alpträume.





























