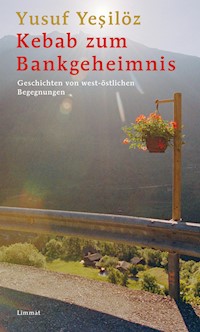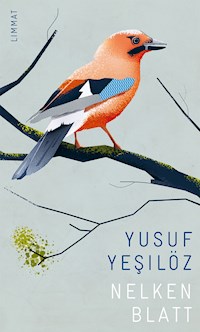17,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Beyto mit seinen Eltern das Flugzeug besteigt, um seine Verwandten im tscherkessischen Dorf in der Türkei zu besuchen, freut er sich, die Freunde aus der Kindheit wieder zu sehen, obwohl ihm die Trennung von seinem heimlichen Geliebten Manuel nicht leicht fällt. Umso grösser ist sein Schock, als er überraschend mit seiner Cousine Sahar verheiratet wird. Völlig allein gelassen, stürzt Beyto in einen Strudel von Gefühlen. Die grosse Wut auf die Eltern lässt ihn jede Ehrfurcht vor ihnen vergessen, die kindliche Zuneigung zu Sahar, die er nie verloren hat, verwirrt ihn, die Angst, Manuel gegenüberzutreten, lähmt ihn. Beyto, selber noch fast ein Kind, erfährt einzig von seiner Lehrlingsbetreuerin Tania Unterstützung, und weg vom Dorf im Osten und von der Stadt im Westen, wo er seit vielen Jahren lebt, findet er langsam wieder etwas Halt. Ironisch und humorvoll nimmt Yusuf Yesilöz die Leserinnen und Leser mit in eine reiche Welt voller Geschichten, die in einem schmerzhaften Widerspruch steht zur grossen Einsamkeit des jungen Beyto.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Als Beyto mit seinen Eltern das Flugzeug besteigt, um seine Verwandten im tscherkessischen Dorf in der Türkei zu besuchen, freut er sich, die Freunde aus der Kindheit wiederzusehen, obwohl ihm die Trennung von seinem heimlichen Geliebten Manuel nicht leichtfällt. Umso größer ist sein Schock, als er überraschend mit seiner Cousine Sahar verheiratet wird.
Völlig alleingelassen, stürzt Beyto in einen Strudel von Gefühlen. Die große Wut auf die Eltern lässt ihn jede Ehrfurcht vor ihnen vergessen, die kindliche Zuneigung zu Sahar, die er nie verloren hat, verwirrt ihn, die Angst, Manuel gegenüberzutreten, lähmt ihn. Beyto, selber noch fast ein Kind, erfährt einzig von seiner Lehrlingsbetreuerin Tania Unterstützung, und weg vom Dorf im Osten und von der Stadt im Westen, wo er seit vielen Jahren lebt, findet er langsam wieder etwas Halt.
Ironisch und humorvoll nimmt Yusuf Yeşilöz die Leserinnen und Leser mit in eine reiche Welt voller Geschichten, die in einem schmerzhaften Widerspruch steht zur großen Einsamkeit des jungen Beyto.
Foto Luca Zanier
Yusuf Yeşilöz, geboren 1964 in einem kurdischen Dorf in Mittelanatolien, kam 1987 in die Schweiz. Heute lebt er mit seiner Familie in Winterthur und arbeitet als freier Autor und Filmemacher. Romanveröffentlichungen, u. a. «Steppenrutenpflanzen», «Der Gast aus dem Ofenrohr», «Der Imam und die Eselin». Im Limmat Verlag sind lieferbar die Romane «Lied aus der Ferne», «Gegen die Flut» und «Soraja» sowie der Geschichtenband «Kebab zum Bankgeheimnis».
Yusuf Yeşilöz
Hochzeitsflug
Roman
Limmat Verlag
Zürich
1
Ich heiße Beyto. Den Namen gab mir mein Großvater. Auch das Dorf meiner Eltern heißt Beyto. Dieser Name macht meine Vorfahren seit Generationen in ihrem für mich ziemlich weit entfernt liegenden Land stolz und berühmt wie die Sonne. Den Ruf seiner Familie umschrieb mein Vater einmal mit einem einzigen Satz: «Fällt der Name ‹Beyto›, bleiben alle Flüsse stehen!» Dieser Stolz der Familie hat für mich, der ich in meiner Schule lediglich ein Immigrantenkind war, nur so viel bedeutet wie ein Stückchen Stroh. Bei uns zu Hause in der Bischofstraße wurde sehr viel über das Dorf gesprochen, das für meine Eltern einen größeren Wert hatte als hochkarätiges Gold. Meine Eltern wiederholten täglich mehrmals Anekdoten aus dem Dorf, die für sie lustig, für mich aber bedrückend waren und mir wie ein ausgekauter Kaugummi vorkamen. Ich wollte nicht mehr hören, wie sie seit Jahren ununterbrochen vom Dorf sprachen und einander immer wieder die gleichen Geschichten erzählten, die in der Dauerfremde ihr einziges Vergnügen waren. Noch nie habe ich verstanden, warum die farbigen Facetten aus dem kargen Dorf den wichtigsten Gesprächsstoff meiner Eltern bildeten. Ihre Liebe für das Dorf hatten sie nie abgelegt, sie hielten am Dorf fest, wie eine Türe an der Zarge fixiert ist.
Beyto war der Name meines Großvaters. Und auch sein Großvater hieß Beyto. Den eigenen Kindern durfte man nicht den Namen des Vaters geben, sonst gäbe es ein Durcheinander mit den Namen. Großvater Beyto konnte uns von zehn Urgroßvätern mit Namen Beyto erzählen. All diese Großväter seien groß und gerade gewachsen gewesen wie eine Pappel, erzählen die Nachkommen. Der Wunsch des Großvaters war, dass auch ich meinen Enkelsohn Beyto nennen würde. Der Name Beyto stand jedoch auch für edel. Keine Frau, die einen Beytomann heiratete, durfte kleiner als der Türrahmen sein. Sie sollte einen starken Gesichtsausdruck haben wie ein General, ihre Schönheit musste berühmt und in die Erzählungen, die Generationen, gar Jahrhunderte überlebten, eingegangen sein. Zudem musste die Frau einen geraden Wuchs haben und auf ein adliges Pferd ohne Hilfe springen können. Selbstverständlich besaß meine Mutter all diese Eigenschaften, denn sie war selbst eine Beyto. Sie heiratete meinen Vater, der ihr Cousin war und dem sie gleich nach der Geburt versprochen worden war.
Da ich der einzige Nachkomme meines Vaters bin, sollte ich nun für die Berühmtheit und Langlebigkeit des edlen Namens Beyto sorgen, und das bedeutet zunächst, viele Kinder zu zeugen, wobei die Zahl der Jungen die der Mädchen übersteigen muss. Ich darf keine kleine Frau heiraten, meine Kinder müssen groß und schlank sein. Und mein erster Enkelsohn würde auf jeden Fall Beyto heißen.
Kaum versuchte ich als Kleinkind die ersten Schritte, machte der Vater mich mit meiner Aufgabe vertraut: Die Last auf meinen Schultern sei schwerer als ein hoher Berg, ich solle diese Schultern immer gerade wie einen Kandelaber halten, und das allein deshalb, weil ich der erste Enkelsohn von Großvater Beyto war. Großvater, für den ich allein die Fortsetzung der Familie garantierte, hatte mich wie seinen Augapfel geliebt.
Meinen Großvater, der unter der Erde des Beytolandes in seinem aus Marmorsteinen in Milchfarbe prächtig gebauten Grab liegt – einem Grab, das unter anderen Gräbern den Blick anzieht wie eine im Wind wehende Fahne –, musste ich enttäuschen, denn ich liebte einen Mann.
Der Name Beyto ist im Herkunftsland meiner Familie legendär, bedeutet aber mir in meiner Welt in der Bischofstraße nichts, außer dass ich die Art des guten und bildhaften Erzählens und die großzügige Gastfreundschaft meiner Familie, die sie ein Erbe der Beyto nennen, sehr schätze. Früher hießen die großen Kamelkarawanen noch Beyto. Großvater hatte mindestens fünf Karawanen, und mit jeder trugen sechs starke Kamele aus weit entfernten Regionen Ladungen mit Rosinen oder Feigen in sein Land. Jahre später hießen die Schafherden Beyto, und wieder Jahre später fuhren Lastwagenflotten der Marke MAN unter der Flagge Beyto. Die Schrift «Beyto-Transport» steht auch heute noch auf einem alten verrosteten Tanklastwagen, mit dem die Familie Erdöl transportierte, neben dem geräumigen Steinhaus der Beytofamilie im Dorf, das meine Eltern einmal im Jahr, am liebsten zusammen mit mir, besuchen. Selbstverständlich heißt das Geschäft meiner Eltern in der Bischofstraße «Beyto Kebab House». Und der große Wunsch meines Vaters ist noch immer, dass ich nach meiner Informatikerausbildung ein Geschäft eröffne und es «Beyto IT Informatik» nenne.
2
Als wir im neuen Flughafen der Hauptstadt Ankara bei der Landung den Atem anhielten, sah ich, dass mein Vater schwitzte. Das Landen tat ihm nicht gut, das wussten wir von früheren Reisen. Wir saßen nebeneinander auf einem Dreiersitz in der vollen Maschine, die melancholisch wirkende und mit vollen Gesichtern gepflegt aussehende ehemalige Dorfmenschen und heutige Stadtarbeiter aus ihrer Fremde ins Dorf nach Hause, also ins Herz ihrer Sehnsucht, brachte. Mein Vater Safir war am Fenster und meine Mutter Narin in der Mitte zwischen uns. Mein Vater ließ sogar seine knochige, mit stark hervortretenden Adern versehene Hand von meiner Mutter halten. Sie durfte das nur im Flugzeug. Nie habe ich sonst die beiden so nah beisammen, Hand in Hand, gesehen. Der Respekt, den sie ihrer Gesellschaft entgegenbringen, erfordert es, als Ehepaar keine Körpernähe zu zeigen, auch nicht vor den Kunden in ihrem Kebab House, die sich wie Tauben küssten, während meine Eltern für sie einen scharfen Kebab zubereiteten. Ich wusste nicht, worauf dieser Respekt basierte, interessiert hatte es mich oft. Aber niemand konnte es mir erklären. Mein Vater sagte mir jeweils, ich würde diesen Respekt nicht verstehen, weil ich in der Bischofstraße in einem traditionslosen Land aufwachse und nicht aus der Erde der Heimat meiner Eltern geknetet worden sei. Damit wollte er sagen, dass ich in der Beytokultur keine Erfahrungen gemacht hatte.
Ich, der ich die letzte Nacht nicht geschlafen, sondern nur gefeiert hatte, nickte im Flugzeug hin und wieder ein, um immer wieder von den Ankündigungen des Flugkapitäns geweckt zu werden. So bekam ich auch das Flüstern meiner Eltern mit. Wenn sie merkten, dass ich erwachte, brachen sie ihr Gespräch ab, wie mit einem Messer schnitten sie den Gesprächsfaden durch und schwiegen oder sprachen vom Umsatz in ihrem Kebab House, das neben dem Dorf jeweils das zweitwichtigste Thema an unserem Esstisch war. Dass in ihrem Flüstern die Rede war von der Zahl der geladenen Gäste, von einem großen beytowürdigen Empfang, davon, wie viele Schafe man schlachten werde oder welche Frau in der Verwandtschaft das Essen für die vielen Gäste am besten kochen könne, nahm ich, der ich benommen war vom Vorabend, gar nicht wirklich wahr.
Kaum wandten wir uns zum Ausgang des Flughafens, entdeckte ich auch schon Onkel Mamdoh, den Bruder meines Vaters. Er hatte eine Filterzigarette im Mund, was ich von ihm gut kannte. Sobald er uns in der großen Menschenmenge, die sich aus dem Tor hinausdrängte, erblickt hatte, kam er lächelnd und im Eilschritt auf uns zu und spaltete die Menschenmenge auf wie ein Messer die Gurke. Er umarmte meine Eltern fest, alle drei ließen sich während Minuten nicht los, küssten einander mehrmals auf die Wangen, sehr innig. Sie zogen sogar erstaunte Blicke anderer Menschen auf sich. Dann, fast beiläufig, gab Mamdoh mir die Hand und küsste mich auf beide Wangen, so zurückhaltend, als erledige er eine Schulpflicht. Ich hatte ihn seit langer Zeit nicht gesehen und bemerkte, dass sein Schnurrbart, der wie ein Besen aussah und sein Markenzeichen war, fast ganz grau und er breiter geworden war. Er nahm die Koffer meiner Eltern, und wir gingen alle vier nebeneinander durch die Halle. Ich rollte meinen Koffer selber.
Meine Eltern schauten mit großem Erstaunen auf den neuen Boden, der wie ein Spiegel glänzte, und auf die moderne, die Augen blendende Beleuchtung des Flughafens und sagten im Chor zu Mamdoh, das sei ja moderner als im Westen. Mamdoh grinste und meinte verschmitzt: «Wir haben Fortschritte gemacht. Jetzt sind wir dran, den Komfort zu genießen.» Draußen zeigte er auf das neue hellblaue Auto auf dem Parkplatz schräg vis-à-vis vom Ausgangstor des Flughafens. Wir schlängelten uns durch die vielen Autos und hörten das Klicken der Autotüre, die Mamdoh mit der Fernbedienung demonstrativ öffnete, bevor wir den Wagen erreicht hatten. Es war sehr heiß in diesem Juli, man hatte das Gefühl, vom neu asphaltierten Boden steige einem Glut ins Gesicht hoch. Mamdoh wies uns die Plätze im Auto zu, es war sehr angenehm im klimatisierten Wagen. Mein Vater machte seinen Scherz, dass sie hier jetzt besser leben würden als in der Bischofstraße, mein Onkel sagte seinem jüngeren Bruder, während er seinen Gurt anschnallte, dass dies alles dank dem jüngeren Bruder Safir so sei, der der Familie immer treu geblieben sei wie der Baum seinen Früchten.
Wir begaben uns in den Verkehr, der wie ein Ameisenzug anmutete. Wir fuhren auf der Autostraße, die Sonne, die auf dem Asphalt spiegelte, blendete uns. Sechs Stunden Reise hatten wir vor uns bis in unser tscherkessisches Dorf, den Ort der ständigen Sehnsucht meiner Eltern. Vater saß auf dem vorderen Sitz neben seinem älteren Bruder, ich und meine Mutter auf dem hinteren Sitz. Die Mutter hielt mich, seit wir im Auto saßen, an der Hand, wie sie es immer machte, wenn wir auf Reisen waren. Auch ich hielt gerne die Hand meiner Mutter, sie hatte trockene, aber warme Hände. Meine Eltern fragten den Onkel über das Dorf aus, Hunderte von Namen der Dorfbewohner fielen so im Eiltempo, und von allen wusste Onkel Mamdoh ein für meine Eltern erstaunliches Ereignis zu berichten. Die wichtigsten Mitteilungen waren mit Abstand die über die Heiratsangelegenheiten der Leute aus dem Dorf, die überall in der Welt lebten. Als Mamdoh von den Scheidungen dieser Dorfleute, die wie Pilze gewachsen waren, berichtete, drückte meine Mutter ihr Erstaunen mit «Vah vah!» aus und schlug sich mit beiden Händen auf ihre Schenkel. Die Welt sei ja zuerst im Dorf untergegangen, sagte sie mehrmals. Mein Vater bemerkte laut lachend, dass unser Dorf in diesen Bereichen mittlerweile die Heiden überholt habe.
Auch die Felder, Wasserleitungen, Strommasten und Tiere des Dorfes blieben von Onkel Mamdoh nicht unerwähnt. Dann berichtete er noch über die schlechte Ernte und wer wegen des Regenmangels, der im Dorf wie eine chronische Krankheit sei, wie stark von der schlechten Ernte betroffen war. Meine Mutter rief wieder: «Vah vah!»
Ich wusste schon lange, dass die Geschichten über die Verwandten im Dorf, die meine Eltern auch immer in unserem Kebab House in der Bischofstraße erzählten, während der Vater Kebab zubereitete und die Mutter die Brötchen dafür backte, für sie ein wichtiges Lebenselixier war, das ihnen mehr bedeutete als die gescheiten Reden eines Professors.
Schon bei der Begrüßung hatte ich gemerkt, dass Onkel Mamdoh sich zu mir anders verhielt, als ich es in Erinnerung hatte. Früher, wenn er uns am Flughafen abholte, warf er mich jeweils mehrmals in die Luft, umarmte mich lange, küsste meine Augen mindestens dreimal und drückte mich fest an sich, wobei mich, das muss ich gestehen, störte, dass er nach Rauch und Schweiß stank, woran ich mich heute noch gut erinnern kann. Jedes Mal, wenn wir in den Urlaub flogen, holte er uns am Flughafen mit einem neuen Auto ab. Gekauft hatte ihm dieses mein Vater, der in seinem Kebab House in der Bischofstraße, über dem wir auch unsere Wohnung hatten, mehr als sechzehn Stunden pro Tag arbeitete.
Onkel Mamdoh nahm mich jeweils schon am Flughafen zur Seite, wollte unter vier Augen über Frauen scherzen, fragte mich, wie schön und wie groß meine Lehrerin sei, und ob ich mich im Schwimmbad schon an junge Frauen heranmache. Ob mir Frauen mit großem Busen oder breitem Hintern am besten gefallen würden. Mir war es immer peinlich gewesen, wenn er so redete, trotzdem mochte ich Mamdoh sehr, weil er immer lieb zu mir war.
Dass Onkel Mamdoh diesmal so distanziert zu mir war, beschäftigte mich, während ich vom hinteren Sitz aus im Spiegel sein liebevolles Gesicht, das nun einige Falten aufwies, betrachtete. Ich interpretierte sein verändertes Benehmen mit meinem Erwachsenwerden. Mamdoh würde mich nun als einen Mann betrachten. Weiter dachte ich auf dieser Reise ins Dorf nicht.
Onkel Mamdoh kannte die Vorlieben meines Vaters und hatte eine Papiertüte mit gerösteten Kichererbsen im Auto. Mein Vater hatte die linke Hand bereits voller Kichererbsen, die er mit der rechten Hand in rhythmischen Abständen in den Mund schob. Er aß mit Genuss, ich hörte nur noch das Geräusch, wenn er in eine biss. Mein Onkel und mein Vater sprachen im Auto leise und irgendwie verschlüsselt. Ihr Gerede drehte sich ganz offensichtlich um ein Fest, das bevorstand. Ich bekam nicht alles mit, interessierte mich auch nicht unbedingt dafür, zumal ich alle fünf Minuten eine SMS von meinem Geliebten Manu beantwortete, auf Englisch, weil wir vermeiden wollten, dass mein Vater hinter unsere Geschichte kam. Manu schwärmte von meiner Zärtlichkeit. Er liebe mich, schrieb er, könne kaum warten, bis diese drei Wochen Urlaub vorbei seien. Ich liebe ihn auch, schrieb ich, diese drei Wochen würden so schnell vergehen, wie das Wasser im Fluss fließe. In meiner letzten SMS schrieb ich ihm, dass ich im Dorf keinen Empfang haben würde. Ich würde in eine andere Welt eintauchen.
3
Ob mir nicht heiß sei mit dem zugeknöpften Hemd, stellte Mamdoh seine Frage an mich in den Rückspiegel. Ich schüttelte verneinend den Kopf, auch auf den Spiegel gerichtet. Ich hatte am Nacken eine Wunde, die ich mit dem zugeknöpften Kragen des weißen Hemdes zu verstecken versuchte. Mamdoh grinste und wandte sein Gesicht auf die Straße. «Das wird halt die neue Mode sein», flüsterte er vor sich hin. Mein Vater reagierte nicht, er schaute im Spiegel zu mir. Sein Blick war tadelnd. Meine Mutter lachte gezwungen und sagte, dass die Mode spinne. Ihr wäre es natürlich ganz lieb gewesen, wenn wir gar nicht darauf gekommen wären. Sie wechselte geschickt das Thema und fragte Mamdoh nach seinen verheirateten Töchtern, wie es ihnen gehe in den neuen Familien. Mamdoh antwortete mit dem alten Spruch, dass jede Tochter ein Geschwür auf dem Herzen sei. Mutter hakte nach, was den drei verheirateten Töchtern fehle, ob ihre Männer oder Schwiegermütter sie unwürdig behandelten oder ob die Familien arm seien. Mamdoh ging nicht drauf ein, sagte nur, er hätte alles dransetzen sollen, dass sie ein Studium gemacht hätten. Dann konzentrierte er sich auf die Straße.
Die letzte Nacht vor unserer Reise in das Heimatland meiner Eltern hatte ich im «Black Paradise» verbracht. Es war stickig heiß gewesen, der Kellner hatte alle Fenster geöffnet, wir waren wie Verrückte am Tanzen, als würden wir Bauchwürmer hinausschwitzen. Die einen Männer hatten am Stehtisch weißes Pulver auf einem Plastikteller geschnüffelt, während sie laut stöhnten und dann schallend lachten. Die anderen tanzten die ganze Zeit auf der Bühne Brust an Brust, also nackte Haut an nackter Haut, eingetaucht in andere Welten. Die jungen Männer zeigten gerne ihre gepflegten Körper, wie ein Gemüsehändler es mit seiner besten Melone machen würde, und dass das Fett am Körper, ein Überbleibsel des Winters, verbrannt war. Ich war mit meinem dichten Brusthaar, auch das ein Erbe der Beytofamilie, die große Attraktion, denn seit Kurzem sind Brusthaare in unserem Kreis sehr gefragt. Mein Telefon vibrierte alle zehn Minuten, ich nahm es nicht ab, weil ich wusste, dass es meine Eltern waren, die vor der Reise unruhig waren und Angst hatten, ich würde nicht mitkommen und die Reise absagen, wie es in den letzten Jahren ein paarmal geschehen war. Doch ich hatte fest im Sinn, mein Versprechen, mitzukommen, das ich ein Jahr zuvor gemacht hatte, einzuhalten. Damals hatte mein Vater mich mit allen Mitteln, finanziellen und moralischen – sogar dem Versprechen, mir ein fruchtbares Ackerfeld im Heimatland zu kaufen, was ich absurd fand –, überzeugen wollen, mitzukommen. Ich war siebzehn und weigerte mich mit Erfolg. Und er hatte die Geduld aufgebracht, noch ein Jahr zu warten. Für dieses Versprechen hatte mir der Vater zum ersten Mal erlaubt, ins Ausland zu fliegen, zusammen mit Manuel.
Als nach Mitternacht das Lokal voll und nun alle berauscht waren, aus ihnen Energie, Schönheit, auch Freude sprudelten, wollte ich mit meinem Freund Manuel hinausgehen, um mich von ihm zu verabschieden. Denn ich traute mich immer noch nicht, in Gegenwart anderer Menschen meinen Freund auf den Mund zu küssen. Bei mir war da so etwas wie ein Knoten, und ich weigerte mich. Ich hatte auch nie gesehen, dass mein Vater meine Mutter in Anwesenheit anderer Leute küsste.
Manu, mit dem ich eine Informatiklehre machte, war nach einem strengen Arbeitstag betrunken gewesen, und er wollte mich nicht gehen lassen. Wir hatten im Park, im Dunklen, zwischen den Bäumen, eine Zunge auf die andere gelegt, uns lange geküsst, als wäre es unser letztes Mal und dies unser letzter Tag im Leben. Er war außer sich gewesen, hatte seine Zähne in meinen Nacken gedrückt. Erst als das heftige Gewitter vorbei gewesen war, wir unseren Saft entladen hatten und auf dem Kiesboden gekrümmt lagen wie ausgepresste Zitronen, war mir bewusst geworden, was los war. Die Wunde hatte so gebrannt, dass es kaum auszuhalten war. Auch ihm war es peinlich, dass er mich gebissen hatte. Wir fanden in der Nacht einen Spray in der Notapotheke, besprühten die Wunde, und ich ging nach Hause. Meiner Mutter, die auf mich gewartet hatte, war mein farbiges Halstuch nicht entgangen, das wir mittels großer Lügereien von der schläfrigen Angestellten der Apotheke erhalten hatten. Mutter hatte das Tuch zerrissen und natürlich gemeint, die Zahnspuren seien von einer Frau. Sie schimpfte mich heftig aus und bemerkte, dass sie diese Frau nicht verstehe, die einen Mann in den Nacken beiße. Ich übergab ihr den roten Glückskäfer aus Stoff, den Maria, die Mutter von Manuel, auf die Reise mitgegeben hatte. Sie bedankte sich und steckte ihn in ihre Reisetasche. Dass sie meinte, eine Frau habe mich gebissen, war meine Rettung. Wie meine Eltern reagierten, wenn sie wüssten, wo und wie ich die letzte Nacht verbracht hatte, wollte ich mir gar nicht vorstellen. Da wäre erst richtig die Hölle los gewesen. Dann wäre ihre Welt untergegangen, wie sie es immer ausdrückten, wenn sie vor irgendeinem Problem standen.
4
Onkel Mamdoh fuhr konzentriert, seine Augen auf die Straße gerichtet, doch immer wieder trafen sich unsere Blicke kurz, seine Augen im Spiegel waren die warmen von früher. Auf beiden Seiten der Straße waren hohe und dünne Pappeln, die sich vom Wind bewegen ließen, als tanzten sie in der Reihe. In jedem Auto, das uns überholte und hupte, saßen mindestens fünf Menschen. Mein Onkel ärgerte sich und murmelte, diese Fahrer seien noch in der Zeit des Pferdereitens steckengeblieben, würden auch auf Rädern zu schnell fahren und so ihrem Tod entgegenrasen.
Als die traurigen Geschichten aus dem Dorf ausgegangen waren, kamen die Scherze an die Reihe. Onkel Mamdoh schaffte mit gekonnten Sätzen den Übergang mit einer Geschichte über einen knausrigen Nachbarn, der bei der Hochzeit seines Sohnes jedes Mal geschwitzt habe, wenn er für die Ausgaben Geld aus seiner Tasche herausholte, das er mit drei Tüchern umwickelt hatte.
Meine Eltern lachten im Auto, waren für einmal nicht mehr die melancholischen Menschen, wie ich sie von ihrem Kebab House her kannte. Ich fühlte, wie sie im Auto, auf dem Weg ins Dorf, sehr glücklich waren. Ich verglich sie mit einem Hund, der zu seiner Besitzerin fand.
Die ewige Sehnsucht meiner Eltern war allgegenwärtig, oftmals viel wichtiger als Essen und Trinken. Sie war spürbar wie das Licht in der Dunkelheit. Sie war eine Fluchtoase für meine Eltern, in die sie sich zurückzogen, wenn sie in ihrem eigentlich verfluchten Leben in der Bischofstraße, wie sie es nannten, vor wichtigen Entscheidungen standen oder irgendetwas sie bedrückte, zum Beispiel wenn sie einen Behördenbrief nicht verstanden. Ihre Sehnsucht stillten meine Eltern jeden Tag ein bisschen nach zwölf Uhr nachts, wenn sie nach sechzehn Stunden Arbeit das Kebab House, den dreißig Quadratmeter großen Laden, abschlossen und erschöpft und traurig in unsere Wohnung über dem Laden zurückkamen. Sie hätten den ganzen Tag Löwen gefüttert, pflegten sie zu sagen, um ihre Müdigkeit zu begründen, während sie ihre orangefarbenen Arbeitsschürzen auszogen. Wenn sie da waren, stanken alle Zimmer der Wohnung, die Wände, die Teppiche, ihr Atem und ihre Kleider, sogar der nie fehlende Goldschmuck meiner Mutter am Hals, nach fettigem Fleisch und in Öl gebratenen Kartoffeln. Mutter kochte vor sich hinredend Schwarztee im aus Zink hergestellten, mit Nelken und Kamillen verzierten Teekrug, den sie natürlich vom Beytodorf mitgenommen hatte, nachdem sie sich frisch und schön gemacht hatte. Sie zog jeweils ihre schönsten Kleider an, als würde sie an eine Hochzeit gehen. Vater streckte stöhnend seine Beine auf dem Teppich aus, auf den er stolz war, weil er von seiner Mutter geknüpft worden war. Jeden Tag erzählte er die gleichen Geschichten von den komplizierten Mustern des Teppichs – etwa ein Rentier mit Hörnern – und vom Geheimnis seiner Mutter, die sich ohne Vorlage mit diesen rätselhaften Mustern auskannte. Der Tee und das Geschichtenerzählen waren ein Ausgleich zu ihrem anstrengenden Leben. Meine Mutter schenkte Tee in die schmalen Gläser mit der goldfarbenen Verzierung, während Vater den Tagesumsatz von Hand auf der leeren Schachtel seiner Zigaretten ausrechnete, so konzentriert, als würde er ein Flugzeug steuern. Nur dann setzte er eine Brille auf. Sie stellten eine Tasse voll farbigem Bonbonzucker auf ein Tischchen zwischen sich und tranken Tee in der berühmten Art des Dorfes: Sie nahmen den Zucker in den Mund, versteckten ihn in einer Backe, bis der heiße Tee aus dem schmalen Glas ausgetrunken war. Beide waren redselig. Sogar ich hatte meine Freude daran, ihnen zuzuhören. Mutter hatte von irgendwem gehört, dass diese Art Tee mit Bonbonzucker nicht dick mache. Meine Eltern wurden aber Jahr für Jahr breiter und breiter. Sie würden mich noch mehr lieben, sagten sie, wenn auch ich auf dieselbe Art Tee mit farbigem Bonbonzucker trinken würde. Sie wollten nicht auf mich hören, wenn ich ihnen weiszumachen versuchte, dass sie als Erstes gegen das unerwünschte Fett an den Knochen diesen ewigen Bonbonzucker weglassen sollten. Der Vater war jeweils verletzt durch meine unüberlegte, lächerliche Feststellung. Stolz sagte er: «Die Art unseres Dorfes, Tee zu trinken, macht nicht dick, weil wir auch im Dorf nicht dick wurden.» Er wiederholte einen Satz aus seinem Dorf, das Pferd solle am Gerstenessen sterben, wenn es sein müsse, also jemand dürfe an dem sterben, was er gerne habe. Meine Eltern gingen erst zu Bett, wenn die Zuckertasse und die Teekrüge leer waren und sie genüsslich und lange vom Dorf gesprochen hatten.
Am nächsten Morgen begann ihr Leben dann mit dem Seufzen meines Vaters und seinen Beschimpfungen von Onkel Mamdoh, der das Vermögen der Beytofamilie für sein ungesättigtes Schilfrohr ausgegeben habe, wie Vater den Grund für die Nachtclubbesuche seines Bruders umschrieb.
Mein Vater hatte immer wieder von Onkel Mamdoh erzählt, auch den Gästen in seinem Kebab House. Wenn sein Deutsch nicht ausreichte, musste ich einspringen und für die Gäste, die mein Vater in seinem Laden wie Könige behandelte, die Geschichten vom anstößigen Umgang meines Onkels mit den Barfrauen übersetzen, der meinen Vater in seiner Existenz bedroht hatte. Dass er schuld war, dass mein Vater im Alter von dreiundzwanzig Jahren in die Fremde gehen musste, wo er in ein schwieriges Leben «dazwischen» trat, wie er es ausdrückte – ich glaube, diesen Begriff hatte ein Kunde meines Vaters benutzt, dem er seine Lage geschildert hatte, und Vater hatte ihn übernommen –, hatte der Vater ihm nie verziehen. Er hatte aber Mamdoh vom Kebab House aus in all den Jahren bedingungslos unterstützt. So wollten es die archaischen Gesetze seines Dorfes. Bevor wir jeweils in den Urlaub fuhren, suchte der Vater für sich einen ganzen Tag lang einen billigen Anzug, aber wenn er für Mamdoh einen Anzug kaufte, was zu den Reisevorbereitungen gehörte, ging er in das teuerste Modegeschäft. Mamdoh, der ältere Bruder, war sein hoher Prinz, den er seit je bewunderte. Das begründete mein Vater mit seiner Kultur: dass der Kleine den Großen zu respektieren habe, denn wenn man den Älteren keinen Respekt entgegenbringe, falle eine Gesellschaft auseinander wie ein Kartenhaus und schmelze wie Schnee unter den starken Sonnenstrahlen.
Mamdoh hatte den Erlös aus den Ländereien des Beytolandes, wie mein Vater stolz den Herkunftsort seiner Familie bezeichnete, in den damals noch wenigen Nachtclubs der Hauptstadt ausgegeben, ließ Vater mich sehr oft seinen Gästen im Kebab House in der Bischofstraße übersetzen. Mamdoh, der verwöhnte Bruder, der Wunschsohn, den der allmächtige Gott dem reichen Großvater nach der Geburt von drei Töchtern geschenkt hatte, genoss es, aus dem Nabel der Frauen Schnaps zu trinken. Deshalb liebte er nur die breitesten Frauen, weil ihre Nabel mehr Platz böten, sagte Vater abschätzig. Mamdoh goss Schnaps in dieses ihm wertvolle Loch, das er mit viel Geld gekauft hatte, und trank oder schleckte das bittere Wasser mit der Zunge aus. Es geschah über Jahre immer das Gleiche: Mamdoh verlor Geld im Nachtclub oder auch beim Glücksspiel, und am nächsten Tag kam der Gläubiger zu meinem Großvater Beyto. Dieser wollte in niemandes Schuld stehen, weder eines Zuhälters noch eines Nachtclubbesitzers, die er als minderwertig betrachtete, verkaufte einen Acker und beglich die Schulden. Er schlug seinen Sohn nicht, wie man im Dorf erwartet hätte, weil dieser sein erster, nach langer Zeit von Gott ins Haus geschickter Sohn war. Mit dem Spruch, Mamdoh sei sein Augapfel, musste er sich jeweils getröstet haben. Das ging so weiter, bis alle fruchtbaren Ländereien des Großvaters, der nicht wenig Tränen vergossen haben soll, den Besitzer gewechselt hatten. Als Mamdoh alles verspielt hatte, aber sein Auto nicht verkaufte, mit dem er weiterhin in die Hauptstadt fuhr, schickte mein Großvater seinen zweiten Sohn, also meinen Vater, zu seinem ehemaligen Hirten ins Land der Heiden zum Arbeiten, damit die Familie wenigstens ein Einkommen habe. Mein Vater unterstützte seither die ganze Familie. Mamdoh hörte mit dem Schnapstrinken aus Frauennabellöchern auf, allerdings erst, als seinen vier Töchtern Brüste wuchsen, wie meine Mutter sein verändertes Verhalten begründete.
5
Die Autofahrt wollte nicht enden. Mein Herz klopfte stark, wie ich all die Straßenbilder wahrnahm: So war der Laderaum eines Lastwagens voll mit Menschen beladen, die stehend fuhren. Nur die Haare der Männer und die farbigen Tücher auf den Köpfen der Frauen, die im starken Fahrtwind flatterten, ragten über den Rand hinaus. Hinten war der Wagen offen. Einige der Männer trugen sogar Kinder auf den Armen, der Wind blies ihnen die langen Haare in die Augen. Mein Onkel schüttelte verurteilend den Kopf, zeigte mit dem Finger auf die Leute auf dem Lastwagen und sagte mit gedämpfter Stimme, dass diese Männer Arbeiter seien, von weit her aus ärmlichen Regionen kämen, um hier mit der ganzen Familie auf den Kümmelfeldern zu arbeiten. Dass die Verkehrspolizei nicht eingreife, sei eine Schande, es bestehe die Gefahr, dass solche Transporte einen Unfall verursachten, vielleicht werde man schon am Abend im Fernsehen sehen können, wie viele von diesen Leuten aus dem Wagen wie Bälle heruntergerollt und ihre Köpfe wie Melonen zertrümmert worden seien.
Allmählich verstummten meine Eltern und der Onkel. Meine Mutter döste neben mir, ich hielt weiterhin ihre Hand, hörte ihr leises Schnarchen. Onkel Mamdohs Augen im Spiegel hatten sich verkleinert. Mein Vater war am Rechnen auf der Zigarettenschachtel, ich wusste nicht, was. Um mir die Zeit zu vertreiben, schrieb ich die ganze Zeit SMS an Manuel, die ich nicht schicken konnte, weil ich keinen Empfang mehr hatte. Meine Bisswunde brannte, ich konnte sie aber nicht mit Salbe oder Spray behandeln. Es hätte einen Aufruhr geben können, wenn mein Onkel diese Wunde gesehen hätte. Ich biss auf die Zähne, schloss die Augen und ließ den Vorabend wie einen Film in meinem Kopf ablaufen. Es war ein schönes Gefühl, Manuel in mir zu fühlen auf dieser Reise, die unendlich sein konnte, wie ich von den früheren Reisen her wusste.
Onkel Mamdoh hielt abrupt bei einer Raststätte an. Auch meine Mutter erwachte durch sein starkes Bremsen. Bevor er das Auto verließ, sagte er, halb gähnend und sich streckend, dass es Zeit zum Gebet sei. Dass Mamdoh vom Gebet sprach, war für uns alle eine kleine Sensation, sogar ich wurde hellwach. Meine Eltern schauten ihn mit großen, fragenden Augen an, sie blieben so stumm, als hätten sie ihre Zunge verschluckt. Mamdoh sagte, wir könnten in dem Restaurant auch etwas essen, bis er sein Gebet verrichtet habe. Mein Vater gab sofort seiner Freude auf die Suppe mit weißen Bohnen, die er vermisst habe, Ausdruck. Wir blieben im Auto und schauten Mamdoh nach, bis er in den Hof der kleinen Moschee mit einem runden Dach wie ein Flaschenhals und einem großen Minarett verschwand. Die blaue Farbe der Moschee war so intensiv, als hätte man aus Eimern Farbe auf die Wändegegossen. Meine Mutter flüsterte, während sie ihre Haare mit einer Spange festband, dass Mamdoh früher sogar bei Tauben nachgeschaut habe, ob diese nun weiblich oder männlich seien, er sei der Weiblichkeit so sehr erlegen gewesen, und heute würde er aus sich einen frommen Menschen machen. Offenbar hätten die Jahre ihn verändert. Mein Vater gähnte, lachte dann schallend, meine Mutter müsse ihren Schwager jetzt als reifen Schwiegervater, nicht mehr als den konfusen Frauenheld sehen. Er müsse sich aber für seine Sünde, für viele Frauen ein Ehrbeschmutzer gewesen zu sein, beim Allmächtigen eine Amnestie erbitten. Meine Mutter schüttelte den Kopf, sie sagte, es fehle nur noch, dass er sich einen langen Bart wachsen lasse, die Pilgerreise mache und sich in Mekka für seine Sünden entschuldige. Wir stiegen aus.