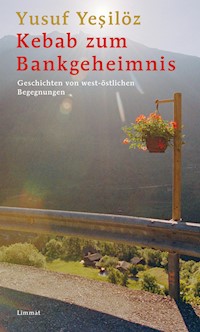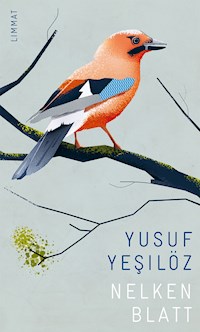14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mathematiker Ferhad, gegen fünfzig und unverheiratet, beschließt, in die Türkei zurückzukehren. Vor vierundzwanzig Jahren hat er das Land im Laderaum eines Lastwagens verlassen. Seine große Liebe Soraja, die er einst zwei Jahre lang heimlich traf, durfte er nicht heiraten, weil er vierzehn Jahre älter war als sie und nicht fromm. Auch zu dunkelhäutig, ein Erbe seiner Mutter, die von kenianischen Sklaven abstammte. Soraja hatte überstürzt den neureichen und gläubigen Murad geheiratet, aber die Ehe wurde ihr zur Qual. Die fromme Muslimin orientiert sich an westlichen Werten, Murad bleibt den Vorstellungen seines anatolischen Heimatdorfes verhaftet. Aber sich aus der unglücklichen Ehe zu befreien, wagt sie nicht. Während Ferhad Abschiedsbesuche bei Landsleuten und Einheimischen macht, beginnt Soraja, ihren drohenden Verlust zu realisieren. Einfühlsam und humorvoll zugleich erzählt Yusuf Ye_ilöz aus dem Leben zweier Menschen zwischen traditionellen Wertvorstellungen und ihrer Liebe, vom Leben mit zwei Heimaten und (von der großen Sehnsucht nach Zugehörigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Foto Luca Zanier
Yusuf Yeşilöz, geboren 1964 in Mittelanatolien als drittes von sechs Kindener in die kleinste Familie des kurdischen Dorfes. Kam 1987 als Flüchtling in die Schweiz. Seit 1994 Übersetzungen kurdischer Literatur ins Deutsche im eigenen Ararat Verlag . 1992–1995 Leitung einer eigenen Buchhandlung in St.Gallen, seit 1995 auch tätig als Übersetzer für die Sprachen Kurdisch, Türkisch und Deutsch. Yusuf Yeşilöz ist verheiratet und hat zwei Kinder, er lebt in Winterthur.
www.yesiloez.ch
Yusuf Yeşilöz
Soraja
Roman
Limmat VerlagZürich
Zuerst erschien ihre Silhouette hinter der Glastür. Dann kam sie herein, schüchtern, die automatische Tür fiel leise hinter ihr ins Schloss. Sie schaute uns an, lächelte und grüßte mit einem Kopfnicken.
Sie nahm sich die einzige Zeitschrift, eine Kunstzeitschrift mit schwarz-weißen Fotografien, setzte sich auf den dritten und letzten Stuhl im kleinen Wartezimmer und begann in der Zeitschrift zu blättern. Seit etwa drei Jahren begleitete ich Fate als Übersetzer zu Anita Burger, und immer lag dieselbe Zeitschrift im Metallständer. Inzwischen sah sie ebenso abgenutzt aus wie die strapazierten Kinderbücher. Ich hatte Anita nie gefragt, warum sie diese Zeitschrift nie ersetzte, jedes Mal hatte ich sie in die Hand genommen und wieder hingelegt, weil es noch immer dieselbe war.
Die Frau neben mir klappte die Zeitschrift wieder zu, legte sie auf ihre Knie und fuhr mit ihrer Hand durch die braun gefärbten Haare, die bis zu ihren Schultern reichten. Sie hatte einen eher hellen Teint, trug einen dunkelgrünen Pullover mit weißen Querstreifen. Ihre Augen waren blau geschminkt. Ich meinte, sie hin und wieder in der Stadt auf dem Fahrrad gesehen zu haben. Ganz sicher war ich nicht.
Ob ich sie kenne, flüsterte Fate mir in Türkisch zu, ihr war nicht entgangen, dass ich die Frau beobachtete.
«Nein, woher denn?»
Fate fragte, ob diese Frau wohl auch eine Patientin von Anita sei. Noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, sprach sie flüsternd, als verrate sie mir ein Geheimnis: «Nein, nein, eine so schöne Frau kann unmöglich eine Irre sein. Vielleicht ist diese schöne Fee die Tochter der Ärztin!»
«Fate, du hast mich öfter fragen lassen, ob Anita Kinder habe. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie nur einen Sohn.»
«Dann ist sie ihre Schwiegertochter?»
«Die Frau neben uns ist zu alt, um Anitas Schwiegertochter zu sein, Fate!»
«Dann ist sie eine Schwester der Ärztin?»
«Sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Anita ist blond wie eine Zitronenschale und mindestens einen Kopf größer als diese Frau.»
«Wenn sie verschiedene Mütter haben, ist es möglich, warum auch nicht!», sagte Fate und drehte sich zu mir. «Wenn ich die Sprache so gut könnte wie du, hätte ich diese Fee längst gefragt, warum sie hier ist oder ob sie mit Anita verwandt sei.»
«Eine Fee, das hast du treffend gesagt, Fate. Sie ist wirklich schön und anziehend. Aber es wäre aufdringlich und unhöflich, sie direkt zu fragen, warum sie zu Anita komme.»
Noch bevor ich mit meinem letzten Satz zu Ende war, klingelte mein Telefon. Soraja, Fates Tochter, wollte wissen, ob ich ihre Mutter nach dem Arztbesuch nach Hause begleite oder ob ich sie mit dem Bus schicken würde. Murad, ihr Mann, sitze bestimmt im Café und diskutiere über Fußball, sie werde anrufen und ihn nach Hause schicken, um die Mutter zu empfangen. Sie wolle nicht, dass Fate allein zu Hause sei, das sei nicht gut für sie. Soraja sprach schnell, ein Zeichen, dass viel los war in der Apotheke.
Ich sagte, dass ich Fate nur bis zur Haltestelle begleiten könne, weil ich zu tun hätte, Telefonate mit dem Elektrizitätswerk und den Einwohnerbehörden wegen meines interkontinentalen Umzuges.
Fate riss mir das Telefon aus der Hand und berichtete ihrer Tochter über ein Gespräch, das sie an diesem Morgen mit ihrem Vetter Cevat geführt habe. Fate müsse unbedingt diesen Sommer für einige Wochen zu ihnen ins Dorf kommen, habe dieser gesagt, was sie davon halte.
Soraja hatte schon aufgehängt, bevor Fate zu Ende gesprochen hatte, ich hörte es tuten, während Fate noch eifrig weiterredete. Als sie mir das Telefon zurückgab, murmelte sie vor sich hin, seit drei Jahren habe sie ihre Verwandten nicht besuchen können. Im Moment wünsche sie sich nur dieses eine. Die Tochter passe ja schon gut auf sie auf, aber sie wolle nicht wie das kleine Kind der leider immer noch kinderlosen Soraja behandelt werden. Ich reagierte nicht, ich kannte das strenge Regime, das Soraja mit der Mutter führte, die sie seit dem Tod ihres Vaters vor drei Jahren bei sich aufgenommen hatte.
Ich machte das Telefon aus und steckte es in meine Hosentasche.
Auf der Couch neben der großen Kaktuspflanze im Besprechungszimmer ließ mich Anita, die vis-à-vis von Fate saß, ihre Patientin fragen, ob das neue Medikament besser wirke. Fate ihrerseits wollte aber zunächst nur wissen, wer die Frau im Warteraum sei. Mit lauter Stimme fügte sie hinzu: «Diese Frau ist so schön wie der Mond, ist sie etwa eine Schwiegertochter von Frau Doktor?»
Anita sagte in ihrer freundlichen Art, sie könne der lieben Frau Fate Ozan alle Fragen beantworten, sei es über ihre eigenen Beschwerden, vielleicht auch über ihre Eltern oder andere Verwandte, nach denen Fate sich ja freundlicherweise immer wieder erkundige, aber nicht über die Menschen in ihrem Warteraum. Das verbiete ihr das Arztgeheimnis.
Fate wurde laut. «Was soll diese kleine Frage mit einem Arztgeheimnis zu tun haben? Ich will nur wissen, wer diese Frau ist!»
Anita stand auf, ging zu ihrer mit Büchern vollgestopften Bibliothek, die die ganze Wand, rund vier Meter lang, bedeckte, holte ein Buch heraus, und zwar ein dickes. «Alles steht hier drin. Das ist meine Bibel – oder mein Koran –, der das Arztgeheimnis regelt.» Sie lächelte Fate an.
Sie versorgte das Buch wieder und setzte sich auf ihren Stuhl.
Ich übersetzte für Fate, dass die Frau Doktor nicht verraten wolle, wer alles sie besuche, sie meine, dass Fate zu neugierig sei.
Das habe mit Neugier gar nichts zu tun. «Wenn zwei Menschen dasitzen und eine Frau hinzukommt, will man zu Recht wissen, wer der Neuankömmling ist!»
Sie sagte es in einem so bestimmten Ton, als würde sie von Anita ihren längst fälligen Lohn verlangen. Das übersetzte ich nicht, und Anita wollte auch nicht wissen, was Fate gesagt hatte, sondern nur, bei wem Fate momentan wohne und ob sie sich unterdessen entschieden habe, bei der Tochter zu bleiben oder zum Sohn zu wechseln. Auf jeden Fall würde sie ihr empfehlen, nicht allein zu leben, zumindest solange sie Medikamente einnehmen müsse.
Fate sagte, dass sie bei Soraja lebe, die sie hüte wie ein Huhn sein Küken, und berichtete auch, dass diese Pille, die wie eine weiße Bohne aussehe, sie sehr fröhlich mache. Wenn sie diese einnehme, sei sie voll Freude, als würde sie gerade ihre Hochzeit mit Memed feiern. Anita lachte, hielt sie an beiden Händen und fragte, ob sie Memed wieder heiraten würde.
«Auf einem Pferd reitend würde ich zu ihm gehen!», antwortete diese, mit Stolz in der Stimme. Anita lachte. «Für Ihre Sprache liebe ich Sie, Frau Ozan!», sagte sie und fragte, ob sie und Soraja sich vorstellen könnten, dass sie definitiv bei Soraja wohnen bleibe, sie wolle mit Soraja noch einmal reden. Sie doppelte nach, betonte jedes Wort, es sei wichtig zu wissen, wo sie künftig definitiv wohnen würde.
Fate meinte, dass sie momentan bei Soraja lebe, da der Sohn leider ohne Kopf, also noch ledig sei. Aber es sei in ihrer Kultur so, dass die Mutter beim Sohn wohnen müsse. Ihr Sohn wolle sich aber einfach nicht für eine Heirat entscheiden. Sie habe leider keinen Einfluss auf ihn. Auf Anitas Nachfrage sagte sie, dass er mit einem Studienkollegen eine Wohnung teile, die Wohnung der beiden sei für sie sowieso nicht betretbar, da die beiden die Wohnung nie aufräumten, jedes Mal, wenn sie dort sei, habe sie das Gefühl, dass in dieser Wohnung ein Fuchs Vögel gefangen habe.
Wir drei lachten laut.
Nach rund fünf Minuten standen wir auf. Fate holte aus ihrer Handtasche eine Tüte, reichte Anita wie immer ein in Aluminiumpapier gewickeltes Börek. Diese schüttelte den Kopf, bedankte sich.
«Sehr lieb, aber, Fate, schon wieder für mich gearbeitet? Kommen Sie nie mit leeren Händen?»
«Du auch arbeiten für alte Fate!», antwortete diese auf Deutsch.
Beim Abschied küsste sie Anita auf die Wangen, wie immer. Anita hatte sich nur in der ersten Zeit gegen Fates Küsse gewehrt. Und ich musste auch diesmal, schon im Stehen, Anita erklären, dass ich nicht mit Fate verwandt sei, sondern nur ihre Tochter Soraja gut kenne. Weil diese sehr beschäftigt sei in der Apotheke, würde ich ihre Mutter begleiten. Ich wechselte dann ins Englische, damit Fate es nicht verstand: Früher hätten Soraja und ich eine kleine gemeinsame Geschichte gehabt. Darauf sah Anita mich mit großen Augen an und sagte: «Ihr hättet gut zueinandergepasst!»
Später fragte ich mich öfter, warum ich dieses Geheimnis, das ich über Jahre hinweg strikt für mich behalten hatte, Anita gegenüber lüftete. Weil ich davon ausgegangen war, dass ich nach Ankara gehen und sie nie mehr sehen würde?
Ich wollte mich von Anita verabschieden, da ich in meine Heimat zurückkehren wollte, nach vierundzwanzig Jahren in dieser Stadt. Sie war überrascht. Was ich dort machen würde, frag te sie.
«Ich weiß es noch nicht. Zuerst will ich meine Wohnung in Ankara streichen lassen und sie einrichten. Vorher muss ich hier die Wohnung und in Ankara den Mieter loswerden. Es ist noch vieles offen. Wer weiß, wohin der Wind einen führt», schloss ich.
Das sei schön gesagt, meinte Anita, während sie Fate die Jacke hielt, «aber stellen Sie sich einen Umzug und einen neuen Beginn so einfach und locker vor?»
Im Moment sei meine große Sorge, antwortete ich, wie ich meine zwei Möbelstücke, einen Esstisch und eine Kommode, zu denen ich einen besonderen Bezug hätte, und meine Bibliothek nach Ankara transportieren könne. Fate, die unser Gespräch auf Deutsch verstanden hatte, flüsterte, dass ich Hunderte von Wohnungen hell streichen und sie mit den teuersten Möbeln einrichten könne, aber ohne die darin wohnende aufrechte und schöne Frau würde diese Wohnung immer noch düster und leer aussehen, und ich würde das Glück nie finden. Ich übersetzte auf Anitas Wunsch diesen Satz. Sie sagte, zu Fate gewandt, es komme darauf an, was man unter Glück verstehe. Glück habe viele Bedeutungen.
Anita bedankte sich bei mir dafür, dass ich Fate in den letzten drei Jahren öfter zu ihr begleitet hatte. Wenn sie gewusst hätte, dass ich zum letzten Mal zu ihr komme, hätte sie bestimmt ein kleines Geschenk für mich mitgebracht, ein Andenken. Sie habe es sehr geschätzt, dass ich mir für diese alte Verwandte Zeit genommen hätte. Ich wiederholte, dass Fate nicht mit mir verwandt sei. Nicht weil die unterstellte Verwandtschaft mit Fate mich störte, sondern Anitas Vergesslichkeit.
Sie reichte mir ihre Visitenkarte, während sie sagte, sie hoffe, dass ich nach vierundzwanzig Jahren in der Fremde ein leichtes, gutes Ankommen habe. Sie wünsche mir einfach viel, viel Kraft. Sie hoffe, dass die Träume des Träumers in Erfüllung gingen. Ich sagte «Insch-allah», dann lachten wir beide.
Anita gab uns die Hand und wartete – in der Tür stehend – auf die nächste Person. Als wir an ihr vorbeigingen, erhob sich die Frau im Warteraum, und wir standen uns kurz gegenüber. Ich fing ihren Blick auf, und eine Nuance zu lange schauten wir uns in die Augen. Ich hätte auf der Stelle geschworen, dass sie schöner war als der Mond.
Es regnete leicht, die Wolken waren unfreundlich trüb an diesem Tag Anfang März. Fate zählte unter dem Glasdach der Bushaltestelle auf, was sie alles gekocht habe: Bohnensuppe, Teigtaschen mit Spinat, Auberginenmoussaka, Pilaw und als Nachspeise Kadayif. Mit dem einzigen Ziel, mich zu ihrer Tochter Soraja und zu sich zu lotsen. Sie hielt mich an beiden Handgelenken fest: «Mir ist lieber, dass du bei mir isst, als mein Schwiegersohn Murad, der zu nichts taugt und nichts macht.»
Fate hatte ihre Dankbarkeit dafür, dass ich sie zur Ärztin begleitete, bei jeder Gelegenheit ausgedrückt. Ich schätzte ihre Kochkunst und ihre grenzenlose Großzügigkeit. Ich glaubte ihr sofort, dass sie extra für mich gekocht hatte, aber ich wollte nicht mitgehen, weil ich wusste, dass Murad Sorajas Befehle wie ein Soldat befolgte und nach dem Anruf seiner Frau unverzüglich nach Hause gegangen war, um auf seine Schwiegermutter zu warten. Und ich wollte Murad, meinem Nachfolger bei Soraja, nicht begegnen, auch wenn weder er noch Fate von meiner heimlichen Liebesbeziehung zu Soraja wussten, die auch schon mehr als zehn Jahre her war.
Ich musste Fate versprechen, dass ich sie, bevor ich definitiv nach Ankara ginge, noch einmal besuchen würde, damit sie mir ihre Kochkunst vorführen könnte. «Der Geschmack muss dann für immer in deinem Gaumen bleiben!», lobte sie sich. Früher, als ihr Mann Memed noch gelebt hatte, hatte ich mir erlaubt, ihr zu sagen, dass sie zu fett koche, worauf sie lachend entgegnet hatte, ihr Mann habe diese Küche gerne, das reiche ihr. Nun erlaubte ich mir aus Höflichkeit nicht mehr, der gebrechlichen Fate ein ihr nicht genehmes Wort zu sagen, sie ertrug nichts mehr und war schnell beleidigt.
Fate winkte mir durch das Türfenster des Busses. Als er losfuhr, hinterließ er Rauch und Ruß.
Ich setzte mich im Café da Mila an einen kleinen, runden Tisch mit Marmorplatte am Fenster. Die Ausgangstür der Praxis auf der anderen Straßenseite hatte ich gut im Auge. Die Weinstraße war kurz vor Mittag ziemlich befahren, ein Auto folgte dem anderen wie in einem Ameisenzug. Ich erwartete, dass die Fee etwa in einer halben Stunde aus der Praxis kommen würde. Falls sie eine Patientin war. Vielleicht war sie aber auch eine Firmenvertreterin, die Anita Medikamente verkaufen wollte.
Den ersten Espresso trank ich in drei Zügen. Ich war überrascht, dass mein Entscheid zurückzugehen bei vielen Menschen, bekannten und unbekannten, für Kopfschütteln sorgte. Dass ich nach so vielen Jahren zurück will in eine Stadt, zu der meine einzige Beziehung die Appartementwohnung in einem vornehmen Viertel war, die mir von meinem vor vier Jahren verstorbenen Vater geschenkt worden war. Dass auch Anita mich spontan einen Träumer nannte, machte mich betroffen und wühlte mich auf. Vor allem Anitas Bemerkung, Soraja und ich hätten gut zu-einander gepasst, stimmte mich traurig und versetzte mich zehn Jahre zurück, als ich Soraja in meiner Wohnung heimlich empfangen hatte. Wenn sie bei mir weilte, war sie angespannt wie ein Bogen, aus Angst, ihre strengen Eltern würden unsere verbotene Liebe entdecken.
Nein, sagte mir meine innere Stimme, vergiss diese schmerzhafte Zeit, wühle nicht weiter darin. Soraja hast du verloren, an einen Murad, den sie nicht liebt. Dass du sie nicht geheiratet hast, lag nicht allein in deiner Hand, du darfst dir keine Vorwürfe machen. Du hättest dein Wesen ändern müssen, du hattest für ihre Eltern eine zu dunkle Haut, du warst nicht religiös, wie sie und ihre Familie es gern gehabt hätten. Vor allem warst du vierzehn Jahre älter als sie. Die Familie mochte dich als einen Freund und Helfer. Aber du warst der Familie nicht würdig, passtest nicht in die Normen, wie ein Schwiegersohn auszusehen hätte!
Jedes Mal, wenn die Kellnerin zu mir hersah, bestellte ich einen Espresso, obwohl ich bald keine Lust mehr hatte. Am Schluss waren es fünf Tassen. Jedes Mal brachte sie eine Tasse in einer anderen Farbe, weiß, grün, gelb, rot und hellblau. Den fünften habe sie nicht eingetippt, sagte sie und bemerkte, dass sie in ihrer fünfjährigen Karriere als Kellnerin das erste Mal jemanden bediene, der innerhalb von einer halben Stunde fünf Espressi hinunterkippe. Einen, der fünf Bier hintereinander trinke, erlebe sie leider oft. Sie spendiere mir nun einen sechsten. Ohne eine Antwort abzuwarten, brachte sie diesmal eine Tasse in schwarzer Farbe. Sie stellte die sechs Tassen auf dem Tisch in eine ordentliche Reihe, fragte mich, ob sie ein Foto machen dürfe, das wolle sie als Erinnerung behalten. Sie habe ihr Studium abgeschlossen, höre mit diesem Nebenjob auf und gehe auf eine Weltreise. Nachdem sie mich mit meinen sechs Tassen fotografiert hatte, fragte ich sie, ob sie mir davon einen Abzug machen könne. Sie freute sich über meinen Wunsch. Ich solle morgen um dieselbe Zeit vorbeikommen, dann bekäme ich ein Foto.
Die Kellnerin sprach noch über die geplanten Destinationen ihrer Reise, da kam auch schon die Fee aus dem gegenüberliegenden Haus. Ich legte das Geld auf den Tisch, eilte hinaus. Im Gehen zog ich mein Jackett an, schlängelte mich durch die Autos durch, was nicht ganz ungefährlich war. Der Fahrer eines Lieferwagens hupte laut, als ich vor seinen Wagen rannte. Die Bremsen quietschten wie das Zischen einer Schlange.
An der Bushaltestelle zögerte ich doch, sie anzusprechen, obwohl wir einander vielleicht eine halbe Minute lang anschauten.
Noch während ich einen Vorwand suchte, unter dem ich sie ansprechen könnte, hielt ein Auto an, und sie stieg ein, nicht ohne mich noch eines verstohlenen kurzen Blicks zu würdigen. Wer am Steuer saß, sah ich nicht, weil die Scheiben des roten Aut os vom leichten Regen verschwommen waren. Ich schaute dem Auto nach, merkte mir die Nummer, tippte sie in mein Handy, löschte sie aber sofort wieder, weil mir das aufdringlich vorkam und ich mich wie ein schmieriger Detektiv fühlte.
Anita war im Warteraum ihrer Praxis beim Aufräumen. Sie war nicht wenig überrascht, dass ich zurückgekommen war. Als wäre sie an den Boden genagelt, stand sie da und schaute mich fragend an. Fast stotternd sagte ich, dass ich meinen Schal vergessen habe, worauf sie lächelnd sagte, dass sie keinen Schal gesehen habe. «Und in welcher Farbe war der?»
Überrascht von der Frage, fiel mir nicht gleich eine Farbe ein. «Er ist blau – also dunkelblau!»
Anita stand gerade vor mir, ihre Miene wurde ernst: «Wenn Sie ein Gespräch mit mir wollen, müssen wir einen Termin vereinbaren. Ich brauche jetzt meine Mittagspause.»
Ein Gespräch mit der Psychiaterin wollte ich nicht, mir reichte schon, dass ich Fate, die seit dem Tod ihres Mannes eine Therapie machte, zu Anita begleitete. Wenn Anita Fragen stellte, um herauszufinden, wie stark Fates Depressionen waren, stellte ich diese Fragen jeweils auch an meine innere Stimme. Ich glaubte nicht, dass ich unter Depressionen litt. Ich wollte auf keinen Fall auf Anitas gelber Couch sitzen, um herauszufinden, wie es mit meiner psychischen Verfassung stand. Der weiße Stuhl, auf dem ich als Übersetzer saß, genügte mir vollkommen.
Ich fand, dass es sinnlos war, das Spiel hier länger zu spielen, zumal ich mir sicher war, dass die clevere Anita sogar in meinen Augen lesen würde, was ich suchte. Ich sagte direkt, dass ich wissen wolle, wer diese Frau sei, die nach uns an die Reihe gekommen war.
Anita blieb stehen, musterte mich von Kopf bis Fuß. Ihr Blick war durchdringend. Ich hatte den Eindruck, dass sie mir ihre Überlegenheit demonstrieren wollte. Den Satz «Ach so!» zog sie in die Länge. Dann überraschte sie mich mit einer harten Frage: «Laufen Sie jeder Frau nach, die Sie schön finden? Können Sie das auch in Ankara tun?» Sie lachte danach irgendwie sarkastisch, und ich hatte keine Antwort parat.
Die Frage war treffend und verletzte mich doch, sodass ich entschied, wieder zu gehen.
Zu meinem Erstaunen fragte sie, ob ich mich zu ihr gesellen wolle, wenn sie ihr Sandwich esse, sie habe eine Dreiviertelstunde Mittagszeit. Bis der nächste Mensch mit seinen Problemen vorbeikomme, wolle sie einen Bissen im Magen haben, sonst könne sie den langen Tag nicht aushalten. Ich sagte ohne zu zögern zu und fragte, ob ich ihre Toilette benützen dürfe. Die vielen Espressi wollten nicht länger in der Blase ausharren. Als ich zurückkam, war das Mittagessen schon bereit.
Anita, die schlanke Frau, aß schon im Stehen ein Sandwich aus Vollkornbrot und reichte mir das Börek, das Fate ihr gebracht hatte. Sie entschuldigte sich dafür, dass sie mir nur das geschenkte Börek gebe, sie habe leider sonst nichts hier, «außer Leitungswasser und ein paar Salznüssen». Wir setzten uns, Anita auf den Stuhl, auf dem Fate gesessen hatte, ich auf den, der zuvor der Platz der Fee gewesen war. Auf den Stuhl zwischen uns hatte sie Essiggurken im Glas, gleichmäßig geschnittene Kohlrabi auf einer farbigen Serviette, sechs Stück kleine Tomaten in einer Glasschale und eine Wasserkaraffe mit zwei Gläsern gestellt.
Wir wünschten einander gleichzeitig guten Appetit und sprachen vom regnerischen Wetter, das uns beiden nicht gut tue, vom nicht kommen wollenden Frühling, den wir beide vermissten. Es habe sie vorhin beschäftigt, sagte sie nach einer kurzen Stille mit ihrer sanften Stimme, warum ich mich nach so vielen Jahren dafür entscheide, zurückzukehren. Zuerst habe sie gedacht, dass vielleicht die Liebe eine Rolle spiele. Wenn ich aber der schönen Frau nachlaufe, den Satz betonte sie extra, heiße das für sie, dass dort in Ankara keine Frau auf mich warte. Ich war diese Frage gewohnt und antwortete, dass ich etwas Neues wolle. Mit meiner unklaren Antwort gab Anita sich nicht zufrieden.
«Was Neues?», sagte sie vor sich hin, während sie die Gläser füllte. Sie reichte mir ein Wasserglas. «Haben Sie vielleicht genug davon, in einem Land immer als Fremder betrachtet zu werden?»
Ich trank das Glas in einem Zug leer. Die Frage überraschte mich, die folgende Frage, warum ich so viel dunkler sei als die anderen aus meinem Land, noch mehr. Das sei nicht immer ein Vorteil, gab ich wortkarg auf die zweite Frage zur Antwort. Auf die erste Frage wusste ich noch nichts zu entgegnen.
«Ich bin zu Ihnen gekommen, damit sie mir den Namen dieser Frau sagen.»
«Ich darf Ihnen auf keinen Fall den Namen dieser Frau preisgeben. Haben wir nicht eben dieses Berufsgeheimnis erklärt?» Sie lachte mit einem Unterton: «Wenn ich Fate das Geheimnis verrate, muss ich mit Ihnen nach Ankara kommen, weil ich dann den Beruf an den Nagel hängen müsste. Ich liebe aber meinen Beruf!»
«So weit möchte ich Sie nicht bringen, aber verraten Sie mir doch so viel, ob die Frau mit Ihnen verwandt oder eine Patientin ist?»
«Jedes Kind wird darauf kommen, dass sie eine Patientin ist, wenn sie im Warteraum einer Arztpraxis gesehen wird!»
Anita wechselte das Thema. Vorher biss sie zweimal hintereinander heftig in ihr Sandwich. Dann warf sie in schnellem Tempo Tomaten und Gurken nacheinander in den Mund.
«Sagen Sie mir, was haben Sie hier gearbeitet? Sie scheinen immer adrett gekleidet zu sein.»
«Ich bin Mathematiker, habe aber mein Brot mehrheitlich als Übersetzer bei den Asylbehörden verdient, weil ich in meinem ursprünglichen Beruf nicht habe arbeiten können. Ich habe hier leider keinen Abschluss gemacht.» Ich fragte Anita, was meine Kleider mit dem Beruf zu tun hätten. Sie ging nicht darauf ein.
«Um im Asylamt zu arbeiten, braucht man ja auch eine dicke Haut, all diese traurige Geschichten übersetzen und anhören …»
«Auch Sie hören ja täglich Schlimmes …»
«Das stimmt schon, trotzdem liebe ich die Menschen. Nicht nur mit ihren Sonnengesichtern, sondern den Menschen als Ganzes, dazu gehört auch, dass Menschen Probleme haben. Und es tut ihnen gut, davon zu erzählen.»
«In jedem Beruf gibt es nicht nur Schmerz.»
Anita sagte nichts. Ich war geneigt, das Thema Beruf abzuschließen und zeigte auf mein rechtes Ohr.
«Der Mensch vergisst ja zum Glück viel, das geht da rein, da raus.»
Stille. Anita hatte ihr Sandwich fertig gegessen. Sie trank Wasser.
«In Ankara», sie machte nach diesem Wort eine kurze Pause, «was erhoffen Sie sich dort?»
Diese Frage hatte ich mir auch schon einmal gestellt, sie aber gleich wieder verdrängt. Ich wolle erst einmal in Ankara ankommen, meine Wohnung einrichten und dann sehen, was passiere. Sie überraschte mich auch mit der nächsten Frage.
«Denken Sie, dass Sie dort einfacher leben können, als alleinstehender Mann?»
«Hier lebt ja jede zweite Person allein», war meine ausweichende Antwort. Ich war verblüfft, wie sie die Fragen, die auch mich beschäftigten, kurz und direkt stellte. «Vielleicht finde ich in Ankara die Zufriedenheit, die ich suche», lachte ich dazu. Dann korrigierte ich mich, das sei ein Witz gewesen, und fügte mit ernster Stimme hinzu, dass ich den letzten Ort für das Leben, meine letzte Lebensstation, noch nicht gefunden habe.
«Die ist überall zu finden und auch wieder nirgends», sagte Anita, während sie die leeren Gläser in die Hand nahm und aufstand. «Ich muss ein paar Minuten allein sein für eine Yogaübung, bald kommt die nächste Frau, ich möchte aber, dass Sie dieser hier nicht begegnen. Sie verstehen, was ich meine.»
Die Botschaft war klar, Anita hatte mir freundlich gesagt, ich solle gehen. Ich stand auf. Auch jetzt – ich hatte es noch einmal versucht und war selber überzeugt, dass ich aufdringlich war – sagte Anita nicht, wer die Frau war, die ich suchte.
Sie verlor aber den Satz: «Einer Lehrerin und Mutter wächst schnell einmal alles über den Kopf.»
«Ist sie Lehrerin?»
«Das weiß ich nicht», korrigierte sie sich schnell, «sie könnte Lehrerin, Ärztin, Krankenschwester oder auch Coiffeuse sein, aber ich möchte Ihnen sagen, dass Sie die Finger lassen sollten von dieser Frau. Sie ist für ein Vergnügen kurz vor Ihrer Reise ins Ungewisse nicht geeignet. Sie tun dieser fragilen Frau bestimmt nichts Gutes, wenn Sie ein kurzes Abenteuer mit ihr suchen.»
Ich musste mich wehren: «Ich suche kein kurzes Abenteuer! »
«Was dann?»
Anitas Frage dröhnte in meinem Ohr. Sie machte mich auch verlegen. Ich wusste ja selbst nicht, warum ich gerade von dieser Frau so gebannt war. Ich sagte, es sei mein Hobby, schöne Menschengesichter zu fotografieren. Ich wolle in der Stadt Ankara, die ich nicht kenne, mit einer Fotoausstellung schöner Gesichter aus vielen Kontinenten einen Freundeskreis finden. Zu mindestens hoffte ich das.
Anita blieb stehen und blickte mich skeptisch an. Sie stellte die Überreste des Essens in ihr Sprechzimmer und kam mit einem Notizblock und einem Stift zurück.
«Ich vertraue Ihnen, weil Sie zuvorkommend waren und bei mir für die alte Frau immer korrekt übersetzt haben. Ich mache eine Ausnahme, ich werde die Frau, die Sie suchen, nachher anrufen und von Ihrem Wunsch erzählen. Und ihr auch sagen, dass ich nicht genau wüsste, warum Sie so hartnäckig seien. Sie kann selber entscheiden, ob sie sich bei Ihnen meldet oder nicht. Zuerst aber noch einmal ganz ehrlich: Suchen Sie sie nur fürs Fotografieren?»
«Ja, ja, ja, natürlich», schoss es aus meinem Mund. Anita schrieb meine Telefonnummer auf, während sie vor sich hinmurmelte, ein einziges Ja hätte ihr auch gereicht.
Ich stand auf, sie reichte mir die Hand. «Viel Glück auf der Suche nach Zufriedenheit!»
Aus ihrer angenehmen Stimme war deutlich Spott herauszuhören.
Ich stieg auf mein Fahrrad, das im Unterstand das Zweite war. Ich nahm an, dass das andere, ein altes Damenfahrrad einer stadtbekannten Marke, die einmal unter den Umweltschützern Kult war, Anita gehörte.
Da ich in den Schulen übersetzt hatte, wusste ich, dass im Augenblick in den Korridoren der Schulen Fotos der Lehrer aufgehängt waren. Ich radelte die Bahnlinie entlang zu der nächstgelegenen Schule. Der Regen hatte aufgehört. Wenn ich in eine Straßenpfütze fuhr, spritzte das Wasser bis zu meinem Gesicht.
Ich wusste, dass ich ein Mensch auf der Suche war, wusste aber nicht mehr, seit wann. Warum überraschte und traf es mich, dass auch die Ärztin Anita mich einen Träumer nannte? Ein Träumer war ich ja immer gewesen. Ist nicht jeder Mensch ein Träumer?
Ohne mein Fahrrad abzuschließen, ging ich hinein ins Schulhaus Gutenberg, wo ich während mehrerer Jahre für meine Landsleute, die das Deutsche nicht genug beherrschten, übersetzt hatte. Die Schüler hatten noch Unterricht, der Schulhof war verlassen. Hätten die Kids Pause, wäre in den Gängen ein Lärm wie ein Erdbeben, ging mir durch den Kopf. Der Hauswart stand an der Außentreppe. Mit einem Besen in der Hand tat er so, als würde er die Treppe reinigen von einem braunen Saft, der verschüttet worden war.
Ich versuchte zielstrebig an ihm vorbeizugehen. Er hob den Kopf mit einem Seufzen und fragte, wo ich hin wolle. Ich nannte den Namen der Schulpräsidentin, Frau Sommer. Er fragte, ob ich der Vater eines Schülers von ihr sei, worauf ich sagte: ja, so etwas Ähnliches. «Aha», sagte er, auch er sei so etwas Ähnliches wie der Vater des Kindes seiner Partnerin, und er lachte. Frau Sommer sei noch in der Stunde, fügte er hinzu, ich könne im Gang auf sie warten. Wenn ich einen Kaffee wolle, müsse ich warten, bis das Lehrerzimmer in der Pause aufgeschlossen werde. Ich durfte hinein.
Es dauerte nur eine Minute, bis ich mir im Parterre auf einer Pinnwand die etwa zwanzig Fotos der Lehrerschaft angesehen hatte. Ich war enttäuscht und gleichzeitig erleichtert, dass die Fee nicht dabei war. Enttäuscht war ich, weil sie nicht dabei war, obwohl ich nicht erwartet hatte, sie so schnell zu finden. Warum ich froh war, wusste ich nicht. Hatte ich Angst vor der neuen Begegnung? Weil ich nicht wusste, warum ich sie suchte? Dem Hauswart an der Treppe sagte ich, dass ich doch keine Zeit habe zu warten bis zur Pause. Er reagierte nicht, und ich radelte zu der nächsten Schule. Ein kalter, mit leichtem Regen vermischter Wind stach mir ins Gesicht, aber der störte mich nicht, ich pfiff sogar eine Melodie auf dem Fahrrad.
Ich hatte viele Erinnerungen an diese Orte, die ich jetzt mit dem Fahrrad durchquerte, kannte Geschichten von hier, die ich in Ankara würde erzählen können. Mein Landsmann, wie hieß er wieder? Er war groß gewachsen, hatte eine Brille mit goldenen Rändern, seine Haare waren modisch und kurz geschnitten, mit Gel geformt, wie von Hand gezeichnet. In seinen engen, schwarzen Leibchen wirkte er wie ein Model. Er saß vis-à-vis der zierlichen Lehrerin – wie hieß sie doch gleich? Der Schülerstuhl, auf dem er saß, war für ihn zu klein, es sah aus wie ein Elefant auf einem Autositz. Die Lehrerin versuchte zu erklären, wie sie seinen Sohn empfinde, warum er Mühe habe, sich in die Gruppe einzubringen und dort seinen Platz zu finden. Sein Sohn habe den Kreis der Familie nie verlassen, sie denke, dass ihm deshalb die soziale Kompetenz fehle. Und mein Landsmann sagte der Lehrerin, er selber habe in seinem Dorf fünfhundert Schafe bei der Stange gehalten, und die Lehrerin sei nicht imstande, elf kleine Kinder zusammenzuhalten. Er frage sich, was man in einer Lehrerschule überhaupt lerne. Wir alle hatten gelacht. Auch die Lehrerin, deren Gesicht aber rot angelaufen war. Ich habe, wie viele andere, auch diese Menschen aus den Augen verloren.
Auch im nächsten Schulhaus fand ich kein Foto der Fee. Anschließend durchsuchte ich volle sieben Schulhäuser, aber das schöne Gesicht war auf keiner der Fototafeln dabei. Ich konnte meine Enttäuschung nicht mehr unterdrücken. Ich war müde vom Radfahren und gleichzeitig froh, mich genügend bewegt zu haben. Meine innere Stimme redete mir zu, sie habe zwar ein sehr schönes Gesicht, aber kurz vor der geplanten Reise sei es überhaupt nicht klug, sich noch auf eine neue Geschichte einzulassen.
Zu Hause kochte ich mir einen Pilaw und wärmte mir die Reste der weißen Bohnen auf. Während des Essens hörte ich wie jeden Abend die Nachrichten im Radio. Es berichtete als erstes vom befürchteten Bürgerkrieg in einem Land weit weg von hier und dann vom Plan einer Gruppe, die für viele Milliarden Franken eine Autobahn durch den großen Berg bauen wollte. Beide Nachrichten hatte ich auch am Tag zuvor gehört, ich stellte das Radio ab.
Als ich danach mit dem Sortieren meiner Bücher, die ich nach Ankara mitnehmen wollte, fortfuhr, waren die Gedanken an die Namenlose, die Fate eine Fee genannt hatte, schon ziemlich verblasst. Sie war wie ein Traum der vergangenen Nacht. In Gedanken versunken, wer mir welches Buch geschenkt hatte – ich hatte vor, nur die mir geschenkten Bücher mitzunehmen –, meinte ich zu hören, dass mein Handy im vorderen Fach meines Rucksacks vibrierte. Ich hastete hin und ertappte mich dabei, dass ich doch auf ein Zeichen der Fee gewartet hatte.
Es war Soraja. Sie foppte mich wie immer. «So Einsamer Was mchst zu dsr Std Was wühlst du in dnm dicken Schdl auf?»
Ich wusste, dass sie mir diese abgekürzten Zeilen ohne Punkt und Komma hastig auf der Toilette geschrieben hatte, in Anwesenheit ihres Mannes hätte sie nicht solch persönliche Dinge an einen anderen Mann schreiben können. Ich schrieb ihr zurück, dass ich nur in meiner Vergangenheit wühlte und die mir von der besten Frau der Welt geschenkten Bücher in den Koffer einpackte. Sie schrieb nicht mehr zurück, ein Zeichen, dass sie nicht mehr auf der Toilette war.
Soraja hatte mir zu jedem Geburtstag ein Buch geschenkt, ich zählte zwölf Stück, die in einer Reihe standen, ich hatte in jedem Buch auf die erste Seite gekritzelt: «Von ihr». Und das Datum. Ich schaute in all diese Bücher, spazierte durch meine Erinnerungen mit Soraja. Wann hatte ich sie das erste Mal gesehen? Sie stand neben ihrem Vater, der Spenden sammelte im Namen eines religiösen Hilfswerkes für die Erdbebenopfer in Istanbul. Das Datum wusste ich noch, es war der 20. August 1999: Drei Tage vorher hatte dieses apokalyptische Drama, das gegen hunderttausend Menschen das Leben kostete, sogar mich, den Soraja später als gottlos bezeichnen würde, erweicht gegenüber den Religiösen, die für mich bis anhin ein rotes Tuch waren. Ich war zu diesem Stand am Bahnhof gegangen, hatte mich vorgestellt und meine Absicht kundgetan, helfen zu wollen. Als der Vater von Soraja erklärt hatte, dass er plane, persönlich hinzureisen und das von ihm gesammelte Geld und die Waren eigenhändig einigen Bedürftigen auszuteilen, hatte ich ihm eine Spende versprochen. Und der kluge Mann erkannte meine Skepsis, sagte, dass er jede Geldübergabe fotografieren lasse, er werde schauen, dass meine Spende an eine kinderreiche Familie gelange. Als ich ihm Geld gegeben hatte, rezitierte er einen Vers, ebenso, als er mir eine Empfangsbestätigung aushändigte.
Tatsächlich hatte Soraja eine Woche später angerufen und mir im Café da Mila einige Fotos gezeigt, wie ihr Vater mit weißem Bart vor einer Hausruine Männern, die von vielen Kindern umgeben waren, mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen Geld übergab. Dort, eben in diesem Café, hatte ich zum ersten Mal das süße Parfüm einer Frau mit Kopftuch eingeatmet und erstmals auch die Gelegenheit gehabt, an einem kleinen, runden Tisch nah bei ihr zu sitzen und ein paar persönliche Worte mit ihr zu tauschen. Als sie von den Erdbebenopfern sprach, von der Trauer dort, fand ich in ihren Worten, ihren Empfindungen, ihrer Empathie auch meine eigene. Diese Frau in dem langen, grauen Mantel, der bis zu den Knöcheln reichte, begann mich zu interessieren. Als sie den Mantel auszog, überraschte mich der enge Pullover an ihrem schlanken Körper. Als hätte ich geglaubt, dass eine Frau im langen Mantel und mit einem Tuch auf dem Kopf überhaupt keinen Körper habe.
Mehr als ein Jahr lang sah ich Soraja mindestens zweimal im Monat, immer am späteren Vormittag, wenn sie sicher war, dass ihr Vater bei der Arbeit war. Erst nach dem dritten Treffen hatte sie mir die Hand gegeben, endlich ein Zeichen von Nähe. Ihre Hand war warm. Die Abende und die Wochenenden, Zeiten, in denen ihr Vater nicht bei der Arbeit war, waren tabu für ein Treffen. Und wenn ich sie sonst zufällig in irgendeiner Begleitung auf der Straße sah, begrüßte sie mich nur mit einem Kopfnicken.
Ich betrachtete die ersten Bücher, die sie mir geschenkt hatte. Sie waren verstaubt, das Papier vergilbt. Es waren religiöse Schriften, die religiöse Moral predigten, die Haditen des Propheten interpretierten oder in die Entstehung der islamischen Religion einführten. Ich hatte sie nicht gelesen, obwohl sie von Soraja, meiner großen Liebe, die ich nicht berühren durfte, kamen. Darunter war ein Buch, wie man Beten lernt, und ein anderes Buch berichtete vom Leben des Propheten Mohammed.