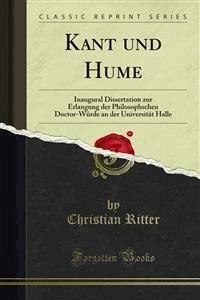Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsichtbar Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
La dolce vita, aber streng nach Zeitplan! So geht Urlaub für Deutsche. Christian Ritter, umtriebiger Humorist aus Berlin, hat seine Landsleute rund um die Welt beim Urlauben beobachtet und festgestellt: Sie können's einfach nicht. Wenn kurz nach Mitternacht der Wecker klingelt, weil die besten Plätze am Pool belegt werden wollen, wenn die Urlaubsbräune generalstabsmäßig erarbeitet wird und wenn der karibische Katamaranausflug zu Helene Fischer schunkelt, heißt es: Die Deutschen sind da! Zum Clash der Kulturen kommt es unweigerlich, sobald Improvisation, Fremdsprachen-Kenntnisse oder schlicht: Lässigkeit, gefordert sind. Dann hilft nur noch Humor seitens des Betrachters. Mit satirischer Pointiertheit und viel Selbstironie erzählt Christian Ritter seine hochkomischen Urlaubsgeschichten aus aller Welt. Als Teil eines deutsch-italienischen Haushalts macht er sich nur allzu gern selbst zur Zielscheibe des Spotts. Denn wer nicht selbst ein wenig zu deutsch ist, werfe die erste Kartoffel!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTIAN RITTER
HOFFENTLICHREGNET ESZU HAUSE
WENN DEUTSCHE URLAUB MACHEN
CHRISTIAN RITTER
(Jahrgang 1983) lebt als freischaffender Autor in Berlin und ist außerdem viel unterwegs, als ständiger Vorleser seiner eigenen Geschichten im deutschsprachigen Raum, gelegentlich auch einfach privat auf der ganzen Welt.
Er veranstaltet und moderiert Poetry Slams sowie andere Literaturveranstaltungen und ist Teil der Berliner Lesebühne »Zentralkomitee Deluxe«.
Ritter war bayerischer Meister und deutschsprachiger Vizemeister im Poetry Slam, hat zwei Romane (zuletzt »Die sanfte Entführung des Potsdamer Strumpfträgers« im Heyne-Verlag) und mit diesem Buch nun sieben Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht und bestückt außerdem seinen Podcast »Rittergeschichten« regelmäßig mit neuen Texten.
Die Arbeit an diesem Buch wurde durch ein »Neustart-Kultur«-Stipendium der VG WORT gefördert.
Lektorat: Volker Surmann
Korrektorat: Jan Freunscht
Coverfoto: Christian Ritter
Autorenfoto: Kerstin Musl
1. Auflage 2022
©opyright 2022 by Autor
eISBN: 978-3-95791-113-1
Hat dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter: [email protected]
Mehr Infos jederzeit im Web unter: www.unsichtbarverlag.de
Unsichtbar Verlag | Dieselstr. 1 | 86420 Diedorf
Die gedruckte Ausgabe dieses Buches erschien im Juni 2022 im Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin
www.satyr-verlag.de
INHALT
L’Apfelschorle
Treppensteigen und Eiersalat
Eurotrash in NYC
Mein Freund, die Frau
Gefährliches Griechenland
Entspannen nach Stechuhr
Familie Müller geht fast baden
Pastadesaster
Maria Hilf
Schiffstaufe
Von Drag Queens und Zauberern
Saunieren bei Seegang
Bus an Kopf
Kein Entkommen
Schmäh
Bäuche der Karibik
Mit der Jugend reden
Radieschen
Irische Odyssee
Der Pferdi und die Nena
Rügen auf Rügen
Sich Rügen fügen
Die andere Bubble
Balkonien und die Folgen
Ostsee oder so
Italienerwochenende
L’APFELSCHORLE
Paris. In einem Straßencafé in der Nähe des Cimetière Père Lachaise kitzeln mir Sonnenstrahlen auf der Nase. Ich wiege mich in der Musikalität des Französischen, das um mich herum an den kleinen Tischchen, beladen mit Wasserkaraffen und Weingläschen, gesprochen wird. Zurückgenommen, fast flüsternd, werden angeregt Wichtigkeiten diskutiert. Auf Französisch redet man nicht über Banalitäten, dafür ist die Sprache nicht gemacht, nur über die großen Themen, die Liebe, die Mode, die Kunst. Französische Männer in den besten Jahren tragen kurze Hosen mit einer beneidenswerten Stilsicherheit, stelle ich fest. Es liegt wohl am passenden Schuhwerk.
»Très bien, Madame, bon choix«, wird eine Vorspeisenbestellung am Nebentisch vom Kellner gelobt. Gute Wahl. Von zu Hause bin ich als direkte Reaktion auf egal welche Bestellung nur ein herzhaft gebelltes »Außerdem?« gewohnt.
Apropos Bellen: Selbst die Hunde hier kommen mir ziemlich fein vor, fast schon hochnäsig, trotz der platt gezüchteten Nasen. Sie schreiten elegant über das Trottoir, als gehöre ihnen die Stadt, und betrachten mich gleichmütig, wie ihre Herrchen und Frauchen auch. Ich lese ein paar Seiten in meinem Buch, variiere die Beinverschränkung, bestelle noch ein Getränk. Bon choix. Der Nachmittag zieht sich angenehm und lässt tief durchatmen, fast nicke ich ein.
»Ob du die Heizung ausgemacht hast daheim, hab ich gefragt.«
Ich vernehme ein lauter werdendes Störgeräusch.
»Da fahren wir vier Tage weg und die Trulla lässt die Heizung an, ich glaub’s nicht.«
Ein deutsches Touristenpaar rumpelt in Crocs und Birkenstocks heran, zeigt die blassen Beine und wenig Sinn für die Wahrung meiner Ausgeglichenheit. Sie schnauben sich an wie Pferde auf einem beschwerlichen Ausritt.
»Weißt du, was ich habe?«
»Nö!«
»Die Schnauze voll! Und Durst.«
Sie werden ja wohl nicht … doch, sie fallen in mein Café ein. Versuchen es zumindest. Es gibt Probleme.
»Rück mal den zweiten Tisch ran, der hier ist ja viel zu klein für uns zwei.«
Tischbeine rattern über historischen Stein. Die vierköpfige Familie an meinem direkten Nebentisch wirkt kurz irritiert, lässt sich aber nicht weiter in ihrer Diskussion über Sartres Spätwerk stören. Die neu Angekommenen richten sich häuslich ein und breiten die Inhalte ihrer Rucksäcke auf ihren beiden Tischen aus, Stadtplan, Mützen, Sonnenbrillenetuis, ein Pocket-Langenscheidt »Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch«, eine Kamps-Bäckertüte, aus der sofort eine Brezel gefischt wird. Wohl erst angekommen, die beiden weltgewandten Globetrotter. Ich beschließe, sie Walter und Gisela zu nennen, passt irgendwie.
»Wird man hier auch mal bedient?«, motzt Walter.
Wie gerufen schwebt der Kellner in leichtem Gang heran und erklärt etwas schnippisch, dass es nicht unbedingt üblich sei, ungefragt Umbaumaßnahmen am Mobiliar vorzunehmen, außerdem würden die Gäste normalerweise auf ihn warten, um platziert zu werden, statt sich einfach irgendwo niederzulassen, ob Madame und Monsieur noch nichts von dieser durchaus verbreiteten Etikette gehört hätten? Ebenso gehöre es sich nicht, eigene Verpflegung mitzubringen. Er bitte also darum, das eigenartige, verknotete Laugengebäck wieder wegzupacken.
»Was sagt er?«, fragt Walter brezelmampfend.
»Wahrscheinlich will er wissen, was wir trinken wollen, oder?«, schlägt Gisela vor.
»Apfelschorle, was denn sonst.«
»Apfelschorle«, wiederholt Gisela gen Kellner gerichtet. Der ist etwas überrumpelt von der ihm fremden, forschen Art und begreift nicht gleich, aus mehreren nachvollziehbaren Gründen. Gisela wählt die Taktik, auf die noch immer Verlass war, wenn man sich in der Fremde verständlich machen möchte. Das Gleiche noch mal, aber langsamer und lauter: »AP-FEL-SCHOR-LE.«
Der Kellner schaut Hilfe suchend um sich, bewahrt aber Haltung. Er könnte noch immer vom Fleck weg für die Titelseite der GQ France fotografiert werden.
»Désolé, Madame«, sagt er.
»Was will er?«, fragt Walter.
»Sie haben wohl keine Apfelschorle«, erklärt Gisela.
Im Blick des Kellners nehme ich ein gewisses Entsetzen wahr. Die eigenwillige Schuhmode scheint ihm aufgefallen zu sein.
»So ein Saftladen hier!«, empört sich Walter und haut mit der flachen Hand auf den Tisch.
Die Gespräche im direkten Umkreis des Geschehens verstummen. Auch Passanten haben Halt gemacht, um das Spektakel zu bestaunen und nötigenfalls einzugreifen. Durch die Weltgeschichte polternde deutsche Touristen sind doch immer einen kurzen, analytischen Blick wert.
»Monsieur?«, sagt der Kellner mit Nachdruck. Seine Intonation lässt keinen Zweifel daran, dass Walter nur noch ein zu lautes Wort vom lebenslangen Hausverbot entfernt ist. Der aber scheint immun für Zwischentöne. Gisela trifft ein Geistesblitz, sie greift zum Taschenwörterbuch und blättert eifrig, ganz vorne, unter A. Es wird Zeit, einzugreifen.
»Entschuldigen Sie, liebe Landsleute. Hab ich eben mitbekommen, dass Sie ein kleines Apfelschorleproblem haben?«, frage ich mit ausgesuchter Höflichkeit.
»Das kann man wohl so sagen«, knurrt Walter.
»Heute morgen war ich in einem Café, da kriegen Sie die beste Apfelschorle von ganz Paris«, schwärme ich.
»Nein!«, freut sich Gisela.
»Darf ich?«, sage ich, gehe unter den neugierigen Blicken der Zuschauenden die paar Schritte zu ihnen hinüber, breite den Stadtplan aus und beuge mich darüber. Ich lasse den Finger konzentriert kreisen und senke ihn auf eine zufällige Stelle in der Nähe des Centre Pompidou, etwa zwei Kilometer entfernt.
»Genau hier«, verkünde ich. »Das ist auch ein richtig schöner Spaziergang von hier.«
»Ich liebe schöne Spaziergänge«, sagt Gisela.
»Sie sind ein Ehrenmann«, sagt Walter.
»Wie man’s nimmt«, sage ich aus tiefstem Herzen und setze mich wieder.
Die beiden packen ihre Siebensachen zurück in die Rucksäcke und brechen auf. Auch das Publikum verschwindet. Der Kellner stellt die Tische komplett geräuschlos wieder auseinander und zeigt mir seine unendliche Dankbarkeit durch einen wahren Gefühlsausbruch, ein angedeutetes Nicken. Aus naher Ferne weht noch ein letzter Abschiedsgruß zu uns herüber: »Mensch, Walter. Ich glaub, ich hab die Heizung daheim doch ausgemacht.«
TREPPENSTEIGEN UND EIERSALAT
Als ich zum ersten Mal in New York City urlaubte, sind mir doch einige Unterschiede zum gewohnten Leben in Berlin aufgefallen. Zunächst das Offensichtliche: ziemlich viele sehr hohe Häuser. Sehr viel mehr Leute. Eine ziemlich unnatürliche Obsession, alle Gebäude und U-Bahnen auf 20 Grad unter Außentemperatur runterzukühlen. Und Eichhörnchen in Dackelgröße in öffentlichen Parks.
Aber, dachte ich, auch wenn die hier so rumprotzen, Großstadt ist Großstadt, oder? Das Mindset der Leute wird sich schon nicht so sehr von dem von zu Hause gewohnten unterscheiden, wa? Folgende Ereignisse haben mich an dieser grundnaiven Annahme zweifeln lassen:
Als in unserem Hotel beide Aufzüge ausgefallen waren, herrschte in der Lobby große Fassungs- und Ratlosigkeit – bis der Front-Desk-Manager entschied, dass die einfachste Lösung wohl die sei, nun gemeinsam mit allen Gästen auf den Techniker zu warten und gratis Leitungswasser mit einem Zitronenschnitz in Plastikbechern zu verteilen. Ich schlug vor, dass man statt des Lifts ja auch einfach das Treppenhaus benutzen könnte. Nach einem kurzen Moment des allgemeinen Wirkenlassens dieser absonderlichen Idee erntete ich großes Gelächter der versammelten Amerikaner aus den Fly-over-States.
»He wants to climb the stairs. That’s so European.«
Dem sonstigen Gemurmel entnahm ich, dass das Benutzen von Treppen, wenn eigentlich ein Aufzug vorhanden ist, bestimmt gegen irgendwelche Menschenrechte, zumindest aber mit Sicherheit gegen einen Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung verstoße.
Da die Tür zum Treppenhaus verschlossen war – es war offenbar seit Jahren nicht benutzt worden –, musste ich dem Manager wiederholt versichern, dass mein Vorschlag ernst gemeint war, ich Übung darin hätte, selbstständig über Treppen vom Erdgeschoss bis in den fünften Stock zu gelangen, und dann nur noch eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, das Hotel nicht zu verklagen, sollte mir auf dem Weg etwas zustoßen. Schon wurde ich unter großem Staunen auf eigene Faust ins Ungewisse entlassen – und erreichte doch tatsächlich wohlbehalten mein Zimmer.
Später hörte ich, dass aufgrund des zwei Stunden (!) andauernden Liftvorfalls reihenweise Zimmer storniert und Anwälte eingeschaltet wurden. So lovely.
Eine andere grundamerikanische Verhaltensweise, mit der ich wirklich überhaupt nichts anzufangen weiß, ist die aufdringliche und grundlose Freundlichkeit, die einem allerorten entgegenschlägt.
Auf offener Straße und in Bars konnte ich mich vor spontanen Komplimenten wildfremder Personen überhaupt nicht retten. In Situationen, in denen man hierzulande einander maximal knapp zunickt, weil man sich zufällig in derselben Örtlichkeit aufhält, und dann sein Portemonnaie vorsorglich ein Stück weit in die andere Richtung schiebt, weil man ja nie weiß, was der Fremde so im Schilde führt, schlägt einem zur Gesprächseröffnung dort ungewohnt offene Sympathie entgegen. »Oh wow, I like your shirt. I like your shoes. I like your smile. I like your jacket. I like your moustache.« All die dahingesagten Komplimente überforderten mich dermaßen, dass ich nichts zu antworten wusste außer »Öh, ja, thanks, ne« und nichts zu tun wusste, außer mich sehr schnell zu entfernen. Das ist Freundlichkeit in meinem Sinne.
Als Kontrast hier ein ehrliches, deutsches Kompliment, das ich kürzlich von einer Freundin bekommen habe: »Christian, weißt du, es gibt Leute, die richtig gut zuhören können. Du überhaupt nicht. Aber du kannst richtig gut Flaschen aufmachen! Und da ist es auch egal, ob es jetzt ’ne Bier-, Weinoder Sektflasche ist. Bei dir weiß man einfach immer: Die kriegst du auf.« Und das fand ich gut, weil es so persönlich und so ehrlich war.
Zurück nach Amerika: Lässt man sich nach der Komplimenteröffnung unvorsichtigerweise ein wenig auf den üblichen Smalltalk ein, wird es sehr schnell unangenehm persönlich. Nach einer Minute bekommt man Fotos von der Grandma in Michigan gezeigt (»I really love her. I love her so much. She raised fourteen kids and worked hard for all of her life …«) und wird zum Familien-Thanksgiving eingeladen.
Eine solche zwischenmenschliche Offenheit finde ich als distinguierter Europäer einfach nur unnatürlich. Im schlimmsten Fall weiß man noch nicht mal, was der andere arbeitet, auf wie vielen Quadratmetern er wohnt und wie viel Miete er zahlt – die aus deutscher Sicht zweifelsfrei wichtigsten Informationen bei einem spontanen Kennenlernen –, aber kennt schon dessen Familiengeschichte bis zurück ins 19. Jahrhundert. Das geht einfach nicht zusammen.
Beim traditionsreichen amerikanischen Shoppingkonzern Walmart gibt es den Job des Greeters, dessen einzige Aufgabe es ist, die ankommenden Kunden am Eingang zu begrüßen und ihnen einen guten Tag und guten Einkauf zu wünschen. Da werden Menschen nur dafür bezahlt, um freundlich zu anderen Menschen zu sein. Crazy!
Mit der deutschen Servicekultur ist das absolut unvereinbar. Man stelle sich nur mal vor, der Job des Begrüßers würde bei uns eingeführt werden: »Hey, willkommen bei Penny. Heute ist Framstag!« – »Halt die Fresse und geh mir aus dem Weg!«
Der Greeter würde es nicht lange machen. Und ich finde das ganz angenehm so. Denn man macht ja keine Besorgungen, um ständig von irgendwelchen Corporate-Clowns angeentertaint zu werden, sondern weil man etwas braucht. Und das unter dem größtmöglichen Verzicht auf zeitlich höchst ineffiziente Freund- und Menschlichkeit. Das ist deutsche Lebensart.
Wenn ich zum Beispiel zu Hause in Berlin-Friedrichshain in meine Stammmetzgerei in der Frankfurter Allee gehe, um mir Buletten und einen hausgemachten Eiersalat zu holen, habe ich immer irgendwie das Gefühl, die Verkäuferin durch meine bloße Anwesenheit gerade bei etwas Wichtigerem zu stören. Und das fühlt sich richtig an. Wir treffen uns regelmäßig alle paar Tage, aber etwas anderes als pure Feindseligkeit ihrerseits ist mir noch nie entgegengeschlagen. Ein freundliches Lächeln in ihrem Gesicht erschiene mir geradezu grotesk und fratzenhaft und entspräche überhaupt nicht ihrer äußeren und inneren Persönlichkeit. Wenn sie mich fragen würde, wie es mir heute geht, oder mir ein Kompliment für meine Jacke machen würde, würde ich für alle Zeit die Metzgerei wechseln. Ich verlasse ihren Laden nie, ohne mich von ihr demütigen und anschnauzen zu lassen, weil: »Dis hätten Se sich auch vorher überlejen können, dass Se noch wat von der Wurst wollen. Jetzt muss ick da wieder rüberloofen.« Einen Meter. »Noch wat?« – »Nee, heute nix mehr.«
Deshalb hab ich es noch nie fertiggebracht, bei ihr alles zu kaufen, was ich auf der Liste hatte. Aus purer Angst.
Dennoch fühle ich mich bei ihr richtig geborgen, denn sie verkauft einfach den besten Eiersalat – und spielt mir nicht vor, sich sonst irgendwie für mich zu interessieren. Das ist Heimat. Und auch sie würde, wenn im Hotel der Lift ausfällt, einfach mal die Treppen nehmen.
EUROTRASH IN NYC
Es ist zu kalt im Stonewall Inn. Nachdem ich schon Dutzende Christopher-Street-Day-Paraden in mehreren Ländern besucht hatte, um das selbstverständliche, freizügige Regenbogenleben zu feiern und zu bewerben, war es nur ein logischer Schluss – wenn man schon mal in New York unterwegs ist –, sich auch den Ursprung all dessen anzuschauen, die Christopher Street. Quasi ein historischer Ausflug. Wer weiß, wo wir akzeptanzmäßig stünden in der westlichen Welt, hätten nicht schon 1969 schwule, lesbische und trans Menschen genau dort, im und um das Stonewall Inn, 53 Christopher Street, New York City, den Aufstand entfacht und unter dem Schlachtruf »Gay Power!« für ihre Rechte gekämpft. Nun steh ich da. Und friere. Die überlebensgroße Geschichte der Bar zurrt sich zusammen auf eine bedeutend zu kalt eingestellte, ratternde Klimaanlage. Gänsehaut! Die anwesende Gay Power besteht aus fünf müden Typen um die sechzig und in Jeansjacken, die die Barhocker vor der Theke besetzt haben, der Rest der Bar ist leer, der mit rotem Tuch bezogene Billardtisch verwaist, der Barkeeper zieht am Zapfhahn, ohne hinzusehen. Ich hatte Flair und Flamboyanz erwartet, es gibt Bier aus Plastikbechern. Da wenigstens auf den Kapitalismus Verlass ist, gibt es aber auch Merchandise-Produkte, also nehme ich zum ersten Bier auch gleich einen Hoodie dazu, in Regenbogenfarben. Die Gänsehaut legt sich, es wird heimelig, ein Barhocker ist noch frei für mich.
»Wanna have some fun?«, fragt der Typ neben mir, und bevor ich auf falsche Gedanken kommen kann, ergänzt er, dass er gern Billard spielen würde. Erst nach dem Anstoß fragt er, woher ich denn käme, und lässt mich wissen, dass er auch schon mal in Europa war, auf dem Oktoberfest nämlich. Wir kreieren eine emotionale Verbindung dadurch, dass uns beiden schon einmal auf einer Wiesn-Bierbank tanzend in den Nacken gekotzt wurde.
»Happens a lot«, erkläre ich und versenke aus Versehen die schwarze Acht.
»Where is everyone?«, traue ich mich im Lauf der dritten Partie zu fragen und versuche, dabei nicht vorwurfsvoll zu klingen. Die Anwesenden können ja nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass andere nicht anwesend sind.
»Europarty«, bellt mein neuer Freund, guckt kurz um sich und findet, was er gesucht hat. Er wirft einen Flyer auf den Tisch, der seine Aussage bestätigt. EUROPARTY, steht da, das tagesaktuelle Datum und die Adresse einer anderen Bar ein Stück die Straße runter. Das sei genau das Richtige für mich, schließt er an, er ließe mich aber erst gehen, sobald die nächste Partie entschieden sei. Der Vorschlag findet meine Zustimmung, immerhin spielen wir mittlerweile um einige Dollar Einsatz.
Was hat man sich wohl unter einer Europarty vorzustellen? Ich bin ratlos. Auf dem kurzen Fußweg male ich mir die Möglichkeiten aus. So ziemlich jede Party in meinem Leben war eine Europarty, schon geografisch bedingt. Das Spektrum ist weit, von der Geburtstagsparty mit Papierhütchen auf dem Kopf bis zum Technofestival auf verschlammtem Ackerboden, ist alles in Europa passiert. Der Ansatz bringt mich nicht weiter. Was stellt sich der New Yorker unter »Europa« vor, ist die bessere Frage. Mir wurde in den letzten Tagen öfter mit Stolz berichtet, dass meine Gegenüber auch schon mal eine »Tour through Europe« gemacht hätten, und meistens, wie vorhin erst bestätigt, hatten diese Touren über einen ganzen Kontinent die Stationen Rom, Paris und Oktoberfest. Wenn man noch einen Tag dranhängen wollte, vielleicht noch eine flotte Führung durchs Schloss Neuschwanstein zum Ausnüchtern. Zack fertig, Europa gesehen. Was würde mich also gleich erwarten auf der Europarty, wie tief wird in die Klischeekiste gegriffen werden? Baskenmützenträger mit unter die Arme geklemmten Baguettes? Karl-Heinze, die Bratwurst essen? Würde im schwulen Kontext Sinn machen, immerhin sind jeweils Phallussymbole im Spiel. Oder wird es doch eher nach dem antiken griechischen oder römisch dekadenten Vorbild in die Orgienrichtung gehen? Wäre mir auch nicht unrecht.
Als ich die Ausweiskontrolle beim Türsteher erfolgreich absolviert und den Laden betreten habe, haue ich mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ja gut, da hätte man drauf kommen können. Woran denkt man denn weltweit, wenn man Schwule, Party und Europa kombiniert? An den Eurovision Song Contest. Die Europarty ist eine Karaokeparty, bei der zu ESC-Beiträgen, gezeigt rundherum auf zwanzig an den Wänden befestigten Monitoren, immer einer auf der Bühne steht und singt, inklusive Windmaschine. Wenn das heute die angesagteste Party der angesagtesten Metropole der Welt ist, brauche ich dringend noch ein Getränk. Die Performances und die Kostümierungen sind aber nicht von schlechten Eltern, das muss ich schon zugeben, im Moment wird Conchita Wursts Siegesbeitrag von 2014 von einem Holzfällertyp mit üppigem Bart und blonder Zopfperücke interpretiert. Rise like a Phoenix! Schon wieder Gänsehaut. Ich bin an der Theke angekommen und finde nach etwas Dollarscheinwedeln die Aufmerksamkeit des Barkeepers.
In New York ist alles möglich. Außer einen Weißwein zu bekommen.
»You really want a white whine?«, fragt er zum dritten Mal.
Mit Blick auf die Alternativen – Bier aus Plastikbechern – wiederhole ich, dass das schon sehr nett wäre von ihm, würde er mir einen Weißwein geben können, ja.
»Are you really sure?«, fragt er.
Ich nicke, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher und komme ins Grübeln darüber, ob ich vielleicht irgendwas verpasst habe und Weißweingenuss hier neuerdings illegal ist. Kann ja mal vorkommen, so eine spontane Prohibition im Land of the Free. Der Barmann veranstaltet einen solchen Zirkus darum, als hätte ich ihn nach einer Heroinspritze gefragt.
»Really, really sure?«, fragt er.
»Yes, Sir«, antworte ich mit durstigem Nachdruck.
»White wine is over there«, raunt er und deutet neben sich an die Wand.
Die Tür neben der Theke ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, da sie in die Wand eingelassen und auch wie die Wand tapeziert ist, mit unscheinbarem, angeschraubtem Griff. Ich greife zu.