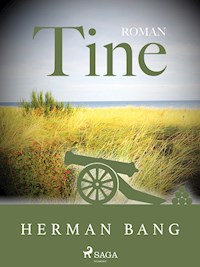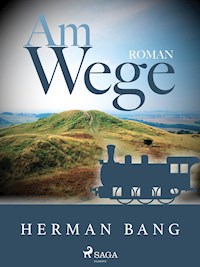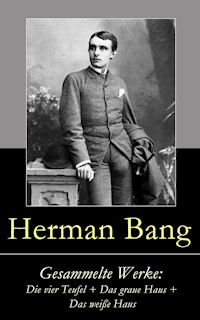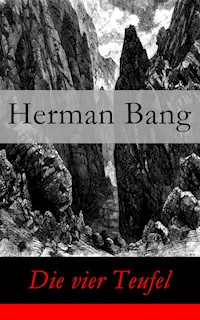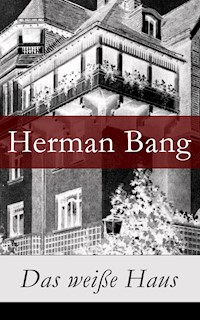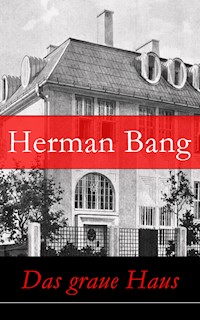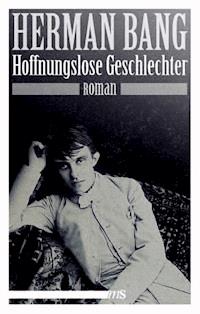
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herman Bang (1857-1912) schrieb seinen Debutroman im Alter von 23 Jahren, und sowohl sein Held William Hög als auch dessen dekadenter Freund Bernhard Hoff tragen autobiografische Züge. William, ein "sehr dunkler Junge, fast wie ein Zigeuner", ist der letzte Spross einer alten, berühmten Familie, doch schon sein Vater hatte durch sinnliche Ausschweifungen seine Gesundheit ruiniert und war früh in Wahnsinn und Drogensucht gestorben. Als William erkennt, dass ihm ein bürgerliches Leben nicht gelingt, ermutigt ihn Hoff, das künstlerische Schattenreich als Rückzugsort zu wählen. Damit ist William der literarische Ahnherr von Thomas Manns Hanno Buddenbrook und auch von Heinrich Manns Professor Unrat. Bangs Zeitgenossen empfanden bereits die realistische Darstellung gesellschaftlichen Verfalls als Provokation, aber mehr noch die mitschwingende Behauptung von Unausweichlichkeit. Denn wie sagt der Dorfarzt: "Diese Linie ist fertig." Dass William Hög eine Liebesaffäre mit der ehemaligen Geliebten seines Vaters beginnt, lieferte den Vorwand für ein Verbot des Romans. Wie fünfzehn Jahre später im Prozess gegen Oscar Wilde war es auch hier wohl nur das Wissen um die Homosexualität des Autors, das den harmlosen Schilderungen ihre unmoralischen Interpretationen hinzufügte. In Deutschland erschien 1900 die Übersetzung der gekürzten und überarbeiteten 2. Auflage des Romans, nachdem Bang hierzulande durch den Roman "Am Wege" schlagartig bekannt und beliebt geworden war. Mit dieser Neuübersetzung der ungekürzten Erstfassung legen wir Bangs Debut nun erstmals vollständig in deutscher Sprache vor. Bangs letzter, in deutscher Sprache seit langem vergriffener Roman "Michael" erschien 2012 in der Bibliothek rosa Winkel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
HERMAN BANG
HOFFNUNGSLOSE GESCHLECHTER
Roman Aus dem Dänischen von Gabriele Haefs Mit einem Nachwort von Claudia Gremler
Männerschwarm Verlag Hamburg 2013
Der Romanautor muss wissen, dass er kein Recht hat, seine Zeit zu verleumden, wohl aber das Recht, sie zu malen, sonst hat er gar kein Recht … Man wird hier nur die Wahrheit über Charakter und Schicksal eines Mannes finden, die für mich den besten Ausdruck für den Geist seiner Zeit und seines Landes zu geben scheint …
Octave Feuillet: Monsieur de Camors
Was ich auf diesen Blättern erzählen möchte, sind Bruchstücke einer Lebensgeschichte. Und ich will dieses Leben erzählen, wie es gelebt worden ist, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, und ohne mir Sorgen zu machen, wie weit das, was ich erzähle, verstanden wird oder nicht, oder ob es Weinen oder Lachen auslöst.
Was ich meine, lässt sich kurz sagen:
William Høgs Leben erscheint mir als Warnung gelebt worden zu sein, und deshalb habe ich den Lebenslauf dieses Unschuldigen aufgeschrieben.
ERSTES BUCH «WIE MAN SÄT …»
PROLOG
Es war ein altes Geschlecht, sehr alt, altersgrau geworden im Land. Aus dem Stammbaum ging hervor, dass es einst Zweige auf Fünen und in Seeland gegeben hatte, doch das war nun lange her, und in den letzten beiden Jahrhunderten war es mit der Größe abwärtsgegangen. Dass sie von Adel waren, war in Vergessenheit geraten, und der Ruhm war mit dem Adelstitel ins Grab gesunken. Die Familie lebte unauffällig, einige trieben Handel, andere ein Handwerk, es gab zwar auch ab und zu studierte Menschen bei ihnen, denn es war ein weit verbreitetes Geschlecht, aber nichts ragte heraus, alles war recht mittelmäßig und unscheinbar. Die meisten hatten ihre berühmte Herkunft wohl sogar vergessen.
Aber gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts kam ein einzelner Zweig des Geschlechts wieder zu Kräften. Manche Familien ließen ihren Adelstitel per reskript erneuern; andere begnügten sich damit, sich durch Taten zu verjüngen. Diese zeichneten sich in der Juristerei aus: Ihre Mitglieder schwangen sich zu den höchsten Ämtern auf, wohlklingende Titel und Orden aus aller Herren Länder wurden abermals Attribute ihres Namens. Sie waren strenge, willensstarke Männer, die arbeiten konnten und die wussten, was sie wollten. Sie verdankten ihr Glück ihrem eisernen Fleiß und ihrem starken Verstand.
Aber mit dieser Tüchtigkeit, auf gleichem Fuße mit dem angestrengten Fleiß, ging in der gesamten Verwandtschaft eine gewisse Exzentrizität Hand in Hand, ein Hang zur Übertreibung in allem, und das zeigte sich auf unterschiedliche Weise. Der Erneuerer des Geschlechts war ein eifriger Pietist, er verfasste fromme Bücher und züchtigte seinen Leib auf vielerlei Weise. Seine Frau war leichtsinnig und launenhaft, sie beschenkte andere und bestahl ihren Mann, um diese Leidenschaft zu befriedigen. Während der täglichen Hausandacht lachte sie mit ihren Kindern, als wäre sie selbst ein Kind, und bewarf die Dienstboten mit Papierkügelchen. Zudem schrieb sie Verse, in denen es zumeist um Hirten und anmutige Hirtinnen mit lockeren Sitten ging. Ihr Handeln wurde stets von ihren Leidenschaften geleitet.
Das waren die Stammeltern.
Ihre Tochter bereitete ihnen offenbar mancherlei Kummer. Was sich wirklich zugetragen hatte, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass die junge Dame das war, was man im Allgemeinen «von lockeren Sitten» nennt. Sie wurde von einem adligen Offizier verführt und von ihrem Vater verstoßen, aber ihre Mutter unterstützte sie offenbar – die beiden heirateten dann später –, bis sie in der Dunkelheit verschwanden.
Der Sohn trat in die Fußstapfen des Vaters und brachte es ebenso weit. Er besaß den eisernen Fleiß seines Vaters, dessen raschen Blick und dessen Begabung. Er arbeitete zudem mit größerer Perspektive in einer jüngeren Zeit. Redlich trat er in die Reihe der starken Männer, die das vergangene Jahrhundert vom Anfang bis zur Mitte hin so sehr prägten. Von seiner Mutter hatte er eine große Unruhe geerbt, er musste immer beschäftigt sein, er vergrub sich in Arbeit. In seinen Mußestunden schrieb er Verse; sie waren nicht gut, und obwohl ein Minister unter Kristian VIII. viel zu tun hatte, verfasste er so viele davon, dass er sie in Wäschekörben verstecken musste. Er hatte aber noch mehr von seiner Mutter geerbt: Er war ebenso freigebig wie sie und ebenso heftig. Außerdem war er ein eitler Mann, der das öffentliche Aufsehen genoss.
Das Familienwappen wurde auf alle Kutschenpolster gestickt, er ließ Ordnung in seinen Stammbaum bringen und knüpfte Kontakte zum neuen Adel, um seine Familie zu erheben. Seine Frau unterstützte ihn bei diesen Bestrebungen. Er hatte sie spät, als angesehener Mann, geheiratet, und die Leute fragten sich, ob die schöne Frau den Mann oder den Namen und dessen Zukunft begehrenswert fand. Dennoch war die Ehe glücklich; er überschüttete sie mit einem damals fast unbekannten Luxus und ließ sie in Schmuckstücken, Seidenkleidern und Gedichten schwelgen. Das war seine Freude. Die Gattin nahm alles mit großer Gelassenheit entgegen und versuchte nur, die Unruhe Seiner Exzellenz zu dämpfen. Sie lebte in der Hoffnung auf eine strahlende Zukunft für ihre Kinder, fürchtete jedoch, die Exzentrizität ihres Mannes könne alles ruinieren. Sie weinte einen ganzen Tag, als der Minister einmal in Gedanken verloren mitten in einem Bericht für den Staatsrat plötzlich ein Gedicht geschrieben hatte. Aber als Seine Majestät diese Episode so witzig fand, dass er den Verseschmied mit dem Großkreuz belohnte, war die Gattin besänftigt.
Das Familienwappen wurde auf alle Kutschenpolster gestickt, er ließ Ordnung in seinen Stammbaum bringen und knüpfte Kontakte zum neuen Adel, um seine Familie zu erheben. Seine Frau unterstützte ihn bei diesen Bestrebungen. Er hatte sie spät, als angesehener Mann, geheiratet, und die Leute fragten sich, ob die schöne Frau den Mann oder den Namen und dessen Zukunft begehrenswert fand. Dennoch war die Ehe glücklich; er überschüttete sie mit einem damals fast unbekannten Luxus und ließ sie in Schmuckstücken, Seidenkleidern und Gedichten schwelgen. Das war seine Freude. Die Gattin nahm alles mit großer Gelassenheit entgegen und versuchte nur, die Unruhe Seiner Exzellenz zu dämpfen. Sie lebte in der Hoffnung auf eine strahlende Zukunft für ihre Kinder, fürchtete jedoch, die Exzentrizität ihres Mannes könne alles ruinieren. Sie weinte einen ganzen Tag, als der Minister einmal in Gedanken verloren mitten in einem Bericht für den Staatsrat plötzlich ein Gedicht geschrieben hatte. Aber als Seine Majestät diese Episode so witzig fand, dass er den Verseschmied mit dem Großkreuz belohnte, war die Gattin besänftigt.
Von ihren Kindern war Ludvig, der älteste Sohn, der Liebling des Vaters. Er verfügte ebenfalls über hervorragende Begabungen und viel von der Eleganz, die ererbte Vornehmheit schenkt. Man sah sofort, dass dieser junge Mann von sechzehn Jahren es auch mit einem geringen Fundus an Tüchtigkeit und Tatkraft weit bringen würde. Andere hatten bereits die Fundamente gelegt, auf denen er aufbauen konnte. Aber es zeigte sich alsbald, dass Ludvig das Schicksal vieler Söhne großer Männer teilte – er war überaus schwächlich, nervös, schon früh sehr melancholisch. Mit ihm hatte die Familiengeschichte ein neues Stadium erreicht.
Die Kraft war verschwunden. Die Gehirne waren nicht mehr so stark. Die Exzentrik hatte überhandgenommen. Ludvig wusste nichts von der gesunden Mitte, er übertrieb alles; zugleich war er noch unruhiger und gehetzter als sein Vater, und er hatte keine bedeutende Arbeit als Bollwerk gegen seine Laster.
Der Vater wollte das alles nicht sehen: Die Begabungen des Sohnes – er schrieb Verse, die um einiges schöner waren als die der Exzellenz, er war sprachbegabt, er sang außerordentlich schön, und niemand konnte seine Vollblutpferde eleganter lenken als er – blendeten ihn; und er ließ ihn lange nach Belieben schalten und walten. Seine große Eitelkeit verleitete ihn zudem dazu, Ludvig noch mehr als üblich mit Geschenken zu überschütten, seine Mittel erlaubten es ihm, ihn in Gesellschaft blendend auftreten zu lassen.
Der Sohn reiste viel, nahm zu Hause an allem teil, was vornehme Muße an Zerstreuung zu bieten hatte, machte Schulden, die von der Exzellenz ohne Murren beglichen wurden, dilettierte in vielen Bereichen und war frühzeitig in vielerlei Hinsicht am Ende. Er wurde immer nervöser und immer leidender – seine Melancholie war beunruhigend, und die Munterkeit, die sie bisweilen ablöste, war ängstlich und überspannt. Man fragte sich bereits, was aus Ludvig Høg einmal werden sollte, und bedauerte seinen Vater.
Eines Tages rief Seine Exzellenz den Sohn in sein Arbeitszimmer, und dort wurde sehr laut und lange geredet. Die Gattin hörte, wie die Stimme ihres Mannes heiser aufschrie, darauf folgte ein heftiges, lange anhaltendes Heulen.
Es war im Herbst, als das geschah.
Den ganzen Winter hindurch studierte Ludvig daraufhin wie ein Besessener, er schlief nur drei Stunden pro Tag und hielt sich wach, indem er Sherry trank und die Füße in Eiswasser stellte. In ihm steckte durchaus etwas vom Arbeitseifer seines Geschlechts, nur fehlte ihm dessen physische Stärke. Der plötzliche übertriebene Fleiß richtete ihn vollends zugrunde, seine Gesundheit wurde unwiderruflich untergraben und seine Fähigkeiten beträchtlich geschwächt.
Dennoch bestand er im Sommer seine juristischen Examen mit den besten Noten, und Exzellenz waren zufrieden. Jetzt sollte der Sohn sich erst einmal erholen, nach seiner Rückkehr könnte dann etwas für ihn getan werden. Ludvig fuhr nach Paris.
Außer Ludvig gab es noch zwei Söhne, der eine war recht begabt, der andere wurde Bauer.
Begabung, Kraft und eiserner Fleiß wurden im Geschlecht der Høgs schwächer und schwächer, und die Exzentrik wuchs, die Launen, die mit der Verse schreibenden Stammmutter in die Familie gekommen waren, die Übertreibung, aus der heraus der Stammvater einer der eifrigsten Pietisten seiner Zeit geworden war. Weder Ludvig noch seine Brüder brachten es sonderlich weit. Sie alle hatten zu schnell gelebt und waren ohne Energie, sie lebten als Söhne reicher Eltern und verlegten sich in ihrer Jugend auf einen substanzlosen Dilettantismus, wie es in geschwächten Familien oft der Fall ist. Die Familie Høg hatte sich verausgabt, und ihre Kinder waren von der Verausgabung gezeichnet.
Die Kraftlosigkeit des Geschlechts wurde vom damaligen Zeitgeist noch gesteigert.
Ludvigs Jugend fiel mit dem Ende des ästhetischen Zeitalters in Dänemark zusammen. Die große Arbeit war getan, die großen Werke waren geschrieben, man ruhte sich aus, wiegte sich voll Wohlbehagen in Hegel’scher Fantasterei und hochtönender poetischer Empfindsamkeit. Die Politik erwachte … man sprach von Freiheit, von Gleichheit und von Tyrannei. Alles gerann damals zu Ideen, Vaterland, Freiheit, Verfassung, alles, und deshalb geriet alles so leicht durcheinander, Ideen, die der Wirklichkeit vorgezogen werden, sind stumpfe Waffen, mit denen selbst Kinder spielen können; es ist schon gefährlicher, mit Realitäten Scherze zu treiben.
Dann kam das Jahr achtundvierzig. Das Jahr der Tat. Man sah, dass im Volk Kräfte hinter den Worten lauerten, aber man riss sich zusammen. Wer sich beim Volk einschmeicheln wollte, nahm die Ereignisse dieses Jahres als Anfang, als Eintritt in die neue Zeit, aber vielleicht war es eher der Abschluss einer alten, die Frucht der nationalen Erweckung zu Beginn des Hundertjahres und der Zähigkeit, die die Notzeiten uns damals gelehrt hatten. Aber das soll die Geschichte beurteilen, die nicht von Söhnen geschrieben wird, die unter den Irrungen ihrer Väter gelitten haben.
Der Krieg des Jahres achtundvierzig1 war eine Tat, die das Volk zumindest für einige Zeit zusammenhielt. Wer dieses Volk erschaffen haben mag, das bei Isted kämpfte – das sei dahingestellt, wie auch die Frage, wer den Geist erschaffen hat, der sich nach ’64 ausbreitete … die Geschichte wird ihr Urteil fällen.
Ludvig meldete sich freiwillig. Seine Begeisterung loderte auf, und er zog los. Drei Tage lang hätte er gern sein Leben für das Vaterland gegeben, aber die Tage wurden zu Wochen, die Wochen zu Monaten, ohne dass er Pulver gerochen hätte. Folglich erkaltete seine Begeisterung, die ihn befähigt hätte, ohne Klage in den Tod zu gehen, die jedoch nicht die Strapazen des eintönigen Exerzierens ertrug. Er wurde krank und ließ sich den Abschied geben.
Zwei Jahre verstrichen. Der Minister nahm seinen Abschied und wurde Stiftsamtmann. Ludvig wollte sich nicht auf ein Amt bewerben, er ging auf Badereisen, irrte sommers wie winters ruhelos durch Europa. Sein Vater wartete. Der zweitälteste Sohn war inzwischen Bürgermeister in einer kleinen Stadt in Seeland geworden, und der Bauer hatte einen Hof bekommen, der mehr Geld verbrauchte, als er erwirtschaftete.
Eines Sommers zu Beginn der fünfziger Jahre beschloss Ludvig, im Lande zu bleiben und sich bei seinem Bruder, dem Bürgermeister in S., niederzulassen. Vielleicht hatte er das Reisen satt, vielleicht gab es finanzielle Gründe, die ihn zum Daheimbleiben zwangen, denn der Vater verlangte, dass er sich eine Stellung suchte, und unterstützte ihn nicht mehr so reichlich wie zuvor.
Ludvig langweilte sich in S. Die Gesellschaft der kleinen Provinzstadt konnte ihn nicht befriedigen, und er hatte keine Beschäftigung, die seine Zeit hätte in Anspruch nehmen können. Unter diesen Umständen nutzte er seine freien Stunden, um sich zu verlieben. Das Objekt seiner Verliebtheit war eine junge Dame aus der Umgebung, sehr lebhaft, sehr hübsch und sehr jung. Sie hatten sich bei morgendlichen Ausritten im Wald kennengelernt und nur wenig miteinander gesprochen. Stella war achtzehn Jahre alt, unerfahren und verwöhnt. Der fünfunddreißig Jahre alte Høg war der eleganteste Mann, den sie je gesehen hatte, er war gerade Dichter genug, um seine Liebe im glänzenden Rahmen formvollendeter, wirklich schöner Verse zu präsentieren, und seine Vergangenheit war geheimnisvoll genug, um mit der Macht des Unbekannten, aber Erahnten zu locken.
Als er um sie anhielt, sagte Stella Ja.
Es wurde viel über diese Verbindung geredet, sogar mehr als sonst üblich. Die meisten bezeichneten es als Mesalliance und bedauerten Seine Exzellenz, der keine «richtige» Freude an seinen Kindern habe. Auch Stella wurde bedauert: Er war so viel älter als sie und verfügte wohl nicht mehr über sonderlich große Kräfte, sie war dagegen so jung und munter. Aber sie würde ja in eine vornehme Familie einheiraten.
Der alte Arzt in S. war überaus unzufrieden. «Das ist eine schmutzige Geschichte», sagte er an einem Dienstag am L’hombre- Tisch des Pastors. «Schmutzige Geschichte … jemand wie Høg dürfte nicht heiraten. Diese Linie ist fertig, die Kraft ist verbraucht. Er hat die Veranlagung zur Melancholie, die anderen sind nüchtern und träge, sowohl der Bürgermeister als auch der Bauer. Ja, das ist wirklich traurig.» Dr. Hermansen setzte sich in seinem Sessel zurecht und rückte die Brille gerade. «Und wenn er schon unbedingt heiraten muss, dann hätte er sich ein Melkmädchen nehmen sollen, damit dickes Blut in die Familie kommt.» Die anderen lachten. «Ja, so sehe ich das eben. – Für Stella ist es eine Sünde und Schande. Die hätte einen strammen Burschen gebraucht. In der Familie der Mutter gibt es die Veranlagung zur Brustkrankheit. Das kann eine schöne Geschichte geben, wenn diese beiden Schwächen aufeinandertreffen. … Hoffentlich bekommt der Kavalier keine Kinder, damit das hier der letzte Akt bleibt … sonst möge Gott den Sprösslingen gnädig sein.»
Und Dr. Hermansen rückte abermals die Brille gerade und machte ein bedenkliches Gesicht.
Die Exzellenz empfing die Schwiegertochter, ohne mit der Wimper zu zucken; seine Gattin konnte sich nicht ganz so gut beherrschen, aber Ludvig ließ sich nicht beirren; im Herbst bekam er eine Stelle, und im November wurde Hochzeit gefeiert. Es war das Jahr ’52.
In einer nach so kurzer Bekanntschaft geschlossenen Ehe besteht immer die Gefahr von Irrtümern. Stella hatte vielleicht, als sie Frau Høg wurde, nicht so recht gewusst, was sie da tat – vielleicht fehlte ihr etwas, eine gewisse Glut, eine starke Hingabe, vielleicht auch Kraft. Aber sie war sehr jung und sehr jugendlich, wusste wenig von der Welt und noch weniger von der Liebe. Anfangs glaubte sie wohl, alles sei, wie es sein sollte, und als sie dann langsam feststellte, dass das nicht der Fall war, war dieses Leben ihr schon zur Gewohnheit geworden.
Ludvig glaubte, ein Kind geheiratet zu haben. Er gab ihr alles, was er zu geben hatte, aber was er hatte, waren nur Reste. Ihm und anderen wurde immer deutlicher, dass er zerstört war, dass sein Leben an der Wurzel zerfressen war; er wurde überaus melancholisch, und wenn er doch einmal munter war, äußerte seine gute Laune sich in beißenden Sarkasmen, mit denen er andere geißelte. Er und Stella waren so verschieden wie Tag und Nacht.
In den ersten beiden Jahren ihrer Ehe spielte Stella noch mit Puppen, oder sie spielte Høg eine Komödie vor. Sie besaß eine lebhafte Fantasie, schmückte sich zu gern mit Schleiern und Blumen und spielte «Opern» auf dem Klavier. Eine solche Oper war eine wilde Mischung von Melodien, zu der sie beim Spielen Worte ersann.
Manchmal am Abend, wenn Høg zu Hause war – tagsüber war er entweder unterwegs oder in seinem Zimmer beschäftigt –, verkleidete sie sich als Nonne und führte lange selbst erdachte Szenen auf, in denen sie vorgab, ihr grausamer Vater habe die Unglückliche zum Eintritt ins Kloster gezwungen und sie von ihrem treuen Geliebten getrennt; sie zog ihr Brautkleid an und tanzte Menuett, oder sie spielte Kirche. Eines Abends kam sie herein und sagte, sie wolle ihn überraschen und er dürfe erst ins Zimmer kommen, wenn das Stubenmädchen ihn riefe.
Als Ludvig danach Stellas Boudoir betrat, waren alle Wände mit Laken verhängt, und Stella lag mit weißem Gesicht in einem riesigen, mit Trauerflor behängten und mit Laken überdeckten Holzkasten mitten im Zimmer. Sie trug ihr weißes Kleid und einen Myrtenkranz über dem Schleier. Ludvig war unangenehm berührt. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn, und er brach in heftiges Zittern aus. Dann riss er Stella überaus grob und unsanft aus dem Kasten. Sie aber lachte übermütig und sagte, sie sei Julia in der Grabkammer.
Am liebsten wollte sie vorlesen. Sie bat Ludvig, mit ihr zu lesen, und wenn er dazu bereit war, saßen sie oft bis in die Nacht hinein bei der Lektüre. Sie hatte eine schöne Stimme und las wunderbar sanft, bisweilen war er davon wirklich hingerissen und verlor sich in Lobesworten. Sie lachte nur. «Ja», sagte sie. «Ich bin eben nicht zur Beamtenfrau geboren.»
So lebten sie anfangs. Als Stella dann älter wurde, erkannte sie langsam, aber sicher, dass ihre Ehe eine ziemlich ungleiche Verbindung war, dass er alt war und sie jung, und das, was er gab und womit sie sich zufriedengeben musste, nur eine apathische Freundschaft war, gewürzt mit einer fieberhaften und kurzen Verliebtheit. Aber sie verlor nicht den Mut, immer war sie munter, lebhaft, beredt. Sie war der Mittelpunkt in der Geselligkeit des ganzen Bezirks und im Umkreis von dreißig Kilometern bei jeder Gesellschaft unentbehrlich. Was Ludvig betraf, so war er recht zufrieden, er wurde vom Temperament seiner Gattin mitgerissen, sie wurden beide in der Gesellschaft gefeiert, und ihr Haus war das schönste weit und breit.
Die Exzellenz besucht sie jedes Jahr und war von der Schwiegertochter überaus eingenommen.
Diese war jetzt zweiundzwanzig Jahre alt. Sie waren bereits seit drei Jahren verheiratet, und es schien, als solle der alte Arzt in S. mit seinen Hoffnungen recht behalten.
Gegen Ende des dritten Ehejahres kam es zu einem Zwischenfall, den man nicht gänzlich verschweigen kann. Stella verliebte sich; ihr Geliebter war ein Freund ihres einzigen Bruders und ungefähr in ihrem Alter, kräftig, gut aussehend und bis über beide Ohren verliebt. Niemand weiß, was dann geschah, aber eines schönen Tages reiste Ludvig Høg mit seiner Frau ins Ausland. Über diese plötzliche Reise wurde in der Gegend viel geredet, dann wurde sie wieder vergessen.
Nach ihrer Heimkehr ging Stella etwas weniger aus als zuvor, das lag an ihrem gesundheitlichen Zustand; sie hustete viel, und der Arzt fürchtete, ihre Brust könne angegriffen sein.
Ein Jahr darauf wurde sie Mutter. Das Kind wurde nach der gnädigen Frau Stiftsamtmännin Nina getauft, denn diese hatte sie über die Taufe gehalten. Stella war sehr glücklich, sie spielte mit dem Kind wie mit einer Puppe, stillte es selbst. Sie wurde mit der Heiligen Jungfrau verglichen – Nina wurde also zum Jesuskind. Als Nina älter wurde, putzte Stella sie heraus wie eine französische Bébépuppe, war immer bei ihr und wachte fast eifersüchtig darüber, dass niemand anders Anteil an dieser Liebe nahm.
Høg kümmerte sich nicht sonderlich um das Kind. Seit der Reise litt er dauernd an Kopfschmerzen und Nervengicht, und nachts redete er mit Geistern.
Zwei Jahre darauf war Stella abermals guter Hoffnung. Während dieser Schwangerschaft verhielt sie sich auf seltsame Weise, sie konnte den Anblick ihres Mannes kaum ertragen, sie wollte wochenlang niemanden empfangen und schloss sich in einem dunklen Zimmer ein, wo sie die Tage in einem Schaukelstuhl verbrachte; dann wiederum hetzte sie von einer Gesellschaft zur anderen, von Ball zu Ball in der Umgebung, sie arrangierte im fünften Monat ihrer Schwangerschaft eine dramatische Abendunterhaltung, und immer wieder aß sie Dinge, die Hitze auslösen: Im siebten Monat musste der Arzt ihr das Tanzen verbieten.
Die Geburt des Kindes dauerte einen ganzen Tag. Der Arzt meinte, Stella habe sich während der Schwangerschaft zu stark geschnürt.
Als der Junge endlich geboren war, hielt die Hebamme ihn für blind, er wog nur fünf Pfund und wurde sofort in ein Kräuterbad gelegt, danach wickelten sie ihn in Watte. Am dritten Tag wurde der Kleine für tot gehalten. Der Hausarzt tunkte ihn in Eiswasser, und er erwachte wieder zum Leben.
Stella erholte sich nur sehr langsam.
Vom ersten Tag an brachte sie dem Jungen eine fast fieberhafte Zuneigung entgegen, und in der Taufe erhielt er ihren Lieblingsnamen, William.
Die Zeit verging, und drei Jahre später kam Stella ein weiteres Mal nieder, diesmal mit einer Tochter.
Im selben Jahr, im Herbst, verstarb die Exzellenz als Ritter des Elefantenordens. Er starb so energisch, wie er gelebt hatte. – Die Pflegerin saß an seinem Bett und fühlte ihm den Puls. Die Exzellenz schaute auf die Uhr über dem Bett, dann fragte er: «Er wird schwächer?» – «Ja, Eure Exzellenz.» Abermals Schweigen. Vor dem Bett die Pflegerin, kniend, bewegungslos. Die Exzellenz ruhig, leichenblass, mit geschlossenen Augen. Dann dieselbe Frage und dieselbe Antwort.
«Ja, Eure Exzellenz.» Die Wörter fielen wie eine Handvoll Erde auf einen Sargdeckel. Dann wieder Stille.
«Schwächer?»
«Ja, Eure Exzellenz.» –––
Im Nebenzimmer standen Ludvig, Stella und der Bürgermeister. Ludvig stützte sich auf eine Marmorkonsole und schluchzte. Der Bürgermeister spielte achtlos mit einem Brieföffner, Stella stand bei der Tür, sie hob die Samtportiere an und beugte sich vor, um zu lauschen. Aber nur das leise nervöse Ticken der Tischuhr war zu hören.
Die Frage der Exzellenz klang nun wie ein undeutliches Gemurmel, sie konnten die einzelnen Wörter nicht mehr verstehen, aber immer, wenn sie die Stimme hörten, beugten sie sich mit angehaltenem Atem vor.
Derweil waren auch Stimmen aus dem Zimmer der Gnädigen zu hören. Die Gattin lag im Bett, sie hatte die zweite Kindheit erreicht. Sie rief bisweilen nach dem Mädchen, heiser, lachend. Ludvig fuhr jedes Mal zusammen.
Stella hielt die Uhr an. Im Krankenzimmer wurden die Atemzüge schwerer, schwerer. Sie hatten das Gefühl, von der Stille erstickt zu werden, während sie warteten.
Die Exzellenz bewegte sich im Bett.
«Hilf mir beim Aufsitzen», sagte er sehr laut. Es war schon fast ein Ruf.
Alle liefen hinüber. Stella und die Pflegerin stopften dem Sterbenden Kissen in den Rücken. Ludvig und sein Bruder standen am Fußende. Sie hatten das Gefühl, den Tod vorübergehen zu spüren.
Der Sterbende richtete sich im Bett gerade auf, stemmte die Füße gegen das Fußende und starrte mit seinen brechenden Augen vor sich hin.
«Jetzt kommt es», sagte er. Sein weißes Haupt sackte schwer auf seine Brust – alle fuhren zusammen und traten einen Schritt vor.
Dann wurde die Stille von einem plötzlich hervorbrechenden Schluchzen zerrissen. Seine Exzellenz war tot. –––
In der Stadt hatte man noch niemals einen solchen Trauerzug gesehen. Der ganze Bezirk war zusammengeströmt, der König ließ sich durch seinen Ersten Adjutanten vertreten.
In seiner langen Rede erklärte der Bischof, mit diesem Mann werde eine entschwundene Zeit begraben und es sei schön zu sehen, dass so viele einer Ordnung Respekt erwiesen, deren Zeit vorbei sei, die man aber dennoch ehren solle, denn es handele sich ja um die Taten der Väter. Die neue Zeit stelle größere Ansprüche und hoffe, ein größeres und reicheres Glück in ihrem Schoß zu tragen, aber man solle trotzdem seine Fahne für diejenigen senken, die, wie dieser Mann, in ihrem Bereich – und sei er noch so eng gewesen – ihre Pflicht und ihr Bestes getan haben.
Seine Hochwürden waren national-liberal …
Auf diese Weise wurde Exzellenz Høg begraben. –––
Einige Monate darauf wurde Ludvig Høg versetzt, er war nun Bürgermeister von H.
Stella war darüber verzweifelt. Am letzten Abend vor dem Umzug stieg sie mit Nina und William auf einen Hügel vor der Stadt. Es war Mai, die Umgebung lag eingehüllt in die Frische des Frühlings vor ihnen. Weit hinten glitzerte das Meer. Stella zeigte den Kindern ein letztes Mal das alles, wies auf jeden Kirchturm, auf jede Mühle, auf jeden Weg. Nina weinte, William steckte die Finger in den Mund und schaute aus großen staunenden Augen zu seiner Mutter auf. Sie zeigte immer weiter, sie zeigte ihnen jeden Flecken – als sie zum letzten Mal hier stand und von dieser Anhöhe auf die vertraute Umgebung blickte, schien sie aus einem geliebten Buch vorzulesen.
Dann ließ sie sich ins Gras fallen und weinte. William musterte die Mutter verdutzt, dann lief er zu ihr und zog ihr die Hände vom Gesicht.
«Willi küssen», sagte er.
Stella nahm den Jungen auf den Arm und ging mit Nina an der Hand schnellen Schrittes den Hang hinab.
I
Im folgenden Jahr war Stella zum vierten Mal guter Hoffnung und brachte einen Sohn zur Welt. Er wurde auf den Namen Aage getauft.
Høgs hatten in H. sehr zurückgezogen gelebt. Es brauchte seine Zeit, sich dort einzurichten. Nina bekam die Masern, dann folgte Stellas Schwangerschaft. Das alles hatte zur Folge, dass sie in H. fast Fremde waren, da sie in der Stadt kaum Besuche gemacht und keinen gesellschaftlichen Verkehr angeknüpft hatten. So verging die Zeit bis zum Ende ihres zweiten Jahres in ihrer neuen Heimat. – Inzwischen haben wir den Herbst ’63 erreicht.
An diesem Abend nun empfingen sie zum ersten Mal Besuch: den Gemeindepfarrer, den Rektor der Schule und den Stiftsphysikus Berg. Eigentlich hatten die Herren in Høgs Zimmer Karten spielen wollen, blieben dann aber im Salon bei den Damen. Sie sprachen über die Krankheit des Königs. In H. wie überall im Land hatte man die Erkrankung des Königs eigentlich nicht weiter ernst genommen und gehofft, er werde sie bald überwunden haben. Aber an diesem Abend hatte Høg eine Nachricht aus Kopenhagen erhalten, in der der Schreiber wie aus einer Vorahnung heraus das Schlimmste befürchtete.
Mit diesem Gefühl der Bedrohung waren alle im Salon geblieben, wie bei einem Unwetter, wenn man sich im selben Zimmer zusammendrängt.
Auch über die Gräfin2 wurde gesprochen. Høg redete sich in Rage und meinte, man solle lieber versuchen, sie zu vergessen; der Rektor belegte sie mit einem Ausdruck aus einer Festrede im Klub und nannte sie Dänemarks erhabene Aspasia. Der Physikus lachte und fragte scherzhaft, wer denn dann Perikles sei.
Der Gemeindepfarrer, ein magerer Mann von elegantem Äußeren, lenkte das Gespräch geschickt von der Gräfin fort und brachte abermals die Frage der Herzogtümer zur Sprache.
Nun redeten alle durcheinander. Wenn der König jetzt starb, so hieß es, stünde sehr viel auf dem Spiel.
«Das möge Gott verhüten», sagte der Pfarrer.
Stella hatte aufgehört, mit den Damen zu plaudern, sie beugte sich auf ihrem Stuhl vor und lauschte konzentriert dem Gespräch der Herren.
«Vielleicht brauchen wir einen Krieg», sagte sie.
Der Arzt lächelte. «Die gnädige Frau wird sich dann wohl dem Pflegepersonal anschließen?», fragte er.
Nun wurde die Kriegsgefahr erörtert. Der Rektor sprach glühend über den Geist des Jahres achtundvierzig. Der Pfarrer meinte, die Zeiten hätten sich seit damals geändert, so etwas wiederhole sich nicht, sagte er.
Später ging es in der Unterhaltung eher um allgemein politische Themen, sie sprachen über die Londoner Konferenz, der Rektor rechnete unbedingt mit Hilfe durch Frankreichs mächtigen Cäsar.
Die Damen schalteten sich in das Gespräch ein, als es sich anderen Themen zuwandte. Die Gattin des Arztes hatte in Paris die Kaiserin Eugénie gesehen, ihre Reifröcke hatten die ganze Kutsche gefüllt. Høg erzählte Hofklatsch aus den Tuilerien.
«In Spanien ist es aber wohl noch schlimmer», rutschte es der Gattin des Arztes heraus.
Alle lachten und erzählten Geschichten über Königin Isabella; die Frau Rektor meinte, die Königin habe zu viele Beichtväter, und der Arzt behauptete, Beichtväter – also solche mit Zölibat – seien eine überaus gefährliche Einrichtung. Auf diese Weise stichelte er gegen den eleganten Pfarrer, von dem es hieß, er zeige gegenüber der Damenwelt und nicht zuletzt gegenüber Stella gewisse katholische Neigungen.
Der Pastor lächelte und ging auf den Scherz ein: Man könne doch nicht zu viel verlangen, wir seien alle nur Menschen …
In dieser Stimmung erhob man sich, um zu Tisch zu gehen. Nina und William durften auch dabei sein.
Stella bat um den Arm des Rektors, Høg führte die Frau Rektor. Der Tisch war überreich gedeckt. Stella hatte der Jahreszeit zum Trotz den großen Aufsatz mit stark duftenden Blumen gefüllt, es herrschte ein Überfluss an geschliffenen Gläsern und Karaffen, Kompotttellern und Dessertschalen … Nach dem Tod der Exzellenz hatte Ludvig das meiste des kostbaren Geschirrs geerbt, und Stella, die sicher mit den prachtvollen Besitztümern des Hauses glänzen wollte, benutzte an diesem Abend so viel wie überhaupt nur möglich.
Das Büffet war vollgestellt mit großen Pflanzen, Palmen und Farnen, und alle Kerzen im Kronleuchter brannten.
Die Provinzdamen waren geblendet, sie warfen sich heimlich Blicke zu und musterten forschend jeden Gegenstand auf dem Tisch: Nach fünf Minuten hatte die Frau Rektor jeden Löffel und jede Schüssel taxiert. Die Frau Pastor zwinkerte ihrem Mann missbilligend zu, aber der Pastor, der Luxus liebte, reckte sich voller Wohlbehagen auf seinem Stuhl und genoss die Gerichte schon im Voraus.
Er bemerkte eine Vase mit einem prachtvollen Namenszug in Gold. Ob sie aus Sèvres sei?
Die Exzellenz habe sie von Louis Philippe erhalten – auf einer diplomatischen Mission in Frankreich – sie sei wirklich aus Sèvres …
Der Pastor hatte sich das schon gedacht. Er hatte die Fabriken von Sèvres selbst besucht.
Die Frau Rektor wollte gerade ihre Handschuhe ausziehen, sah aber plötzlich, dass Stella ihre anbehielt, errötete und knöpfte ihre wieder zu.
Der Diener in hellblauer Livree reichte das Fischgericht herum.
Es sei so schwer, um diese Jahreszeit Fisch zu bekommen – wo Frau Berg denn einkaufe? – Frau Berg lachte und erklärte, das wisse sie nicht, dafür sei das Mädchen zuständig. – Fisch komme für einen Haushalt sehr teuer, wenn der Mann keinen Auflauf aus Fischresten essen wollte. – Und der Rektor tue das also nicht? – Niemals. – Ob Stella etwas Schlimmeres gesehen habe als «Königin Marguerites Novellen»3?» – Nein, niemals? Berg behauptete, der König esse mit den Fingern … die Königin habe mit dem Messer Pfannkuchen verzehrt.
Der Blaue hatte die Gläser mit Hochheimer gefüllt. William weinte, weil er keine Schnittchen bekommen hatte.
Die Frau Rektor setzte sich den Kneifer auf die Nase: Sie habe noch nie ein so dunkles Kind gesehen. Der wahre Zigeuner.
Der Physikus trank privat dem Pastor zu.
Stella beugte sich am Rektor vorbei vor und fragte die Frau Pastor, ob ihre Kinder noch immer Tran bekämen. – Frau Berg verabscheute Kinder, wenn man sechs davon habe …
Die Stimmung wurde immer lebhafter. Der Rektor setzte zu einem Vortrag an, der Pfarrer gestikulierte eifrig vor seiner Tischdame und legte ihr in seinem Eifer die Hand auf den Arm. Die junge Frau hatte runde Arme und trug halblange Ärmel … Berg sprach über Malthus. Stella hörte den Namen und fragte über den Tisch hinweg, wer Malthus sei. Der Pfarrer lächelte verlegen, Frau Berg lachte, ließ sich auf dem Stuhl zurücksinken und rief den Namen ihres Mannes.
Das sei einer der Wohltäter der Menschheit, sagte der.
Ob Høg wisse, wie groß das Asyllegat sei. Der Pfarrer hatte von 5 000 Reichstalern gehört. Das sei eine große Wohltat für die Stadt.
Es sei töricht zu behaupten, dunkle Kinder seien leidenschaftlicher als blonde. Die Frau Rektor hatte viele blonde Kinder gesehen, die überaus leidenschaftlich waren …
Nein, Høg wusste es nicht …
Sie redeten abermals wild durcheinander. Der «Blaue» lief umher und schenkte ein, einen alten Rotwein aus der Zeit der Exzellenz. Der Pastor erklärte, schon lange keinen solchen Wein mehr gekostet zu haben … Er betrachtete zufrieden, wie der Wein im Glas funkelte.
Die Stimmung wurde überaus lebhaft. William setzte sich auf Stellas Schoß, Nina saß beim Arzt.
Es sei ja kein Problem, wenn man so schöne Kinder bekäme, Frau Berg erklärte ihre eigenen für hässlich; der Rektor fand, sie übertreibe die Selbstkritik – der Älteste sei doch sehr gut in Latein …
Ja, in Latein …
Høg trank in diesem Zusammenhang auf die Damen, als Mütter der Gesellschaft. Stella streifte ihre Handschuhe ab. Die Frau Rektor staunte über einen Tafelaufsatz … Der sei ein Geschenk des Königs … übrigens verbinde sich mit diesem Aufsatz eine pikante Geschichte …
Stella erzählte. Høg fiel ihr ins Wort und korrigierte. Die Geschichte war wirklich pikant. Dann kamen sie wieder auf Geschichten über die Gräfin zu sprechen. Der König hatte ihr einen mit Apfelsinen gefüllten Nachtstuhl geschenkt, und jede Apfelsine war in einen Fünf-Taler-Schein eingewickelt gewesen … Das war doch sehr komisch und sehr großzügig vom König, der Arzt meinte, so etwas habe die antike Aspasia wohl kaum von ihrem Perikles bekommen.
Alle lachten herzlich, sogar die Frau Pastor ließ sich von der Heiterkeit mitreißen. Frau Berg zerbrach den Stuhlrücken, weil sie sich zu heftig zurücksinken ließ, der Pfarrer hielt sie fest.
Der Blaue trat mit einem Tablett ein und brachte es Høg. «Es ist ein Telegramm gekommen.»
«Ein Telegramm …» Høg sprang auf, griff nach dem Telegramm. Im selben Moment hatten alle es gesehen. Es wurde sehr still. Stella setzte William hart auf den Boden.
Høg war sehr bleich. Er umklammerte das Papier.
«Der König ist tot», sagte er mit dumpfer, belegter Stimme.
Die Stühle wurden zurückgeschoben, alle erhoben sich. Dann wurde es wieder sehr still. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können. Alle starrten zu Boden – der Pfarrer hatte die Hände gefaltet.
William stand neben seiner Mutter. Er ließ den Blick durch die Runde wandern. Dann brach er plötzlich in Tränen aus.
Bald danach waren Stella und Høg allein in ihrem Esszimmer. Die Gäste waren einer nach dem anderen lautlos davongeschlichen. «Jetzt kommen harte Zeiten», sagte Høg. Stella löschte die Kerzen auf dem Büffet. –––
Der Krieg kam. In H. lagen viele dänische Soldaten, aber man fürchtete, sie müssten die Stadt bald aufgeben und sich weiter nach Norden zurückziehen. Der Feind war schon über Kolding hinaus vorgerückt – der Weg lag offen vor ihm.
Der Kronprinz war nachmittags in die Stadt gekommen, um die Verwundeten in den Lazaretten der Stadt zu besuchen. Høg war mit Seiner Königlichen Hoheit unterwegs.
Es war gegen Abend. Ein kalter, durchdringender Herbstregen, gepeitscht von einem heulenden Sturm.
Bei Høgs zu Hause war das kleinste Kind krank. Lungenentzündung. Berg konnte nur wenig Hoffnung machen.
Über die Lampe war ein Schirm gestülpt worden. Stella saß bei der Wiege in der dunklen Ecke hinter dem Kachelofen. Sie bewegte die Wiege mit dem Fuß, ganz mechanisch; wenn das Kind wimmerte, summte sie leise. Ab und zu fuhr sie aus ihrer Geistesabwesenheit auf, beugte sich tief über die Wiege und lauschte den keuchenden Atemzügen. Griff sich dann an den Kopf und seufzte.
Der Regen prasselte gegen die Fensterscheiben, packte das klirrende Thermometer – draußen auf der Straße wurde laut gesprochen.
Stella setzte sich abermals auf. Das Kind hatte große ängstliche, fragende Augen, die ihr die ganze Zeit folgten. Dieser stumme, hilflos flehende Blick war für sie eine Qual. Sie schaute zur Seite, wollte dem Blick entkommen, spürte ihn aber hilflos auf sich gerichtet, konnte sich nicht davon befreien. Und die Augen waren groß, glasig, glänzend.
«Nina, wieg Aage ein wenig», sagte sie.
Nina hatte neben der Lampe gesessen und gestrickt. «Wo ist William?», fragte die Mutter.
Er saß zusammengekrümmt auf einem Schemel hinter dem Vorhang und schlief. Sein Bilderbuch war auf sein Knie gesunken.
Aage bewegte auf seinem Kissen ein wenig den Kopf und schaute hinter Stella her, die zum Fenster ging, wo sie William sanft schüttelte. «Ane bringt dich ins Bett», sagte sie.
Sie kehrte dem Zimmer den Rücken und schaute aus dem Fenster.
Auf der Straße liefen die Menschen unruhig hin und her. Sie riefen einander im Vorüberrennen etwas zu, liefen weiter, den Kopf im Regen gesenkt. Der Sturm hatte im Haus gegenüber das Schild des Barbiers abgerissen, und das Messingbecken klapperte gegen die Mauer – der Regen steigerte sich noch immer in unregelmäßigen Stößen –
Stella ging zurück zur Wiege. Aage sah sie an und lächelte sehr schwach, seine Brust bewegte sich heftig auf und nieder, seine Händchen griffen krampfhaft nach dem Rand der Wiege. Sein Gesicht wurde ganz blau.
William ging zur Wiege und betrachtete neugierig seinen Bruder.
«Brüderchen ist krank», sagte er und zupfte an der grünen Decke. Stella fand keine Ruhe, sie lief im Zimmer hin und her, blieb in der Ecke stehen, lief wieder hin und her. Sie fand, der Sturm steigere sich von Minute zu Minute. Sie stand wieder am Fenster. Høg musste doch bald da sein … Sie fuhr zusammen, als sie am Ende der Straße ein einzelnes Hornsignal hörte.
«Wann kommt Vater?», fragte Nina.
Stella schaute aus dem Fenster. Eine Menschenmenge lief auf der Pflasterstraße hin und her, sie hörte vom Marktplatz her Rufe, laute Rufe wie militärische Kommandos. Sie sah zwei Offiziere, die auf der anderen Straßenseite unter der Laterne erregt miteinander sprachen. Sie trugen lange durchnässte Regenmäntel.
Aage weinte in der Wiege. Stella ging zurück, um ihn zu wiegen. Der Sturm wurde stärker, der Regen peitschte – sie hörten viele Schritte auf der Straße, immer mehr. Der Wind seufzte im Kachelofen, das Kind wimmerte ganz leise.
«Wie sie laufen», sagte Nina. Sie war am Fenster auf einen Stuhl geklettert.
William stand daneben und zupfte sie am Rock.
Sie hörten Hufschläge auf der Straße, eilige Rufe, Hornsignale … Stella fuhr von der Wiege hoch.
«Mutter, Mutter», rief William ängstlich und rannte auf sie zu. Nina kam vom Fenster gelaufen. Beide Kinder fingen an zu weinen …
Die Hornsignale ertönten jetzt aus allen Richtungen – eilige Hufschläge, Schritte – auf der Straße wurde laut gerufen. Stella riss das Fenster auf. Der Sturm schlug lärmend gegen die Mauer, der Regen peitschte ihr Gesicht und zerzauste ihren Pony …
In allen Türen standen Menschen, die Soldaten liefen aus und ein. Eine Kompanie marschierte in geschlossener Formation schnellen Schrittes durch die Straße. Ihre Stiefel machten auf der überfluteten Brücke schwappende Geräusche – Stella hörte zwei Frauen unten auf der Straße weinen.
«Kommen sie?», rief sie den beiden zu. Und dann, lauter: «Kommen sie?»
Der Sturm zerriss ihre Worte, niemand hörte sie, sie hielt das klappernde Fenster fest – Hornsignale erklangen wie ängstliche Notrufe, eilig von allen Seiten.
«Kommen sie?», rief sie abermals und beugte sich weit aus dem Fenster. Niemand antwortete. Ein Adjutant galoppierte vorüber – sie rief noch einmal, er antwortete und schaute sich um. Der Sturm wischte seine Worte aus.
Nina saß bei der Wiege.
«Mutter, Aage wird schwarz im Gesicht», sagte sie.
Die Mutter stürzte hinüber. Das Kind röchelte und starrte vor sich hin, Stella riss Nina weg und warf sich mit einem verzweifelten Schrei über die Wiege – sie hob das Kind auf, legte es wieder hin.
«Er stirbt, er stirbt», rief sie. Sie stürzte davon, griff zu einer Flasche und goss einige Tropfen in einen Löffel. «Er stirbt», wiederholte sie leiser und wiederholte mechanisch: «Er ist tot, er ist tot …»
Das Fenster schlug heftig gegen die Mauer. Der Wind packte den Vorhang und riss ihn los, sodass er wie eine Fahne ins Zimmer flatterte; die Flamme in der Lampe flackerte und qualmte – William und Nina saßen in einer Ecke hinter dem Bücherschrank und weinten leise; der Junge hatte den Kopf in den Schoß der Schwester gelegt –
Stella lag quer über der Wiege. Unten auf der Straße war hektisches Trampeln vieler Stiefel zu hören, verwirrte Rufe, sie schaute voller Angst das Kind an.
Dann wurde die Tür aufgerissen.
Høg trug einen langen Regenmantel, das Wasser tropfte herab und floss in langen Strömen über den Teppich. «Sie sind hier», sagte er eilig. «Der Prinz flieht.»
Die Kinder schrien jetzt lauter. Høg strich sich Wasser vom Mantel.
Das Sprechen fiel ihm schwer.
«Gehst du wieder?», rief Stella ängstlich.
«Ja. Der Prinz bricht gleich auf.»
Sie schwieg für einen Moment. Dann sagte sie:
«Das Kind stirbt.»
Høg ging zur Wiege, wo Aages Händchen das Laken krampfhaft gepackt hielten. Dann senkte er den Kopf und ging …
Stella sah ihn durch die Straße zum Klub laufen. Auf dem Marktplatz machte eine lange Reihe von Soldaten kehrt. Sie rannten mehr, als dass sie gingen, die Köpfe tief zwischen die hochgeschlagenen Kragen gezogen, der Regen fiel immer dichter, man hörte das Wasser um die laufenden Beine schlagen – die langen Reihen sahen aus wie ein einziger dunkler Leib.
Männer und Frauen liefen auf der Straße ziellos hin und her. Die Hörner riefen unablässig.
Dann hörten sie vom Marktplatz her Hufschläge. Die Kavalkade donnerte vorüber, Umhänge flatterten im Sturm. Die Pferde stöhnten. Stella erkannte den Prinzen. Sie sah im Licht der Straßenlaterne deutlich seine Züge – er war weiß wie ein Laken.
Stella zitterte so sehr, dass ihre Zähne klapperten. Der Regen hatte ihre Haare und ihr Gesicht durchnässt. Sie drehte sich um. William zog an ihrem Kleid.
«Was willst du?», fragte sie.
«Warum blasen die?», fragte er.
«Weil die Dänen fliehen», sagte sie und schaute wieder aus dem Fenster. William heulte.
«Jetzt schläft Aage», sagte Nina.
«Was sagst du da?»
«Aage schläft.»
«Schläft?» Es klang wie ein Schrei, sie schaute zur Wiege hinüber – sie glaubte, keinen Fuß bewegen zu können –
Das Fenster knallte gegen die Mauer, eine Scheibe zerbrach, und die Scherben fielen klirrend auf die Steintreppe. Der eilige, eintönige Marsch der Truppen durch die Straße verlor sich mehr und mehr …
Nur ab und zu war ein einzelnes schrilles Horn zu hören.
Stella warf sich neben Aages Wiege zu Boden und bohrte schluchzend das Gesicht in den Teppich.
William weinte die ganze Nacht.
II
Die meisten hielten William für ein seltsames Kind.
Er war sehr dunkel in Haut und Haaren und hatte seltsam große Augen mit einem vagen, schwermütigen, ein wenig flackernden Blick. Sein Kopf wirkte zu groß für seinen Körper, und er hatte eine schlechte Haltung, durch die sein Rücken krumm wirkte. Er hatte sehr dünne Beine und lange Arme, und er machte seltsame halb eckige, halb theatralische Bewegungen.
Sein Gang war unregelmäßig und befremdlich. Er konnte in Selbstgespräche vertieft an den Häusern vorbeischlendern – Stella behauptete, er scheuere sich Löcher in die Ellbogen, da er sie immer an den Mauern rieb –, mit gesenktem Kopf und krummem Rücken, schlackernden Armen. Dann plötzlich stolperte er über seine eigenen Füße, die er immer nach innen drehte, und rannte los. Wie er aussah, wenn er rannte! Man musste an die kleinen missgestalteten Trolle mit den unverhältnismäßig großen Köpfen denken, die zusammengepresst in ihrer Schachtel liegen und dann hervorschnellen, wenn die Schachtel geöffnet wird. Nach einer Weile blieb er stehen, schlenderte weiter und rannte dann abermals los.
Beim Sprechen gestikulierte er heftig. Er benutzte viele seltene Wörter und formulierte seine Sätze wie die Dialoge in einer Komödie.
So sah William aus, und so redete er. –
Nina und William standen früh auf, lange vor den anderen. Dann kamen sie an den Wintermorgen in die kalte Küche, wo das Küchenmädchen ihnen bei tropfendem Talglicht die Schulbrote schmierte. Sie trug immer ihr Nachthemd und presste sich zum Schneiden das Brot gegen die Brust. Manchmal wurde William schlecht von den Broten – das Nachthemd des Mädchens war oft graugelb verfärbt –, und er warf sie auf dem Weg zur Schule weg. Während die Kinder Tee tranken, kämmte das Mädchen sich über dem Küchentisch die Haare, sie hielt den einen Zopf im Mund, während sie den anderen flocht.
Wenn die Kinder gegangen waren, kehrte sie ins Bett zurück. Später wurde sie vom Milchmann geweckt, der um neun in die Küche kam, um halb zehn servierte sie Stella in ihrem Schlafzimmer den Tee.
Ab und zu kam es vor, dass Høg, gequält von seiner ewigen Schlaflosigkeit, sehr früh aufstand.
«Pst», sagte dann das Mädchen, wenn die Kinder zähneklappernd die Küchentür aufrissen. «Der Bürgermeister ist schon auf.»
An diesen Tagen wagten Nina und William nicht, auch nur ein Wort zu sagen. Nina stand bei dem qualmenden Licht und las flüsternd ihren Katechismus. William setzte sich neben den Wassereimer. Aber er konnte nicht still sitzen, deshalb rutschte er unruhig auf der Bank hin und her, und das Wasser plätscherte im Eimer.
«Pst, William», sagte Nina. «Du weißt doch, Vater ist auf.»
Und wenn er sich leise durch den Raum schleichen wollte, stolperte er über den Kohlenkasten beim Schornstein. Vor Schreck lutschte er an allen fünf Fingern.
«Da soll doch dieser und jener … du Tollpatsch!», schimpfte das Mädchen.
Wenn die Kinder durch das Esszimmer gingen, sahen sie ihren Vater mit einem Handtuch um den Kopf am Tisch sitzen. Sie sagten sehr leise: «Guten Morgen», er nickte nur, ohne sich umzudrehen oder zu antworten. Nina öffnete die Tür und schlich sich hinaus, gefolgt von William, aber der Junge schaffte es in seiner Verwirrung nur selten, die Tür zu schließen. Dann machte er sich lange am klappernden Schloss zu schaffen, bis der Vater sich mit einem ungeduldigen «also» erhob und die Tür zuknallte.
Rasch liefen die Kinder die Treppe hinunter. An einem solchen Morgen waren sie froh, wenn sie unversehrt unten auf der Straße ankamen.
William war morgens fast immer schlecht gelaunt. Sein Weg zur Schule erschien ihm als bitteres Unrecht, als Martyrium. Er führte laute Selbstgespräche und schmiedete Rachepläne gegen die, die ihn bei Nacht und Nebel aus dem Haus jagten und selbst schliefen; er dachte sich lange Mordromane über den Rektor und die Schule und alles andere aus. Ab und zu hob er auch den Arm und drohte den dunklen Fenstern der Bürgerhäuser, hinter deren Vorhängen die Glücklichen schliefen, mit der Faust, denn diese Glücklichen hatten nicht in der ersten Stunde Mathematik. Mitten in seinen Fantastereien konnte er gegen eine Straßenlaterne stoßen oder in ein Kellerloch fallen. Immer, wenn er unterwegs war, widerfuhr ihm irgendein Missgeschick.
Im Vorraum saßen die Jungen auf langen Bänken und dösten vor sich hin. Der Aufseher wanderte schlaftrunken umher und schlug ihnen unbarmherzig mit der Faust auf den Kopf; dann zerriss ein Schrei das schläfrige Gemurmel und das flüsternde Aufsagen von Kofoed, Balslev und Luthers Kleinem Katechismus. Wenn ein Lehrer die Treppe hochkam, sprangen alle Jungen auf. Wer eingeschlafen war, wurde von seinem Nebenmann durch einen Stoß geweckt und fuhr hoch, wobei ihm das Buch aus der Hand fiel. Der Aufseher ließ ihn über den Stock springen, bis er wach war. Überhaupt war der Herr Aufseher morgens mit Vorsicht zu genießen. Er rieb sich die Augen und reckte die Glieder; dann folgte etwas, das er eine notwendige Zurechtweisung der Lümmel aus der 5. Real nannte, das aber für unparteiische Augen verdächtig nach einem Ringkampf aussah, bei dem das Kriegsglück von Mal zu Mal wechselte.
Ansonsten säuberte er sich die Nägel und ließ den Pedell, der lautlos in einem Paar abgelegter Turnschuhe umherschlich, seinen Mantel bürsten, der ohnehin schon so gut gebürstet war, wie ein glänzender Mantel das überhaupt nur sein kann.
Die Jungen waren froh, wenn der Unterricht begann.
Und doch waren diese Stunden nicht unbedingt interessant. Die Schule in H. hatte alte Lehrer, die sich an ihre Lehrbücher und das vorgeschriebene Pensum hielten. Geschichte bestand aus Jahreszahlen, Geografie aus Zahlen und Namen. Die Sprachen waren Verben, die gebeugt werden mussten, es gab Syntax und Bojesens Antiquitäten, die die Jahreszahlen und die Dürre der Geschichte in wiedergekäuter Form darstellten.
Die Lehrer saßen mit krummem Rücken auf dem Katheder, vor den aufgeschlagenen Büchern, aber mit geschlossenen Augen. In der Schule herrschten Zucht und Ordnung, deshalb konnten sie sich das leisten. Wer an der Reihe war, stand mit der Übersetzung auf einem Blatt Papier im Buch da, die anderen schliefen. Sie saßen mit weit nach vorn geschobenem Hinterteil da, hatten den Kopf auf die Arme gelegt und schliefen, oder wippten auf der Bank hin und her, während sie heimlich die nächste Textstelle lasen.
Wenn der, der vorne gestanden hatte, fertig war, stellte er sich auf Zehenspitzen, um seine Note zu sehen, zeigte seinem Nebenmann, wo er aufgehört hatte, und setzte sich zu den anderen. So vergingen die Stunden.
In den kleinen Pausen blieben alle in der Klasse. Meistens lasen sie wild durcheinander etwas vor, bewarfen sich mit Papierkugeln oder spritzten mit Tinte im ganzen Klassenzimmer hin und her. Wenn der Lehrer hereinkam, gingen die Stunden weiter wie zuvor.
Seine Lektion zu beherrschen war das große Ziel. Die Klasse lernte Sprachen, indem sie fertige Übersetzungen auswendig nachplapperte, Geschichte nach Tabellen von Jahreszahlen, Geografie wurde von der Landkarte abgelesen. Die Lehrer schätzten die Worte der Bücher und hassten die Fantasie.
Die Fleißigen bekamen bei der monatlichen Sitzverteilung gute Noten, Fleißbildchen und Lobesreden, die Faulen erhielten schlechte Noten, wurden herabgestuft und mussten als äußerste Strafe «zum Rektor». Zum Rektor zu müssen war entsetzlich. Die letzten Tage des Monats wurden mit Furcht und Beben erwartet, wen würde das Los treffen; wer sein monatliches Zeugnis nicht ausgehändigt bekam, wusste, wo er es zu holen hatte.
Das Zimmer des Rektors war ein großer Raum mit Regalen an den Wänden. Auf dem Kachelofen stand eine alte Büste des Sokrates. In einer Ecke auf einem kleinen Tisch lag ein rot eingebundenes Monstrum, ein griechisches Wörterbuch, das die Lehrer ihrem Vorgesetzten zu seiner Silberhochzeit geschenkt hatten. Beim Abitur lag das Buch neben seinem Besitzer auf dem Prüfungstisch. Der Pedell betrachtete es als Heiligtum und wickelte es in ein grünes Tuch, wenn er es tragen musste.
Und hierhin kam man also, wenn man zum Rektor musste.
Die Sünder warteten mit bleichem Gesicht im Vorzimmer und hatten sich den Atlas der Alten Welt zwischen Weste und Hemd in den Rücken gesteckt. Sie wussten ja, was sie erwartete. Einer nach dem anderen wurde hineingerufen.
Der Schulleiter öffnete die Tür. Der bestrafte Sünder drückte sich hindurch und verschwand.
«Der Nächste», sagte der Rektor sehr laut. Der «Nächste» kam herein. Der Rektor setzte sich, zog kurz an seiner Pfeife, schob den kurz geschorenen grauen Kopf dicht zu dem Unglücklichen hin und starrte ihn aus kleinen bohrenden Augen an. Hob dann mit einem vielsagenden Fingerschnippen die Hand.
«Bist du das schon wieder?», fragte er und presste die Lippen mit einem seltsam klagenden Zischen aufeinander. «Bist du das schon wieder?» Der Rektor wiederholte solche Fragen immer, und beim zweiten Mal klang die Klage noch trauriger und zischender. Ein Sturzsee aus Spucke begleitete diese wachsende Sorge, und der Sünder stand da und wagte nicht, sie wegzuwischen.
Er war es ja schon wieder.
Der Rektor musterte sein Opfer ein weiteres Mal. «Willst du deinen Eltern denn nur Schande machen?», fragte er dann. Er betonte immer das erste Wort, spulte dann den Satz ab und endete mit einem langen Fingerschnippen, das gewissermaßen den Satz mit einem klangvollen Fragezeichen abschloss.
Dann mahnte er. Er sprach langsam und schüttelte dabei den Kopf. «Es ist doch seltsam mit dem Knaben. Er hat gute Anlagen, daran ist nicht das Geringste auszusetzen, und er hat redliche Eltern, die ihm ein gutes Beispiel geben.» Danach plötzlich und überaus nachdrücklich:
«Was sagt denn dein Vater?»
Abermals das fragende Schnippen und die fixierende Pause. Der Sünder ließ ein Murmeln hören. Einen furchtsamen Versuch, der Sturzsee zu entgehen …
«Ja – und deine Mutter. Sie ist eine überaus liebenswürdige Frau», der Rektor dehnt seine Wörter bedeutungsvoll. «Wirst du daran denken, sie herzlich zu grüßen?»
Der Sünder wischt sich eilig das Gesicht. Der Rektor mustert seine weißen, gepflegten Hände, sehr weiche Hände.
«Also.» Er erhebt sich, geht mit knirschenden Stiefeln durch das Zimmer, bleibt einen Moment stehen, legt den Finger an die Nase und schaut zu Sokrates hoch.
«Jetzt komm schon her!», sagt er. Der Sünder macht zwei Schritte, der Rektor schiebt den Kopf bis zu ihm hin, sodass seine Nase, deren drei rote Warzen von der schweißtreibenden Anstrengung tropfen, fast die Stirn des Jungen berührt. «Wirst du dich also bessern?» Und nachdem er dem Unglücklichen diese energisch vorgetragene Frage gestellt hat, dreht er sich um und nimmt hinter dem Tisch ein langes Futteral hervor.
Der Junge schielt zu dem Futteral hinüber, verschiebt die «Alte Welt» in seinem Rücken und sieht aus wie ein Häuflein Elend. «Auf den Teppich treten!» Die Stimme des großen Mannes klingt gedämpft und bedeutungsschwer, seine Handbewegung ist langsam und würdevoll. Er berührt seine Nase mit der linken Hand und zieht mit der rechten den Rohrstock hervor.
Der Junge weint.
«Ja, jetzt weinst du – aber bessere dich, hörst du, bessere dich.» Die Stimme klingt noch immer geheimnisvoll mahnend, verschleiert wie die eines katholischen Priesters im Beichtstuhl. Er lässt den blanken Rohrstock vor den Augen des Opfers einen langen würdevollen Bogen beschreiben.
«Knöpf deine Jacke auf», sagt er dann plötzlich mit Kommandostimme und richtet sich auf, sodass er sehr viel größer wird. Und während die Warzen an seiner Nase aufleuchten und ein Blick zu Sokrates auf dem Kachelofen wandert, lässt der Schulleiter drei schwere Schläge auf den Rücken des Sünders fallen.
«Jetzt geh.»
Der Rektor stöhnte, der Sünder lief vom Teppich. Dann drehte der Rektor sich wieder um, und mit Fingerschnippen und Sturzsee wiederholte er rasch und mit immer stärkerer Betonung und wechselndem Akzent: «Nun bessere dich, sieh zu, dass du dich besserst, wir können nur hoffen, dass du dich besserst.»
Und dann endete er mit den Worten:
«Grüß deine Eltern!» Das kam wie ein lindernder Abschlusspunkt.
Das war die Strafe in der Schule.
Aber man verstand nicht nur zu strafen, man wusste auch zu belohnen. Am letzten Tag des Schuljahres war der Tag der Belohnung, die Honoratioren der Stadt wurden eingeladen, Høg und der Gemeindepfarrer und der Bezirksarzt und viele andere. Sie saßen auf ehrwürdigen weiß gemalten Stühlen um das Pult, wo der Rektor stand und spuckte, während er Abschied von den Abiturienten nahm, «die jetzt von dannen ziehen, begleitet von den besten Wünschen und dem Segen der Schule».
Wenn dieser Gruß ausgesprochen worden war, kam die Reihe an die anderen. Die Noten wurden verlesen, man tadelte, man lobte, die ganze Schule, fanden die Jungen, zog an den fürchterlichen Richtern auf den alten Stühlen vorüber.
Dann klappte der Rektor sein Protokollbuch zu, und seine Stimme wurde gleichsam tiefer. Es war ziemlich still im Saal. Die Jungen saßen dicht nebeneinander, aller Augen waren auf dieselbe Stelle gerichtet. Die Herren auf den Stühlen saßen sehr gerade … der Rektor liebkoste seine Nase.
«Die Lehrerversammlung hat sich zur Fleißbelohnung eingefunden», hieß es dann.
Wie die Herzen in den vielen kleinen ehrgeizigen Brüsten pochten. Sie schienen alle mit dem Atem zu ringen, während sie hofften. Und die anderen drängten sich vor, um zu sehen.
Jetzt wurde der erste Name verlesen. Der Schulprimus. Er ist purpurrot im Gesicht, schwankt ein wenig, greift sich in die Haare. Dann steht er vorn am Pult. Er bekommt das Buch, macht in seiner Bewegung einen großen Bogen durch den Saal, erreicht seinen Platz – und merkt, dass sein Hemd ihm am Rücken klebt.
William wurde als Letzter aufgerufen. Er hatte an diesem Tag nichts gegessen und war leichenblass. Er hörte seinen Namen kaum, und er wusste nicht, ob er die Füße bewegen könnte. Aber alle Jungen in seiner Nähe flüsterten seinen Namen und schoben ihn nach vorn. Dann gab einer der Großen ihm einen leichten Tritt.
«Los, zum Teufel», sagte er.
Auf diese Weise landete William unsanft und sozusagen Hals über Kopf vor den Reihen, und mit allen Fingern im Mund stand er vor dem Pult.
Er streckte die Hand nach dem Buch aus, das der Rektor ihm reichte. Aber er ließ es fallen, lief purpurrot an. Das Buch fiel zu Boden, und William fing leise an zu weinen, als er es aufhob. Wie er an seinen Platz zurückgekommen war, wusste er nicht, aber an diesem ganzen Tag hatte er so dicht am Wasser gebaut, dass Stella ihn sehr früh und auf schwankenden Beinen ins Bett gehen ließ.
Er hatte «Prinz Otto» bekommen.
Ansonsten rührte das Schulleben ihn nicht sonderlich. Die Schule strafte die Faulen, belohnte die Fleißigen. Damit war ihre Aufgabe erfüllt – was die Jungen empfanden, was sie dachten, interessierte nicht weiter. Man war in der Schule Knabe, bis man sechzehn wurde, zwischen sechzehn und achtzehn war man so etwas wie eine unselige und bedauernswerte Amphibie. Die Knaben wurden behandelt wie eben geschildert. Die Amphibien durften in der großen Pause in der Klasse bleiben. Davon, ihr Gefühlsleben zu behüten, sie vor den gefährlichen Ansteckungen der Pubertät zu beschützen, ihre Herzen rein und ihre Fantasien unberührt zu erhalten, davon war nicht die Rede – das überließ man dem Zufall und dem Zuhause.
Und das Zuhause überließ es oft der Schule! Aber in der Schule wurden nur die Lektionen gelehrt!
Høgs aßen, sowie William und Nina aus der Schule kamen. Bei Tisch wurde nicht viel gesprochen. Wenn Nina mit einer langen Geschichte begann und William und die anderen zu laut lachten, griff Høg sich mit einer nervösen Geste an die Stirn, und Stella brachte die Kinder zum Schweigen. Stella war überhaupt nie so stumm wie in Gegenwart von Høg, er tötete ihr Lachen.
Dieses Schweigen bedrückte die Kinder, sie aßen wortlos und stießen einander unter dem Tisch an. Nach dem Essen küssten sie Høg – William hatte dabei immer eine seltsame Angst und wurde ziemlich rot, wenn er nach dem Kuss aus dem Zimmer lief.
Nach dem Essen war er bis zum Abend sein eigener Herr.
Manchmal versammelten sich alle Kinder der Nachbarschaft auf dem Hinterhof der Høgs – ein großer Hof mit Schuppen, wo man sich verstecken konnte, mit hohen Brennholzstapeln und großen Toren für die Wagen. Es gab auch alte Zuckertonnen, die der Krämer seit Jahren dort herumliegen ließ, die türmten die Jungen zu Festungen aufeinander, wenn sie Soldat spielten. William war von allen Jungen der kleinste, der kleinste und der schwächste. Deshalb war er immer König – zu etwas anderem taugte er nicht. Aber König durfte er immerhin sein: Er stand oben auf den Tonnen und verteilte Orden – kleine Zigarrenringe, die er sich von seinem Vater erbettelte –, und er machte sich eine Schärpe aus Resten von Tarlatan, die er von Stella bekam.
Er hielt lange Reden, und jedes Mal, wenn seine Truppen gesiegt hatten, ließ er sich mit der Pappkrone krönen, die seine Kusine ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Und seine Truppen siegten immer. Nina war Bischof und setzte ihm die Krone auf den Kopf – Nina durfte sich ja nicht raufen, und deshalb waren sie und ihre beste Freundin die oberste Geistlichkeit des Reiches.
Manchmal spielten die Jungen auch, die Tonnen seien Schiffe und sie segelten in weite, weite Ferne; William war Kapitän, er sagte, er sei Kolumbus und er entdeckte Amerika. Er saß traurig unten in einer Tonne, die Matrosen hatten ihn gefesselt. Aber dann rief Nina: «Land! – Land!» Und William griff zu der alten Flagge und sagte zu den anderen, sie sollten ihn im Triumph über den Hof tragen.
Der Himmel allein wusste, wie oft er Amerika entdeckt hatte.
Das waren die Spiele unten auf dem großen Hof. Aber meistens spielte Nina allein mit den Jungen. William blieb oben und las. Er lag lang ausgestreckt auf dem Bauch, den Kopf in die Hände gestützt, und las und las. Wenn die Geschichte ihn packte, kroch er, noch immer mit den Augen im Buch, über den Teppich; oft las er laut – er wusste es nicht, aber er deklamierte Verse über Frau Helene und über Bengerd4. Manchmal flüsterte er, dann wurde er wieder sehr laut, er deklamierte. Bisweilen stand er auch auf und lief mit dem Buch in der Hand hin und her, während er rezitierte, seine Stimme überschlug sich vor Anstrengung.
Stella saß ganz still da und sah ihn an. Dann legte er das Buch weg, trat vor den Spiegel und redete mit sich selbst, breitete die Arme aus und stellte sich in Positur.
Bald darauf lag er wieder auf dem Bauch, mit rotem Gesicht und schweißnass. Man konnte sich unterhalten, das störte ihn nicht. Er hörte das Gespräch nur wie etwas Fernes, weit weg. Er hatte das Gefühl, tief unten in einem Brunnen zu sitzen, während oben gelärmt wurde.