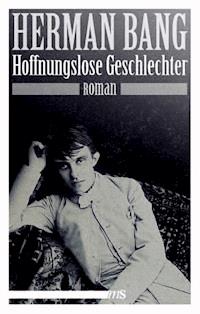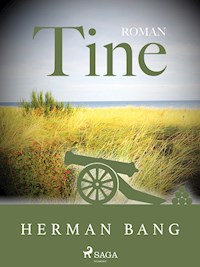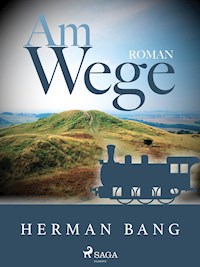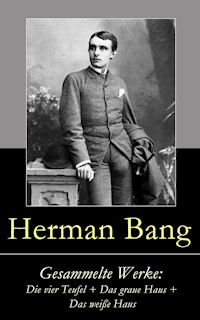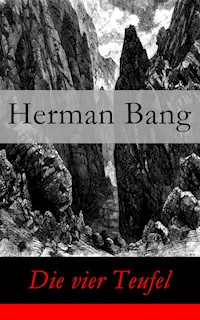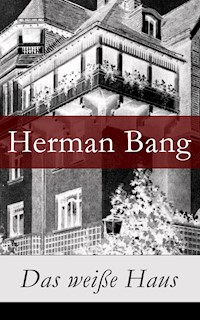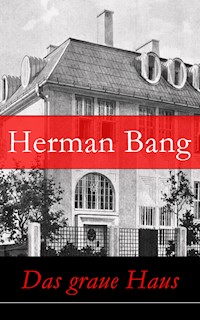Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane und Novellen
- Sprache: Deutsch
Die Werke Herman Bangs (1857-1912) gehören zu den bedeutendsten der dänischen Literatur, teils wegen ihres tiefen Einblicks in die menschliche Seele, teils wegen ihres impressionistischen, filmischen Stils, der die Prosa seiner Zeit veränderte und noch immer die Literatur der Neuzeit prägt. Die auf zehn Bände angelegte Neuübersetzung der Romane und Novellen fußt auf der großen historisch-kritischen Gesamtausgabe der „Danske Sprog- og Litteraturselskab“, Kopenhagen 2008–2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Mikaël
Anmerkungen
Nachwort
Ohne Vaterland
Anmerkungen
Nachwort
Hinweis
Mikaël
Nun kann ich ruhig sterben; ich habe eine große Leidenschaft gesehen
Nu kan jeg dø roligt; jeg har sét en stor Lidenskab
I
Der Meister öffnete die Tür zum Balkon und trat hinaus. Seine Augen waren leicht zusammengekniffen, entweder weil sie noch versuchten, das Werk zu betrachten, das seine Gedanken endlich verlassen wollten, oder vielleicht nur, weil sie vom Licht des Tages geblendet wurden.
Er setzte sich auf den gewohnten Stuhl, wo der mächtige Bart, dessen weiße Streifen sich wie sonderbare Wellen durch das Schwarz schlängelten, fast bis zum Geländer reichte, und er drückte, nach getanem Tagewerk, einen Augenblick lang seine Hände auf das Eisen des Geländers, als wollte er sie gegen einen unverrückbaren Stein stemmen.
Mikaël saß wie immer, das schlanke Kinn auf das Geländer gestützt, und starrte in die Luft. Ein paar Skizzen lagen auf seinem Schoß, als wären sie vergessen.
Der Diener trat mit der Post des Tages und Visitenkarten→, die er dem Meister auf einem Tablett reichte, in die Tür. Der Meister las die Karten und ließ sie auf ihr Tablett zurückfallen, als ob keine von ihnen irgendeinen Namen getragen hätte. Er behielt eine einzige, die er links oben in seine Weste schob.
Dann ergriff er die Zeitungen. Die meisten waren über Kreuz zusammengebunden, und die Spalten waren blau umrandet.
„Worüber schreiben sie?“ fragte Mikaël und hob den Kopf.
„Über die Ausstellung in Melbourne.“
„Was?“ sagte Mikaël und blickte Claude Zoret ins Gesicht.
„Was sie immer schreiben“, sagte der Meister, der, wenn er sprach, die Lippen nur ganz wenig öffnete, und schob die Zeitung weg.
Mikaël setzte sich in seinem halbhohen Stuhl auf und breitete die Zeitungen auf dem Geländer aus, während er in jedem Augenblick, in seinem Eifer, das lange, dunkle Haar aus seiner Stirn strich, als hinderte es seine Augen zu sehen.
Der Meister rührte sich nicht. Sein Blick weilte auf dem Garten der Tuilerien2, wo der beginnende Abend seine fallenden Schleier bereits über die Schultern der Statuen senkte und das Dunkel der Lorbeerbäume vertiefte; und es war in seinem Blick etwas von dem Ausdruck, den seine bäuerlichen Vorväter gehabt hatten, wenn sie gegen Abend vor ihren Äckern saßen.
Claude Zoret drehte den Kopf.
„Du kannst ja gar kein Englisch lesen“, sagte er.
„Ein bißchen, ein bißchen“, sagte Mikaël und blieb über den Zeitungen aus Melbourne gebeugt sitzen.
Der Meister hob die Skizzen auf, die von Mikaëls Schoß gefallen waren, und betrachtete sie: Es waren wieder ein paar ausgestreckte Frauenkörper. Bei dem einen war der Kopf nicht ganz gezeichnet oder vergessen worden. Der andere bestand aus nicht viel mehr als einer Lende.
– Nie kam Mikaël weiter. Eine Brust, eine Lende, einen Nacken, einen Hals, aber nie den ganzen Körper.
– Aber – und der Meister hielt die Skizze vor sich – die Strichführung war gut.
– Ja, sie war gut.
Der Meister lächelte:
– Natürlich, die Skizze war bereits signiert. Unter jeder Studie stand immer in seiner wunderlich fließenden oder vielleicht eher verhedderten Schrift, denn jeder Buchstabe klammerte sich fest an den anderen: „Eugène Mikaël“, und der Strich unter dem Namen wirkte mit seinen drei Punkten wie gestickt.
Claude Zoret hob wieder seinen Kopf und, ohne daß er selbst es bemerkte, sogen seine Augen die Farbe des Himmels ein, die unter dem fortschreitenden Abend immer bleicher wurde, ein sonderbares, weißliches Blau, ganz ähnlich dem allerersten Schein des frühen Lichtes eines Sommermorgens.
Auch Mikaël hatte den Kopf erhoben und betrachtete den Himmel. Wenn er so aufrecht saß, erhob sich sein dunkles Haar über dem Kopf fast wie ein Helm:
„Welch wunderliche Farben der Himmel doch hat“, sagte er; und er versuchte wieder zu lesen, während der Lärm der Rivolistraße3 wie ein hervorquellender Strom von Geräuschen, in denen man nichts unterscheiden konnte, zu ihnen aufstieg.
Einige Augenblicke sprach keiner, bis Mikaël die Augen aufs neue aufschlug und lange in den Himmel blickte:
„Weißt du“, sagte er, „ist es nicht merkwürdig? Ich habe diese Farben zu Hause gesehen, an Maimorgen, zu Hause über dem Hradschin.“
Der Meister lachte kurz:
„Warst du schon so früh auf?“
„Ja, damals“, sagte Mikaël und las weiter.
Der Meister rollte, ohne sich dessen bewußt zu sein, Mikaëls Skizzen zusammen und hielt sie in seiner geschlossenen Hand, während er ihn, der las, betrachtete:
Wie kräftig seine Glieder geworden waren. Sein Körper bekam Muskulatur. Er wuchs sich aus. Diese Linien dort – und unwillkürlich fuhr Claude Zoret mit der Skizzenrolle durch die Luft – waren andere, als er ihn malte, als Alkibiades4 oder als den „Sieger“.
– Aber das war auch fünf Jahre her – und die Augen des Meisters bekamen einen Ausdruck, als läse er die verrutschten Signaturen auf seinen eigenen Leinwänden – ja, wirklich fünf Jahre, seit er den Sieger malte. Und über fünf Jahre, seit er die Studien auf dem Hradschin gemacht hatte.
– Wie gut er sich immer noch an diese Zeit erinnern konnte. Die Luft über Prag, wie merkwürdig sie doch der Luft über dem Montmartre glich, all ihre Farbtöne, ihre ganze Stimmung – – Und dann war es ja auch in Prag, wo Mikaël zu ihm gekommen war.
– An jedem Abend, wenn er vom Hradschin zurückgekehrt war, sagte der Hotelportier zu ihm: „Der junge Mensch ist da“, und jeden Abend antwortete er: „Morgen!“ Bis er endlich eines Abends, halb in Wut, gesagt hatte: „Schon wieder! Nun, lassen Sie ihn dann kommen.“ Und Mikaël war in sein Zimmer getreten und war dort an der Tür gestanden, mit leicht gebeugten Knien, kreideweiß in seinem ganz ebenmäßigen Gesicht, mit Schweißperlen, Perle an Perle über die ganze Stirn. „Nun, was wünschen Sie?“ – „Dem Meister etwas zu zeigen.“ – „Was?“ – „Einige Zeichnungen, Meister.“ – „So. Zeichnet man in Ihrem Alter? Lassen Sie sie mich sehen.“
Und er hatte sie bekommen, das Machwerk, die Striche, wie es war. Aber es waren ein paar Frauenskizzen dazwischen, die trotz allem …
„Setzen Sie sich“, hatte er gesagt: „Ja, wenn Sie Maler werden, werden Sie zu nichts anderem kommen, als Frauen zu malen.“
Er hatte zu Mikaël hingesehen, der sich weder hingesetzt noch gerührt hatte. Immer noch blaß, mit Schweiß auf dem Gesicht fast wie einen Schleier, stand er da – und es mußte wohl etwas über dieser Statue aus Angst gewesen sein, etwas, das seine Augen ergriff, denn er hatte plötzlich gesagt, wie man ein auf Wiedersehen sagt, wenn man es freundlich tun will –:
„Nun, Sie, wenn Sie mir innerhalb eines Jahres ein Bild bringen, eine Frau, die gemalt ist, richtig gemalt ist – – dann können wir ja darüber reden.
Im übrigen bin ich kein Hr. Bonnat5, und ich nehme keine Schüler an.“
– Und er fragte noch, als Mikaël bereits die Tür geöffnet hatte, immer noch blaß und mit weit aufgerissenen Augen: „Wie alt sind Sie?“ – „Siebzehn Jahre, Meister.“ – „Und wie heißen Sie“ – „Mikaël“, hatte er geantwortet und seinen Kopf gesenkt.
– Nein, er hatte noch nie einen Menschen gesehen, der bis in seine Fingerspitzen ein Gefühl ausdrückte: Angst. Er hatte ihm die Hand gereicht: „Auf Wiedersehen“, hatte er gesagt und Mikaëls Hand gespürt, die wie sein ganzer Körper eiskalt war.
„Auf Wiedersehen, Meister“, hatte Mikaël geantwortet und wieder seinen Kopf geneigt, bevor die Tür zufiel.
Claude Zoret betrachtete weiter den ausgeblichenen Himmel:
– Wo wohl die Studien vom Hradschin eigentlich waren? Denn er hatte sie nie gebraucht. Als er aus Prag heimkam, war er plötzlich, erinnerte er sich, ohne Grund, ohne erdenkliche Ursache in einen der unnatürlichen, sinnesleeren Anfälle von Ohnmacht gefallen, wo er viele Monate hindurch Tag für Tag in seiner eigenen Ohnmacht herumirrte wie ein sich in seinem Käfig schüttelnder Bär, oder wo er sich in eine ungeheure Betäubung warf, die die Wochen zu einer einzigen Nacht auslöschte, woran er sich an nichts mehr erinnerte außer an seinen dumpfen Drang zur Bewußtlosigkeit oder zu Schlaf.
– Ja er hatte gerade einen solchen Anfall gehabt, einen verdammten Anfall. Fast ein halbes Jahr lang hatte er gedauert. Mikaël war manchmal mit der Studie dieser Frau gekommen, die nackt und in irgendwelches Gras hingestreckt war. Viele Monate hatte der Anfall gedauert, bis er plötzlich, ohne zu denken, ohne abzuwägen, ohne zu wissen, er, in dessen Gehirn Gedanken und Gestalten sonst halbe Jahre lang lagen, ganze Jahre lang, viele Jahre lang, alle seine Vorstellungen einsaugend, wie ein Schwamm Blut aufsaugt, ihn peinigend, bis er sie wie einen Mühlstein von sich schleuderte – sich auf der Leinwand niedergeschlagen hatte: „Die Athener erwarten die Antwort des Orakels“, wo es ihm endlich einmal gelungen war, die elende Todesangst der Menschen zu malen, und wo er Mikaël, dort, ganz hinten, gerade so in die Knie gebeugt, wie er in Prag gestanden war, an der Tür, hingestellt hatte.
– Und nach der „Angst“ hatte er den „Sieger“ gemalt.
Mikaël hatte sein Gesicht erhoben:
„Weißt du, was hier steht?“ fragte er.
Der Meister antwortete nicht.
Durch die fahle Luft fiel die Röte des westlichen Himmels wie der Widerschein einer Flamme über die Dächer des Louvre.
„Weißt du, was da steht?“ wiederholte Mikaël.
Und als hätte er es auswendig gelernt, sagte er in die Luft:
„Da steht: ‚Aber der Eindruck bleibt zurück, daß hoch über allem sich Frankreichs Name wie ein Banner erhebt, von den gewaltigen Händen Claude Zorets getragen.‘“
Der Meister veränderte seinen Gesichtsausdruck nicht, aber Mikaël stützte den Kopf in seine Hände, während er in den Abend hinaus sagte:
„Derjenige zu sein, über den dies geschrieben wird.“
Der Meister lächelte:
„Ja, Mikaël, der Mann muß ja malen können“, sagte er und schleuderte die letzten Worte des Satzes wie in bösem Hohn hinaus.
Plötzlich wechselte er den Ton:
„Aber du müßtest über dieses Gitter springen“, sagte er und schlug seine Hände gegen das Geländer.
„Warum?“
Die Klingeln der Fahrräder schrillten zu ihnen herauf, während sie beide schwiegen.
„Warum“, fragte Mikaël und sprach ganz leise, „sagst du mir immer dasselbe?“
Der Meister gab keine Antwort.
Aber Mikaël sagte und sprach weiter leise, während eine plötzliche Röte sich über das gesenkte Gesicht ausbreitete:
„Darf ich dir etwas sagen?“
„Was du willst.“
„Verstehst du nicht … Kannst du gar nicht verstehen, daß wenn ich … daß wenn ich lese, wie jetzt hier, daß deine Bilder, daß sie wie die der großen Meister sind, die hundert Jahre bestehen werden, und Menschen sie anschauen werden nach so langen Zeiten, wie wir uns gar nicht vorstellen können …“
Claude Zoret schüttelte den Kopf:
„Niemand“, sagte er, „weiß, wie lange etwas dauert.“
Und während er seine behaarte Hand zum Louvre erhob, sagte er, und seine Stimme bekam denselben Tonfall wie vorher:
„Geh dort hinüber, um zu sehen, wie viele der Unsterblichen dort bereits tot sind.“
Mikaël hob das Gesicht:
„Du weißt, daß du lebst. Wenn ich auf dich blicke, während du malst, sehe ich an deinem Gesicht, daß du weißt, du malst nicht für die, die jetzt leben.“
Der Meister lachte:
„Wie sieht denn mein Gesicht aus, wenn ich male?“
„Du lächelst“, sagte Mikaël.
Claude Zoret lachte aufs neue mit dem lauten Lachen des Bauern, das ihn plötzlich überkommen konnte:
„Ja, weil ich weiß, daß die Leute nichts verstehen werden.“
„Nein“, sagte Mikaël und schüttelte seinen Kopf: „Du lächelst, weil du weißt, daß diejenigen kommen werden, die verstehen.
– Aber“, und er senkte seine Stimme, „kannst du denn nicht begreifen, daß ich – ich sage es zu mir selbst …“
„Was?“ fragte der Meister.
„Daß ich bei mir selbst sage“ – und plötzlich redete Mikaël sehr schnell fast wie einer, der sich schämt – „es ist dein Körper, den er malt.“
Er erhob sich mit einem Satz, als bräuchte er für seine eigene Sinnesbewegung Platz:
„Du bist es, den er verewigt“, sagte er.
Er schwieg einen Augenblick, und während er sich wieder setzte, sagte er:
„Aber dann mußt du auch, ja, verstehen, daß mit meinem Körper (er suchte nach einem Wort und fiel über das merkwürdigste) auch nicht verfahren werden darf wie mit dem der anderen.“
Mikaël schwieg, und auch der Meister sagte nichts. Das schwere Rumpeln der elektrischen Wagen drang zu ihnen wie der Lärm gewaltiger Pflugscharen, die die Erde spalten wollten.
Dann sagte der Meister in das Halbdunkel:
„Du wirst einen Tag mehr als deinen Körper geben.“
„Was?“
„Alles“, erklang die Stimme des Meisters durch das Dunkel.
Sie schwiegen wieder, bis Mikaël sagte und seinen Kopf fast ganz auf das Geländer des Balkons gebeugt hatte, während er flüsterte:
„Sag mir, wie war sie?“
„Wer?“
Mikaël zögerte einen Augenblick, bevor er sagte und wie zuvor sprach:
„Deine Ehefrau.“
Der Ausdruck des Meisters veränderte sich nicht.
„Du hast sie doch gesehen“, sagte er und rührte sich nicht.
Mikaël starrte in die Dämmerung:
„Ja“, sagte er und bewegte den Kopf ganz leicht, er hatte nicht gewagt, ihn zu wenden. Und er fühlte aufs neue dieselbe Scheu oder fast Angst, die er gefühlt hatte, und nicht gewußt warum, damals, als der Meister ihn auf den Friedhof in Montreuil6 geführt hatte und dort vor dem Denkmal gestanden war, vor der Statue, die die einzige war, die der Meister in seinem ganzen Leben geschaffen hatte: der Frau, die, gebeugt und vor sich hinstarrend mit einem zerbrochenen Gefäß in ihrer Hand dasaß. An ihrem Fuß – wie müde er war – war ein „Maria“ eingeritzt.
„Aber“, sagte Mikaël, und seine Stimme zitterte ein wenig, während er immer noch das Gesicht der weißen Frau vor seinen Augen sah: „Wie war sie?“
Claude Zoret rührte sich nicht, und seine Stimme klang wie zuvor:
„Sie war aus meiner Heimat“ sagte er und schwieg wieder.
Mikaël bemerkte selbst nicht, wie weiß sein Gesicht war oder daß seine Hände zitterten.
„Aber“, fuhr der Meister fort und redete immer noch mit derselben Stimme: „Hier ist nicht von mir die Rede.“
Claude Zoret erhob sich und ging an seinem Pflegesohn vorbei, der in einer Gedankenverbindung immer wieder sagte:
„Wer ist eigentlich glücklich?“
Der Meister antwortete:
„Ja, wer? Der, der bekommt, weil er gibt.“
Mikaël blickte den Meister an.
„Du gabst ja alles“, sagte er.
Der Meister blieb stehen. Der Wind, der aus dem Garten der Tuilerien wehte, bewegte seinen wogenden Bart.
„Ich gab nichts zum Leben“, sagte er.
Mikaël hörte es nicht. Die ganze Zeit sah er das Grabmal vor sich, die Frau und ihr Starren auf das zerbrochene Gefäß und ihre todmüden Arme.
Aber der Meister wiederholte die Worte, und plötzlich erreichte das letzte Wort Mikaëls Ohr.
Und tief ausatmend – er wußte nicht, warum oder welche Last er heimlich von sich warf – sagte er und lächelte, so daß man seine weißen, kräftigen Zähne sah:
„Ja, das Leben.“
Der Meister hatte auf einmal beim Laut von Mikaëls Worten, ihrem Klang, den Kopf gedreht, und er blieb stehen, während auf einmal der ganze Ausdruck seines Gesichts wechselte und er weiter den Pflegesohn mit einem Paar Augen, die größer geworden waren, betrachtete. Er sah ihn von der rechten Seite: Die Lippen des Profils waren begehrlich geöffnet, als ob er noch stark atmete, und die Stirn – der Meister sah es zum ersten Mal – trat danach besonders steil zurück.
„Mikaël“, sagte er – und es war nicht zu erkennen, ob es der Mensch war oder der Maler, der sich wunderte –:
„Du hast ja zwei Gesichter.“
Eine tiefe Röte überzog Mikaëls Gesicht:
„Das weiß ich gut“, sagte er und lachte wie einer, der verwirrt ist oder verlegen wird.
„Nein, bleib sitzen“, sagte Claude Zoret, und es trat, während er weiter auf Mikaël starrte, plötzlich jene Schärfe in seinen Blick, die darin aufleuchtete, wenn er stark angespannt vor seinen Leinwänden stand:
„Das habe ich nie gesehen“, sagte er.
Und kurz darauf:
„Das ist eigentümlich.“
Mikaël hatte den Kopf weggedreht, und keiner von ihnen sprach.
Die elektrischen Lichter gingen auf dem weiten Platz an. Es sah aus, als hüpften Irrwische hervor, wenn sie angezündet wurden. Der Lärm der Straße drang zu ihnen hoch wie ein Fluß, der am Ufer hochsteigt.
Der Meister stand noch am Geländer mit demselben Ausdruck in seinem Gesicht.
Der Diener trat in die Tür:
„Es ist angerichtet“, sagte er.
„Danke.“
Claude Zoret ging an Mikaël vorbei, um hineinzugehen:
„Wirf den Ruhm ins Feuer“, sagte er, indem er auf die Zeitungen zeigte, und er selbst bückte sich, um die eine aufzuheben.
„Du hast eine Karte verloren“, sagte Mikaël und hob die Visitenkarte vom Boden auf, die der Meister in seine Weste gesteckt hatte.
„Ja“, sagte der Diener, der an der Tür wartete: „Madame möchte Bescheid haben.“
„Ach“, sagte der Meister: „Sie ist es. Sagen Sie, ich sei heute Abend zuhause.“
Der Diener ging.
Mikaël hielt die Karte vor der Tür ins Licht:
„Fürstin Lucia Zamikof.“
„Ja“, sagte der Meister: „das ist ein Frauenzimmer, das gemalt werden will.“
Mikaël lachte, während er noch einmal den fremden Namen nachäffte. Mit den Zeitungen in der Tasche ging er vor dem Meister die Treppe hinunter ins Atelier, wo er den Zeitungsstapel in den großen Kamin warf, während er sich selbst auf einen Schemel setzte. Die Flammen des brennenden Papiers leuchteten rot auf seinem Gesicht.
Der Meister blieb einen Augenblick stehen:
„Kommst du dann?“ sagte er: „Adelsskjolds kommen heute zum Essen.“
Der Meister ging.
Mikaël blieb noch auf seinem Schemel sitzen. Über den Kohlen im Kamin lag das verbrannte Papier wie ein grauer Schleier von Asche oder Staub.
Claude Zoret geleitete Frau Adelsskjold die drei weiß lackierten Stufen zum Speisesaal hinab.
Ihnen folgten Adelsskjold und Hr. de Monthieu.
Charles Schwitt, der zusammen mit Mikaël kam, sagte, während er auf einen Ring an Mikaëls Finger blickte:
„Was ist das für ein Ring?“
„Ein ägyptischer“, antwortete Mikaël und hob die Hand.
Es war ein Geschenk des Meisters.
„Natürlich“, sagte Schwitt: „Er schenkt Ihnen wohl bald ein Paar Fußringe.“
Sie nahmen alle Platz, während die beiden Dienstmädchen mit den weißen Hauben die Suppe auftrugen, und sie sprachen wieder von Schmuck, antikem Schmuck, einem syrischen Gefäß, das vom Herzog von Rochefoucauld 7 gekauft war, und von ein paar Erwerbungen des Louvre, über welche sie alle lachten.
Frau Adelsskjold hob ihre Hände, die schwer von Diamanten waren, ein wenig vom Tisch und sagte:
„Ich mag antike Ringe nicht. Man weiß nie, an wessen Händen sie gesteckt haben. Ich glaube, sie bringen Unglück.“
Charles Schwitt lachte und sagte:
„Glauben Sie, so ein Ring habe zweitausend Jahre lang in der Erde gelegen und Unglück eingesogen?“
Frau Adelsskjold antwortete:
„Ich weiß nicht. Es ist nur so ein Gedanke. Und außerdem habe ich Angst vor Leichen.“
Adelsskjold, der trotz seines fünfzehnjährigen Aufenthalts in Paris die Sprache nur mühsam und als etwas, mit dem schwierig umzugehen war, sprach, sagte:
„Alice ist abergläubisch wie die Wirtin im Gasthaus ‚Der Graue Bär.‘“
Der Meister lachte an dem Gedanken an die alte Wirtin vom Bären in St. Malo8, wo er, der sonst immer alleine arbeitete, Künstlerkolonien scheuend und immer nur von Mikaël begleitet, sich einen einzigen Sommer mit Adelsskjolds zusammengetan hatte – bis sich der Ausdruck in seinem Gesicht auf einmal änderte und er sagte:
„Ja, sie war so abergläubisch wie meine alte Mutter.“
Der junge Herzog beugte sein Gesicht, das diese zarte Farbe hatte, die von Cremes und Essenzen verursacht wird, herab und sagte:
„In unserer Familie glauben wir jetzt alle an Wahrsagungen.“
„Ja, ist es nicht unglaublich“, sagte Herr Schwitt, der immer merkwürdig stoßweise und mit vielen eigenartigen Handbewegungen, wie die meisten Männer jüdischer Abstammung, redete: „Aber der Aberglaube verbreitet sich buchstäblich in ganz Paris, und am stärksten in unseren Kreisen.“
Der Herzog wandte sein Gesicht und sagte zu Herrn Schwitt, während seine Stimme äußerst ehrerbietig klang:
„Ist das nicht ganz natürlich? Ich meine, daß diejenigen, die überhaupt einen Zusammenhang suchen, in das Unnatürliche fallen?“
Der Meister drehte sein Gesicht und sah auf den jungen Mann:
„Sie haben recht, Monthieu“, sagte er schnell: „Um das Unnatürliche zu erklären, sucht man das Unnatürliche auf.“
„Aber das ist doch zu dumm“, sagte Herr Schwitt und schlug mit der Hand in Höhe seines Gesichtes aus: „Du endest wohl auch damit, Sterndeuter zu werden? Man findet in ganz Paris bald keine Stelle mehr, wo sie nicht in den Sternen oder in den Händen lesen.“
„Ich habe nicht gesagt, man müsse irgendeinen Zusammenhang suchen“, sagte der Meister.
Aber Frau Adelsskjold beugte hastig den Busen über den Tisch und sagte:
„Sie bezeichnen doch wohl Chiromantie nicht als Aberglaube?“
Alle lachten über den Eifer oder fast die Verärgerung in ihrer Stimme (ausgenommen der Herzog, dessen blaue Augen weniger als eine Sekunde auf Frau Adelsskjolds nacktem Busen ruhten), während Herr Schmidt sagte:
„Wie sollte ich sie doch sonst nennen?“
Frau Adelsskjold sagte mit derselben Stimme wie zuvor:
„Sie glauben ja an gar nichts, sodaß man mit ihnen nicht diskutieren kann. Aber daß man aus den Händen lesen kann, ist doch wirklich etwas, das bewiesen ist.“
Und sie begann, eine Menge Geschichten von Menschen zu erzählen, Menschen meiner Freunde, sagte sie, die aus ihren Händen gelesen bekommen hatten:
„Sie haben Geheimnisse gelesen, die sie unmöglich wissen konnten“, sagte sie: „Sie haben daraus gelesen, was geschehen war und was geschehen würde – alles, und es ist eingetroffen.“
„Haben Sie auch die Zukunft gelesen“, sagte Hr. de Monthieu und hob einen Augenblick seine Augen.
„Ja, alle Dinge in der Zukunft … Und es ist eingetroffen.“
Der Meister lächelte ein wenig:
„Ich hätte nun niemals Lust, aus der Hand gelesen zu bekommen, selbst wenn ich sogar daran glaubte.“
„Warum nicht?“
„Ach“, sagte der Meister: „In meinem Alter ist das Geheimnis dessen, was geschieht, nur das, daß nichts geschieht.“
Hr. de Monthieu senkte den Kopf:
„Es wird doch erschaffen.“
„Ja“, antwortete Claude Zoret, dessen Stimme etwas lauter oder ungeduldig klang: „Es wird ein Teil gemalt.“
„Ich“, sagte Mikaël, dessen Worte oft so herausplatzten, „ließe mir unglaublich gerne aus der Hand lesen.“
„Um was zu erfahren?“ fragte Hr. Schwitt.
Mikaëls Wangen wurden rot:
„Um zu erfahren, was geschieht.“
Hr. Schwitt lachte über den Ton in seinen Worten, während Adelsskjold seinen großen Kopf erhob:
„Alice ist übrigens nie geweissagt worden.“
„Nicht?“ kam es vom Herzog.
„Nein“, sagte Frau Adelsskjold: „Ich traue mich nicht.“
Und mit einem Lächeln, das plötzlich die allerersten Falten ihrer gut dreißig Jahre um ihren Mund zeigte, sagte sie:
„Ich habe Angst davor, man würde etwas über meinen Tod lesen.“
„Sie?“ sagte Herr Schwitt und ließ auf einmal seine Augen auf ihrer starken Gestalt ruhen, wo der schöne und weiße Busen von Adern durchzogen war wie ein halb unsichtbares geklöppeltes Netz.
„Ja“, sagte Frau Adelsskjold und sagte vielleicht in unwillkürlicher Sinnesbewegung mehr als sie wollte: „Ist es nicht merkwürdig, aber ich kann plötzlich von einer Todesangst ergriffen werden, so daß ich nicht weiß, wo ich vor Angst hinfliehen soll. Ich kann – und sie lachte halblaut – Alexander mitten in der Nacht wecken, den Armen, und wir zünden die Lampen im ganzen Haus an, während er für mich spielt … Denn ich traue mich einfach nicht, in meinem Bett zu liegen.“
Alle hatten auf Frau Alice geblickt: Eine matte Blässe hatte sich von ihrem Gesicht über ihren Busen bis zum Saum ihres rotbraunen Kleides ausgebreitet:
„Ja“, sagte sie und strich mit der Hand über ihre Stirn, während sie den Ton änderte:
„Das ist wirklich lächerlich.“
Herr Schwitt, der sie weiter betrachtete, sagte mit einem Lächeln, das man kaum sah:
„Das ist nur, weil Sie so stark sind.“
Hr. de Monthieu, der so bleich war, als ob die Blässe von Frau Alice ihn angesteckt hätte, sagte halblaut, während er in die Lüster blickte:
„Ich weiß eigentlich nicht, ob es so schwer wäre, am Abend eines Tages, an dem man gelebt hatte, zu sterben.“
Frau Alice blickte ihn plötzlich an und schlug die Augen wieder nieder.
„Oder, Monthieu“, sagte der Meister, „an einem Abend, wo man nur die anderen hat leben sehen.“
Adelsskjold saß da wie einer, der nichts hört. Sein ganzes Leben war in seinen Augen, die auf Frau Alice weilten, zusammengefaßt.
Dann sagte er:
„Aber nun reisen wir bald in die Normandie.“
Hr. de Monthieu drehte hastig den Kopf zu Adelsskjold:
„Wirklich?“ sagte er.
„Ja“, sagte Adelsskjold: „Das tut allen Nerven gut.“
Aber Hr. Schwitt, der noch beim Thema „Tod“ war, sagte:
„Für mich ist der Tod einfach der letzte Teil des Lebens.“ Während Mikaël, der ständig Frau Adelsskjold ansah, zu ihr sagte:
„Ich habe nie Angst vor dem Sterben gehabt – nicht einmal damals, als ich Typhus hatte und alle glaubten, ich müsse sterben.“
„Warum nicht, Mikaël“, fragte der Herzog, dessen Augen oft gleichsam aus ihrer Trauer erwachten, wenn Mikaël plötzlich etwas sagte.
Mikaël warf den Kopf zurück, so daß das füllige Haar sich auf seinem Kopf wie eine Krone aufbäumte:
„Denn ich wußte genau, ich würde nicht sterben“, sagte er.
Hr. de Monthieu lachte, während Frau Alice, die dem Gespräch eine andere Wendung geben wollte, sagte, während sie ihr Gesicht hob und die Decke betrachtete, wo sich weiße Fayencelilien über einen einzigen mächtigen Spiegel ergossen:
„Wie schön die Lilien doch sind!“
Der Meister, der sich immer noch, nach zwanzig Jahren Weltberühmtheit, geschmeichelt fühlte, wenn jemand das Haus bewunderte, das er für ein paar Millionen errichtet hatte, um es wie „die anderen“ zu haben, auf das Glas zeigte, das das Dienstmädchen gerade mit Champagner füllte:
„Sie sind hübsch“, sagte er und hob das Glas, wo der gelbe Wein in englischem Schliff funkelte. Er hielt einen Augenblick lang das Glas in seiner Hand. Er besaß noch, manchmal, den Drang seiner Väter, sein Eigentum vorzuweisen.
Die Dienstmädchen schenkten weiter Champagner ein, den Hr. Schwitt mit Selters gemischt trank, und Mikaël sagte rasch und laut über die Gläser:
„Sie stammen aus London nach einem Entwurf von Jones9.“
Frau Adelsskjold hob das Glas in ihrem Arm, dessen Ellbogen mit einem blutroten Chiffon verschleiert war, um seinen Schliff gegen das Licht des Leuchters zu betrachten, als sie, nach einem Blick auf Mikaël, lachend zum Meister sagte:
„Mikaël beginnt Augen zu bekommen.“
„Wie?“ fragte Mikaël, während alle lachten und Hr. Schwitt sagte:
„Ja, er wird erwachsen.“
Der Meister lächelte und sagte:
„Frauen hat er immer sehen können.“
Und zu dem selben Gedankengang zurückkehrend, der ihn zuvor auf dem Balkon verfolgt hatte, sagte er:
„Haben Sie noch nie seine Skizzen gesehen?“
„Nein, nein!“ rief Mikaël und sprang vom Stuhl hoch.
Aber der Meister sagte, zum Haushalter gewandt, der breit und wie ein Pfeiler vor der weißen und gewaltigen Anrichte stand:
„Holen Sie sie!“
„Nein, nein!“ rief Mikaël wieder.
„Holen Sie sie!“
Sie lachten alle über Mikaël, der vor Entsetzen feuerrot geworden war.
„Ach, Mikaël, nun wollen wir Ihre Werke sehen“, sagte Frau Adelsskjold, während alle weiterlachten. Adelsskjold lachte immer, als lachte sein ganzer großer Körper, so dröhnend – was plötzlich Frau Adelsskjolds Gelächter zum Aufhören brachte.
„Wir bekommen vielleicht mehr zu sehen“, sagte Schwitt.
Der Haushalter kehrte mit Mikaëls Mappe unter seinem Arm zurück:
„Nein, das nützt nichts, das nützt nichts“, sagte Hr. de Monthieu: „Nun wollen wir sie sehen.“
Mikaël wollte ihm die Skizzen entreißen, aber Monthieu hielt die Mappe fest.
Die Blätter begannen von Hand zu Hand zu gehen, während alle beim Betrachten, einen eigenen Ausdruck in ihre Augen bekamen.
Adelsskjold zog unwillkürlich den Jackenärmel über seine Manschette. Er mußte immer, wenn er etwas unternahm, gleichsam seinen schweren Körper von Kleidern befreien, und er malte immer halb angezogen.
„Wo zum Teufel hat der Junge all dies gesehen?“ sagte er und blickte Mikaël an.
Er führte seine großen Hände in einem Bogen über eine neue Skizze:
„Wo zum Teufel hat er dies gesehen?“ sagte er wieder zum Meister hin, der aufrecht in seinem Stuhl mit dem mächtigen Bart zum Tisch hin saß:
„Wohl in Böhmen“, sagte der Meister, während seine Augen auf Mikaël ruhten, in dessen schmalem Gesicht die dunkelblauen Augen vor Bewegung verschleiert waren.
„Er hat es wenigstens nicht in Träumen gesehen“, sagte Hr. Schwitt, der eine Skizze vor sich hielt, während der Herzog hastig den Blick von dem Blatt, das er in seiner Hand hielt, gehoben hatte und Frau Adelsskjold betrachtete, die ein wenig schnell die Blätter auf das Tischtuch gleiten ließ.
„Ich habe immer gedacht, Mikaël“, sagte Hr. Schwitt und hob seinen Blick von der Skizze auf ihn, diesen Blick, der seine Rasse zu den großen Kritikern der Welt gemacht hat:
„Daß Sie für Frauen gefährlich würden.“
„Warum?“ sagte Mikaël und lächelte in seiner Verwirrung.
Hr. Schwitt ließ das Blatt sinken und sagte mit jenem Klang von Zynismus, mit dem er den Menschen ins Gesicht schlug:
„Weil die Frauen immer wissen, wer bereit ist, ihnen das Ganze zu geben.“
„Und“, fuhr er fort: „Es gibt immer weniger Männer, die das Ganze geben.“
Der Herzog drehte langsam seinen Kopf:
„Glauben Sie?“ sagte er:
„Ich weiß das. Und der Grund ist ganz einfach. Die Männer heutzutage“, sagte Hr. Schwitt, „müssen zu allererst an das Geld denken. Dann bekommen die Frauen die Reste.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Adelsskjold, der den Kopf hob, während er auf seine Gemahlin sah.
„So?“ sagte Hr. Schwitt, und seine Augen glitten kurz an Adelsskjold vorbei: „Aber wahr ist es trotzdem. Ja, einige Männer werden natürlich zu Arbeitstieren, weil sie lieben, und während sie sich abrackern, hören sie auf, geliebt zu werden, weil sie sich abgerackert haben. Das haben Sie davon.“
Es wurde einen Augenblick still am Tisch, während Adelsskjold unwillkürlich mit der Serviette über seine Stirn fuhr, als wäre sie feucht, bevor Frau Alice lächelnd sagte:
„Wie viele Paradoxen“, sagte sie, „stoßen Sie, Hr. Schwitt, wohl täglich jede Stunde aus?“
Entweder hörte Hr. Schwitt es nicht, oder er wollte nicht fortfahren, denn er wandte sich an Mikaël und sagte:
„Mikaël, was meinen Sie?“
Mikaël lachte, während er antwortete:
„Ich verstehe nichts davon.“
Hr. de Monthieu hatte sich hastig zu Adelsskjold gewandt und sprach über ein Buch von Anatole France10, während der Meister, der eine der Skizzen Mikaëls vom Tisch genommen hatte, zu Frau Adelsskjold sagte:
„Schauen Sie sich einmal Mikaël an – – jetzt … Wie er dasitzt. Der Junge hat zwei Gesichter.“
„Ja, eines im rechten Profil und eines im linken“, antwortete Frau Adelsskjold, die wieder den Kopf wandte: „Das habe ich schon immer gewußt. Haben dies eigentlich nicht alle Menschen?“
„Zwei Ausdrücke, doch“ – und der Meister betrachtete aufs neue seinen Pflegesohn, mit demselben Blick wie auf dem Balkon – „aber nicht zwei Gesichter.“
Er drehte etwas Brot in seinen Fingern, so daß es wie Krümel oder Sand auf das Tischtuch fiel, während er weitersprach:
„Aber es stimmt, wir sehen alle nur das Gesicht eines Menschen alle fünf Jahre, und dann sehen wir, es ist ein anderes Gesicht geworden.“
„Ja“, sagte Frau Adelsskjold, die den Meister plötzlich anschaute: „Das stimmt.“
Und kurz darauf wiederholte sie und nickte mit dem Kopf, während sie in die Lampen blickte:
„Das ist wahr.“
Der Meister hatte es nicht gehört. Er hatte die Serviette weggeschoben und stützte den Kopf in seine Hand, als er auf einmal zu Herrn Schwitt hinunter sagte:
„Charles, weißt du, ich habe die Idee zu einem Bild bekommen – – heute – vorhin – –“
Alle am Tisch schwiegen. Es geschah sonst nie, daß Claude Zoret zu anderen als zu Mikaël über seine Bilder redete – nie, nicht einmal zu Charles Schwitt, dem ersten Kritiker, der sein Genie erkannt hatte.
Claude Zoret nahm, fast ohne es zu bemerken, die Seemannspfeife, die neben seinem Gedeck lag und die er immer bei Tisch rauchte, auch wenn er Gäste hatte:
„Weißt du, ich werde Cäsar malen – – ich wollte diesen Mann schon immer malen. Aber jetzt“ – und er betrachtete den Rauch der Pfeife, die er angezündet hatte – „nun weiß ich, wie … Ich will ihn in dem Augenblick malen, wo er verwundet wird – – von einem germanischen Soldaten – einem unwissenden, gemeinen, barbarischen, jungen Soldaten.“
Er verweilte einen Augenblick, bevor er hinzufügte:
„Am Fuß soll er ihn verwunden.“
Sie betrachteten alle Claude Zoret. Seine diamantenähnlichen Augen leuchteten in den Raum, als sähen sie bereits Form und Werden der Gestalten.
Mikaël starrte mit einem Blick auf den Meister, als säße er zu seinen Füßen:
„Wie soll er aussehen?“ sagte er, so leise, als wären die beiden allein.
Aber der Meister brach plötzlich ab und sagte aufgeräumt zu Frau Adelsskjold:
„Dieser Gedanke daran ist schuld, daß ich ein so schlechter Gastgeber bin.“
Und schnell seinen Gedankengang verlassend, ergriffen von dem Drang, Freude zu schaffen, die über ihn kommen konnte – vielleicht auch, weil er selbst in ihr ausruhte – begann er über den Präsidenten der Republik zu sprechen, den er bei einem Gartenfest im Elysee gesehen hatte und rief nach dem Haushalter, dem er eine Weisung zuflüsterte.
Sie redeten alle über den Präsidenten, lustig, mit hellen Stimmen, wie Leute, deren Gedanken verweilen:
„Die Gattin des Präsidenten hatte ein Gesicht wie ein glühendes Bügeleisen, so geschnürt war sie.“
„Aber am lächerlichsten sind ihre Hüte“, sagte Frau Adelsskjold.
„Sie wehen wie der Schwanz des gallischen Hahns“, sagte Hr. de Monthieu.
Hr. Schwitt sagte:
„Ich habe gesehen, wie sie Prämien an französische Mütter, die sieben Kinder bekommen haben, verteilte. Dazu ist sie geboren.“
Der Haushalter kam mit zwei Körben zurück, in denen er ein paar staubige Flaschen brachte, aus denen er selbst den Wein in die aufgetragenen Pokale einschenkte, ein Geschenk des Prinzen von Wales.
„Das ist Burgunder“, sagte Adelsskjold und hob den Pokal, während seine kleinen hellblauen Augen aus Freude ob der Farbe des Weins größer wurden.
„Ja, er ist alt“, sagte der Meister: „Und echt. Diese Traube trägt die Kraft der Erde in sich.“
Gläser und Teller hatte er von sich geschoben, und er saß an seinem Tischende, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, breit wie einer seiner bäuerlichen Väter beim Gastmahl, am Namenstag:
„Dann zum Wohl“, sagte er und erhob sein Glas.
Sie tranken.
Frau Adelsskjold hatte ihren Kopf leicht zurückgebeugt, während sie den duftenden Wein auf ihrer Zunge kostete, bis Charles Schwitt aufsprang und sagte:
„Dann trinken wir auf Cäsar, der vom Germanen verwundet wird.“
Alle standen auf und wandten sich zum Meister, während Adelsskjold, grüßend, das Messer an seinen Teller schlug und Monthieu mit gebeugtem Haupte rief:
„Caesar vivat!“
„Caesar vivat!“ riefen die anderen, während Mikaël den vollen Strom des Weines durch seine schwellende Kehle gleiten ließ:
„Caesar vivat“, rief er und schwang sein Glas: „Vivat Caesar!“
„Mikaël, du wirst betrunken“, rief der Meister.
Und sie lachten alle, während sie zu reden begannen. Frau Adelsskjold fragte – durch eine Gedankenverbindung – Hr. de Monthieu nach einer Luxusausgabe von Paul Bourgets11 Büchern über Italien, und Adelsskjold sprach über eine Ausstellung, die bei Georges Petit12 eröffnet werden sollte.
„Arrangiert nicht Hr. Leblanc sie?“ fragte Schwitt.
„Doch, ich glaube“, sagte Adelsskjold.
„Ich kenne keine lumpigere Person als Leblanc“, sagte Schwitt: „Das müßte dann Mr. George Pinero sein.“
Der Meister verharrte einen Augenblick. Dann sagte er, die Hand auf die Tischkante gestemmt:
„Sind die beiden gemeiner als alle anderen, die die Erde flach treten?
Leblanc“, fuhr er fort, „ist nur das Bild der Masse, und wir bedienen uns seiner, weil er uns gut bedient.“
„Ja“, sagte Adelsskjold, der den Meister vielleicht nicht ganz verstanden hatte: „Ich habe mich mit meinem Arrangement mit Hr. Leblanc gut gestanden.“
Hr. de Monthieu redete über „Le Disciple“13. Aber Frau Adelsskjold sagte:
„Von allen Büchern mag ich „Le Mensonge“14 am meisten.
Hr. de Monthieu erhob seinen Blick:
„‚Le Mensonge‘?“ Es kam etwas zu hastig oder vielleicht erstaunt, denn Frau Adelsskjold sagte, während eine fast unsichtbare Röte über ihre Wangen gezogen war:
„Von allen neuen Büchern.“
„Ich“, sagte der Herzog, „lese sehr oft „Peints par eux-mêmes“15.
Und leiser fügte er hinzu:
„Ich verstehe den Einsatz des ‚Helden‘ so gut.“
Frau Adelsskjold antwortete nicht. Aber am Meister vorbei blickte sie schnell auf Hr. de Monthieus Gesicht, während Claude Zoret sagte:
„Ich lese überhaupt nicht mehr.“
„Wir lesen die Bibel“, rief Mikaël.
„Ja“, sagte der Meister: „Diese Menschen sieht man.“
„Aber“, fuhr er fort und wandte sich zum Herzog, „ich habe gelesen und gelesen, wenn ich nicht malen konnte, um etwas zu sehen, verstehen Sie, um Bilder mit meinen beiden Augen zu sehen. Aber sie zeigen uns nichts – diese Leute machen weder Menschen noch Rot.“
„Wir Böhmerinnen“, sagte Frau Adelsskjold und lachte – sie war eine geborene Rohan16 österreichischer Linie –: „sind nun einmal dem Lesen für immer verfallen.“
Claude Zoret nahm einen Zug aus seiner Pfeife:
„Lesen verdünnt das Blut“, sagte er.
„Ja“, sagte der Herzog und behielt einen Augenblick lang die Augen weit geöffnet.
„Worüber redet ihr?“ sagte Claude Zoret zu Herrn Schwitt.
Sie redeten wieder über Ausstellungen.
Hr. Schwitt sagte:
„Über Melbourne.“
„Ja“, sagte der Meister, „nun muß man auch in Australien verkauft werden.“
Mikaël sagte zu Herrn Adelsskjold hinüber:
„Die Kritiken sind gekommen. Wir bekamen sie heute.“
„Aus Melbourne? Sind sie gekommen?“ – Adelsskjolds Worte stolperten fast übereinander –: „Ich habe sie nicht bekommen.“
Und fast mit Schweiß auf seiner Stirn, fieberhaft, sagte er, der täglich stundenlang über Ausschnitten von Werbeanzeigen aus zwei Erdteilen gebeugt saß, (von der Angst gepeinigt, daß dies gesagt werden sollte, was sein einziger Gedanke war, daß er zurückging, daß er sich selbst wiederholte, daß er sich zurückzog):
„Was stand dort?“
Und Mikaël, der rot wurde, weil er es kaum gelesen hatte, sagte:
„Dort stand eine ganze Menge. Aber am Schluß stand dort: ‚Es gibt keinen größeren Virtuosen der Schilderung von Frankreichs Landschaft als diesen Mann aus dem Norden.‘“
Adelsskjold hatte seine Serviette zerknüllt:
„Virtuose, Virtuose“, sagte er, für den es kein Wort gab, das ihn stach wie dieses eine, das die Kritiker zu wiederholen begonnen hatten und das für ihn wie der erste Vogelschrei des Rückschritts klang: Technik wird bald ein Verbrechen.
„Wo sind sie?“ sagte er zu Mikaël, und, zu Schwitt gewandt, fuhr er fort:
„Wenn man diese Leute liest, könnte man glauben, Talent sei, nichts zu können.“
„Wo sie sind“, sagte der Meister zum Tisch hinab: „Sie sind verbrannt. Ich wollte diese Papiere nicht im Hause herumliegen haben. Ich lese sie doch nie. Mikaël stopft mich genug.“
Adelsskjold sagte:
„Man muß doch wissen …“
Der Meister stopfte mit dem Daumen langsam den Tabak fester:
„Wissen, was denn? Die Alten hat man, und sie kennt man. Sie haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht.“
Plötzlich lachte er und mit dem Hohn, der auf einmal seinen Nächsten wie ein Peitschenschlag treffen konnte, sagte er:
„Ich weiß sehr gut, Schwitt meint, ich sei ein Genie.“
Und etwas leiser sagte er:
„Es ist sogar Teil seines Lebensunterhalts, dies zu meinen.“
Schwitt war unter seinem Bart weiß geworden und bog die Speisekarte, so daß sie brach:
„Ja, ich schrieb über dich in den Sous- Tagen17“, sagte er.
Einen Augenblick errötete das Gesicht des Meisters, aber Adelsskjold sagte, ohne an Hr. Schwitts Alter zu denken:
„Es sind wohl auch die Jüngeren, die man liest.“
„Von den Jungen“, antwortete der Meister, und seine Stimme klang wieder wie gewöhnlich, „lernt man auch nichts. Sie sagen auch nicht die Wahrheit. Und das können wir auch nicht verlangen. Sie müssen ja Platz für sich und die ihrigen haben.“
Er lachte auf einmal erneut, breit und aus ganzem Herzen:
„Die Jungen müssen unser Blut sehen, damit das Publikum sie sehen kann.
Nun“, sagte er und seine Stimme veränderte sich, während Mikaël ihn mit seinen großen Augen ansah:
„Wenn man nicht mehr malen kann, hat man wohl aufgehört zu malen.“
Hr. Schwitt stieß mit seinem Glas gegen das Mikaëls, während auch er seine Augen auf Claude Zoret richtete.
Aber Frau Adelsskjold sagte zum Meister:
„Aber ist das wahr, was Frau Simpson sagte, daß Sie in diesem Jahr endlich ausstellen wollen?“
„Wo?“ sagte der Meister.
„Hier, in Ihrem Atelier.“
„Nein“, sagte Claude Zoret, der nie mehr in Paris ausgestellt hatte seit der Schmach mit den Sous, die die Pariser ihm in seiner Jugend zugefügt hatten, und er legte die Pfeife auf den Tisch: „Das bekommen Sie nicht zu sehen.“
Einen Augenblick später sagte er:
„Es ist verrückt genug, daß man verkaufen muß.“
„Danke“, rief Adelsskjold, „das verstehe ich ganz und gar nicht.“
Und während er seinen großen Körper aufrichtete und sein Gesicht fast jung wurde, sagte er:
„Ich glaube, daß solch eine Probe“ – und er schlug die Hände heftig zusammen – „gleichsam das gewisse Siegel darauf ist, daß man da ist und noch etwas taugt.“
„Ja“, sagte Mikaël, als sähe er einer Seifenblase nach, die er gepustet hätte: Geld.“
Schwitt wandte ihm das Gesicht zu, fast erstaunt:
„Kümmern Sie sich um Geld?“ sagte er und sah ihm ins Gesicht.
„Ja“, antwortete Mikaël etwas hastig: „denn ich habe ja nie welches gehabt.“
Aber der Meister sagte am Tischende:
„Hm, ich kann versichern, daß wenn die Amerikaner“ – und es war, als kochte in ihm ein plötzlicher Aufruhr hoch – „hierher kommen, um zu kaufen, ich oft Lust hätte, ihnen direkt ins Gesicht zu schlagen und ihnen mit ihren eigenen Dollars den Rücken auszupeitschen.
„Ach ja“, sagte er und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch: „Es ist schön, im Museum in St. Louis zu hängen und von einigen Viehhirten in Illinois beglotzt zu werden.“
Adelsskjold sagte und fuhr mit der Hand aus:
„Sie sind es aber doch, die uns leben lassen – leben wie wir tun. Das sind die Käufer. Das ist der Markt – dort drüben.“
„Ja“, sagte der Meister, „und wir sind die Zauberer, die die bemalte Leinwand aus unseren Mündern ziehen.“
Schwitt lachte:
„Nun bist du in Fahrt“, sagte er und notierte in seinen Gedanken den Gang des Gesprächs für die Tagebücher, die er über den Meister führte und die seines Lebens Hauptwerk werden sollten: „Nun lösen sich die Siegel von deinem Mund.“
Der Meister vernahm ihn nicht:
„Nein, das waren andere Zeiten“, sagte er, „als man ein Bild für zweihundert Francs18 an einen Freund, der es zu würdigen wußte, verkaufen konnte.“
Er schwieg, während Hr. de Monthieu ganz leise sagte:
„Wie ich Sie verstehe.“
Frau Adelsskjold beugte den Kopf:
„Ich auch“, flüsterte sie.
Der Meister hatte auf einmal den Gedanken gewechselt, und zu Mikaël gewandt sagte er:
„Was stand da von Ulpiano Checa19?“
„Wo?“
„In diesen Zeitungen.“
„Ich weiß nicht“, antwortete Mikaël: „Ich habe nichts gesehen.“
Schwitt hatte seine Augen erhoben und blickte den Meister an.
„Sonst siehst du alles“, sagte Claude Zoret und stieß den Rauch aus seiner Pfeife in den Duft der Veilchen, der gleichsam wie eine Wolke auf dem Tisch lag.
Hr. de Monthieu sagte:
„Ja, seine ‚Wettfahrt‘ vergißt man nicht.“
„Aber er beherrscht nie seine Farbe“, sagte der Meister, den Schwitt beständig ansah.
„Noch nicht“, sagte der Kritiker plötzlich und beugte sich vor, um die afrikanischen Trauben in seinen Wein zu tauchen.
Der Haushalter schenkte den Madeira ein, der wie eine gelbe Flamme in den Gläsern leuchtete.
Adelsskjold sagte:
„Diese Spanier haben immer Anstand“, während Frau Adelsskjold zum Meister sagte:
„Ist es wahr, Sie sollen Prinzessin Lucia Zamikof malen?“
Man hörte die Antwort des Meisters nicht, während Adelsskjold weiter laut mit kleinen roten Flecken auf seinen Wangen über Benlliure y Gill20 und die Spanier redete, und Hr. Schwitt den Namen Zamikof aufgriff und sagte:
„Ja, wie ist sie eigentlich? Ich hörte in Sankt Petersburg so viele Geschichten.“
Frau Adelsskjold antwortete:
„Ich kenne sie so wenig.“
Mikaël, der einen Strauß Veilchen in die Hände genommen hatte, um sein Gesicht zu kühlen, schnarrte das Wort Zamikof zu Hr. de Monthieu hinüber, während Herr Schwitt, der kopfschüttelnd seinen Kopf über den Tisch beugte, sagte:
„Aber sie ist doch unglaublich reich.“
„Vielleicht“, sagte Frau Adelsskjold mit ganz spitzen Lippen.
Aber Hr. Schwitt begann, zurückgelehnt, über Petersburg, die Eremitage und die slawischen Frauen zu reden. Es waren überhaupt nur die slawischen Frauen. Allein ihre Haltung in einem Wagen zu sehen, nur die Bewegungen ihrer Arme zu erblicken, nur wie sie ihren Nacken erhoben …
Sie schwiegen alle, während Hr. Schwitt weiterredete mit Augen, als sähe er die Frauen vor sich, und seine Hand durch die Luft führte, als wollte er ihre Linien zeichnen:
„Und wie sie gehen“, sagte er: „Sie gehen wie Perserinnen.“
Er redete noch über Fürstin Ruschewkin:
„Haben Sie sie gesehen?“ sagte er zu Hr. de Monthieu, der keine Antwort gab, aber nur, unter halbgeschlossenen Augenlidern, auf die Rubinstickerei auf Frau Adelsskjolds Brust starrte. Charles Schwitt redete weiter über Prinzessin Demidoff, über die Schönheiten des Hofes, als strahlten ihre Körper vor seinen Augen – während Mikaël, vor sich hinlächelnd, die Veilchen an seine Wangen drückte, und Adelsskjold, mit seiner großen Hand auf eine der hohen Karyatiden21 der silbernen Blumenschalen gestützt, seine Gemahlin unaufhörlich mit Augen betrachtete, die nichts sahen außer ihrem schönen Gesicht, das sie plötzlich unter Hr. de Monthieus Blick gesenkt hatte.
Der Meister saß nur unbeweglich und blies Rauchwolken aus seiner Pfeife in die Luft als große Ringe, die sich in bläuliche Schlangen auflösten und davonwaberten.
Der Haushalter hatte die große Tür geöffnet, und Claude Zoret stand auf, während Hr. Schwitt schwieg und der Meister sagte:
„Dann wollen wir aufstehen.“
Und mit einer alten Gastmahlsformel aus seiner Heimat, fügte er hinzu:
„Und dafür danken, daß wir leben.“
Er leerte sein Glas.
Aber während er Frau Adelsskjold den Arm bot, sagte er zu Herrn Schwitt:
„Er dort wird doch nie alt.“
Und er begann zu lachen:
„Meinen Frieden soll Frau Lucia wenigstens nicht stören.“
Aber Adelsskjold blieb plötzlich auf dem mittleren Treppenabsatz stehen und sagte zu Hr. de Monthieu, während er im direkt ins Gesicht schaute:
„Gott helfe mir, wie schön meine Frau ist.“
Hr. de Monthieu blickte an der Seite Mikaëls vom Treppenabsatz aus, der zum Atelier führte, über die Wohnstube: Frau Adelsskjolds Schleppe hatte fast dieselbe Farbe wie der Teppich. Nun nahm sie neben dem Meister Platz. Und Hr. de Monthieu blickte zu Hr. Schwitt hinüber, der, an den Fuß von „Die Dame mit der Maske“ gelehnt, die ihren Bronzekörper unter zwei Palmen erhob, mit Herrn Adelsskjold fast so laut sprach, daß es oben zu hören war.
Hr. de Monthieu sagte:
„Warum will der Meister eigentlich Prinzessin Zamikof malen?“
Mikaël, der die Beine an das goldene Geländer der Treppe schlug, sagte:
„Niemand hat gesagt, er wolle sie malen. Sie kommt heute abend nur hierher.“
Und während er weiter mit seinen Beinen gegen das Geländer trat, sagte er:
„Wir haben sie doch noch nie gesehen.“
Hr. de Monthieu lächelte:
„Sie haben Sie schon hundertmal gesehen, Mikaël“, sagte er, und fügte hinzu, während das Lächeln von seinen Lippen, die wie bei allen Monthieus etwas zu schwellend waren, verschwand:
„Aber wir sehen wohl alle nur eine Sache – –“
Mikaël hatte dies sicher gar nicht gehört. Er sagte, während er ständig wie ein großer, langer Junge mit den Beinen an das Geländer schlenkerte:
„Wie hübsch Frau Adelsskjold ist!“
„Ja“, sagte Hr. de Monthieu und merkte selbst nicht, daß er dies gesagt hatte.
„Mikaël!“ rief der Meister die Treppe hinauf: „Weißt du, wo meine Studien vom Hradschin sind?“
„Ja“, antwortete Mikaël und sprang vom Geländer.
Er war im Gesicht blutrot geworden wie ein Dieb, der auf der Tat ertappt wird: Er hatte sie eines Tages gefunden, zwischen anderen Studien, und sie weggelegt.
„Wo sind Sie denn?“ fragte der Meister.
„Ich hole sie“, antwortete Mikaël und lief die Treppe hinauf ins Atelier, wo er aus einem Schrank in einer Ecke eine Mappe aus einer halbversteckten Schublade zog.
„Er hebt zuletzt auch noch seine Mallappen auf “, sagte Hr. Schwitt halblaut zu Adelsskjold.
Mikaël kehrte mit der Mappe zurück, und der Meister band sie auf. Sie versammelten sich alle um den Tisch, wo Claude Zoret die Studien ausbreitete, Studie auf Studie plötzlich wieder erkennend:
„Ja, das war das“, sagte er und erinnerte sich auf einmal an sein eigenes Werk, das er mehr als halb vergessen hatte:
„Aber da war eine“ – und er suchte zwischen den Skizzen – „von den Sarkophagen.“
„Die kommt jetzt“, sagte Mikaël und kramte zwischen den Studien wie einer, der mit kundigen Händen kramt:
„Aber da ist eine andere vom Chor“, sagte er und suchte sie.
Der Meister legte sie vor sich, und als wäre sie von einem Fremden gemalt, von einem anderen, sagte er:
„Ja, sie ist gut – sie ist gut.“ Und er schob sie zu Frau Adelsskjold hin, die jede Studie lange in ihrer Hand hielt, bevor sie sie langsam an Hr. de Monthieu weiterreichte:
„Ja“, sagte sie, „das sind die Sarkophage.“
„Wie“, – und ihre Stimme hatte den Klang desjenigen, dessen Gedanken auf etwas zurückgehen, was längst vorbei ist – „schön es doch ist.“
„Aber hier ist die andere“, sagte Mikaël und zeigte ein neues Blatt.
Der Meister blickte plötzlich auf und sagte:
„Wo hast du die Blätter so lange gehabt?“
„Ich“, sagte Mikaël, und mit einem kleinen Ruck verbarg er sein Gesicht mit den Studien, bevor er fortsetzte, „ich habe sie nicht gehabt.
Ich“, sagte er und log den Meister an, gewiß zum ersten Mal: „Ich fand sie erst kürzlich.“
„Ja dann“, sagte der Meister und blickte ihn unverwandt an.
Schwitt, der aufstand und die Skizzen mit einem eigentümlichen Blick wie Gerard Dows „Arzt“22 die Flüssigkeit in dem erhobenen Glas betrachtete, sagte, während er „Die Sarkophage“ in seiner Hand hielt:
„Diese Schweden haben trotzdem der Menschheit einen Dienst erwiesen.“
Und als Adelsskjold lachte, sagte er:
„Doch, die Verstümmelungen Ihrer lieben Landsleute haben sie viel schöner gemacht.“
Und er begann, während er beständig die Studien ansah, die bei ihm im selben Augenblick und unwillkürlich eigene und weit reichende Gedanken in Gang setzten, über historische Verstümmelungen zu sprechen, wo die Barbarei unwissend neue Schönheit geschaffen habe.
Aber Mikaël hatte eine neue Studie ergriffen:
„Das ist ‚Die Mauer‘“, sagte er und behielt die Studie einen Augenblick in seiner Hand, bevor er sie Frau Adelsskjold reichte.
Es war das Bild „Die Mauer“, worüber er in den drei Jahren, seit er die Studien vom Hradschin fand, am meisten gebeugt saß, wenn er in heimlichen Stunden von dem überfallen wurde, wovon er glaubte, es sei Heimweh.
„Erkennen Sie ‚Die Mauer‘ wieder?“ fragte er.
Frau Adelsskjold nahm die Studie mit ihrer langen schmalen Hand, die, wenn sie sie hob, merkwürdig müde von ihrer eigenen Diamantenbürde zu sein schien:
„Ja“, sagte sie, und ihre Stimme klang, als gliche sie auf einmal ganz der Mikaëls: „Das ist die Mauer auf dem Hradschin.“
Adelsskjold hatte sich genähert – unwillkürlich und mit zwei Schritten – und berührte mit seiner warmen Hand ihre Schulter, ganz sachte, aber etwas hastig. Aber Frau Adelsskjold rückte, ohne es zu bemerken, mit der Schulter eine Handbreit weg, während sie die Studie Hr. de Monthieu weiterreichte:
„Ist sie nicht schön?“ sagte sie.
„Wunderschön“, sagte der Herzog und ergriff die Studie, während seine und Frau Adelsskjold Hand eine Sekunde dasselbe Bild hielten.
Frau Adelsskjold blieb mit dem Kopf zurückgeneigt sitzen. Dann sagte sie, mit derselben Stimme wie vorher, zum Meister gewandt:
„Haben Sie das Schloß der Rohans22 in Böhmen nie gesehen?“
„Nein“, antwortete Claude Zoret, der die Studien nicht mehr weiter betrachtete, als wäre er bereits von diesem hier, was längst fertig war, ermüdet: „Ich hatte nie die Gelegenheit, dorthin zu kommen.“
Frau Adelsskjold blieb in derselben Stellung sitzen:
„Ich glaube, das ist Böhmens schönster Fleck.“
Und kurz darauf fügte sie in verändertem Ton hinzu:
„Ein Flügel des Hauses ist von Böhmens alten Königen erbaut.“
„Ich habe so viel über den Rittersaal gehört“, sagte Hr. de Monthieu.
„Haben Sie?“ sagte Frau Adelsskjold und blickte ihn an, fröhlich, wie wenn man auf einen Menschen trifft, der etwas kennt, was man liebt.
Aber der Meister sagte mit einer Stimme, die die Worte über einen heimlichen und unwillkürlichen Zorn spannte:
„Ja, die alten Steine, die zusammengekarrt wurden, machen sich gut in der Landschaft.“
Frau Adelsskjold hatte dies kaum gehört. Sie wandte den Kopf zu ihrem Mann und sagte, sehr milde:
„Alexander, du solltest einen Sommer an der Moldau malen.“
„Ja“, sagte Adelsskjold, in dessen Gesicht es plötzlich beim Klang der Worte seiner Gemahlin aufleuchtete: „Du weißt, das habe ich schon lange gewollt.“ In Wirklichkeit hatte er es nie gewollt, aus einer verborgenen Eifersucht oder vielleicht aus Angst vor der Heimat seiner Gemahlin.
Der Herzog hatte sich abgewandt und hörte Hr. Schwitt zu, der über den Dom in Agram23 redete.
Keiner betrachtete mehr die Skizzen, mit Ausnahme Mikaëls, der, beim Licht einer Stehlampe, die Bilder vor seine Augen hielt, während sich in dem bleichen Gesicht sein Mund, dessen Form sich beständig änderte, unter einem Lächeln bog, als weilte er in glücklichen und vergangenen Erinnerungen.
Der Meister hatte sich erhoben und blickte Mikaël an:
„Leg sie auf die Seite“, sagte er, und es klang aufs neue wie eine plötzliche Erbitterung in seiner Stimme.
„Ja“, sagte Mikaël, dessen Gesicht sich veränderte, als wären alle Zügel an einer unsichtbaren Schnur zurechtgezogen worden.
Aber Adelsskjold, der immer sehr schnell müde wurde, die Arbeit anderer zu betrachten, von Ungeduld wegen seiner eigenen ergriffen, sagte, und hatte ganz die Stimmung geändert, zu Mikaël:
„Haben Sie sie alle verbrannt?“
„Was?“ fragte Mikaël.
„Die Zeitungen? Aus Melbourne?“
„Ja“, sagte Mikaël und lachte (er hatte diese Angewohnheit, oft Adelsskjold ins Gesicht zu lachen, woran vielleicht der Meister Schuld war, dessen innerste Meinung über „Adelsskjolds Farben“ er kannte): „Sie sind leider verbrannt.“
„Aber was stand drin?“ sagte Adelsskjold wieder.
Und auf Mikaëls Antwort begann er wieder über die Technik zu reden:
„Warum nennen sie uns nicht genauso gut Handwerker?“ sagte er: „Einfach Handwerker – warum nicht? Das ist doch ihre Meinung von allen denen, die etwas können.“
Frau Adelsskjold, die die Worte ihres Mannes hörte und die vielleicht unterbrechen wollte, sagte zu Hr. de Monthieu ein wenig laut:
„Wir reisen wirklich diesen Sommer in die Normandie.“
Hr. de Monthieu neigte den Kopf und sagte halblaut:
„Das hätte ich nicht gedacht.“
„Warum nicht?“ fragte Frau Adelsskjold wie jemand, der nicht begreift.
Hr. de Monthieu sagte verwirrt:
„Ich weiß es nicht.“
Und mit einer Anstrengung fügte er einen Augenblick später hinzu, wie der, der sich unterhält, hinzu:
„Wir haben ein Landgut dort.“
„So?“ sagte Frau Adelsskjold:
„Ja, richtig, das haben Sie ja. Ich weiß es.“
Und wie um für die Gleichgültigkeit zu büßen, mit der sie fühlte, daß sie gesprochen hatte, sagte sie:
„Was hat man Ihnen eigentlich geweissagt, Herzog?“
Hr. de Monthieu blickte in die Stube und sagte, während seine Lippen sich kräuselten:
„Etwas sehr Glückliches.“
„Ja dann …“
„Und“, fuhr der junge Herzog mit derselben Stimme fort: „Etwas, das nie eintreffen wird.“
Frau Adelsskjold blickte wie schon vorher bei Tisch auf das gesenkte Gesicht des Herzogs – vielleicht war es der Klang der Stimme, der sie dazu veranlaßte – und sagte:
„Warum sollte es denn nicht eintreffen? Sie, die an Wahrsagungen glauben.“
Die Lippen des Herzogs zitterten, so wenig, daß man es kaum sehen konnte:
„Weil es Dinge gibt, von denen man weiß, das sie nie eintreffen können.“
Und fast wie um für etwas zu trösten, was sie nicht wußte, was es war, sagte Frau Alice, dem Gespräch eine Wendung gebend:
„Wo liegt eigentlich ihr normannisches Landgut?“
Hr. de Monthieu, der sich setzte, nannte den Ort.
Er hatte nach dem Tode seines Vaters den größten Teil seiner Kindheit dort verbracht, allein zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester. Eichen standen dort im Park, es war fast die einzige Stelle in Frankreich. Es ging die Sage, sie stürben ab, wenn der letzte Monthieu starb. Das war merkwürdig, der Blitz hatte nicht weniger als fünf Eichen in dem Sommer gespalten, wo seine einzige Schwester starb, die Marquise de Beaupaire.
„Ist es nicht fünf Jahre her, daß Ihre Schwester starb?“ sagte Frau Adelsskjold.
„Doch, fünf Jahre.“
„Und Sie war doch so jung …“
Frau Adelsskjold hatte ihre Schultern gehoben, als hätte sie die Zugluft einer offenen Tür gestreift.
„Ja, so jung“, sagte der Herzog, und, den sehr schlanken Körper ehrerbietig im Stuhl nach vorne gebeugt, erzählte er wieder vom Schloß zuhause. Keine Bäume liebte er so wie Eichen. Sie waren so stark, die Eichen. Und mit einem Lächeln, so traurig, wie es sich nur bei Menschen der alten Rassen findet, die offenbar alles gesehen und alles getragen haben, was hier in der Welt ihre achtzehn Ahnen zusammen sahen und trugen, sagte er plötzlich mit einem Gedankensprung, den Frau Adelsskjold verstand:
„Als Kind hat man so viele Träume.“
„Ja.“
Frau Adelsskjold hatte ihren Kopf zurückgebeugt, so daß das Gesicht im Schatten der großen Palmen hinter ihrem Stuhl war, und bei dem einen Wort hatte ihre Stimme ein klein wenig gezittert.
„Aber der Stolz meiner Mutter“, fuhr der Herzog fort, „ist eine Akazienallee. Sie wurde an ihrem Hochzeitstag gepflanzt.“
Frau Adelsskjold hielt einen Augenblick inne. Dann sagte sie, immer noch mit nach oben gewandtem Gesicht:
„Nirgendwo sind die Akazien so schön wie in Böhmen.“
Der Meister und Schwitt, die in dreißig Jahren einander nie hatten entbehren können und die sich selten etwas zu sagen gehabt hatten, hatten fünf Worte gewechselt und waren vor einem Wandtisch stehengeblieben, auf dem Porzellan aus Sèvres24 stand; während Adelsskjold, der in Gesellschaften, wo es sich nicht um mögliche Geschäfte drehen konnte, leicht schläfrig wurde, in einem Stuhl saß, wo sein massiver Körper schwer hineingefallen war.
Hr. de Monthieu redete von der Klosterschule für Waisen, die seine Mutter zuhause errichtet hatte, und er sagte, nachdem er etwas geschwiegen hatte:
„Wie doch alle solche Erinnerungen einen Menschen binden.“
Frau Adelsskjold neigte ihren Kopf wie zu einem stummen Ja, und auf einmal sagte sie, ohne die Stellung zu verändern:
„Das ist merkwürdig. Die Gesellschaft zu wechseln, ist fast wie das Vaterland zweimal zu wechseln.“
Es war, als wollte sie ihre eigenen Worte anhalten, als sie bereits gesagt waren, während sich eine schnelle Röte über Hr. de Monthieus Gesicht ausbreitete, der mit einem Ruck den Kopf erhoben hatte.
„Ja“, erklang es plötzlich hinter ihnen.
Es war Mikaël, und die beiden fuhren zusammen. Sie wußten nicht, daß jemand so nahe bei ihnen stand. Aber Mikaël sagte verwirrt und vielleicht, um einen Ausweg zu finden:
„Können Sie, Frau Adelsskjold, nicht auch aus der Hand lesen?“
„Ganz wenig“, antwortete Frau Adelsskjold, die mit einem Lächeln bereits ihr Gesicht verändert hatte.
„Lesen Sie dann aus meiner“, sagte Mikaël und streckte die Hand vor.
Frau Adelsskjold ergriff sie und betrachtete einen Augenblick die Handfläche im Licht der Lampe.
Dann ließ sie sie plötzlich los, so daß der ganze Arm auf Mikaëls Körper zurückfiel.
„Wie brutal Ihre Hand ist, Mikaël“, sagte sie.
Und während sie das Unbehagen vernahm, das durch ihre Worte erklungen war, fügte sie lachend hinzu:
„Ich kann überhaupt nicht aus der Hand lesen, Mikaël.“
Mikaël hatte seinen Mund geöffnet, aber schloß ihn wieder: Es schien, als ob sich das ganze Blut seines Gesichts in seinen dunkelroten Lippen gesammelt hätte.
„Was las sie?“ fragte plötzlich der Meister.
Aber Mikaël gab keine Antwort.
Er ging weg.
Frau Adelsskjold sagte, vielleicht um dem unbestimmten Mißbehagen zu entrinnen, das sie noch spürte:
„Was aber hat man Ihnen, Hr. de Monthieu, geweissagt?“
Der junge Herzog hob seine Augen fast unmerklich.
„Daß der letzte Monthieu“, sagte er und blickte ihr ins Gesicht, „ein großes Glück teuer bezahlen muß.“
Frau Adelsskjold lachte einen Augenblick, bevor sie ihren Fächer zusammenfaltete:
„Aber ist das nicht eine schöne Weissagung?“ sagte sie und sprach auf einmal so kalt, als empfinge sie eine steinreiche Amerikanerin in ihrem Salon.
Sie schwiegen, bis der Herzog sagte – vielleicht hatte er Frau Adelsskjolds veränderten Ton nicht bemerkt oder möglicherweise voller Furcht gewagt zu erraten, was er verstecken könnte –:
„Wenn Sie in die Normandie kommen, würde es meine Mutter freuen, Sie und Herrn Adelsskjold zu sehen.“
Frau Adelsskjold sagte und schien zerstreut:
„Wir kommen vielleicht gar nicht hin. Wir kommen nie dahin, wo wir wollen.“
Und in einem neuerlich veränderten Tonfall, der beinahe irritiert erschien, fügte sie hinzu:
„Wir kommen hin, wo mein Mann ein Motiv findet. Unser Leben ist eine Eisenbahnreise, wo Alexanders Motive die Bahnhöfe sind.“
Hr. Schwitt ging durch das Zimmer zu ihnen:
„Ich habe lange auf Sie geblickt“, sagte er, und es trat ein Glanz in seine Augen wie in die eines Nagetiers, während er in Hr. de Monthieus Gesicht blickte: „Sie sind wirklich ein schönes Werk aus sechs Jahrhunderten.“
Hr. de Monthieu, der manchmal gleichsam ob Hr. Schwitts gesellschaftlicher Freimütigkeiten ganz verwirrt war, sagte, nachdem er sich eine Sekunde lang in die schwellenden Lippen der Monthieus verbissen hatte:
„Die Jahrhunderte, Hr. Schwitt, verschönern die Rassen nicht immer.“
Und nachdem er noch einige weitere Worte gesagt hatte, ging er, während Hr. Schwitt, dessen Gesicht einen Augenblick unter dem Bart gezittert hatte, sich setzte und sagte:
„Ich kann nicht vergessen, gnädige Frau, daß Sie vor dem Tod so viel Angst haben.“
Frau Adelsskjold sagte, den Fächer bewegend:
„Warum gerade – daß ich?“
„Weil“, sagte Hr. Schwitt (und es blitzte in seinen Augen etwas von dem vorangehenden Hohn auf, der ihn vierzig Jahre lang für so viele Frauen unwiderstehlich gemacht hatte –): „Weil die Todesangst ein Symptom bei denen zu sein pflegt, die noch nicht satt sind … vom Leben.“
Frau Adelsskjolds Fingernägel hatten sich durch ihre Handschuhe gebohrt. Aber sie antwortete, während ihre Stimme ganz ruhig klang:
„Sie sollten eigentlich überhaupt nicht die Erlaubnis haben, über unsere Türschwelle zu kommen, Hr. Schwitt. Sie machen wirklich viel zu viele Beobachtungen.“