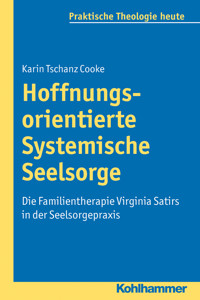
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Um heutigen Kontexten und Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Identität nicht zu verlieren, schlagen Theologie und Kirche vielfach neue Wege ein. Einen dieser neuen Wege im Bereich der Seelsorge beschreitet die vorliegende Arbeit. Sie stellt das Konzept der hoffnungsorientierten systemischen Seelsorgepraxis vor und beschreibt Erkenntnisse über das Miteinander von Therapie und Seelsorge. Dabei werden ausgewählte therapeutische Konzepte, Methoden und Interventionen der Familientherapie von Virginia Satir (1916-1988) in den Ansatz der Systemischen Seelsorge integriert mit dem Ziel, die Systemische Seelsorge durch die familientherapeutischen Erkenntnisse Satirs zu bereichern und zu erweitern, wobei das Proprium der Systemischen Seelsorge definiert und bewahrt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Um heutigen Kontexten und Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Identität nicht zu verlieren, schlagen Theologie und Kirche vielfach neue Wege ein. Einen dieser neuen Wege im Bereich der Seelsorge beschreitet die vorliegende Arbeit. Sie stellt das Konzept der hoffnungsorientierten systemischen Seelsorgepraxis vor und beschreibt Erkenntnisse über das Miteinander von Therapie und Seelsorge. Dabei werden ausgewählte therapeutische Konzepte, Methoden und Interventionen der Familientherapie von Virginia Satir (1916-1988) in den Ansatz der Systemischen Seelsorge integriert mit dem Ziel, die Systemische Seelsorge durch die familientherapeutischen Erkenntnisse Satirs zu bereichern und zu erweitern, wobei das Proprium der Systemischen Seelsorge definiert und bewahrt wird.
Dr. theol. Karin Tschanz Cooke ist Spitalpfarrerin, Systemtherapeutin und Supervisorin in Aarau; Co-Studienleitung in Systemischer Seelsorge, Universität Bern; Leitung Palliative Care Reformierte Landeskirche Aargau.
Karin Tschanz Cooke
Hoffnungsorientierte Systemische Seelsorge
Praktische Theologie heute
Herausgegeben von Gottfried Bitter Kristian Fechtner Ottmar Fuchs Albert Gerhards Thomas Klie Helga Kohler-Spiegel Isabelle Noth Ulrike Wagner-Rau Band 129
Karin Tschanz Cooke
Hoffnungsorientierte Systemische Seelsorge
Die Familientherapie Virginia Satirs in der Seelsorgepraxis
Verlag W. Kohlhammer
Meinem Mann, Timothy, und unseren Kindern Julian und Nathalie gewidmet.
Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Reproduktionsvorlage: A und O Textservice, Dr. Katrin Ott Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-023010-1
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-026419-9
epub:
978-3-17-027180-7
mobi:
978-3-17-027181-4
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
1. Vorbemerkungen
1.1 Fragestellung
1.2 Abgrenzungen
1.3 Die Quellen
1.4 Vorgehen
1.5 Ziele dieser Arbeit
2. Das persönliche Umfeld Virginia Satirs: Eine Kurzbiographie
2.1 1916–1935: Ginny Pagenkopf
2.2 1936–1941: „Miss Peggy“
2.3 1941–1950: Peggy Rogers
2.4 1951–1958: Die Pionierjahre Virginia Satirs als Familientherapeutin in Chicago und die Ehe mit Norman Satir
2.5 1959–1988: Virginia Satirs Wirken als Familientherapeutin, Dozentin und Ausbildnerin in Kalifornien und weltweit
3. Das professionelle Umfeld Virginia Satirs: Die Entwicklung der Familientherapie
3.1 Das psychotherapeutische Umfeld vor der Entstehung der Familientherapie
3.2 Die Entstehung der Familientherapie
4. Virginia Satir: Die Entwicklung ihrer Familientherapie während der fünf Berufsetappen ihres Wirkens
4.1 Erste Berufsetappe 1936–1950: Virginia Satirs Tätigkeit als Lehrerin und Sozialarbeiterin
4.1.1 Das professionelle Umfeld
4.1.2 Die prägenden Einflüsse von Freud, der Sozialarbeit, der Child-Guidance-Bewegung und der Gruppentherapie
4.1.3 Erste Bewegungen Satirs in Richtung Familientherapie
4.2 Zweite Berufsetappe 1951–1956: Virginia Satirs eigenständige Pionierarbeit als Familientherapeutin in Chicago
4.2.1 Das professionelle Umfeld
4.2.2 Die prägenden Einflüsse von Adler, Rank, Moreno, Rogers und Maslow
4.2.3 Die Entwicklung der Familientherapie Satirs 1951–1956
4.3 Dritte Berufsetappe 1957–1962: Satirs Begegnung mit den Pionieren der Familientherapie und ihre Zusammenarbeit am „Mental Research Institute“ (MRI) in der Palo-Alto-Gruppe
4.3.1 Das professionelle Umfeld
4.3.2 Die prägenden Einflüsse: Die Vorläufer und die Pioniere der Familientherapie
4.3.3 Die Entwicklung der Familientherapie Satirs 1957–1962
4.4 Vierte Berufsetappe 1963–1969: Virginia Satir am Esalen Institut in Big Sur
4.4.1 Das professionelle Umfeld
4.4.2 Die Entwicklung der Familientherapie Satirs 1963–1969
4.5 Fünfte Berufsetappe 1970–1988: Virginia Satirs internationale Tätigkeit
4.5.1 Das professionelle Umfeld
4.5.2 Die Entwicklung der Familientherapie Satirs 1970–1988
5. Virginia Satirs Systemische Familientherapie: Genuin Satir
5.1 Satirs Weltanschauung, Werte und Spiritualität
5.1.1 Satirs Gottesbild
5.1.2 Satirs Menschenbild
5.1.3 Satirs Verständnis von Tod und Leben (nach dem Tod)
5.2 Satirs Grundhaltungen in ihrer Familientherapie
5.2.1 Verbundenheit
5.2.2 Wertschätzung
5.2.3 Kongruenz
5.2.4 Vertrauen
5.2.5 Hoffnung
5.2.6 Satirs Selbstverständnis als Therapeutin
5.3 Perspektiven und Interventionen in Satirs Familientherapie
5.3.1 Die Systemorientierung
5.3.2 Die Ressourcenorientierung
5.3.3 Die Wachstumsorientierung
5.3.4 Die Veränderungsorientierung
5.3.5 Die Erfahrungsorientierung
5.3.6 Selbstverantwortung
5.3.7 Reframing
5.4 Globalziel und Vision der Familientherapie Satirs
6. Die Entwicklung der Systemischen Seelsorge
6.1 Einleitung
6.2 Die Definition der Seelsorge
6.3 Die nordamerikanische Seelsorgebewegung
6.4 Die Entwicklung der Seelsorgebewegung im deutschsprachigen Raum
6.5 Die Entwicklung der Systemischen Seelsorge im deutschsprachigen Raum
7. Hoffnungsorientierte Systemische Seelsorgepraxis: Die exemplarische Integration der Familientherapie Virginia Satirs in die Systemische Seelsorge, Supervision, Ausbildung sowie in die Gemeinde- und Organisationsberatung im kirchlichen Umfeld
7.1 Beispiel 1: Systemische Einzelseelsorge im Gemeindepfarramt. Martin – Der Kampf gegen den Schmerz und die Verzweiflung
7.2 Beispiel 2: Systemisch-seelsorgliches Paargespräch im Gemeindepfarramt. Anna und Frank und die Herausforderung der Ablösung
7.3 Beispiel 3: Systemisch-seelsorgliche Familienkrisensitzungen im Gemeindepfarramt. Mira spielt mit dem Tod – Familie Leuenberger in Krise
7.4 Beispiel 4: Systemisch-seelsorgliche Sterbebegleitung im Rahmen der Spitalseelsorge. Sterben und Abschied in der Familie Maurer
7.5 Beispiel 5: Systemische Seelsorge im Rahmen einer Supervision. Sonja: Wenn Zeit alte Wunden aufbrechen lässt, statt sie zu heilen
7.6 Beispiel 6: Systemisch-seelsorgliche Ausbildung. Die Familienrekonstruktion von Lis – Die Macht der Trauer und der Sog unheilsamer Loyalität
7.7 Beispiel 7: Systemisch-seelsorgliche Gemeindeberatung. Eine Kirchgemeinde blockiert in Trauer
8. Schlüsselelemente der Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge
8.1 Die Wertegrundlagen der Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge
8.2 Person, Rolle und Haltung der Seelsorgeperson
8.3 Die Wirkung der Hoffnungsorientierten Systemischen Interventionen
9. Hoffnungsorientierter Ausklang
Anhang: Ausbildungszentren des Satir-Modells und Satir Institute weltweit
Bibliographie
Personenregister
Geleitwort
Jeder Mensch ist ein Unikat. Gleichzeitig sind Menschen in ihren Beziehungen und aus ihren Beziehungen zu verstehen. Und da sind sie manchmal anderen Menschen ähnlicher als sich selbst. Sie stehen zudem in umfassenderen Bezügen: in Familien und Generationenfolgen, in Geschlechts- und Arbeitsrollen, in Institutionen, Organisationen und Verbänden, in politischen, subkulturellen und kulturellen Zusammenhängen. Wenn Menschen in der Seelsorge und Gemeindearbeit hilfreich begleitet werden sollen, schwingt dies alles mit, sind in der direkten Begegnung auch diese umfassenderen Zusammenhänge präsent und wirksam. Systemisches Denken und Handeln hat sich deshalb in Seelsorge und Pastoralpsychologie als eine aufschlussreiche Perspektive fest etabliert.
Trotzdem sind Arbeiten rar, in denen diese Perspektive auf das Seelsorgegeschehen genauer ausgezeichnet wird. Hier schliesst der Entwurf einer Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge, den Karin Tschanz Cooke vorlegt, gleich mehrere Lücken. Verantwortungsvolles seelsorgliches Handeln legt Rechenschaft ab über seine Herkunft. Karin Tschanz Cooke weist auf, wo ihr Entwurf seinen Ursprung hat. Sie rekonstruiert Schritt für Schritt das Werden familientherapeutischen Arbeitens am Beispiel Virginia Satirs, einer Pionierin der Familientherapie. Sie ermöglicht so eine Besinnung auf die Ursprünge eines Paradigmas der Psychotherapie, das psychosoziale Hilfe seit der Mitte des letzten Jahrhunderts in einem Ausmass revolutioniert hat, wie dies vorher wohl nur die Psychoanalyse vermocht hatte, und leistet einen Beitrag an die Aufarbeitung der Geschichte der Psychotherapie im 20. Jahrhundert. Wer psychotherapeutische Konzepte in seelsorgliches Handeln einbezieht, muss zudem wissen, was er sich damit einhandelt. Das hat die Geschichte der Pastoralpsychologie der letzten Jahrzehnte immer wieder gezeigt. Psychotherapeutische Konzepte und Methoden sind mit bestimmten weltanschaulichen Setzungen und Wertvorstellungen verbunden. Das gilt ebenfalls für die humanistische Psychologie, in deren Tradition Virginia Satir steht. Karin Tschanz Cooke gelingt es, vor dem Hintergrund des geschichtlichen und persönlichen Werdegangs Virginia Satirs aufzuzeigen, auf welchen ideologischen Grundlagen Satirs Modell von Familientherapie steht. Dies schafft Voraussetzungen für eine kritische Rezeption familientherapeutischer Konzepte und Methoden.
Die Rezeption psychotherapeutischer Erkenntnisse in Seelsorge und Pastoralpsychologie war von Anfang der Seelsorgebewegung an auch von der Faszination getragen, durch die Integration neuer Sichtweisen und Arbeitsformen neue Zugänge zu belasteten Menschen und neue Ressourcen der Hilfe zu erschliessen. Satir hat als „Frau der ersten Stunde“ einer systemischen Sichtweise in der Psychotherapie zum Durchbruch verholfen und viele Methoden entwickelt, wie menschliche Systeme inszeniert, erfasst, analysiert und rekonstruiert werden können. Satir war auch höchst kreativ in der Entwicklung psychotherapeutischer Methoden. Wer sich von ihr anregen lässt, erschliesst sich eine Fülle von Anregungen und methodischen Zugängen zur Arbeit mit Systemen. Da Karin Tschanz Cooke diese Zugänge und Arbeitsformen auf dem Hintergrund der persönlichen und professionellen Entwicklung Satirs und des damit verbundenen „Glaubens“ darstellt, wird nochmals verdeutlicht, dass eine lediglich instrumentelle Integration solcher „Tools“ zu kurz greift.
Systemisches Denken hat sich seit seinen Anfängen weiterentwickelt. So liegt der Rückgriff auf eine Pionierin der Familientherapie heute in gewisser Weise auch etwas quer. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass hier systemische Seelsorgepraxis in Auseinandersetzung mit einem konkreten Gegenüber in der Psychotherapie entwickelt wird. Die Darstellung verflüchtigt sich deshalb nicht in systemischem Jargon, sondern die Rezeption bleibt nachvollziehbar, kritisierbar – und nicht zuletzt gut verständlich. Zudem wurde Satirs Ansatz von Schülerinnen und Schülern weiterentwickelt und wird heute weltweit praktiziert. Auf diesen Stand des „Satir-Modells“1 bezieht sich auch die vorliegende Arbeit.
Dadurch dass die Darstellung hinführt auf eine Praxis, welche in Fallbeispielen nachvollziehbar wird, erhält Hoffnungsorientierte Systemische Seelsorge ihr unverwechselbares aktuelles Gesicht oder besser: ihre vielen Gesichter. Was solche Seelsorge bewegen kann, wird eingezeichnet in den Kontext unterschiedlicher Felder kirchlicher Seelsorge. Karin Tschanz Cooke legt in Beispielen offen, wie sie als erfahrene Seelsorgerin und Ausbildnerin mit Familien, mit Menschen in neuen Lebensformen, mit Pfarrerinnen und Pfarrern, ja auch mit Gemeindesystemen arbeitet. Diese Seelsorgepraxis zeichnet sich durch ihre emotionale Intensität und ihren Bezug auf die je einzigartige Erfahrung der beteiligten Personen aus: Solche Erfahrung wird verdeutlicht, in ihrem systemischen Zusammenhang verstanden, ungewohnte, neue Erfahrungen werden initiiert, und ein Prozess der Veränderung kommt damit in Gang, in dessen Verlauf einzelne Menschen sich selbst ähnlicher werden und in eine neue Beziehung zu anderen eintreten können.
Karin Tschanz Cooke vertritt – last but not least – eine „hoffnungsorientierte“ Systemische Seelsorge und vertraut auf die „Möglichkeit des Andersseins“2, die in einem Glauben wurzelt, der nicht nur das „geknickte Rohr“ (Jes. 42,3) aufrichten, wachsen und blühen lassen will, sondern über sich selbst hinausweist.
Ich wünsche diesem Buch viele interessierte Leserinnen und Leser, die ihre eigene Seelsorgepraxis weiterentwickeln wollen – als vernetztes Unikat.
Christoph Morgenthaler
Muri b. Bern
Januar 2013
1 Vgl. Satir, Virginia/Banmen, John/Gerber Jane/Gomori Maria (2000): Das Satir-Modell. Familientherapie und ihre Erweiterung, Paderborn, 2. Aufl.
2 Vgl. Watzlawick, Paul (2007): Die Möglichkeit des Andersseins. Zur Technik der therapeutischen Kommunikation, Bern et al., 6. Aufl.
Vorwort
Die Reformierten Kirchen in der Schweiz des einundzwanzigsten Jahrhunderts bewegen sich in einem zunehmend multikulturellen und multireligiösen Umfeld und sind entsprechend herausgefordert. Sie erfüllen ihren Auftrag in ihren Kernbereichen der Verkündigung, Seelsorge und Diakonie, indem sie sich auf gesellschaftlicher, kirchlicher und privater Ebene, im Zusammenleben von einzelnen, Familien, kirchlichen und anderen Gemeinschaften für die Umsetzung der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus einsetzen. Die Kirchen bringen sich mit ihren Glaubensüberzeugungen, ihrer tätigen Nächstenliebe und ihrer Vision einer neuen Welt, dem Reich Gottes, ins gesellschaftliche Gespräch ein. Sie tun dies sowohl öffentlich und explizit als auch implizit und im Stillen durch ihren Einsatz für Menschen, für die Bewahrung der Schöpfung, für Frieden und für Gerechtigkeit. Der vielfältige Einsatz der Kirchen stösst auf unterschiedliche Aufnahme. Je nach Thema, Situation oder Person wird entweder verlangt, dass die Kirchen deutlicher Position beziehen oder sich nicht einmischen, dass sie Menschen in ihrer Not aufsuchen oder ihre Privatsphäre respektieren, dass sie innovativer werden oder ihre Traditionen vermehrt pflegen. Die Kirchen sind dementsprechend im Umbruch. Sie schlagen neue Wege ein, um dem heutigen Kontext und den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Identität nicht zu verlieren.
Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, einen dieser neuen Wege im Bereich der Seelsorge zu beschreiten. Sie stellt den Entwurf des Konzepts der Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge vor und sammelt Erkenntnisse über das Miteinander von Therapie und Seelsorge. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind eine Fortsetzung der seelsorglichen und pastoralpsychologischen Bemühungen der Integration von psychologischen und psychotherapeutischen Erkenntnissen in die Seelsorge seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sowohl im deutschsprachigen als auch im nordamerikanischen Raum. In ihr werden ausgewählte therapeutische Konzepte, Methoden und Interventionen der Familientherapie von Virginia Satir in den Ansatz der Systemischen Seelsorge integriert mit dem Ziel, dass die Systemische Seelsorge durch die familientherapeutischen Erkenntnisse Satirs bereichert und erweitert wird.
Diese Arbeit wurde möglich durch die grosszügige Unterstützung aus dem beruflichen und privaten Umkreis. Von Herzen danke ich allen, die mich während der Entwicklung dieser Arbeit unterstützt und begleitet haben. Ein herzliches Dankeschön entbiete ich der theologischen Fakultät der Universität in Bern, zuerst Prof. em. Dr. Dr. Christoph Morgenthaler für die kompetente Betreuung der Dissertation, die anregenden Gespräche, inspirierenden Ideen und für seinen Humor. Sein beispielloses Fachwissen in den Gebieten der Seelsorge, Pastoralpsychologie und Psychologie waren für die Begleitung dieser Arbeit ein Glücksfall. Die Begegnungen und die Zusammenarbeit – auch im Rahmen des postgradualen Masterlehrgangs in Systemischer Seelsorge – waren auf fachlicher und persönlicher Ebene ein grosser Gewinn. Ein spezieller Dank geht an Prof. em. Dr. Maurice Baumann für das Korreferat sowie für die kritischen, unkonventionellen und hilfreichen Anfragen im Rahmen des Doktorandinnen- und Doktorandenkolloquiums des Instituts für Praktische Theologie. Ein besonderer Dank geht an Prof. Dr. John Banmen vom Satir Institut of the Pacific/Kanada, für seine Motivation und fachkundige Begleitung dieser Arbeit und dafür, dass er mir unveröffentlichte Schriftstücke und Filmmaterial aus der Zeit seiner langjährigen Arbeit mit seiner Kollegin Virginia Satir zur Verfügung stellte.
Ein Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen der theologischen Fakultät in Bern, insbesondere an Nadja Boeck und Nadja Heimlicher, für ihre weiterführenden Fragen und an die beiden Bibliothekare der Bibliothek der Theologischen Fakultät in Bern für ihre freundliche und von mir sehr geschätzte Hilfsbereitschaft, sowie an die Psychologin Pia Fessler für ihre wertvollen Hinweise. Einen besonderen Dank entbiete ich Dr. Katrin Ott für ihr fundiertes und umsichtiges Lektorat und ihre engagierte Begleitung dieser Arbeit.
Ich danke den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und ihrem Synodalrat für das kirchliche Nachwuchsstipendium, mit dem sie meine Forschung unterstützten und so einen wichtigen Beitrag zur Realisierung meines Dissertationsprojekts leisteten. Ein herzlicher Dank geht an die Reformierte Landeskirche Aargau und ihre Kirchenpräsidentin, Pfrn. Claudia Bandixen, für die Unterstützung dieser Arbeit während meiner langen Weiterbildung, ebenso wie an ihren Nachfolger, Kirchenratspräsident Pfr. Dr. Christoph Weber-Berg für die Unterstützung der Vernissage dieses Buches.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen des Masterausbildungslehrgangs in Systemischer Seelsorge (SySA) Felix Christ, Rita Famos, David Kuratle, Stefan Meili, Karin Ritter und Thomas Wild, die diese Arbeit mit Interesse verfolgten und mit Witz anspornten, und besonders Andrea Figge Zeindler für die herausfordernden und ermutigenden Gespräche. Danke den Pfarrerinnen und Pfarrern der postgradualen Ausbildung in Systemischer Seelsorge für den bereichernden Austausch.
Danke den Ausbildnerinnen, Therapeutinnen und Therapeuten des Satir Instituts of the Pacific in Kanada und des Virginia Satir Global Network in den USA für die informativen Gespräche über ihre Zusammenarbeit mit Virginia Satir und ihren therapeutischen Ansatz. Danke den Mitarbeitenden des humanistischen Archivs der University of Santa Barbara in Kalifornien für die Unterstützung bei der Quellenerforschung und Dank den Mitarbeitenden des Esalen Instituts in Big Sur/Kalifornien, für den Zugang zu ihren Archiven.
Ein herzlicher Dank gehört den Familien, die ich als systemische Seelsorgerin und Systemtherapeutin begleitete, und aus deren Lebensgeschichten ich einige Ausschnitte beschreibe. Die Arbeit mit ihnen und ihr Vertrauen waren ein Privileg.
Zum Schluss danke ich von ganzem Herzen meiner Familie, besonders meinem Mann, Pfarrer Dr. Timothy R. Cooke, für seine phänomenale Unterstützung voller Liebe und Humor, unseren beiden Kindern, Julian und Nathalie, die mit Interesse verfolgten, wie „das Buch“ wuchs, meiner Mutter, die inhaltlich und emotional am Werden der Arbeit Anteil nahm und mich förderte, meiner Schwester Beatrice und meinem Bruder Jonathan, die der Entwicklung der Dissertation mit Spannung folgten sowie meiner Schwiegermutter, die die Arbeit mit Freude verfolgte.
Ich erlebe mich eingebunden in eine tragende Gemeinschaft von glaubenden, hoffenden und liebenden Menschen, mit denen ich lebe, arbeite, bete und mich erhole. Ihnen allen, den hier erwähnten und den vielen anderen, danke ich von ganzem Herzen für ihre Freundschaft und Unterstützung.
Last but not least, danke ich von Herzen dem Ursprung von allem, dem Gott der Hoffnung, der mich erfüllt mit aller Freude und Frieden im Glauben.
Gränichen, im April 20133
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden durch den Glauben, dass ihr reich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
Röm 15,13
3 Die vorliegende Arbeit wurde im April 2011 an der Christkatholisch und Evangelisch Theologischen Fakultät an der Universität Bern/Schweiz als Dissertation eingereicht und seitdem nur geringfügig überarbeitet. Als Stand der Forschung kann folglich April 2011 gelten.
1. Vorbemerkungen
1.1 Fragestellung
Die Systemische Seelsorge4 ist eine der neueren Richtungen im weiten Feld der Seelsorge. Ihre Anfänge liegen im deutschsprachigen Raum in der Mitte der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie baut auf den Grundkonzepten der Systemischen Therapie auf. Da es sich bei der Systemischen Therapie nicht um ein homogenes Ganzes handelt, sondern um unterschiedliche systemisch-therapeutische Schulen und Richtungen, integriert jeder Entwurf einer Systemischen Seelsorge5 andere systemisch-therapeutischen Axiome. Diese Forschungsarbeit macht es sich zum Ziel, den familientherapeutischen Ansatz von Virginia Satir6 für die Systemische Seelsorge zu erschliessen. Sie will damit eine Lücke schliessen, da die Integration der Familientherapie Satirs in die Systemische Seelsorge im deutschsprachigen Raum bisher nur in einem sehr beschränkten Rahmen geschah.7 Gleichzeitig soll durch diese Untersuchung eine sowohl theoretische als auch praxisorientierte Darstellung der familien- und systemtherapeutischen Konzepte, Methoden und Interventionen des Ansatzes von Satir gegeben werden. Die Familientherapie Satirs wurde gewählt, weil es sich um einen ganzheitlichen, ressourcen-, wachstums-, lösungs- und erfahrungsorientierten Ansatz handelt, der auch im 21. Jahrhundert aktuell ist. Die implizite Spiritualität und die expliziten Werte Satirs laden durch ihre Parallelen zu einer Integration in die Systemische Seelsorge ein und fordern sie durch ihre Unterschiede zugleich heraus. Durch die systemische Ausrichtung auf Mehrgenerationensysteme sowie durch die für das Satir-Modell spezifischen lösungs- und erfahrungsorientierten Methoden und Interventionen bietet sich mit der Systemischen Seelsorge ein Ansatz an, der in der Vielfalt seelsorglicher Tätigkeit angewendet werden kann, wie etwa mit Einzelpersonen, Paaren, Familien, Gruppen oder Organisationen, und zwar in kurzen Begegnungen ebenso wie in zielorientierten Gesprächen mit mehreren Sitzungen. In diesem Konzept einer Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge soll der familientherapeutische und systemtherapeutische Ansatz Satirs für die Systemische Seelsorge umsetzbar gemacht werden als eine Anwendung in der kirchlichen Praxis, die eine neue Sicht eröffnet – und zwar nicht nur in seelsorglichen Situationen, sondern auch im Bereich der Ausbildung, Supervision und Organisationsberatung kirchlicher Arbeit.
Der Fokus liegt in den folgenden Ausführungen auf der Person Virginia Satirs, ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung sowie auf dem historischen Umfeld, in dem ihr familientherapeutischer Ansatz und das Satir-Modell entwickelt wurden. Exemplarisch werden die Verortung, die Einflüsse und die Eigenständigkeit dieses familientherapeutischen Ansatzes aufgezeigt. Indem die therapeutischen Konzepte Satirs als Ergebnisse eines Prozesses darstellt werden, wird ein vertieftes Verständnis in die Entwicklung von Satirs Familientherapie gegeben, bevor ihr Ansatz in ein Konzept der Systemischen Seelsorge aufgenommen wird.
Dieser Arbeit ging eine eingehende theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den familientherapeutischen Konzepten des Satir-Modells voraus. Dazu gehörte ihre praktische Anwendung und Umsetzung im Rahmen Systemischer Seelsorge, systemisch-seelsorglicher Supervision, systemischer Seelsorgeausbildung und systemisch-seelsorglicher Organisationsberatung. Die Konzepte, Methoden und Interventionen der Familientherapie Satirs wurden für die Systemische Seelsorge adaptiert. Während dieses Adaptionsprozesses zeigten sich in den erwähnten Praxisfeldern positive Resultate, die zur Fortführung des begonnenen Prozesses der Integration des Satir-Modells in die Systemische Seelsorge ermutigten und zu einer Entwicklung des Konzepts der Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge führten.
Zum Schluss ist die zentrale Rolle der Person von Virginia Satir für das Verständnis ihres familientherapeutischen Ansatzes und daher auch für die Integration ihres Modells in die Systemische Seelsorge hervorzuheben. Ihr Therapiemodell wird bestimmt von ihren Werten, Schwerpunkten und Zielen. Im Folgenden werden sechs Charakteristika von Satirs Werdegang und Therapiepraxis herausgearbeitet, die für ihren familientherapeutischen Ansatz von Bedeutung sind. Einige ihrer Entdeckungen und Erkenntnisse sind bis heute relevant.
Erstens: Die Familientherapie Satirs war und ist international erfolgreich. Sie wird mit Erfolg international in Therapie, Supervision und Ausbildung umgesetzt. Eine beachtliche Anzahl ihrer Konzepte und fundamentaler Grundwerte wurden auch von anderen psychotherapeutischen Richtungen aufgenommen und gehören zu den selbstverständlichen Grundlagen in Ausbildungslehrgängen der Familien- und Systemtherapie, wo sie an neue Generationen von Therapeutinnen und Therapeuten weitergegeben werden. Eine beachtliche Anzahl ihrer familientherapeutischen Grundlagen, Werte, Methoden und Interventionen sind für die Seelsorgepraxis weiterführend, da sie seelsorgliche Erkenntnisse aufnehmen und familientherapeutisch vertiefen.
Zweitens: Satir integrierte ihre Spiritualität. Satir gab als erste Familientherapeutin der Spiritualität einen besonderen Stellenwert. Sie integrierte Meditationen in ihre Ausbildungslehrgänge und Workshops und sprach offen über ihre Werte und Glaubensüberzeugungen. Diese Transparenz ermöglicht es, die Spiritualität und Grundhaltungen Satirs den Menschen, der Welt, Gott und der Zukunft gegenüber zu verstehen und der Frage nachzugehen, welche Rolle ihre Spiritualität in ihrer Familientherapie einnimmt. Die Erforschung dieser Thematik ist für die Systemische Seelsorge nicht nur interessant, sondern auch relevant.
Drittens: Satir hatte einen praxisorientierten Ansatz, der sich für die interdisziplinäre Zusammenarbeit eignet. Sie war eine ausgesprochene Praktikerin und entwickelte ihren therapeutischen Ansatz gleichzeitig in der Theorie und in der Praxis, d. h. sie liess neue Erkenntnisse und Ideen sogleich in ihre Praxis einfliessen – ebenso wie die Erfahrungen aus der Praxis ihre Theorie formten. Ihr familientherapeutischer Ansatz war durch unzählige Beratungen aus ihrer therapeutischen Praxis untermauert. Insofern waren ihre Konzepte, Methoden und Interventionen in der Arbeit mit Familien erprobt und mit Erfolg umgesetzt. Ihre Ausführungen des familientherapeutischen Ansatzes waren nicht nur für psychotherapeutische Experten verständlich und einleuchtend, sondern Satir war es ein Anliegen, dass ebenso Fachpersonen der Medizin, Psychiatrie, Psychologie sowie der verschiedensten Gesundheitsberufe, Erziehungswissenschaften und Seelsorge ihren Ansatz umsetzten.
Viertens: Satir war eine Pionierin der Familientherapie und die einzige Frau in diesem Bereich: Satir wirkte als Familientherapeutin der ersten Stunde an vorderster Front mit und entwickelte gegen Ende der 40er- und 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika einen eigenen Ansatz der Familientherapie. Ihr Beitrag zur Entwicklung der Familientherapie fand in Fachkreisen Beachtung. Ihre Vorgehensweise war, ähnlich wie diejenige der anderen Pioniere der Familientherapie, unkonventionell und originell. Sie hatte die Fähigkeit, integrativ und interdisziplinär zu denken, zu forschen und zu arbeiten. Mehrmals betrat sie als Familientherapeutin Neuland, und es gelang ihr, neue Erkenntnisse und Gedanken in ihr therapeutisches Schaffen und Intervenieren aufzunehmen. Die radikal neue Sicht- und Behandlungsweise der Familientherapie wurde verschiedentlich als Paradigmawechsel8 umschrieben. Ihre Errungenschaften waren nur möglich durch ihren vollen Einsatz im Beruf. Satir war eine rund um die Uhr engagierte und erfolgreiche Berufs- und Karrierefrau, und das in einer Zeit, als von verheirateten Frauen erwartet wurde, dass ihre erste Priorität bei Mann und Familie lagen.
Fünftens: Satir war die Pionierin der Aus- und Weiterbildung für Familientherapie. Satir konzipierte und leitete die erste Weiterbildung auf dem Gebiet der Familientherapie überhaupt in den Jahren 1955–1958 in Chicago, wo sie am Chicago State Hospital angehenden Ärzten und Psychiatern den familientherapeutischen Ansatz lehrte. Hinzu kommt, dass sie Pionierin der Familientherapieausbildung war, nämlich, als sie im Jahr 1959 am Mental Health Institute in Palo Alto in Kalifornien die erste Ausbildung für Familientherapie für Therapeutinnen und Therapeuten konzipierte und leitete. Später war sie international als Ausbildnerin in Familientherapie tätig. Sie lehrte unter anderem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika, Deutschland, Israel und Russland und war Referentin an Universitäten, Berufsschulen sowie in Radio und Fernsehen. Anders als ihre Pionierkollegen gründete sie weder ein Institut noch baute sie ein Ausbildungszentrum auf, in dem das Satir-Modell gelehrt wurde.
Sechstens: Satir war Nicht-Akademikerin. Und sie war unter den Pionieren und Fachpersonen der ersten Stunde der Familientherapie die einzige Nicht-Akademikerin. Ihr erster Beruf war Lehrerin. Ihre Zweitausbildung war ein Masterstudium in Sozialarbeit. Ihre Pionierkollegen Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Ivan Boszormenyi-Nagy, Murray Bowen, Jay Haley, Don Jackson, Salvador Minuchin und Carl Whitaker9, um einige der wichtigsten Vertreter zu nennen, waren spezialisierte Ärzte, Psychiater, Psychoanalytiker, Psychologen und Sozialwissenschaftler, von denen viele als Professoren an einer Universität lehrten oder zum Teil selbst gegründete Institute leiteten. Ein wichtiges Ziel dieser Pionierkollegen war die Erforschung und Entwicklung neuer Theorien für die Behandlung von Familien. Als Akademiker war es für sie selbstverständlich, ihre Forschungsergebnisse fortlaufend zu publizieren, was nicht nur die neuen Erkenntnisse verbreitete, sondern sie auch als die Urheber neuer Ansätze bekannt machte. Anders Satir: da sie ihre Erkenntnisse nicht umgehend publizierte, sondern oft erst, nachdem sie diese jahrelang in ihrer therapeutischen Praxis, ihren Workshops oder ihren Ausbildungslehrgängen gelehrt und angewendet hatte, geschah es, dass andere Fachpersonen ihre Ideen und Konzepte übernahmen, diese in ihren Ansatz integrierten und sie letztlich unter ihrem eigenen Namen publizierten, obschon Satir die Begründerin und Initiatorin einer Anzahl bekannter Konzepte, Methoden und Interventionen war. Indem in der vorliegenden Arbeit exemplarisch aufgezeigt wird, wie sich Satirs Familientherapie entwickelte und dabei das Ineinandergreifen ihres persönlichen und beruflichen Weges und die Einbindung ihres Ansatzes in den historischen Kontext untersucht wird, kann in diesem Zuge auch eruiert werden, was erstmals von Satir entwickelt wurde und eindeutig ihr zugeschrieben werden kann. Weiter wird Satirs familientherapeutischer Ansatz in seiner historischen Entwicklung und Bedeutung dargestellt. Ausgewählte Konzepte, Methoden und Interventionen werden anschliessend für die Systemische Seelsorge erschlossen, und es wird ein Konzept vorgestellt, das aufzeigt, wie der Ansatz Satirs in einer Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge im kirchlichen Umfeld umgesetzt werden kann.
1.2 Abgrenzungen
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der Biographie Satirs, die Entwicklung ihres familientherapeutischen Ansatzes und dessen Integration in die Systemische Seelsorge. Somit wird diese Untersuchung keine Abhandlung über die Entstehung der Familientherapie, ihrer Vorläufer bis hin zur Entwicklung der Systemischen Therapie noch eine Darstellung und Diskussion unterschiedlicher Ansätze der Familientherapie und der Systemischen Therapie sein. Diese historiographischen Darstellungen der Entwicklung der Familientherapie und der Systemischen Therapie wurden bereits in fundierten Fachwerken erarbeitet.10 Im Unterschied zu diesen Grundlagenwerken beschränkt sich die vorliegende Abhandlung auf die exemplarische Darstellung und Diskussion der Familientherapie Satirs in ihrer historischen Entwicklung, ihrem beruflichen Umfeld und in ihrer aktuellen Gestalt als Satir-Modell. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Studie von der ‚Familientherapie Satirs‘, nicht von ‚systemischer Familientherapie Satirs‘ die Rede sein wird – weil Satirs Familientherapie, wie in den Ausführungen über die Theorie und Praxis der Familientherapie Satirs zu zeigen sein wird,11 ohnehin systemtherapeutisch12 ist, und weil Satir den Ausdruck selbst benutzte, wenn sie von „conjoint family therapy“13 sprach, was übersetzt die gemeinsame familientherapeutische Beratung bedeutet. Demgegenüber steht, dass ‚Familientherapie‘ das Wort ist, das heute im Gebrauch ist, wenn von den Ursprüngen des systemischen Ansatzes die Rede ist. Insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Systemtheorie und der davon abgeleiteten Systemischen Therapie grenzen sich von den Ursprüngen der Familientherapie ab und bezeichnen diese als noch nicht im strengen Sinn systemisch.14 Diese Sicht, dass ausschliesslich die therapeutischen Modelle, denen der Ansatz der Systemtheorie zugrunde liegt, als Systemtherapie zu bezeichnen sind, wird in dieser Arbeit nicht geteilt. Vielmehr wird die Familientherapie als eine spezifische Ausrichtung des Verständnisses von Systemtherapie gesehen. Somit wird mit Überzeugung von der ‚Familientherapie Satirs‘ die Rede sein, die als systemischer Ansatz verstanden wird.15
Eine weitere Abgrenzung liegt darin, dass die Entwicklung der Familientherapie Satirs in einem klar umgrenzten Rahmen, nämlich zwischen 1945 und 1988 in den Vereinigten Staaten beschrieben wird. Somit erhält diese Arbeit eine klare Eingrenzung in Bezug auf Zeit, geographischen Raum und Person. Anhand des Beispiels von Virginia Satir soll exemplarisch gezeigt werden, wie die Familientherapie in den Nachkriegsjahren Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten ihren Anfang nahm und nach 1970 nach Europa und in andere Kontinente importiert wurde.
Auch im Bezug auf die Pastoralpsychologie und Pastoraltheologie sind Abgrenzungen vorzunehmen. Gegenstand dieser Arbeit wird keine Abhandlung der Geschichte und Entwicklung der Seelsorgelehre oder der Diskussion ihrer unterschiedlichen Ansätze sein, da es dazu bereits instruktive Darstellungen gibt.16 Die seelsorglichen Erörterungen werden in erster Linie der Verortung und Entwicklung der Systemischen Seelsorge folgen mit dem Ziel, das Konzept einer Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge zu entwerfen, in das familientherapeutische Konzepte, Methoden und Interventionen integriert werden können, um den Ansatz der Familientherapie Satirs für die Systemische Seelsorge zu erschliessen.
1.3 Die Quellen
Die Quellen umfassen die Werke Satirs zusammen mit den zahlreichen Video- und Audioaufnahmen von Workshops und Ausbildungslehrgängen Satirs. Das Quellenstudium fand in vier verschiedenen Archiven statt: erstens im Satir Archiv von Dr. John Banmen in Delta/BC, zweitens im humanistischen Archiv der Universität von Santa Barbara/CA, drittens im Archiv des Virginia Satir Global Networks in Burien/WA und viertens im Archiv des Esalen Instituts in Big Sur/CA. Das Studium der Quellen basierte auf mehreren bisher unveröffentlichten persönlichen Aufzeichnungen Satirs.
Im Archiv von Dr. John Banmen erhielt ich Zugang zu den Unterlagen des letzten, unvollendet gebliebenen Buchs Satirs mit dem Titel „The Third Birth“17. Weiter waren im selben Archiv das im Privatdruck veröffentlichte Werk Satirs „Verbatim 1984“ sowie mehrere nicht vertriebene Tonaufzeichnungen18 verschiedener Vorlesungen und Ausbildungsveranstaltungen Satirs einzusehen. Bei diesen unveröffentlichten Aufzeichnungen und Tonaufnahmen handelt es sich um Material, das zum ersten Mal in einer wissenschaftlichen Arbeit verarbeitet wird.
Zudem wurden die umfangreichen Quellen im humanistischen Archiv der Bibliothek der Universität von Santa Barbara in Kalifornien studiert. Dort ist der grösste Teil des Nachlasses von Satir aufbewahrt. Er besteht aus zahlreichen Videoaufnahmen von Vorlesungen, Workshops, therapeutischen Beratungen und Familienrekonstruktionen, aber auch aus persönlichen Notizen, Briefen und anderen Schriften Satirs.19
In Burien/WA, befindet sich das Satir-Archiv, das als drittes intensiv gesichtet wurde. Während mehrerer Jahreskonferenzen20 des Virginia Satir Global Networks Network in Burien/WA21 konnten Interviews mit verschiedenen Familientherapeutinnen, Psychotherapeuten, Dozentinnen, Professoren und Autorinnen, die mit Satir gearbeitet hatten, geführt werden. Einige davon waren langjährige Mitarbeiter Satirs, die mit ihr zusammen Workshops und Kurse leiteten.22 Diese Interviews enthielten Informationen zur Biographie von Satir, und es wurde erforscht, wann Satir welche Erkenntnisse, Methoden und Interventionen in ihren Workshops umsetzte, damit deren Entstehung ungefähr datiert werden konnte. Die Vermittlung von Adressen und Materialien sowie die Organisation dieser Gespräche wurde möglich durch die Unterstützung von The Virginia Satir Global Network.23
Das vierte Archiv, das aufgesucht wurde, befindet sich im Esalen Institute in Big Sur/CA, wo Satir in den Jahren 1963–1983 zuerst Ausbildungsleiterin und später Ausbildnerin war.24 Aus diesem verstreuten Fundus von Materialien aus der Lehrtätigkeit Satirs konnte ein Teil der persönlichen und beruflichen Entwicklung Satirs sowie einige der Grundkonzepte ihrer Systemischen Therapie aus ihren Anfängen rekonstruiert werden.
Einige Informationen über Satirs persönliche und berufliche Entwicklungen wurden der Sekundärliteratur entnommen. Um eine Biographie Satirs entwerfen zu können, war es nötig, die verschiedensten persönlichen und beruflichen Angaben, die in zahlreichen Werken verstreut sind, zu einem Ganzen zusammenzutragen. Bisher existierten nur zwei Dokumente mit biographischen Angaben zu Satir: Beim ersten handelt es sich um einen dreizehnseitigen, unveröffentlichten biographischen Bericht, der eine Zusammenstellung der wichtigsten Daten, Mitgliedschaften und Publikationen Satirs in chronologischer Folge enthält.25 Er wurde von der ehemaligen Präsidentin des Avanta, The Virginia Satir Network, Margarita M. Suarez, im Jahre 1999 verfasst. Das zweite Dokument ist das im Jahre 2000 erschienene Werk „Virginia Satir. To Life. Her Life and Circle of Influence“.26 Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Artikeln verschiedener Autorinnen und Autoren, die sich an das Leben und Wirken Satirs erinnern, ihr Werk würdigen und über ihr therapeutisches Schaffen berichten. Die Berichte entstammen persönlichen Erinnerungen und müssen folglich als solche eingeordnet werden.
Durch das gesichtete Material in vier Archiven war es möglich, eine Kurzbiographie Satirs zu erstellen. Der Wert dieser Darstellung besteht vor allem in der Zusammenführung etlicher Informationen über das Leben und Werk Satirs, die nun erstmals in einem einzigen Dokument nachzulesen sind. Damit konnten einige der Lücken in den Kenntnissen zur chronologischen Abfolge der persönlichen und beruflichen Ereignisse im Leben Satirs geschlossen werden.
1.4 Vorgehen
Erstens: Zum Aufbau
Die Arbeit gibt einen historischen Überblick über die Entstehung der Familientherapie Virginia Satirs. Nach dem ersten Teil der Vorbemerkungen wird im zweiten Teil die biographische Entwicklung Satirs aufgezeigt; im dritten Teil wird das professionelle Umfeld Satirs skizziert, und die prägenden Einflüsse auf die Entwicklung der Familientherapie Satirs werden kurz erwähnt. Der vierte Teil verfolgt die Entwicklung der Familientherapie Satirs während der fünf Berufsetappen ihres Wirkens. Jeder Berufsetappe werden die während dieser Zeit für die Familientherapie Satirs prägenden Einflüsse zugeordnet. Die Auswahl dieser Einflüsse geschah nach dem Kriterium, dass sie nachweisbar eine wichtige Rolle im familientherapeutischen Ansatz Satirs spielten. Ihre Auswahl ist nicht vollständig, sondern exemplarisch. Durch dieses Vorgehen wird der Einblick in eine Anzahl von Zusammenhängen ermöglicht, die dabei helfen, die Familientherapie Satirs in ihrer biographischen und beruflichen Entstehung zu verorten und die zentralen psychotherapeutischen Einflüsse während der fünf Berufsphasen Satirs aufzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Chronologie der Integration einzelner Erkenntnisse, Methoden und Interventionen Satirs aus anderen therapeutischen Ansätzen in ihren eigenen familientherapeutischen Ansatz. Auf ausgewählte wichtige Ereignisse, Menschen, Daten oder Orte der Biographie Satirs wird auch in diesem Teil hingewiesen, um dadurch die Zusammenhänge von Biographie und beruflicher Entwicklung Satirs zu verdeutlichen. Dies führt zu einigen Doppelungen, weil zum einen in der Kurzbiographie Satirs die berufliche Laufbahn skizziert werden muss, zum anderen aber auch in der Schilderung der fünf Berufsetappen Hinweise auf Satirs persönliches Umfeld enthalten sein müssen. Diese Wiederholungen wurden aus zwei Gründen bewusst stehengelassen: erstens um der besseren Lesbarkeit der Aufzeichnungen der fünf Berufsetappen Satirs willen; zweitens sollte die in dieser Forschungsarbeit veröffentlichte Kurzbiographie Satirs, die zum Teil unveröffentlichte Daten aus den oben erwähnten Quellen enthält und diese neuen biographischen Daten und Erkenntnisse erstmals zu einem Ganzen zusammenführt, als Einheit aufgeführt werden und nicht in fünf Lebensabschnitte im Zusammenhang mit den fünf Berufsetappen aufgeteilt werden. Einzelne Ausschnitte aus dem zweiten Teil kommen also im vierten Teil dieser Arbeit erneut zur Sprache. Im fünften Teil werden die Grundzüge der Familientherapie Satirs vorgestellt, Satirs Weltanschauung, Werte und Spiritualität, ihre Grundhaltungen, ihr Selbstverständnis als Therapeutin sowie die originalen familientherapeutischen Beiträge Satirs. Im sechsten Teil wird die Entwicklung der Systemischen Seelsorge skizziert, zuerst in der amerikanischen Seelsorgebewegung danach auch in der Seelsorgebewegung im deutschsprachigen Raum. Im siebten Teil erfolgt die exemplarische Integration der Familientherapie Satirs in die Systemische Seelsorge im kirchlichen Umfeld durch die Beschreibung ihrer Umsetzung in der Einzel-, Paar- und Familienseelsorge, im Rahmen einer Sterbebegleitung im Bereich der Palliative Care, in der Supervision, in der Familienrekonstruktion und in der systemischen Organisationsberatung einer Kirchgemeinde. Im achten Teil werden die Schlüsselelemente eines Konzeptes der Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge vorgestellt. Die Arbeit endet im neunten Teil mit einem hoffnungsorientierten Ausklang.
Zweitens: Die Sprache
Für diese Forschungsarbeit wurde bewusst eine einfache Sprache gewählt, damit sie lesbar und verständlich bleibt. Dies birgt die Hoffnung, dass der seelsorgliche Teil von Therapeutinnen und Therapeuten und der therapeutische Teil von Seelsorgerinnen und Seelsorgern verstanden werden kann und damit der interdisziplinäre Dialog gefördert wird.
Was die gendergerechte Sprachform angeht, wird der Lesbarkeit halber jeweils nur eine Bezeichnung für Personen beiderlei Geschlechts, dies aber einmal in männlicher und einmal in weiblicher Form verwendet. Diese schliesst beide Geschlechter ein. Statt der Bezeichnung „Seelsorgerin und Seelsorger“ wurde der Begriff „Seelsorgeperson“ gewählt, und anstatt der Umschreibung „Empfängerin und Empfänger der Seelsorge“ wurde die Bezeichnung des „Gegenübers“ verwendet.
Drittens: Die Zitate
In Bezug auf Primär- und Sekundärliteratur der Familientherapie Satirs, wie auch betreffend ausgewählter pastoralpsychologischer und pastoraltheologischer Werke, wurde deutsch- und englischsprachige Literatur berücksichtigt. Original in Englisch verfasste Zitate werden nur dann in deutscher Sprache zitiert, wenn die Werke, aus denen sie stammten, in deutscher Sprache erschienen sind. Ansonsten werden sie in englischer Sprache belassen; Ausnahmen bilden nur solche Fälle, bei denen Feinheiten der englischen Formulierungen durch die Übersetzung ins Deutsche verloren gegangen wären.
1.5 Ziele dieser Arbeit
Erstens: Die Biographie Satirs
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit wird zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum eine Biographie dieser Pionierin der Familientherapie vorgelegt. Satirs Biographie wurde geschrieben, um die Entwicklung ihres familientherapeutischen Ansatzes auch im Kontext ihrer persönlichen Entwicklung verstehen zu können.
Zweitens: Einflüsse auf den familientherapeutischen Ansatz Satirs
Die Entwicklung des familientherapeutischen Ansatzes Satirs wird in fünf Phasen dargestellt. In jeder Phase soll ersichtlich werden, welche Einflüsse aus psychotherapeutischen Ansätzen Satir aufgenommen hat. Durch die exemplarische Darstellung der Entwicklung der Familientherapie Satirs kann gezeigt werden, wie diese Familientherapie in ihrer Zeit und in ihrem Umfeld verortet war.
Drittens: Genuin Satir
Es soll gezeigt und gewürdigt werden, welche Konzepte, Methoden und Interventionen der Familientherapie genuin von Satir entwickelt wurden und auf sie zurückgeführt werden können.
Viertens: Die Grundwerte der Familientherapie Satirs
Zunächst werden die grundlegenden Werte, die Weltanschauung, das Menschen- und Gottesbild, Vorstellungen von Leben und Tod sowie die Zukunftsvision Satirs beschrieben werden; sodann ihr Selbstverständnis und ihre Rolle als Therapeutin sowie die Grundlagen ihrer Familientherapie, zu der die systemische Sicht, die Empathie, Akzeptanz, Kongruenz, Hoffnung, Selbstverantwortung und vertrauensvolle Nähe gehören. Schliesslich werden ihre Konzepte, Methoden und Interventionen vorgestellt, die im Familiensystem angewendet werden, um seiner Dynamik, seinen Machtverhältnissen, den bestehenden Rollen, Regeln, Ausnahmen und Ausschlüssen bewusst zu werden und die Voraussetzung für positive Veränderungen zu schaffen; zuletzt werden ihre Methoden des Reframing, der Ressourcen-, Lösungs-, Wachstums- und Erfahrungsorientierung vorgestellt.
Fünftens: Entwicklung der Systemischen Seelsorge
Bevor der familientherapeutische Ansatz in die systemische Seelsorgepraxis integriert wird, soll die Systemische Seelsorge in ihrer historischen Entwicklung dargestellt werden.
Sechstens: Ein Konzept einer Hoffnungsorientierten Systemischen Seelsorge
Ein Konzept Hoffnungsorientierter Systemischer Seelsorge wird entwickelt, in welchem die Integration von Konzepten und Methoden Satirs in die Systemische Seelsorge vollzogen wird. Dies wird exemplarisch anhand von sieben Beispielen aus den unterschiedlichen Seelsorgekontexten dargestellt.
Das Hauptziel dieser Arbeit ist demnach, den familientherapeutischen Ansatz Satirs darzustellen, ihn zu würdigen und seine Relevanz für die Systemische Seelsorge aufzuzeigen, indem ein Arbeitsmodell einer Integration ausgewählter Konzepte der Familientherapie Satirs in die Systemische Seelsorge erstellt wird.
Neu an der vorliegenden Studie ist der Versuch, Satirs therapeutische Ansätze im Zusammenhang ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung in ihrem historischen Kontext darzustellen.
4 In den folgenden Ausführungen wird auf den systemischen Ansatz in der Seelsorge mit dem stehenden Begriff der „Systemischen Seelsorge“ verwiesen.
5 Vier Entwürfe Systemischer Seelsorge im deutschsprachigen Raum sind besonders zu erwähnen: Held 1998; Morgenthaler 1999/4 2005; Emlein 2001; Schneider-Harpprecht 2001, 2003.
6 In dieser Arbeit wird mit dem Namen „Satir“ stets auf Virginia Satir Bezug genommen.
7 Besonderen Bezug auf die Familientherapie Satirs nimmt Morgenthaler 1999/4 2005, der auf ihren familientherapeutischen Ansatz hinweist (S. 19f.) und die Familienrekonstruktion (S. 96f.), das Figurenstellen (S. 201f.) sowie die Familienskulptur (S. 255) in seiner Systemischen Seelsorge vorstellt.
8 Dieser Begriff „Paradigmawechsel“ wird von Goldenberg/Goldenberg 41996 als Beschreibung des grundsätzlich neuen Verständnisses in der Psychotherapie in Abgrenzung von psychoanalytisch geprägten Ansätzen verwendet. Irene und Herbert Goldenberg gehen in diesem Textbuch zur Familientherapie näher auf diesen Paradigmawechsel ein; vgl. auch Schlippe/Schweitzer 1996, S. 19, welche dort wohl auf Goldenberg/Goldenberg 41996 Bezug nehmen.
9 Sämtliche Literaturangaben zu diesen Pionieren der Familientherapie sind in den entsprechenden Kapiteln zu finden.
10 Solche Gesamtdarstellungen sind bereits vorhanden. Zur Entwicklung und Geschichte der Psychotherapie, insbesondere der systemischen Ansätze, sind die Werke von Goldenberg 1996, Nichols 1998, Brunner/Reiter/Reiter-Theil 1988/2 1997, Schlippe/Schweitzer 1996 und Kriz 2001 als kompetente Gesamtdarstellungen zu erwähnen.
11 Vgl. Kapitel 5.
12 Dass es sich deutlich um einen in seinen Grundzügen systemtherapeutischen Ansatz handelt, wird besonders im letzten Werk Satirs, dem „Satir-Modell“ (Satir/Banmen/Gerber/Gomori 1991), deutlich.
13 Vgl. ihr erstes Buch, Satir 1964. „Conjoint“ beschreibt Familientherapie, welche gleichzeitig und gemeinsam mit allen Mitgliedern der Familie geschieht.
14 Vgl. dazu die Kritik von Held 1998, Kap. 1 und 2.
15 Vgl. dazu auch Nichols/Schwartz41998, S. 14.
16 An dieser Stelle soll besonders auf Nauer 2001 hingewiesen werden. Ausführliche Literaturangaben sind in Kapitel 6. zu finden. Vgl. auch Klessmann22004.
17 Die Kopien der zum Teil handschriftlich verfassten Aufzeichnungen Satirs unter dem Titel „The Third Birth“ wurden mir von Dr. John Banmen, in dessen Besitz sie sind, zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich in seinen Archiven an der folgenden Adresse: Delta Psychological Associates, Inc., 11213 Canyon Crescent, North Delta/BC/Kanada, V4E 2R6.
18 Die Tonaufzeichnungen zahlreicher Vorlesungen Satirs aus den Jahren 1961–1985 befinden sich ebenfalls in den Archiven von Dr. John Banmen. Sie wurden ihm von Satir persönlich zur Verwaltung übergeben. Sie enthalten Aufzeichnungen von Workshops und Lehrveranstaltungen aus den Jahren 1961–1975. Die Tonbänder wurden nicht katalogisiert und enthalten oft nur eine Jahreszahl als Bezeichnung.
19 Der Nachlass ist im humanistischen Archiv in der Bibliothek der Universität von Santa Barbara in Kalifornien in nummerierten Virginia-Satir-Archiv-Boxen eingelagert. Von Bedeutung waren für die Recherchen vor allem die Virginia-Satir-Archiv-Boxen Nr. 9, 10, 14, 17, 19, 21, 48, in denen zahlreiche Originaldokumente wie Scheidungspapiere, Briefe, Notizen und schriftliche Unterlagen zu ihren Workshops und Büchern sowie Audio- und Videotapes aufbewahrt werden. Für die Forschung waren besonders die ältesten Audio- und Videoaufnahmen aus den 1960er-Jahren sowie die Videotapes der jährlichen drei- bis vierwöchigen intensiven Sommertrainings der Jahre 1980–1988 aufschlussreich.
20 Die Autorin besuchte die Jahreskonferenzen 2001, 2003, 2006 sowie die World Family Conference vom 16. bis 19. Mai 2007 in Prag. Bei diesen Anlässen fanden die gleich zu erwähnenden Interviews statt.
21 Avanta ist im Besitz von zahlreichen Videoaufnahmen und Schriften Satirs, welche für diese Arbeit eingehend untersucht wurden. Einige können bei Avanta bestellt oder eingesehen werden. Die Adresse lautet: Avanta, The Virginia Satir Network, 2104 SW 152nd SW, Suite 2, Burien/WA 98166, USA, E-Mail: [email protected], http//:www.avanta.net.
22 Interviews wurden mit den folgenden Personen geführt: John Banmen, Stephen Buckbee, Maria Gomori, Maureen Graves, Sharon Loeschen, Nancy MacDonald, Jean McLendon, Kathleen MakiBanmen, Ira Progroff, Carl Sayles, Hana Scibranyova, Robert S. Spitzer, Margarita Suarez, Gloria Taylor, Walter Zahnd.
23 „The Virginia Satir Global Network“ hiess bis 2009 „AVANTA, The Virginia Satir Network“.
24 Weitere Ton- und Videoaufnahmen sind in den Archiven des Esalen Instituts in Big Sur/CA, zu finden. Auch dieses Archiv wurde im Zuge dieser Untersuchung besucht; dabei konnten wichtige Aufzeichnungen über Virginia Satirs Lehrtätigkeit studiert werden.
25 Dieser 13-seitige Lebenslauf hat im Anhang eine Auflistung der Publikationen Satirs, ihrer professionellen Tätigkeiten, der von ihr geleiteten Konferenzen und Lehrveranstaltungen sowie sämtlicher Mitgliedschaften Satirs, ihrer Arbeit als Herausgeberin von Zeitschriften, ihres Engagements als Vorstandsmitglied und ihrer professionellen Mitgliedschaften.
26 Dodson/Gomori/Suhd 2000.
2. Das persönliche Umfeld Virginia Satirs: Eine Kurzbiographie
2.1 1916–1935: Ginny Pagenkopf
Am 26. Juni 1916 wurde Virginia Mildred, genannt „Ginny“27 Pagenkopf28, das erste Kind von Oscar Alfred Reinnard Pagenkopf, einem Landwirt, und Minnie Happe Pagenkopf29 auf einem Bauernhof in der Gegend von Neillsville/Wisconsin, geboren.30 Der Bauernhof gehörte Satirs väterlichen Grosseltern, Ferdinand und Wilhelmine Pagenkopf, die ihn zusammen mit Virginia Satirs Eltern bewohnten und bewirtschafteten. Drei der vier Grosseltern waren zwischen 1870 und 1876 in Deutschland geboren und in jungen Jahren in die Neue Welt gesegelt. Beide Grossmütter, die aus eher privilegierten Kreisen stammten, hatten jeweils einen Mann aus der Arbeiterklasse geheiratet, weshalb Satir annahm, „that her grandparents left Germany in disgrace for what was then regarded as an unacceptable breach of social custom“.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























