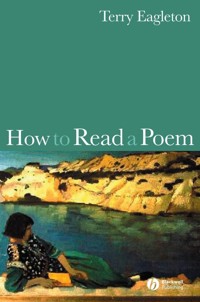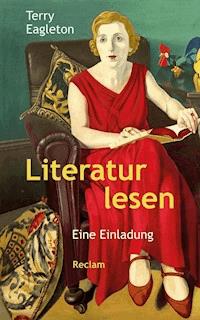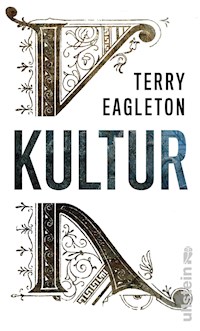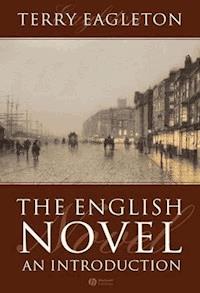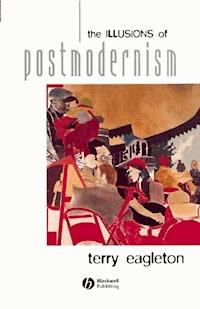16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hoffnung ist mehr als bloßer Optimismus oder Wunschdenken. Sie steht für ein philosophisches Konzept. Terry Eagleton bringt den Begriff zurück in den Diskurs - leidenschaftlich und brillant. Zu erwarten, eine schlechte Situation würde sich ins Gute verkehren, ist schlicht irrational. Nach drei Tagen Dauerregen kann man nicht davon ausgehen, dass am vierten Tag die Sonne scheint, hoffen kann man es sehr wohl. Denn bloßer Optimismus ist banal, Hoffnung dagegen erfordert Reflexion und klares, rationales Denken. Und hält immer auch die Möglichkeit des Scheiterns bereit. Hoffnung ist tragisch und zugleich eine permanente Revolution gegen Selbstzufriedenheit und Verzweiflung. Klug, geistreich und virtuos widmet sich Terry Eagleton dem Konzept Hoffnung. Er analysiert, wie sich unser Verständnis davon in sechs Jahrtausenden gewandelt hat – eine brillante Chronik menschlichen Glaubens und Verlangens, ein Abriss der Ideengeschichte von der Antike über Marx bis zu Ernst Bloch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Zu erwarten, eine schlechte Situation würde sich ins Gute verkehren, ist schlicht irrational. Nach drei Tagen Dauerregen kann man nicht davon ausgehen, dass am vierten Tag die Sonne scheint, hoffen kann man es sehr wohl. Terry Eagleton unterscheidet Hoffnung von bloßem Wunschdenken, Idealismus oder blindem Fortschrittsglauben. Er analysiert, wie sich unser Verständnis davon in sechs Jahrtausenden gewandelt hat und erstellt dadurch eine brillante Chronik menschlichen Glaubens und Verlangens – ein Abriss der Ideengeschichte von der Antike über Marx bis zu Ernst Bloch. Hoffnung ist »eine Form der permanenten Revolution, deren Feind gleichermaßen politische Selbstzufriedenheit wie metaphysische Verzweiflung ist«. Echte Hoffnung ist zweifellos tragisch – aber sie stirbt zuletzt.
Der Autor
Terry Eagleton, geboren 1943, ist Professor für Englische Literatur an der University of Manchester und Fellow der British Academy. Auf Deutsch sind von ihm u. a. erschienen »Einführung in die Literaturtheorie« (1988), der Bestseller »Der Sinn des Lebens« (2008) und »Warum Marx recht hat« (2012).
TERRY EAGLETON
HOFFNUNGSVOLL,ABER NICHTOPTIMISTISCH
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2015unter dem Titel Hope Without Optimismbei Yale University Press, London
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1433-4
© 2015 by Terry Eagletonoriginally published in the United States of America by the University of Virginia Press and by Yale University Press in the United Kingdom© der deutschsprachigen Ausgabe2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinLektorat: Uta RüenauverUmschlaggestaltung: Brian Barth, BerlinAutorenfoto: © Eamonn McCabe
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für Nicholas Lash
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Widmung
Vorwort
Anmerkung zum Kapitel
1Die Banalität des Optimismus
Anmerkungen zum Kapitel
2Was ist Hoffnung?
Anmerkungen zum Kapitel
3Der Philosoph der Hoffnung
Anmerkungen zum Kapitel
4Hoffnung wider alle Hoffnung
Anmerkungen zum Kapitel
Feedback an den Verlag
Empfehlung
Page-Barbour-Vorlesungen2014
Wir sind keine Optimisten; wir liefern kein geschöntes Bild der Welt, für das jeder in Liebe entbrennen muss. Dort, wohin wir gestellt sind, haben wir einfach eine lokal begrenzte Aufgabe zu erledigen – auf der Seite der Gerechtigkeit, für die Armen. (Herbert McCabe, OP)
Vorwort
Als jemand, dessen sprichwörtliches Glas nicht nur halb leer ist, sondern zudem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine faulig schmeckende, potentiell tödliche Flüssigkeit enthält, bin ich als Autor vielleicht nicht die Idealbesetzung für ein Buch über Hoffnung. Es gibt die Leute, deren Motto heißt: »Iss, trink und sei glücklich, denn morgen sind wir tot«, und die anderen, die eher meiner Wesensart entsprechen und deren Philosophie schlicht lautet: »Morgen sind wir tot.« Wenn ich mich trotz dieses fatalen Hangs zum Fatalismus entschlossen habe, über das Thema zu schreiben, so liegt das daran, dass es sich um einen merkwürdig vernachlässigten Begriff in einer Zeit handelt, die uns Raymond Williams zufolge »mit dem gefühlten Verlust eine Zukunft«1 konfrontiert. Vielleicht wird das Thema auch deshalb gemieden, weil jeder, der sich traut, darüber zu schreiben, zwangsläufig in den Schatten von Ernst Bloch und seinem monumentalen Werk Das Prinzip Hoffnung gerät, auf das ich in Kapitel Drei näher eingehen werde. Blochs Abhandlung mag zwar nicht die brillanteste Arbeit in den Annalen des westlichen Marxismus sein, aber sie ist bei weitem die längste.
Es heißt, Philosophen hätten weitgehend alle Hoffnung fahren lassen. Ein flüchtiger Blick in einen Bibliothekskatalog legt den Gedanken nahe, dass sie unser Thema schmählich Büchern mit Titeln überlassen haben wie Half Full: Forty Heartwarming Stories of Optimism, Hope, and Faith; A Little Faith, Hope and Hilarity oder (mein persönlicher Favorit) The Years of Hope: Cambridge, Colonial Administration in the South Seas and Cricket, ganz zu schweigen von den zahlreichen Biographien über Bob Hope. Offenbar ist Hoffnung ein Thema, das jeden naiven Moralisten und spirituellen Chearleader auf diesem Planeten aus der Reserve lockt. Da müsste eigentlich auch Raum für jemanden wie mich sein, der zwar nicht auf eine Karriere im Kricket oder in der Kolonialverwaltung zurückblicken kann, der aber an den politischen, philosophischen und theologischen Bedeutungen des Begriffs interessiert ist.
Dieses Buch ist aus der Page-Barbour-Vorlesungsreihe der Universität von Virginia hervorgegangen, mit der ich 2014 betraut wurde. Ich bin all den Menschen in Charlottesville außerordentlich dankbar, die mich dort so freundlich aufgenommen haben. Das gilt insbesondere für Jenny Geddes sowie für Chad Wellmon, der meinen Besuch hervorragend organisiert hat und ein überaus liebenswürdiger und vorbildlicher Gastgeber war.
T. E.
Anmerkung zum Kapitel
1. Raymond Williams, The Politics of Modernism, London 1989, S. 103.
1Die Banalität des Optimismus
Es mag viele gute Gründe geben, an den günstigen Ausgang einer Situation zu glauben, aber diesen nur deshalb zu erwarten, weil Sie ein Optimist sind, gehört nicht zu ihnen. Das ist genauso irrational wie der Glaube, dass alles gut sein wird, weil Sie Albaner sind oder weil es drei Tage hintereinander geregnet hat. Wenn es keinen guten Grund gibt, warum die Dinge einen befriedigenden Verlauf nehmen sollten, gibt es auch keinen Grund, warum sie schlecht ausgehen sollten, folglich entbehrt die Überzeugung des Optimisten jeder Grundlage. Man kann ein pragmatischer Optimist sein, der meint, dass sich dieses Problem lösen lässt, jenes aber nicht; doch der professionelle oder unverbesserliche Optimist beurteilt bestimmte Situationen einfach deshalb zuversichtlich, weil er grundsätzlich voller Zuversicht ist. Er findet seinen verlorenen Nasenring wieder oder erbt ein jakobinisches Herrenhaus, weil es das Leben prinzipiell gut mit uns meint. Damit läuft er Gefahr, einer wohlfeilen Hoffnung auf den Leim zu gehen. In gewisser Weise ist Optimismus eher eine Frage des Glaubens als der Hoffnung. Er erwächst aus der Annahme, dass sich die Dinge meist zum Guten wenden, und nicht aus dem anstrengenden Bemühen, das uns die Hoffnung abverlangt. Henry James fand, dass der Optimismus im Leben und in der Literatur überhandnehme: »Bei den Verirrungen des oberflächlichen Optimismus ist der Boden (vor allem der der englischen Romanliteratur) mit ihren brüchigen Splittern übersät wie mit Glasscherben.«2
Optimismus als Grundhaltung perpetuiert sich selbst.3 Er lässt sich nur schwer widerlegen, weil er eine fundamentale Einstellung zur Welt widerspiegelt, genau wie der Zynismus oder die Gutgläubigkeit, und weil er die Dinge in dem ganz eigenen Licht seines Blickwinkels zeigt, so dass er gegen jegliche Widerlegung gefeit ist. Daher die abgedroschene Metapher von der rosaroten Brille, die alles, was Sie sehen und was Ihre Ansicht in Frage stellen könnte, in die nämliche rosarote Farbe taucht. Mit Hilfe einer Art moralischer Hornhautverkrümmung legen wir uns die Wahrheit so zurecht, dass sie sich mit unseren natürlichen Neigungen deckt, die ohnehin schon die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben vorherbestimmt haben. Da der Pessimismus im Grunde genommen eine ganz ähnliche geistige Marotte ist, haben diese beiden Einstellungen mehr miteinander gemein, als man gewöhnlich annimmt. Der Psychologe Erik Erikson spricht von einem »schlecht angepassten Optimismus«: Er hindere das Kind daran, die Grenzen des Möglichen zu akzeptieren, weil es weder die Wünsche der anderen erkennen kann noch deren Unvereinbarkeit mit den eigenen Wünschen.4 Sich mit der Unabänderlichkeit der Wirklichkeit abzufinden ist nach Erikson ein entscheidender Schritt der Ich-Bildung, aber genau das fällt dem unverbesserlichen oder professionellen Optimisten so schwer.
Ein Optimist ist nicht nur einfach jemand, der große Hoffnungen hegt. Selbst ein Pessimist kann trotz seines habituellen Missmuts eine positive Einstellung zu einer Sache haben. Er kann hoffen, ohne zu glauben, dass sich im Leben alles zum Guten wendet. Ein Optimist hingegen ist jemand, der dem Leben mit unverbesserlicher Zuversicht begegnet, einfach weil er ein Optimist ist. Er geht stets davon aus, dass die Dinge gut ausgehen, weil er ist, wie er ist. Genau deshalb übersieht er, dass der Mensch zum Glücklichsein Gründe braucht.5 Im Gegensatz zur Hoffnung ist professioneller Optimismus daher keine Tugend, genauso wenig wie es eine Tugend ist, Sommersprossen oder Plattfüße zu haben. Er ist keine Einstellung, die wir uns durch gründliches Nachdenken oder fleißiges Lernen aneignen können. Wir haben es hier mit einer Frage des Temperaments zu tun. »Immer positiv denken« ist in etwa so vernünftig wie »Immer einen Mittelscheitel tragen« oder »Immer den Hut lüften, wenn der Hund sich löst«.
Aufschlussreich in dieser Hinsicht ist auch das ebenso strapazierte Bild von dem Glas, das – je nach dem Blick des Betrachters – halb voll oder halb leer ist. Unschwer lässt sich dem Bild entnehmen, dass die Situation selbst in keiner Weise für die Reaktion des Betrachters verantwortlich ist. Sie kann seine gewohnten Vorurteile nicht in Frage stellen. Objektiv bietet sie keinen Ansatzpunkt dazu. Sie sehen die gleiche Menge Flüssigkeit, egal, ob Sie ein sonniges Gemüt haben oder ein Miesepeter sind. Die subjektive Bewertung des Glases ist also vollkommen beliebig. Und ob ein so beliebiges Urteil überhaupt als Urteil gelten kann, ist fraglich.
Darüber lässt sich sicherlich nicht streiten, so wie man nach den erkenntnistheoretisch naiveren Spielarten der Postmoderne nicht über Ansichtssachen diskutieren kann. Fakt ist, dass Sie die Welt auf Ihre Weise sehen und ich auf meine und dass es keinen neutralen Boden gibt, auf dem sich die beiden Ansichten miteinander messen könnten. Da ein solcher Boden von den beiden fraglichen Standpunkten aus gleichfalls unterschiedlich interpretiert würde, wäre er auf keinen Fall neutral. Keiner der beiden Standpunkte kann empirisch widerlegt werden, da jeder die Fakten so interpretiert, dass sie die eigene Richtigkeit bestätigen. Auf ganz ähnliche Weise sind Optimismus und Pessimismus Beispiele für Fatalismus. Sie können nichts dagegen tun, dass Sie ein Optimist sind, so wenig, wie Sie etwas dagegen tun können, dass Sie ein Meter sechzig groß sind. So ist der Optimist an seine Heiterkeit gekettet wie der Galeerensträfling an sein Ruder – eine ziemlich trostlose Aussicht. Wie beim erkenntnistheoretischen Relativismus ergibt sich daraus nur eine Möglichkeit: Die beiden Lager müssen sich auf eine zahnlose Toleranz einigen und den Standpunkt des jeweils anderen akzeptieren. Es gibt keine Vernunftgründe, anhand deren man sich für einen der beiden Standpunkte entscheiden könnte, genauso wenig, wie uns der moralische Relativismus vernünftige Gründe dafür liefern kann, Freunde zum Essen einzuladen, um sie dann mit den Füßen am Dachbalken aufzuhängen und ihnen die Taschen auszuleeren. Wahre Hoffnung dagegen muss durch Gründe untermauert werden. Darin ähnelt sie der Liebe, und theologisch gesehen, ist sie sogar eine bestimmte Spielart der Liebe. Sonst ist sie nur ein Bauchgefühl, vergleichbar mit der Überzeugung, dass ein Oktopus unter Ihrem Bett lebt. Hoffnung muss fehlbar sein, im Gegensatz zur angeborenen Fröhlichkeit.
Selbst wenn der Optimist zugibt, dass es keine faktischen Gründe für seine Haltung gibt, muss das seiner Begeisterung nicht unbedingt Abbruch tun. Mark Tapley aus dem Roman Martin Chuzzlewit von Charles Dickens ist so finster entschlossen, gut gelaunt zu sein, dass er sich in ausweglose Situationen begibt, die jeden anderen in Verzweiflung stürzen würden, nur um zu beweisen, dass seine Fröhlichkeit nicht bloß Fassade ist. Da Tapley dafür sorgt, dass sein Leben möglichst schrecklich ist, damit er mit sich zufrieden sein kann, ist sein Optimismus letztlich egoistisch, so wie fast alle Standpunkte des Romans. Der Egoismus ähnelt der Empfindsamkeit, einer weiteren verborgenen Seelenverwandten. Martin Chuzzlewit ist so durchdrungen von Egozentrik, dass selbst Tapleys Großzügigkeit eher als Eigenheit seines Charakters erscheint denn als moralische Tugend. In gewisser Weise möchte er seine Lage gar nicht verbessern, denn das würde seiner Herzlichkeit ihre moralische Grundlage entziehen. So macht seine Zuversicht gemeinsame Sache mit den Kräften, die für das Elend um ihn herum verantwortlich sind. Entsprechend ist der Pessimist skeptisch gegenüber allen Verbesserungsvorschlägen – nicht weil sie ihm die Möglichkeit zur Heiterkeit rauben könnten, sondern weil er glaubt, dass sie zum Scheitern verurteilt sind.
Optimisten glauben an den Fortschritt. Doch wenn Dinge verbessert werden können, dann folgt daraus, dass die herrschenden Verhältnisse noch einiges zu wünschen übriglassen. In diesem Sinne ist der Optimismus nicht ganz so absolut wie der Optimalismus des 18. Jahrhunderts – die Leibniz’sche Behauptung, wir lebten in der besten aller möglichen Welten. Der Optimismus ist nicht ganz so optimistisch wie der Optimalismus. Für den Optimalisten befinden wir uns bereits in der besten aller möglichen kosmischen Ordnungen; im Gegensatz dazu kann der Optimist die Mängel der Gegenwart durchaus eingestehen und sich stattdessen an die Verheißungen der Zukunft halten. Es geht um die Frage, ob die Perfektion bereits erreicht ist oder ob sie das Ziel ist, nach dem wir streben. Unschwer ist zu erkennen, dass der Optimalismus der moralischen Trägheit Vorschub leisten könnte, die dann wiederum die optimalistische These untergrübe, dass die Welt sich nicht mehr verbessern lasse.
Optimalisten sind bar jeder Hoffnung, nicht anders als Nihilisten – beide brauchen sie nicht. Weil sie keine Notwendigkeit für Veränderung sehen, finden sie sich oft im Lager der Konservativen wieder, die jede Veränderung beklagenswert finden oder die Lage für zu schlimm halten, um sie sich einzugestehen. Henry James hat einmal gesagt: »Zwar ist ein Konservativer nicht zwangsläufig ein Konservativer, aber ein Optimist ist höchstwahrscheinlich ein Konservativer.«6 Optimisten sind Konservative, weil ihr Glaube an eine erfreuliche Zukunft tief in ihrem Vertrauen auf die grundsätzliche Zuverlässigkeit der Gegenwart verwurzelt ist. Tatsächlich ist der Optimismus typisch für die Ideologie der herrschenden Klassen. Wenn Regierungen ihren Bürgern nicht mitteilen, dass eine schreckliche Apokalypse unmittelbar bevorsteht, dann wohl deshalb, weil die Alternative zur Zuversicht politische Unzufriedenheit sein könnte. Trostlosigkeit hingegen kann eine radikale Haltung sein. Nur wenn wir unsere Situation kritisch beurteilen, halten wir es für nötig, sie zu ändern. Unzufriedenheit ist gelegentlich ein Ansporn für Reformen. Dagegen wird Zuversicht stets zu bloß kosmetischen Lösungen führen. Wahre Hoffnung brauchen wir, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, was von Optimisten allerdings meist geleugnet wird. Sie verzichten lieber auf die Hoffnung, denn wer auf Hoffnung angewiesen ist, muss zugeben, dass das Schlimmste schon eingetreten ist. So hat die Hoffnung in der hebräischen Bibel einen unheilvollen Subtext, bedeutet sie doch die Nähe der Gottlosen. Wer der Tugend bedarf, ist von Übeltätern umgeben.
In Schopenhauer als Erzieher unterscheidet Friedrich Nietzsche zwei Arten der Heiterkeit – die eine, die, wie im antiken Griechenland, durch die tragische Konfrontation mit dem Schrecklichen hervorgerufen wird, und die andere, die eine oberflächliche Form der Herzlichkeit ist und durch Verdrängung des Unabänderlichen erkauft wird. In letzterem Fall sind wir unfähig, uns dem Ungeheuer zu stellen, das wir angeblich bekämpfen. Insofern stehen Hoffnung und angeborener Optimismus auf dem Kriegsfuß. Wahre Heiterkeit ist nach Nietzsches Auffassung eine mühe- und anspruchsvolle Angelegenheit, eine Frage des Mutes und der Selbstüberwindung. Sie hebt die Unterscheidung zwischen Freude und Ernst auf – weshalb er auch in Ecce Homo von der Möglichkeit schreibt, »unter lauter harten Wahrheiten wohlgemut und heiter zu sein«. Nietzsche hatte natürlich höchst zweifelhafte Gründe, den Optimismus abzulehnen. In der Geburt der Tragödie gibt er beispielsweise den Macho, wenn er den Optimismus als »Schwächlichkeitsdoktrin« bezeichnet und ihn mit den gefährlichen revolutionären Bestrebungen des »Sklavenstandes« seiner Zeit in Verbindung bringt.
Theodor W. Adorno hat einmal gesagt, dass die Denker, die uns die nüchterne und ungeschminkte Wahrheit präsentierten (er dachte dabei vor allem an Freud), der Menschheit einen größeren Dienst erwiesen als die blauäugigen Utopisten. Wir werden später sehen, wie Adornos Kollege Walter Benjamin seine revolutionäre Vision aus einem Misstrauen gegenüber dem historischen Fortschritt und einer melancholischen Grundstimmung entwickelte. Benjamin selbst nannte seine Einstellung »Pessimismus«, aber man könnte sie ebenso gut als Realismus bezeichnen – jene moralische Haltung, die wohl am schwierigsten zu erreichen ist. In einem vielgerühmten Aufsatz über den Surrealismus spricht er von der dringenden Notwendigkeit, den Pessimismus für politische Zwecke zu »organisieren«, und bezieht damit Stellung gegen den wohlfeilen Optimismus bestimmter linker Gruppierungen. Nötig sei »Pessimismus auf der ganzen Linie. Jawohl und durchaus. Mißtrauen in das Geschick der Literatur, Mißtrauen in das Geschick der Freiheit, Mißtrauen in das Geschick der europäischen Menschheit, vor allem aber Mißtrauen, Mißtrauen und Mißtrauen in alle Verständigung: zwischen den Klassen, zwischen den Völkern, zwischen den Einzelnen. Und unbegrenztes Mißtrauen in I. G. Farben und die friedliche Vervollkommnung der Luftwaffe.«7 Benjamins beharrliche Skepsis dient dem Wohl der Menschen. Sie ist der Versuch, kühl und unbeirrt zu bleiben, um konstruktiv handeln zu können. Bei anderen könnten diese Vorbehalte zweifellos zum grundsätzlichen Zweifel an der Möglichkeit politischer Veränderungen führen. Ihnen erscheinen Veränderungen umso schwieriger, je schlechter die Verhältnisse sind. Ganz anders Benjamin. Für ihn ist die Widerlegung des Optimismus eine wesentliche Voraussetzung für politische Veränderungen.
***
Optimismus und Pessimismus können Elemente einer allgemeinen Weltanschauung oder einer individuellen Einstellung sein. Beispielsweise neigen Liberale eher zu jenem, Konservative eher zu diesem. Grundsätzlich könnte man sagen, dass ein Liberaler darauf vertraut, dass sich die Menschen anständig benehmen, wenn sie sich frei entfalten können, während der Konservative sie eher als unberechenbare Wesen voller Fehler betrachtet, die gebändigt und diszipliniert werden müssen, wenn sie irgendwelchen Nutzen bringen sollen. Es gibt eine ähnliche Unterscheidung zwischen Romantikern und Klassizisten. Im Großen und Ganzen beurteilte das Mittelalter die Menschen weniger euphorisch als die Renaissance, obwohl beide Epochen in gewissem Sinne dem Glauben an Sünde und Verderbnis verfallen waren. Ignaz Reilly, der Held aus John Kennedy Tooles Roman Ignaz oder die Verschwörung der Idioten und ein fanatischer Anhänger des Mittelalters, erklärt: »Optimismus ekelt mich an. Er ist widernatürlich. Seit dem Sündenfall ist die Stellung des Menschen im Universum durch Not und Elend gekennzeichnet.«
Konservative unterteilt man gelegentlich in sogenannte Deterioristen, für die es einst ein Goldenes Zeitalter gab, bevor es unaufhaltsam abwärts ging, und die anderen, die jedes Zeitalter für gleichermaßen verdorben halten. Man kann Das wüste Land von T. S. Eliot so interpretieren, dass es diese einander ausschließenden Ansichten in sich vereint. Ende des 19. Jahrhunderts gab es solche Ideologen, die zugleich optimistisch und pessimistisch waren. Sie priesen die Vorzüge von Zivilisation und Technik, machten sie aber gleichzeitig verantwortlich für Entropie, Zerfall und nicht zuletzt für das Entstehen einer halb-vertierten Unterklasse.8 Marxisten wie Christen beurteilen den aktuellen Zustand der Menschheit schlechter als Liberale und Sozialreformer, äußern sich aber sehr viel zuversichtlicher über die Zukunftsaussichten – Haltungen, die lediglich die beiden Seiten einer Medaille sind. Man blickt voller Vertrauen in die Zukunft, weil man sich die Gegenwart in den düstersten Farben ausmalt. Wie wir später sehen werden, ist dies eine tragische Weltsicht, die den unverbesserlichen Fortschrittsgläubigen wie den untröstlichen Untergangspropheten gleichermaßen fremd ist.
Dass es in der Geschichte der Menschheit Fortschritte gegeben hat, ist wohl kaum zu bestreiten.9 Die Leute, die daran trotzdem Zweifel äußern – unter ihnen eine Reihe postmoderner Denker –, würden sich vermutlich schön bedanken, müssten sie zur Hexenverbrennung und Sklavenhaltung, zu den sanitären Zuständen des 12. Jahrhunderts oder zu chirurgischen Eingriffen ohne Narkose zurückkehren. Dass wir in einer Welt voller Kernwaffen und grauenhafter Armut leben, kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass einige Dinge sich unglaublich verbessert haben. In Frage stellen sollten wir nicht die Fortschritte im Einzelnen, sondern den großen, den globalen Fortschritt. Zu glauben, dass es in der Geschichte Fortschritte gegeben hat, heißt nicht, dass man davon überzeugt ist, die Geschichte entwickle sich unaufhaltsam zum Besseren. In seiner zukunftstrunkensten und selbstgefälligsten Zeit glaubte das Bürgertum, die Menschheit erreiche aus eigener Kraft einen immer höheren oder gar utopischen Zustand. Selbst Wissenschaftler und Politiker, die ansonsten eher kompromisslos und pragmatisch waren, hingen diesem Perfektibilismus an, wie man damals sagte. Wir werden später einer linken Spielart dieses Glaubens in den Schriften von Ernst Bloch begegnen. Man könnte diese Sichtweise (wenn auch nicht in Blochs Fall) als optimistischen Fatalismus bezeichnen – ohne Frage ein sonderbarer Begriff, denn heutzutage paart sich Fatalismus eher mit Pessimismus. Das Unvermeidliche ist in der Regel unangenehm. Während das Bild des halbvollen Glases Hoffnung auf eine rein subjektive Regung reduziert, verdichtet die Fortschrittsdoktrin die Metapher zu einer objektiven Realität. Für Philosophen wie Herbert Spencer und Auguste Comte kann die Menschheit entweder mit den mächtigen Gesetzen, die die Geschichte vorantreiben, kooperieren oder sie kann sie behindern; aber sie vermag ihren Grundcharakter nicht zu verändern, ebenso wenig wie sie in die Vorsehung eingreifen kann. Ganz ähnlich sieht es Immanuel Kant, für den die Natur selbst den ewigen Frieden garantiert, und zwar durch freie menschliche Tätigkeiten wie Handel und Wirtschaft. Hoffnung ist dabei gewissermaßen mit der Struktur der Wirklichkeit verflochten. Dabei ist sie ein genauso fester Bestandteil der Welt wie jene Kräfte, die die Anatomie des Seesterns festlegen. Wir können sie vielleicht vergessen, aber sie wird uns nicht vergessen. Sie ist eine Sichtweise, durch die die Menschen Gefahr laufen, in eine Art politische Katatonie zu verfallen, denn wenn ihnen ohnehin eine strahlende Zukunft bevorsteht, gibt es eigentlich keinen Grund, dass sie sich um sie bemühen. Die marxistische Richtung, für die eine kommunistische Zukunft bereits eine ausgemachte Sache ist, muss ebenfalls Gründe finden, warum sich der Kampf lohnt.
Extravagante Formen des Optimismus können moralisch fragwürdig sein. Zu ihnen gehört die Theodizee, der Versuch, das Böse mit der Begründung zu rechtfertigen, dass aus ihm auch Gutes erwachsen könne, was dem übertriebenen Optimismus geradezu kosmische Ausmaße verleiht. Alexander Pope erläutert uns in seinem – Leibniz und dem Deismus sehr verpflichteten – Gedicht Vom Menschen, dass das Böse einfach nur das missverstandene Gute sei. Betrachteten wir Gewalt und Sklaverei aus einer globalen, das gesamte Universum umfassenden Perspektive, würden wir erkennen, dass sie wesentlich zum allgemeinen Wohl beitragen. Moralischer Protest sei also in Wirklichkeit Kurzsichtigkeit. In Georg Büchners Stück Dantons Tod spekuliert ein Protagonist: »Es gibt ein Ohr, für welches das Ineinanderschreien und der Zeter, die uns betäuben, ein Strom von Harmonien sind.« Außerdem kann die Not uns zu Menschen machen. Richard Swinburne schreibt, Gott habe guten Grund, »Hiroshima, Bergen-Belsen, das Erdbeben von Lissabon oder den Schwarzen Tod« zuzulassen, damit die Menschen in einer realen Welt leben können, nicht in einer Spielzeugwelt.10 Spielzeugwelten stellen uns nicht vor echte Herausforderungen und geben uns daher kaum Gelegenheit, unsere moralischen Kräfte zu betätigen. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Nicht-Akademiker auf einen derartigen Gedanken verfiele.
Theodizeen von solch widerwärtiger Mitleidlosigkeit lehren uns nicht, dass das Böse, wie widerwärtig es auch sei, manchmal auch Gutes bewirken kann – wer wüsste das nicht –, sondern postulieren, dass das Böse akzeptiert, ja sogar begrüßt werden müsse, weil es eine notwendige Vorbedingung so löblicher Effekte sei. Für einige Philosophen der Aufklärung, die diese Theorie vertraten, ergab sich allerdings ein Problem: Je mehr ihnen das Universum als rationales, harmonisches Ganzes erschien, desto gravierender wurde das Problem des Bösen.11 Solcher kosmischer Optimismus ist eher kontraproduktiv, weil er in den Vordergrund rückt, womit sich seine Vertreter eigentlich besonders schwertun. Wer an die Perfektibilität glaubt, wird größeres Entsetzen bei dem Gedanken an Krieg und Genozid empfinden als der Zyniker oder Misanthrop, der in solchen Katastrophen möglicherweise die tröstliche Bestätigung seiner Annahmen über die menschliche Schlechtigkeit erkennt.
Im 18. Jahrhundert gab es Philosophen, die die Realität des Bösen bestritten, während man im 19. Jahrhundert meinte, das Problem lasse sich durch die Fortschrittsdoktrin lösen. Man historisierte die deistische Auffassung. Das Böse war zwar durchaus real, aber man war im Begriff, es auszumerzen. Auf diese Weise erlaubte die Fortschrittsidee ihren Anhängern, das Unleugbare anzuerkennen, gleichzeitig jedoch dem Glauben an die Vervollkommnung des Menschen treu zu bleiben. Aus historizistischer Perspektive ließen sich harte Arbeit und Entbehrung durch die Auffassung rechtfertigen, sie trügen entscheidend zur Verbesserung der menschlichen Art bei. Ohne die Knochenarbeit der einen kann es keine zivilisierte Existenz der anderen geben. Für jede großartige Skulptur oder Symphonie stehen irgendwo eine Ansammlung erbärmlicher Hütten. Die Ansicht, Zivilisation und Kultur seien nicht ohne Ausbeutung möglich, wurde schon von Friedrich Nietzsche vertreten; auch von einigen anderen, die sich allerdings nicht trauten, sie so offensiv zu verkünden. Arbeit ist die Mutter der Kultur, und ähnlich den vielen vom Leben enttäuschten Müttern findet auch diese Trost im Erfolg ihrer Kinder. Wie der Superstar sich scheut, seine ärmliche Kindheit publik zu machen, so mag sich auch die Kultur nicht zu ihrer schäbigen Herkunft bekennen.
Wenn die Ideologen des Frühkapitalismus Hoffnung hatten, dann unter anderem deshalb, weil sie ihr System noch nicht für abgeschlossen hielten. Produktion war eine Chronik, die noch zu Ende geschrieben werden musste. Im Gegensatz dazu ist der Spätkapitalismus weit weniger hoffnungsvoll, um nicht zu sagen mutlos. Anders als das produzierende Ich bewohnt das konsumierende Ich nur noch eine lose Folge von Momenten in der Zeit, ohne eine kontinuierliche Geschichte zu besitzen. Es ist zu beliebig und diffus, um Subjekt einer erkennbaren Entwicklung zu sein. Aus diesem Grund gibt es auch keine radikal veränderte Zukunft, der es entgegensehen könnte. Hoffnung von greifbaren Ausmaßen ist obsolet. Es ist unwahrscheinlich, dass sich je wieder ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung ereignen wird, weil der Raum, in dem es sich zutragen könnte, zu Staub zerfallen ist. Stattdessen wird die Zukunft eine endlos aufgeblähte Gegenwart sein. So lässt sich die gespannte Erwartung auf das, was die Zukunft bringen wird, mit der beruhigenden Gewissheit verbinden, dass sie keine unangenehmen Überraschungen parat halten wird. In einer früheren Phase des Kapitalismus war Hoffnung möglich, weil sich eine strahlende Zukunft voraussehen ließ; in einem späteren Stadium desselben Systems ist die Erwartung auf die Annahme geschrumpft, die Zukunft werde eine Wiederholung der Gegenwart sein. Es gibt nicht viel Hoffnung; aber diese Tatsache an sich gibt Anlass zur Hoffnung, denn sie bedeutet, dass keine Rettungstaten mehr erforderlich sind.12
Nationen können, genau wie politische Strömungen, optimistisch oder pessimistisch sein. Neben Nordkorea sind die Vereinigten Staaten eines der wenigen Länder dieser Erde, in denen der Optimismus schon fast zur Staatsideologie erhoben wurde. In großen Teilen der Nation ist Optimismus gleichbedeutend mit Patriotismus, während Negativität als eine Form des Gedankenverbrechens gilt. Pessimismus hält man für subversiv. Selbst in finstersten Zeiten wird das kollektive Unterbewusstsein der Nation von Allmachtsphantasien und Entgrenzungswahn heimgesucht. Ein US-amerikanischer Präsident, der seinen Bürgern verkündete, dass ihre besten Jahre bereits hinter ihnen lägen, wäre ebenso undenkbar wie ein Schimpanse im höchsten Staatsamt – auch wenn man ein oder zwei Mal den Eindruck hatte, es sei schon so weit. Ein solcher Politiker wäre wohl kaum vor Attentaten zu schützen. Kürzlich wies ein amerikanischer Historiker darauf hin, dass »Antrittsreden von Präsidenten optimistisch sind, egal, in welchen Zeiten sie gehalten werden«. Der Kommentar war nicht als Kritik gemeint. Bestimmte Aspekte der amerikanischen Kultur sind von zwanghafter Fröhlichkeit bestimmt, einer Ich-kann-alles-tun-was-ich-will-Rhetorik, in der eine fast pathologische Versagensangst zum Ausdruck kommt.
In dem Bestreben, der Hoffnungsideologie seines Heimatlandes eine wissenschaftliche Basis zu verschaffen, befasst sich der amerikanische Forscher Lionel Tiger in einer entsetzlich geschmacklosen Studie mit dem Titel The Biology of Hope mit Affen unter Drogeneinfluss, stimmungsverändernden Substanzen und Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Ausscheidungen von Eltern, die um ihre verstorbenen Kinder trauern. Könnte jemand die physiologische Grundlage der Fröhlichkeit bestimmen, wäre es vielleicht möglich, die politische Unzufriedenheit zu beseitigen und die amerikanische Bevölkerung in einen Zustand permanenter Verzücktheit zu versetzen. Hoffnung ist ein politisch nützliches Stimulans. »Es ist durchaus denkbar«, so heißt es bei Tiger, »dass es unser aller Pflicht ist, den Optimismus zu optimieren.«13 Stalin und Mao scheinen der gleichen Meinung gewesen zu sein. Es ist unsere moralische Pflicht, wider alle Evidenz darauf zu beharren, dass alles zum Besten bestellt ist.
Ganz ähnlich belehren uns die Autoren eines Buches mit dem Titel Hope in the Age of Anxiety: »Hoffnung ist die beste Medizin, da sie einen adaptiven Mittelweg zwischen der Überaktivierung während der Stressreaktion und der Deaktivierung beim Giving-up-Komplex darstellt.« Hoffnung versorgt uns mit »angemessenen Mengen von Neurotransmittern, Hormonen, Lymphozyten und anderen wichtigen gesundheitsrelevanten Substanzen«.14 Ein Mangel an diesen Stoffen schadet Ihrer persönlichen und politischen Gesundheit. Der amerikanische Philosoph William James war etwas zurückhaltender mit seiner zuckersüßen Vision: »Ist das letzte Wort eitel Süßigkeit? Sagt in der Welt alles nur ›Ja, Ja‹? Liegt nicht die Tatsache des ›Nein‹ im innersten Kern des Lebens? Bringt es nicht schon der Ernst des Lebens, von dem wir so viel sprechen, mit sich, daß unvermeidliches Nein-Sagen und vermeintliche Verluste einen Teil des Lebens bilden, daß wirkliche Opfer gebracht werden müssen, daß auf dem Grunde der Schale immer etwas Bitteres zurückbleibt?«15
Die eher »glaubensbasierte« als »wirklichkeitsbasierte« Politik der George-W.-Bush-Regierung machte sich eine verbreitete amerikanische Einstellung so gründlich zu eigen, dass sie im Irrsinn endete: Die Realität ist eine Pessimistin, vor deren verräterischen Reden man seine Ohren verschließen muss. Da die Wahrheit oft genug unangenehm ist, muss sie sich einem eisernen Willen beugen. Diese Form des Optimismus lässt sich kaum von einer psychischen Störung unterscheiden. Solcher Frohsinn entspricht dem Abwehrmechanismus der Verleugnung. Trotz seiner zur Schau getragenen Entschlossenheit ist er in Wahrheit eine moralische Vermeidungsstrategie. Er ist der Feind der Hoffnung, die logischerweise zur Genauigkeit verpflichtet ist, da sie fähig sein muss, die Lage exakt zu erfassen. Im Gegensatz dazu wird der Optimist durch die Unbeschwertheit, dank der er hoffen kann, dazu verleitet, die Hindernisse zu unterschätzen, die es zu überwinden gilt, so dass seine Zuversicht auf tönernen Füßen steht. Der Optimismus nimmt die Verzweiflung nicht ernst genug. Kaiser Franz Josef soll gesagt haben, dass die Lage in Berlin ernst, aber nicht hoffnungslos sei, in Wien dagegen hoffnungslos, aber nicht ernst.
Fröhlichkeit gehört zu den banalen Emotionen. Wir assoziieren sie mit Leuten, die gestreifte Jacken und rote Plastiknasen tragen. So ruft allein das englische Wort happiness (»Glück«) – im Gegensatz zum französischen bonheur oder dem altgriechischen eudaimonia – Konnotationen von Pralinenschachteln wach, während contentment (»Zufriedenheit«) allzu behaglich klingt. »Unweise Leute betrügen sich selbst mit törichten Hoffnungen« heißt es im Buch Jesus Sirach. Der französische Philosoph Gabriel Marcel bezweifelt, dass es eine tiefere Form des Optimismus geben kann.16 Vielleicht tun wir gut daran, ihn als entartete, rettungslos naive Form der Hoffnung zu begreifen. Eine unerträgliche Brüchigkeit zeichnet ihn aus, ähnlich der Hemmungslosigkeit, mit der sich der Pessimist mit kaum verhohlener Lust an der eigenen Trübsal mästet. Wie der Pessimismus überzieht der Optimismus die ganze Welt mit einer Einheitsfarbe, blind gegen alle Abstufungen und Unterschiede. Da es sich um eine allgemeine Geistesverfassung handelt, werden alle Objekte durch eine Art Tauschwert des Gemüts mehr oder weniger auswechselbar. Der unbelehrbare Optimist antwortet auf alles mit den gleichen vorprogrammierten Reaktionen und beseitigt auf diese Weise Zufall und Kontingenz. In unserer deterministischen Welt ist den Dingen mit übernatürlicher Vorhersagbarkeit bestimmt, sich völlig grundlos zum Guten zu wenden.
Es ist schon bemerkenswert, dass in England zwischen dem Erscheinen von Samuel Richardsons Clarissa Mitte des 18. Jahrhunderts und den Büchern von Thomas Hardy Ende der viktorianischen Epoche kaum ein tragischer Roman (soll heißen mit verhängnisvollem Ende) erschienen ist. Natürlich gibt es einige haarsträubende Fast-Katastrophen. Sturmhöhe entgeht der Tragödie um Haaresbreite, während Charlotte Brontës Vilette dem Leser zwei alternative Schlüsse bietet, einen tragischen und einen komischen, als hätte es der Autorin Kopfschmerzen bereitet, sich ganz auf das tragische Ende zu verlassen. Maggie Tulliver, die Protagonistin in George Eliots Die Mühle am Floss, stirbt zwar am Ende der Geschichte, das aber in so ekstatischer Vereinigung mit ihrem Bruder, diesem sturen Flegel, dass der Schluss seltsam erbaulich wirkt. Zwar lässt Eliot ihr Middlemarch eher gedämpft enden, bestätigt allerdings ganz zuletzt – wie elegisch auch immer – den Glauben an den Reformgeist. Die letzten Worte in Dickens’ Klein Dorrit klingen ziemlich trostlos, aber der Autor verhindert in diesem Roman, wie in allen anderen, dass sich die Ernüchterung zur Tragödie auswächst. Folgerichtig veränderte Dickens in Große Erwartungen das Ende so, dass Held und Heldin doch noch zueinanderfinden. Selbst bei der Beschreibung der schlimmsten sozialen Verhältnisse gelingt es ihm mit seinem pyrotechnischen Stil, diese auf Armeslänge von uns fernzuhalten. Er schildert das Elend im viktorianischen England mit so viel Schwung und Feuer, dass er es damit in gewisser Weise überwindet.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.