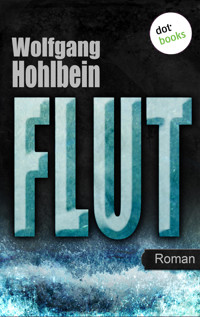1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hohlbein Classics
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Die Story: Nach einer Autopanne irren Damona King und Mike Hunter auf der Suche nach Hilfe durch einen Wald. Als wie aus dem Nichts plötzlich ein dichter Nebel aufzieht, sind sie zwar etwas beunruhigt, ahnen aber noch nicht , welche Gefahren sich dahinter verbergen. Ein kleiner Junge läuft ihnen über den Weg und berichtet von einem Autounfall, den er und seine Eltern gehabt haben wollen. Damona und Mike wollen dem kleinen helfen, tasten sich durch den Nebel und stehen plötzlich vor einem seltsamen Haus. In ihrer Überzeugung, endlich Hilfe gefunden zu haben, hören die beiden Geisterjäger nicht auf ihren untrüglichen Instinkt. Sie schlagen die Warnung in den Wind und klopfen an. Als schließlich die Tür geöffnet wird, packt die Verwirrten das nackte Grauen. Denn der Bewohner des unheimlichen Hauses ist kein Mensch ...
"Das Haus im Nebelmoor" erschien erstmals am 06.09.1982 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe "Damona King".
Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Ähnliche
Inhalt
Hohlbein Classics
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Über diese Folge
Das Haus im Nebelmoor
Ein Damona King Roman
Nach einer Autopanne irren Damona King und Mike Hunter auf der Suche nach Hilfe durch einen Wald. Als wie aus dem Nichts plötzlich ein dichter Nebel aufzieht, sind sie zwar etwas beunruhigt, ahnen aber noch nicht , welche Gefahren sich dahinter verbergen. Ein kleiner Junge läuft ihnen über den Weg und berichtet von einem Autounfall, den er und seine Eltern gehabt haben wollen. Damona und Mike wollen dem kleinen helfen, tasten sich durch den Nebel und stehen plötzlich vor einem seltsamen Haus. In ihrer Überzeugung, endlich Hilfe gefunden zu haben, hören die beiden Geisterjäger nicht auf ihren untrüglichen Instinkt. Sie schlagen die Warnung in den Wind und klopfen an. Als schließlich die Tür geöffnet wird, packt die Verwirrten das nackte Grauen. Denn der Bewohner des unheimlichen Hauses ist kein Mensch ...
»Das Haus im Nebelmoor« erschien erstmals am 06.09.1982 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe »Damona King«.
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
WOLFGANG
HOHLBEIN
Das Haus im Nebelmoor
Ein Damona King Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Damona King
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1448-9
Das Haus im Nebelmoor
Gespensterkrimi von Henry Wolf
Der Hügel lag tief im Wald. Mächtig, schwarz und buckelig ragte er bis fast zur Höhe der Baumwipfel empor, und auf ihm, dräuend und dunkel wie ein Ausschnitt aus einem bizarren, beängstigenden Albtraum, erhob sich das Haus. Graue, treibende Nebelschwaden krochen über das taufeuchte Gras des Hügels, spielten um die Grundmauern des Hauses und leckten wie kleine, gierige Zungen an seinen Mauern empor. Die Sonne war schon vor Stunden aufgegangen, aber über dem Hügel schien es nicht richtig Tag zu werden. Die Nebelschwaden trugen noch eine Ahnung der Nacht mit sich, und hinter den Fenstern des Hauses hatte sich tiefe, von tanzenden Schatten erfüllte Dunkelheit eingenistet.
Eine bedrückende, geisterhafte Stille hatte sich über dem Hügel und dem buckeligen Haus ausgebreitet, ein Schweigen, das an Friedhofsstille und den muffigen Geruch alter Grüfte erinnerte und das vom auf- und abschwellenden Heulen des Windes eher vertieft wurde. In der schwarz glänzenden Oberfläche des Moores, das den Hügel wie ein finsterer Burggraben säumte, erschienen von Zeit zu Zeit große, träge schimmernde Gasblasen, die mit dumpfem Geräusch platzten und Schwaden gelb schimmernder, stinkender Dämpfe entließen. Irgendwo schrie ein verirrtes Käuzchen, aber der Laut klang anders als gewohnt: leiser, zaghafter und voller Angst.
Hinter den schmalen Fenstern des Hauses entstand Bewegung. Ein großer, unförmiger Schatten schob sich vor das wabernde Schwarz, das die blinden Scheiben ausfüllte, verharrte einen Moment reglos und verschwand dann wieder. Wenige Augenblicke später begann sich die Tür knarrend in den rostigen Scharnieren zu bewegen. Eine Welle eisiger, moderig riechender Luft drang aus dem Haus und überzog das niedergetrampelte Gras vor dem Ausgang für Sekunden mit schimmernden Eiskristallen. Dann schob sich ein großes, plump tapsendes Etwas aus dem Gebäude, trat ein paar Schritte auf den Hügel hinaus und starrte aus blinden Augen nach Westen. Seine Hände schlossen sich in einer unbewussten, kraftvollen Bewegung. Aber es war nichts Menschliches an der Geste.
Denn der Bewohner des unheimlichen Hauses war kein Mensch ...
***
»Aus!«
Mike knallte die Motorhaube des Porsche zu, wischte seine ölverschmierten Finger in Ermangelung eines Putzlappens an seiner Jeanshose ab und ließ sich dann seufzend auf den Beifahrersitz neben Damona fallen. »Die Kiste fährt keinen Meter mehr«, sagte er, nachdem er sich mit einer müden Geste über die Augen gefahren war. »Hast du eine Zigarette da?«
Damona griff schweigend ins Handschuhfach und förderte eine zerknitterte Packung Marlboro zutage. Mike schnippte eines der weißen Stäbchen heraus, klemmte es zwischen die Lippen und ließ sein Feuerzeug aufschnappen.
»Was ist überhaupt los?«, fragte Damona nach einer Weile.
Mike zuckte die Achseln. »Ich bin kein Mechaniker, Schatz«, sagte er mit einem schmerzlichen Lächeln. »Aber nach allem, was ich von Autos verstehe, ist die Maschine hin.«
»Aber das ist doch unmöglich!«
»Nichts ist unmöglich«, sagte Mike und blies einen Rauchring durch das halb heruntergekurbelte Seitenfenster. »Vielleicht ist auch nur der Sprit alle – was weiß ich«, fügte er achselzuckend hinzu. »Jedenfalls kommen wir mit der Kiste keinen Yard mehr weiter. Haben wir einen Reservekanister?«
Damona nickte. »Sogar zwei. Einen vollen im Kofferraum des Rovers und einen leeren unter dem Rücksitz.«
»Deinen Humor scheinst du jedenfalls noch nicht verloren zu haben«, murrte Mike. »Aber das ist auch gut so. Du wirst ihn brauchen.«
Damona zog fragend die linke Augenbraue hoch.
»Wir werden wohl oder übel laufen müssen«, sagte Mike nach einer Weile. »Zehn Meilen durch Nacht und Nebel und einen menschenleeren Wald. Brrr!«
Damona lächelte. »Angst?«
»Nein. Aber Senkfüße. Ich wurde deswegen vom Militärdienst freigestellt«, gab Mike übellaunig zurück. »Und alles nur wegen dieser blöden Kiste. Das nächste Mal kaufe ich mir ein Fahrrad. Auf lange Sicht gesehen ist das nicht so anstrengend.« Damona verzichtete auf die ironische Antwort, die ihr auf der Zunge gelegen hatte, schüttelte stumm den Kopf und lehnte sich in dem bequemen Schalensitz des Sportwagens zurück. Sie waren am frühen Abend von Edinburgh aus losgefahren, und eigentlich sollten sie jetzt schon in ihrem behaglich geheizten Schlafzimmer auf Kings Castle liegen. Stattdessen saßen sie auf einer gottverlassenen Landstraße fest und warteten darauf, dass ein Wunder geschah.
Sie sah auf die Uhr. Mitternacht war vorbei, und sie befanden sich in einer derart abgelegenen Gegend Schottlands, dass es selbst am hellen Tage schwer gewesen wäre, einen anderen Autofahrer zu treffen. Um diese Uhrzeit ... Sie schauderte, kurbelte das Fenster hoch und schaltete die Zündung ein. Auf dem Armaturenbrett des Porsche glühten zwei kleine farbige Lämpchen auf. Die Heizung begann zu summen, und aus den Lüftungsschlitzen drang ein angenehm warmer Luftstrom.
»Was glaubst du, wie lange die Batterie das durchhält?«, fragte Mike.
Damona zuckte die Achseln. »Vielleicht so lange, bis jemand vorbeikommt und uns aufliest«, sagte sie ohne rechte Überzeugung.
»Wahrscheinlich ist der Saft in längstens einer Stunde alle«, murrte Mike. »Wird eine ungemütliche Nacht werden.«
»Du willst im Ernst hier im Wagen bleiben?«, fragte Damona.
Mike schnippte seine kaum angerauchte Zigarette aus dem Fenster und kurbelte die Scheibe hoch. »Hast du eine bessere Idee?«
Damona starrte an ihm vorbei auf die massige, schwarzgrüne Wand des Tannenwaldes, der die Straße auf beiden Seiten wie ein gigantischer natürlicher Zaun säumte. Ihr Blick verlor sich schon nach wenigen Metern in ungewissem Schwarz. Ohne dass sie einen logischen Grund dafür angeben konnte, erfüllte sie der Anblick mit Unbehagen. Über der Straße war ein schmaler tintenblauer Streifen des Sternenhimmels sichtbar, der irgendwo in nicht zu bestimmender Entfernung mit dem hellgrauen Asphaltband der Straße verschmolz. Damona hatte plötzlich den Eindruck, sich am Grunde eines tiefen, endlosen Schachtes zu befinden, dessen Wände aus materialisierter Schwärze bestanden. Der Gedanke, die ganze Nacht über in dieser bedrückenden Umgebung praktisch gefangen zu sein, behagte ihr ganz und gar nicht. Aber die Vorstellung, auszusteigen und den – wenn auch nur eingebildeten – Schutz des Wagens zu verlassen, gefiel ihr noch weniger.
Mike beugte sich vor und schaltete das Autoradio ein, aber aus dem Lautsprecher drangen nur knarrende und quietschende Geräusche, egal wie lange er auch an der Sendereinstellung drehte. Schließlich zuckte er mit den Achseln, schaltete das Gerät aus und ließ sich mit einem ergebenen Seufzer zurücksinken.
»Also – was tun wir?«
»Woher soll ich das wissen?«, fragte Damona. »Es kann die ganze Nacht über dauern, bis hier jemand vorbeikommt – wenn überhaupt. Andererseits habe ich keine besondere Lust, die acht Meilen bis zur nächsten Ortschaft zurückzulaufen.« Mike deutete mit einer Kopfbewegung nach vorne. »Gehen wir vorwärts.«
»Und wie weit?«
»Keine Ahnung. Aber schließlich sind wir hier in Schottland, nicht irgendwo in Australien. Früher oder später werden wir auf eine Ortschaft stoßen.«
»Ich fürchte, eher später«, murmelte Damona. »Wenn wir wenigstens eine Straßenkarte hätten.«
»Haben wir«, sagte Mike, wobei es ihm sichtlich schwerfiel, sich ein schadenfrohes Grinsen zu verkneifen. »Im Rover. Direkt unter dem Reservekanister.«
Damona schenkte ihm einen finsteren Blick. »Witzbold«, sagte sie humorlos. »Hättest du rechtzeitig getankt, statt ...«
Mike brachte sie mit einer unwilligen Geste zum Schweigen. »Lassen wir das, Damona. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns jetzt auch noch streiten. Wir lassen den Wagen morgen früh abschleppen und in Ordnung bringen. Schließlich sind wir nicht die Ersten, die mit einer Wagenpanne liegen bleiben.« Er nickte aufmunternd, öffnete den Wagenschlag und stieg mit einer entschlossenen Bewegung aus. »Komm! Gehen wir.«
»Bist du sicher, dass der Wagen morgen früh noch dasteht, wenn wir ihn einfach hierlassen?«, fragte Damona in einem schwachen Versuch, ihn zurückzuhalten.
Mike zuckte gleichmütig die Achseln. »Ich glaube kaum, dass die Autodiebe hier in der Gegend mit einer kompletten Reparaturmannschaft anrücken«, sagte er. »Außerdem ist er ja versichert.«
Damona seufzte, zog den Zündschlüssel aus dem Schloss und stieg ebenfalls aus. Die Nacht fiel mit eisiger Kälte und böigem, durchdringendem Wind über sie her, als sie die geschützte Fahrerkabine verließ. Sie fröstelte, schlang die Hände um die Oberarme und streifte dann hastig ihre Jacke über. Einen Moment lang betrachtete sie stirnrunzelnd ihre modischen Stöckelschuhe, hob dann resignierend die Schultern und zog die Schuhe aus, um sie hinter dem Fahrersitz des Porsche zu verstauen. Für einen vielleicht meilenweiten Fußmarsch war hochhackiges Schuhwerk denkbar ungeeignet.
Sie wartete, bis Mike den Wagen umrundet hatte, hakte sich dann schweigend bei ihm unter und ging zögernd los.
***
Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war ein gewaltiger, berstender Schlag, der die Welt aus den Angeln gehoben und sie in ein Chaos aus Schreien und Schmerzen und Angst gestürzt hatte. Die Windschutzscheibe vor ihrem Gesicht hatte sich plötzlich in ein verästeltes Spinnennetz aus Millionen und Abermillionen winziger Sprünge und Risse verwandelt, und die Welt dahinter hatte begonnen, sich wie in einem irrsinnigen Kaleidoskop zu drehen und zu überschlagen. Dann nichts mehr ...
Lyss hob stöhnend die Hand und fuhr sich über die Stirn. Die Berührung schmerzte, und ihre Fingerspitzen fühlten sich feucht und klebrig an, als sie die Hand zurückzog. In ihrem Rücken saß ein kleiner, beißender Schmerz, und von der Taille abwärts fühlte sich ihr Körper seltsam taub und leblos an. Sie öffnete die Augen, tastete einen Moment lang blind um sich und setzte sich dann mit einem leisen Wimmern auf. Dunkelheit umgab sie. Die Luft roch muffig und feucht, und ihre Finger ertasteten glitschigen, mit feuchtem Schimmel überzogenen Stein.
»Marc?«
Ihre Stimme erzeugte ein seltsames, hallendes Echo. Der Raum, in dem sie sich befand, musste sehr groß sein. Ein Keller vielleicht, ein Gewölbe, oder – ein Grab.
Sie schluckte den Schrecken, den der Gedanke in ihr auslöste, herunter, schlug die Faust vor den Mund und zwang sich dazu, sekundenlang reglos sitzen zu bleiben und mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit zu lauschen. Ihre Umgebung war nicht so still, wie sie zu Anfang angenommen hatte. Irgendwo tropfte Wasser, und dazwischen glaubte sie das Huschen von kleinen, krallenbewehrten Pfoten zu vernehmen. Ratten oder Mäuse. Sie schauderte leicht bei dem Gedanken, drängte die erneut aufkommende Angst aber mit großer Willensanstrengung zurück. Sie war schon immer ein Mensch gewesen, der mit beiden Beinen fest auf der Erde stand, keines von diesen zimperlichen jungen Dingern, die beim Anblick einer harmlosen Maus hysterisch wurden.
Sie setzte sich ganz auf, versuchte, mit den Händen die schmerzende Stelle am Rücken zu erreichen und rief noch einmal Marcs Namen. Diesmal glaubte sie eine Reaktion darauf zu hören – nicht Marcs Stimme, aber ein leises, schabendes Geräusch, dann etwas, das sich wie ein unterdrücktes Stöhnen anhörte. Sie rief ein drittes Mal, lauschte konzentriert und kroch dann auf Händen und Knien in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Alle paar Schritte verharrte sie, lauschte mit geschlossenen Augen und tastete mit den Fingerspitzen über den feuchtkalten Steinboden. Etwas Nasses, Schleimiges blieb an ihrem Arm hängen. Sie zuckte angewidert herum, schüttelte es ab und kroch mit klopfendem Herzen weiter.
Ihre Gedanken drehten sich wild im Kreis. Sie wusste nicht, wo sie war, auch nicht, wie sie hierhergekommen war. Alles, woran sie sich erinnerte, war, dass Marc plötzlich und ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, und dann ... Sie hatten einen Unfall gehabt, das war klar. Und irgendjemand hatte sie gefunden und an diesen dunklen, kalten Ort geschafft, ehe sie das Bewusstsein wiedererlangt hatte. Über das Wie und Warum würde sie sich später Sorgen machen. Zuerst einmal musste sie Marc finden.
Sie tastete sich vorsichtig weiter und stieß schließlich gegen ein Hindernis. Ihre Finger glitten über Stoff und Leder, wieder über Stoff und dann über Haut. Sie zuckte zusammen, als sie das warme, klebrige Blut fühlte.
»Marc!«, flüsterte sie entsetzt. »Bist du ... verletzt?«
Er antwortete nicht. Sein Gesicht zuckte, als sie im Dunkeln mit den Fingerspitzen darübertastete, und seine Lippen öffneten sich zu einem leisen, wimmernden Stöhnen. Seine Haut fühlte sich fiebrig an, und seine Hände zuckten, als sie sie berührte.
»Oh Gott, Marc ...«, flüsterte Lyss. Ihre Sorge über die unwirkliche Situation und diesen grausigen, nachtschwarzen Ort, an dem sie sich unversehens wiedergefunden hatte, verblasste mit einem Schlage, als ihr klar wurde, dass Mark schwer verletzt war. Lebensgefährlich verletzt möglicherweise. Er würde sterben, wenn er nicht möglichst rasch zu einem Arzt kam.
Sie fuhr auf, tastete blind um sich und stand dann schwankend auf. Die Finsternis schien sich zu verdichten, ihren Körper wie eine wattige, erstickende Masse einzuhüllen und sie selbst am Atmen zu hindern. Ihr Herz begann zu rasen; schnell, hart und schmerzhaft. Für einen Moment wurde sie von Panik übermannt', aber das Gefühl verschwand ebenso schnell wieder, wie es gekommen war.
Sie musste hier heraus, ganz egal wie!
Sie streckte die Arme aus, schloss die Augen und tastete sich vorsichtig den Weg zurück, den sie hergekrochen war. Sie versuchte, ihre Schritte zu zählen, kam aber schon nach wenigen Augenblicken durcheinander und gab das Vorhaben wieder auf.
Irgendwo über ihrem Kopf ertönte ein dumpfes, polterndes Geräusch. Sie zuckte zusammen, blieb stehen und legte den Kopf in den Nacken. Aber die Dunkelheit war vollkommen. Das Geräusch wiederholte sich, weiter rechts diesmal und weniger deutlich. Sie streckte die Arme über den Kopf, stellte sich auf die Zehenspitzen und fühlte rauen Zement, durch den die parallel laufenden Spuren der ehemaligen Verschalung verliefen. Ein Keller also. Wenigstens darüber hatte sie Gewissheit. Und wenn es ein Keller war, dann musste er auch einen Ausgang haben ...
Sie ging weiter, die Hände tastend wie eine Blinde vorgestreckt und mit kleinen, schlurfenden Schritten, stieß schließlich gegen eine feuchte Steinwand und tastete sich daran entlang. Nach einer Weile griffen ihre Finger ins Leere. Sie blieb abrupt stehen, sah sich sinnloserweise um und ging in die Knie. Der Boden brach vor ihr entlang einer messerscharf gezogenen Linie ab. Sie ließ sich vollends auf die Knie nieder, legte die Rechte Halt suchend gegen die schleimige Wand und tastete mit der anderen Hand weiter. Ihre Finger glitten über die Kante, tasteten sich ein Stück weit senkrecht hinab und stießen dann erneut auf Widerstand.
Eine Treppe!, durchzuckte es sie.
Eine Treppe, die aus diesem Kellergewölbe noch weiter in die Tiefe führte. In Gedanken malte sie sich alle nur vorstellbaren Schrecken aus, die sie dort unten erwarten mochten. Aber es gab keine andere Möglichkeit, hier herauszukommen. Sie stand auf, atmete tief ein und setzte mit klopfendem Herzen den Fuß auf die oberste Stufe.
Erneut ertönte das dumpfe, polternde Geräusch von oben. Sie blieb stehen, streckte instinktiv die Arme aus und stieß auf beiden Seiten auf Widerstand. Vorsichtig ging sie weiter. Die Treppe schien kein Ende zu nehmen. Nach einer Ewigkeit erreichte sie die letzte Stufe, blieb einen Herzschlag lang stehen und stieß dann gegen eine wuchtige Holztür. Schwere Metallbeschläge, ein schenkelstarker Holzriegel, der offensichtlich von der anderen Seite aus gesichert war ...
Lyss ballte in sinnloser Wut die Fäuste. Sie hatte einen Ausgang gefunden, aber sie hätte genauso gut auf eine massive Steinmauer stoßen können. Sie war gefangen. Sie beide, sie und Marc.
Wieder ertönte das dumpfe Poltern über ihr, gefolgt von etwas, das sie mit viel Fantasie als Schritte identifizieren konnte, dann knarrte eine Tür und fiel gleich darauf wuchtig ins Schloss. Einen Moment lang kehrte wieder Schweigen ein, dann erklangen auf der anderen Seite schwere, schlurfende Schritte.
Lyss’ Herz machte einen schmerzhaften Sprung, als sie begriff, dass die Schritte näher kamen. Ohne zu wissen woher, spürte sie, dass da etwas Gefährliches und vielleicht Tödliches auf sie zukam. Das waren nicht die Schritte eines Menschen! dachte sie entsetzt. Es war ein mühsames, schlurfendes Schleppen, ein dumpfes und machtvolles Geräusch, als wälzte sich irgendetwas Gigantisches auf die Tür zu. Sie zuckte zusammen, als sich der Riegel unter ihren Fingern bewegte, erstarrte für eine halbe Sekunde und presste sich dann mit klopfendem Herzen eng gegen die feuchtkalte Wand.
Ein Schlüssel wurde ins Schloss geschoben und quietschend herumgedreht. Die Tür bebte, quietschte schrill und schwang dann mit einem nervenzerfetzenden Knarren auf. Ein schmaler, trübgrau gefärbter Lichtstreifen fiel in den Raum und vertrieb die Dunkelheit.
Lyss unterdrückte im letzten Moment einen entsetzten Aufschrei, als die riesige Gestalt unter der Tür erschien. Das Gegenlicht verwandelte sie in einen flachen schwarzen Schatten, sodass Lyss nur einen verschwommenen Umriss wahrnehmen konnte, aber das wenige, was sie sah, reichte vollkommen, um ihr das Blut in den Adern gefrieren zu lassen.
Die Gestalt füllte die zwei Meter hohe Tür fast vollständig aus. Ihre Umrisse erinnerten Lyss an einen Menschen, wenn auch an die bizarre, perverse Karikatur eines Menschen. Kopf und Schultern schienen miteinander verwachsen zu sein und ohne Hals ineinander überzugehen. Ein erstickender, moderiger Geruch wehte ihr entgegen.
Die Gestalt blieb einen Moment lang unter der Tür stehen und bewegte sich dann mit einem tapsigen Schritt in den Raum hinein. Lyss presste sich noch enger gegen die Wand und hielt unwillkürlich den Atem an. Das Monstrum stieß einen leisen, grollenden Laut aus, streckte die Hand nach vorne und drehte langsam den Kopf. Kleine, tückische Augen schienen Lyss gierig anzublinzeln.