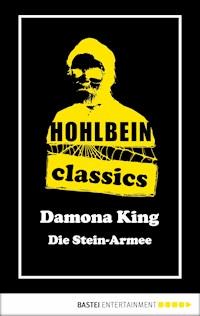
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hohlbein Classics
- Sprache: Deutsch
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Die Story: Nach langen Bemühungen ist es dem Archäologen Charles Hemingford, einem guten Freund von Mike Hunter und Damona King, endlich gelungen, eine Einreiseerlaubnis nach China zu bekommen, um dort Ausgrabungen vornehmen zu können. Ziel seiner Forschungen ist es, die Pyramide mitsamt der Grabkammer des ersten chinesischen Kaisers zu öffnen und die dort enthaltenen Schätze der Nachwelt zugänglich zu machen. Anders als bei den Pyramiden Ägyptens haben die Herrscher des alten China keine schrecklichen Fallen in ihre Grabmäler einbauen lassen. Dafür existieren jedoch geheimnisvolle Wächter, die, von Unbefugten aufgestört, zu schrecklichem Leben erwachen und die sterbliche Hülle ihres Herrn und Meisters schützen!
"Die Stein-Armee" erschien erstmals am 02.11.1981 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe "Damona King".
Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Hohlbein Classics
Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.
Über diese Folge
Die Stein-Armee
Ein Damona King Roman
Nach langen Bemühungen ist es dem Archäologen Charles Hemingford, einem guten Freund von Mike Hunter und Damona King, endlich gelungen, eine Einreiseerlaubnis nach China zu bekommen, um dort Ausgrabungen vornehmen zu können. Ziel seiner Forschungen ist es, die Pyramide mitsamt der Grabkammer des ersten chinesischen Kaisers zu öffnen und die dort enthaltenen Schätze der Nachwelt zugänglich zu machen. Anders als bei den Pyramiden Ägyptens haben die Herrscher des alten China keine schrecklichen Fallen in ihre Grabmäler einbauen lassen. Dafür existieren jedoch geheimnisvolle Wächter, die, von Unbefugten aufgestört, zu schrecklichem Leben erwachen und die sterbliche Hülle ihres Herrn und Meisters schützen!
»Die Stein-Armee« erschien erstmals am 02.11.1981 unter dem Pseudonym Henry Wolf in der Reihe »Damona King«.
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.
WOLFGANG
HOHLBEIN
Die Stein-Armee
Ein Damona King Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Damona King
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1438-0
Die Stein-Armee
Gespenster-Krimi von Henry Wolf
Der Jeep quälte sich mit durchdrehenden Rädern die Steigung hinauf. Selbst die grobstolligen Geländereifen fanden auf dem nassen Gras kaum Halt, und mehr als einmal blieb der Wagen mit winselndem Motor stehen oder rutschte ein paar Meter zurück. Aber der Fahrer gab erbarmungslos Gas. In der mondlosen, geradezu geisterhaft stillen Nacht schien das Kreischen der überdrehten Maschine doppelt laut zu sein.
Tao-Chen achtete nicht darauf. Der Wagen war eine solche Behandlung von ihm gewohnt. Und bei dem Hochgefühl, das momentan von ihm Besitz ergriffen hatte, wäre es ihm wahrscheinlich auch egal gewesen, wenn er die Maschine zuschanden gefahren hätte. Er kuppelte, warf krachend einen kleineren Gang ein und ließ den Wagen die letzten paar Meter den Hang hinaufschießen. Die Stoßdämpfer knirschten bedrohlich, als der Jeep mit einem Satz auf die Straße krachte.
Tao-Chen hielt an, schaltete die Innenbeleuchtung ein und suchte im Handschuhfach nach Zigaretten. Sein schmales, für einen Asiaten ungewöhnlich eckiges Gesicht spiegelte sich matt auf der Windschutzscheibe. Das Lächeln darin schien vielleicht ein wenig selbstzufriedener als sonst zu sein, und jedem, der sich in der schwer durchschaubaren Mimik eines Asiaten auskannte, wäre die ungewöhnliche Erregung des kleinwüchsigen Polit-Kommissars aufgefallen.
Er fand die Zigaretten, riss die Packung ungeduldig auf und setzte sein altmodisches Benzinfeuerzeug in Brand.
Er hatte es diesen eingebildeten Europäern gezeigt! Der betroffene Ausdruck auf Hemingfords Gesicht hatte ihn für die jahrelange Frustration, für all die Monate voller Erniedrigung und hilflosem Zorn entschädigt.
Er blies den Rauch gegen die Windschutzscheibe, lächelte seinem Spiegelbild aufmunternd zu und lehnte sich zurück. Durch die heruntergekurbelten Seitenfenster drang frische, sauerstoffreiche Nachtluft herein. Es war kalt, beinahe eisig, und die altersschwache Heizung des Militärfahrzeuges kämpfte vergeblich gegen die von außen nachströmende Kälte an. Vielleicht würde es in dieser Nacht den ersten Schnee geben, sinnierte Tao-Chen. Der erste Schnee in diesem Jahr. Er würde die Wunden bedecken, die Hemingford und seine Männer in den Boden gerissen hatten. Vielleicht würde das Land im nächsten Frühling schon wieder heil und nicht so verschandelt sein.
Ein helles, abgehacktes Knacken drang durch die wattige Stille der Nacht an sein Ohr. Tao-Chen runzelte die Stirn, schaltete die Innenbeleuchtung aus und blinzelte aus zusammengekniffenen Augen nach draußen. Die voll aufgeblendeten Scheinwerfer bohrten zwei lange, asymmetrische Lichtsplitter in die Dunkelheit, aber das grelle Halogenlicht schien die Schwärze dahinter eher noch zu vertiefen.
Das Knacken wiederholte sich. Irgendwo dort draußen bewegte sich etwas. Vielleicht ein Tier – Fuchs oder Wiesel – das auf einem nächtlichen Beutezug war.
Tao-Chen spürte plötzlich, wie müde er war. Er war seit fast vierundzwanzig Stunden ununterbrochen auf den Beinen. Zuerst die Fahrt zur Provinzhauptstadt und wieder zurück, dann endlose Debatten mit sturen Beamten und Bürokraten, schließlich sein Besuch bei Hemingford. Fast vier Stunden lang. Er hatte jede Minute davon voll ausgekostet.
Tao-Chen war siebenundzwanzig, aber er sah älter aus. Sein Gesicht war das eines Mannes, der schon viel zu viel erlebt und erlitten hatte. Das Leben hatte ihn hart und bitter werden lassen. Er war in den Wirren der Kulturrevolution aufgewachsen, hatte seine Eltern und fast alle weitläufigeren Verwandten verloren und war schließlich mit dem neuen System aneinandergeraten. Vier Jahre Zwangsarbeit hatten ihn hart werden lassen. Erst jetzt, nach der Zerschlagung der Viererbande, nachdem das Land wirklich frei geworden war, hatten die neuen Machthaber seine Talente erkannt und ihn auf den Posten gesetzt, der seinen Fähigkeiten entsprach. Und Tao-Chen würde alles in seiner Macht Stehende tun, um das Vertrauen, das seine Vorgesetzten in ihn investiert hatten, nicht zu enttäuschen.
Er wusste, dass er mit seiner Abneigung Hemingford gegenüber nicht überall auf Gegenliebe stieß. Aber er wusste auch, dass er recht hatte, China war eines der ältesten Kulturländer der Welt. Seine Vorfahren hatten schon über eine beträchtliche Zivilisation verfügt, als die Europäer noch in Höhlen herumkrochen und sich mit Schlamm bewarfen. Die Schätze der Vergangenheit gehörten seinem Volk – nicht den Engländern, den Franzosen, Deutschen oder Amerikanern. Es bereitete Tao-Chen beinahe körperliche Übelkeit zuzusehen, wie sie Löcher in die Erde gruben, wie sie Schätze, die jahrhunderte-, jahrtausendelang sicher im Schoß chinesischer Erde gelegen hatten, hervorzerrten und wegtrugen.
Aber damit war jetzt Schluss.
Es war das Erbe seines Volkes. Und sein Volk würde es eines Tages bergen. Es spielte keine Rolle, ob noch mehrere Jahrzehnte bis dahin vergingen. Hemingford würde abreisen müssen.
Wieder knackte irgendwo in der Dunkelheit jenseits der Lichtkegel ein Zweig, und für einen Moment hatte Tao-Chen den Eindruck, einen riesigen unförmigen Schatten zu sehen.
Er schüttelte ärgerlich den Kopf, schnippte die kaum angerauchte Zigarette aus dem Fenster und gähnte. Er war müde. Seine überreizten Nerven begannen ihm schon Dinge vorzugaukeln, die gar nicht da waren.
Er beugte sich über den Beifahrersitz, angelte ächzend nach der Fensterkurbel und drehte die Scheibe hinauf. Es wurde Zeit, dass er weiterfuhr. Er hatte noch eine gute Stunde Fahrt vor sich.
Als er sich wieder aufsetzte und nach dem Lenkrad griff, sah er den Schatten.
Es war ein riesiges unförmiges Etwas, das wenige Zentimeter jenseits der Scheinwerferstrahlen emporwuchs. Nacht und Entfernung gaben seinen Umrissen etwas Geisterhaftes. Tao-Chen spürte, wie seine Neugier zuerst in Beunruhigung, dann in ein kleines, nagendes Gefühl der Angst umschlug. Er war mehr als fünf Kilometer von jeder menschlichen Ansiedlung entfernt, und Mitternacht war längst vorüber.
Mit zitternden Fingern griff er an der Lenksäule vorbei und schaltete das Fernlicht ein. Im ersten Augenblick blendete ihn die überraschende Helligkeit selbst. Das grelle Halogenlicht ließ die Gestalt zu einer schwarzen scherenschnittartigen Silhouette werden. Hinter ihr bewegten sich weitere Männer – vier, fünf oder mehr, das konnte Tao-Chen nicht erkennen.
Er wusste plötzlich, dass die Männer dort vorne keine guten Absichten hatten. Sie waren bewaffnet, das konnte er deutlich erkennen.
Tao-Chen tastete vorsichtig nach dem großkalibrigen Revolver, den er im Handschuhfach aufbewahrte. Regierung und offizielle Stellen gaben sich alle Mühe, es zu verheimlichen, aber es war ein offenes Geheimnis, dass es in den abgelegeneren Teilen des Landes noch immer Straßenräuber und Banditen gab. Und Tao-Chen konnte sich absolut keinen logischen Grund vorstellen, dass ein halbes Dutzend Bewaffneter lange nach Mitternacht auf der Straße herumlief.
Außer den, ihn zu überfallen.
Der vorderste Mann bewegte sich. Er war immer noch nicht mehr als ein Schatten, aber Tao-Chen konnte jetzt erkennen, dass er nicht annähernd so groß und bedrohlich war, wie ihm seine überstrapazierten Nerven zu Anfang vorgegaukelt hatten. Im Gegenteil – er schien klein und fast zierlich zu sein. Seine Schritte waren seltsam eckig und ungelenk, aber trotzdem schnell.
Tao-Chens Fuß tastete nach dem Gaspedal. Ein schneller Tritt auf die Kupplung, ein blitzschnelles Herunterstoßen des Gaspedales – und er konnte die Mauer durchbrechen. Aber er zögerte noch. Die Männer waren noch immer mehr als dreißig Meter von ihm entfernt, und das kühle Metall der Waffe in seiner Hand gab ihm ein Gefühl der Sicherheit.
Er kuppelte, legte den Gang ein und ließ den Wagen langsam vorrollen. Irgendwo schrie ein Nachtvogel; hoch, schrill und misstönend. Es schien Tao-Chen wie ein böses Omen. Seine Linke verkrampfte sich um das Steuer, während er den Sicherungsflügel der Waffe herumknacken ließ.
Er war jetzt bis auf zehn Meter an die Gruppe herangekommen. Und er konnte sie immer noch nicht erkennen. Ihre Körper schienen das blendend weiße Licht der Scheinwerfer aufzusaugen. Ein seltsamer Geruch drang plötzlich an Tao-Chens Nase, der Geruch nach Erde, frisch umgegrabenem Lehm und Alter.
Und dann erkannte er, wen er vor sich hatte.
Tao-Chen stieß einen erstickten Schrei aus und warf sich instinktiv zurück. Sein Fuß rutschte von der Kupplung. Der Wagen machte einen wilden Satz, walzte eine der Gestalten nieder und kam bockend zum Stehen. Der Motor erstarb mit einem würgenden Geräusch.
Tao-Chen ließ sich blitzschnell zur Seite fallen, als er die Bewegung sah. Mondlicht blitzte hell und silbern auf der Schwertklinge auf, dann schien die Welt in einem berstenden Chaos aus Glassplittern und zerreißendem Metall unterzugehen. Das meterlange Zen-Schwert zerschmetterte die Windschutzscheibe, schnitt wie durch Butter durch die Seitenholme und riss die Polster wenige Zentimeter über seinem Kopf auf. Gleichzeitig bemerkte er aus den Augenwinkeln, wie rechts und links des Wagens weitere Gestalten emporwuchsen.
Aber Tao-Chen dachte nicht daran, aufzugeben. Er hatte in seinem Leben mehr als einen Kampf auf Leben und Tod ausgefochten, und manche von ihnen waren aussichtsloser als dieser gewesen. Er trat wütend nach dem Arm des Angreifers, stemmte sich hoch und drückte zweimal hintereinander ab. Der peitschende Knall schien seine Trommelfelle zu zerfetzen. Für eine schreckliche, endlose Zehntelsekunde sah er das Gesicht des Angreifers im grellen Widerschein der Mündungsflamme aufleuchten. Die Kugeln klatschten wenige Zentimeter nebeneinander in die Stirn des Mannes. Sein Kopf schien in einer riesigen Staubwolke zu explodieren.
Aber er bewegte sich weiter!
Tao-Chen sah mit ungläubigem Entsetzen, wie sich die Arme der kopflosen Gestalt hoben. Die Klinge blitzte grell im Mondlicht auf. Gleichzeitig begannen harte, unmenschlich starke Hände an der Beifahrertür zu zerren. Die Scheibe zerbarst klirrend.
Tao-Chen warf sich mit aller Macht nach links. Die Tür flog auf, traf die kopflose Gestalt vor die Brust und schleuderte sie zu Boden. Das Schwert verschwand klirrend in der Dunkelheit. Aber die unheimlichen Angreifer ließen ihm keine Atempause. Er fiel aus dem Wagen, rollte sich herum und entging im letzten Augenblick einem heimtückischen Schwertstreich, der den Boden neben seiner Schulter zentimetertief auf riss. Eine der großen, ungelenken Gestalten wuchs schwarz und drohend über ihm empor.
Tao-Chen trat wütend nach dem Mann, wälzte sich zwei- dreimal herum und sprang federnd auf die Füße. Sein Tritt hatte den Angreifer zu Boden geschleudert, wo er reglos liegen geblieben war.
Aber es blieben immer noch vier Gegner.
Tao-Chen duckte sich, spreizte die Beine und verschränkte die Fäuste vor dem Bauch. Jeden, der auch nur ein kleines bisschen von asiatischen Kampftechniken verstand, hätte die Art, in der er es tat, gewarnt. Aber die Angreifer schienen keinen Respekt vor menschlichen Kampftechniken zu kennen.
Sie kreisten ihn ein; kleine, schattenhafte, ungeheuer schnelle Gestalten, deren Schwerter einen tödlichen, blitzenden Kreis um ihn herum bildeten. Tao-Chen wartete nicht, bis sie Zeit zu einem koordinierten Angriff hatten. Seine einzige Chance bestand darin, ihnen keine Gelegenheit zu gezieltem Vorgehen zu geben. Er sprang hoch, federte aus dem Lichtkreis der Scheinwerfer, tauchte unter den zupackenden Armen eines Mannes hindurch und schmetterte ihm die Handkante auf das Schlüsselbein.
Er hatte das Gefühl, auf Beton geschlagen zu haben. Ein greller, lähmender Schmerz zuckte durch seinen Unterarm bis in die Schulter hinauf, trieb ihm die Tränen in die Augen und ließ ihn taumeln.
Aber der Schlag hatte ihm Luft verschafft. Der Unheimliche wankte zurück, prallte gegen einen der nachdrängenden Männer und ließ sein Schwert fallen. Seine Schulter schien unter der Wucht des Schlages zu zerbrechen. Große, dunkle Brocken lösten sich aus der braunen Masse, die Schultern und Arme bildeten, rieselten in einem unablässigen Strom zu Boden und bildeten eine große, an staubiges Blut erinnernde Lache zu seinen Füßen. Und die unheimliche Veränderung ging weiter. Fast, als hätte der Hieb die geheimnisvolle Kraft, die ihn am Leben erhielt, unterbrochen, löste sich sein Körper auf. Ein breiter, gezackter Riss spaltete seinen Brustkorb, sandte knisternde Verästelungen in Arme und Beine und verwandelte die Gestalt in Hunderte und Aberhunderte von Scherben.
Chen wich Schritt für Schritt zurück. Die drei verbliebenen Angreifer schienen zu zögern. Offensichtlich hatten sie nicht mit einer derart heftigen Gegenwehr gerechnet.
Tao-Chen sah seine Chance. Er wirbelte herum, hetzte mit zwei, drei Schritten auf den Wagen zu und warf sich hinter das Steuer. Seine Finger drehten verzweifelt am Zündschlüssel. Der Anlasser krachte protestierend, aber der Motor sprang an. Tao-Chen hämmerte den Gang hinein, ließ die Kupplung springen und jagte den Wagen mit aufbrüllender Maschine auf die drei Gestalten zu.
Sie schienen die Gefahr erst im letzten Augenblick zu bemerken. Zwei von ihnen schafften es, rechts und links des heranpreschenden Militärfahrzeuges auszuweichen; der Dritte hob in einer verzweifelten Abwehrbewegung das Schwert.
Erst in dem winzigen, nicht messbaren Augenblick, in dem Tao-Chens Bewusstsein erlosch, begriff er, dass der Mann absichtlich stehen geblieben war.
Der Wagen zerschmetterte die Gestalt zu einer brodelnden Staubwolke. Tausende von kleinen und großen Tonscherben explodierten über den Weg; für einen Moment verschwand der Jeep in einer sich aufblähenden Staub- und Rauchwolke. Er schoss vorwärts, hoppelte über die Straßenbegrenzung und preschte mit aufheulendem Motor die Böschung herunter. Die Scheinwerferstrahlen vollführten einen irren Tanz über Sträucher, Gras und Felsen und erloschen, als der Wagen mit voller Geschwindigkeit gegen einen Baum krachte.
Aber von all dem merkte Tao-Chen nichts mehr. Er saß vornübergebeugt hinter dem Steuer. Seine Hände hatten sich um das Lenkrad verkrampft. In seinen Augen stand ein ungläubiger, fassungsloser Ausdruck, und aus seinen Mundwinkeln lief ein dünner Blutfaden.
Und aus seinem Rücken ragte die blutverschmierte Klinge eines Zen-Schwertes.
***
Damona King schloss behutsam die Tür hinter sich und schlich auf Zehenspitzen zur Treppe hinüber. Sie hatte absichtlich kein Licht gemacht, aber sie kannte sich in den Gängen und Fluren von King’s Castle gut genug aus, um selbst mit verbundenen Augen keinen Fehltritt zu tun.
Sie erreichte die Treppe, tastete nach dem Geländer und schlich mit angehaltenem Atem die Stufen hinunter. Sie wusste, dass ihr Verhalten wahrscheinlich übertrieben war, aber es hatte fast zwei Stunden gedauert, ehe Thomas eingeschlafen war. Selbst jetzt warf er sich noch unruhig im Bett herum, fantasierte und stieß schnelle, unverständliche Worte hervor. Sie wollte auf keinen Fall riskieren, dass er wieder aufwachte. Sein Zustand hatte sich in den letzten Tagen zunehmend verschlechtert. Er brauchte Schlaf.
Mike erwartete sie in der Bibliothek. Er saß in einem der gemütlichen Ledersessel am Kamin, hatte die Beine übereinandergeschlagen und blätterte ohne sonderliches Interesse in einem Buch.
»War es schlimm?«, fragte er, ohne aufzusehen.
Damona seufzte, drückte die Tür hinter sich zu und ging mit hängenden Schultern zur Bar hinüber. Ihre Finger zitterten, als sie ein Glas vom Regal nahm und sich einen vierstöckigen Cinzano einschenkte. Normalerweise trank sie nur mäßig Alkohol, und selbst den nicht vor dem Abendessen. Aber sie brauchte einfach eine Stärkung.
»War es schlimm?«, fragte Mike noch einmal.
Damona nahm einen großen Schluck, schloss die Augen und nippte noch einmal an ihrem Glas, ehe sie antwortete.
»Ziemlich. Ich glaube, er hat mich gar nicht mehr wahrgenommen. So schlimm wie heute war es noch nie.«
Mike klappte das Buch zu und sah sie einen Augenblick lang durchdringend an.
»Sag mal«, begann er vorsichtig, »glaubst du nicht, dass es besser wäre, ihn zu einem anständigen Arzt zu bringen? So geht das nicht weiter. Ich kenne ein paar Spezialisten in Europa, die ihm wirklich helfen könnten ...«
»So wie Waynesdale?«, schnappte Damona. In Mikes Gesicht zuckte ein Muskel. Damonas Worte waren schärfer gewesen, als sie beabsichtigt hatte.





























