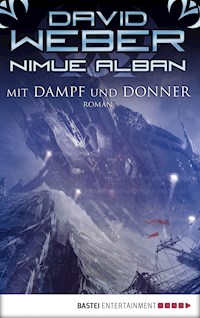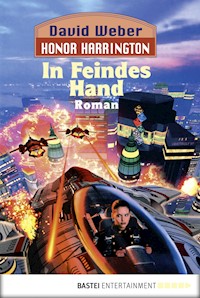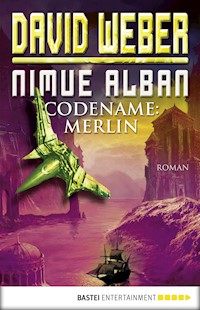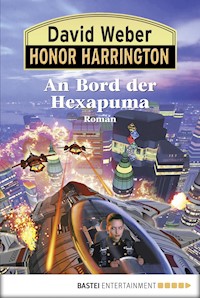9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Das brandneue Abenteuer aus dem Honor-Harrington-Universum! Honor macht sich auf den Weg zum Planeten Casimir, um ein Sklaven-Lager auszuheben. Action-SF von Weltklasseformat, wie die internationale Erfolgsgeschichte des Autors zeigt. Die Gesamtauflage von David Weber beträgt inzwischen rund 7 Millionen Exemplare!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ruth (Ruthless)von Jane Lindskold
Ein kriegerischer Akt (An Act of War)von Timothy Zahn
»Auf zum Tanz!« (»Let’s Dance!«)von David Weber
Einführung in die Entwicklung modernerSternenschiff-Panzerungen(An Introduction to Modern Starship Armor Design)von Mr Hegel DiLutorio, Captain (a.D.), RMN, HMSS Hephaistos
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
DieFeuertaufe
Aus dem Amerikanischen vonDr. Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by David Weber
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»In Fire forged«
Originalverlag: Baen Books, Wake Forest
This work was negotiated through
Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin’s Press, L.L.C.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2012/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Regensburg
Textredaktion: Uwe Voehl
Lektorat: Ruggero Leò
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1579-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Sharon, Megan, Morgan und Mikey.Weil sie es mit Daddy aushalten.
Ruth
(Ruthless)
Jane Lindskold
Fort. Ihr Kind war fort.
Hektisch suchte Judith Newland das gesamte kleine Apartment ab, das sie gemeinsam mit ihrer zwei Jahre alten Tochter Ruth bewohnte.
Schlafzimmer. Bad. Wohnzimmer.
Während Judith schließlich auch noch alle Schränke aufriss und fast hineinkroch, um noch den letzten Winkel einsehen zu können, gestand sie sich endlich ein, was sie eigentlich schon die ganze Zeit gewusst hatte.
In der kurzen Zeit, die sie auf dem Flur mit der neuen Mitarbeiterin vom Sozialdienst gesprochen hatte, war die kleine Ruth spurlos verschwunden.
Judith stand kurz davor, in Panik zu verfallen. Am liebsten hätte sie laut aufgeschrien. Nachdem sie neunzehn Jahre lang Entführungen, Vergewaltigungen, Mord, Piraterie und zahllose andere entsetzliche Dinge erlebt hatte, waren die letzten beiden Jahre für sie vergleichsweise ruhig verlaufen. Beinahe ohne es zu bemerken, hatte sich Judith einlullen lassen und hielt mittlerweile den Frieden für die Normalität und nicht all die anderen Katastrophen, die sich davor ereignet hatten.
Nun meldete sich Judiths stählerne Seele zu Wort und stellte sich der aufsteigenden Panik entgegen. Es war jene Unbeugsamkeit, die es ihr gestattet hatte, die lange Gefangenschaft auf Masada nicht nur zu überstehen, sondern an all diesen Widrigkeiten auch noch zu wachsen.
Judith schloss die Augen und atmete tief durch.
Im Apartment befand sich Ruth nicht. Also gut! Wo konnte sie stecken? Das Apartment besaß natürlich nur eine einzige Eingangstür, aber vor dem Schlafzimmerfenster gab es einen Notausgang mit Feuerleiter. Erst vor wenigen Tagen hatte man einen Probealarm durchgeführt. Ruth war völlig fasziniert davon gewesen, wie plötzlich die Kontragravröhre aufgetaucht war, nachdem Judith einen Knopf gedrückt hatte, der in der programmierbaren Nanotech-»Tapete« verborgen war.
Judith konnte sich nicht vorstellen, dass Ruth den Knopf erreicht und ihn gedrückt hatte, sodass die Kontragravröhre aktiviert worden wäre. Andererseits war Judith wirklich die Letzte, die den Fehler machen würde, jemanden aufgrund seines jugendlichen Alters zu unterschätzen. Hätte Judiths eigener Exmann sie nicht unterschätzt …
Nein. Darüber würde sie jetzt nicht nachdenken! Wenigstens das lag mittlerweile längst hinter ihr.
Ohne es zu bemerken, war Judith schon den kleinen Korridor hinuntergehastet und steuerte auf das Schlafzimmer zu. Ein kurzer Blick reichte aus, um zu erkennen, dass die Kontragravröhre nicht aktiviert worden war. Auf diesem Weg hatte Ruth das Apartment also nicht verlassen.
Wieder drohte Panik in ihr aufzusteigen, doch darauf ließ sich Judith gar nicht erst ein. Sie griff nach den Schlüsseln des Apartments und eilte auf den Flur hinaus. Vielleicht hatten ihre Nachbarn ja irgendetwas bemerkt.
Der Wohnturm, in dem sie beide lebten, stellte selbst für die Manticoraner, die vielerlei Eigentümlichkeiten gewohnt waren, eine Besonderheit dar. Schließlich wohnte in diesem Hochhaus ein Großteil der etwa vierhundert Flüchtlinge, die vor etwa zweieinhalb Jahren gemeinsam vom Planeten Masada entkommen waren. Das alleine wäre gewiss schon bemerkenswert genug gewesen, doch dass es sich bei den Flüchtlingen fast ausschließlich um Frauen handelte – die wenigen Masadaner männlichen Geschlechts unter ihnen waren allesamt noch Kleinkinder gewesen, meist weniger als fünf Jahre alt –, betonte diese Besonderheit noch. Dazu kam, dass die meisten dieser Frauen es zuvor gewohnt gewesen waren, in einem Harem zu leben. Auch jetzt noch war es für sie regelrecht beunruhigend, so etwas wie eine Privatsphäre zu haben. Jeder Manticoraner hingegen hätte gewiss eher den etwaigen Mangel einer Privatsphäre beklagt. Aus diesem Grund besaßen die drei Stockwerke, in denen die masadanischen Flüchtlinge lebten, deutlich mehr Ähnlichkeit mit einem Bienenstock als mit einem gewöhnlichen Wohngebäude.
Judith selbst gehörte zu den wenigen Frauen, die Privatsphäre sehr wohl zu schätzen wussten. Deswegen hatte sie sich auch dafür entschieden, nicht zusammen mit zwei oder noch mehr Erwachsenen und allen zugehörigen Kindern ein gemeinsames, größeres Apartment zu beziehen. Andererseits unterschied sich Judith auch in vielerlei Hinsicht von den anderen Schwestern Barbaras, nicht zuletzt aufgrund ihres Geburtsortes und der Ausbildung, die sie genossen hatte. Wichtig war auch, dass ihr zur Gänze jener feste, tief verwurzelte Glaube fehlte, der auch jetzt noch das Seelenleben ihrer Gefährten dominierte – auch wenn besagter Glaube mittlerweile so manche Veränderung erfahren hatte.
Trotzdem fühlte sich Judith mit ihren Mitflüchtlingen immer noch deutlich enger verbunden als mit beinahe allen anderen Manticoranern. Ganz besonders eng war Judiths Beziehung zu genau der Frau, zu der sie nun hastete, um ihr das Problem darzulegen.
»Dinah!«, sagte Judith, eilte an ihr vorbei und schloss die Tür hinter sich. »Ruth ist weg! Spurlos verschwunden!«
Dann sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus: wie es an der Tür geschellt hatte, wie diese neue Mitarbeiterin des Sozialdienstes gefragt hatte, ob sie kurz mit Judith sprechen könne. Ruth hatte gerade geschlafen, und damit die Kleine nicht gestört wurde, war Judith mit ihrem Besuch auf den Flur hinausgegangen.
Dinah hörte ihrer Freundin zu, ohne sie auch nur ein einziges Mal zu unterbrechen. Der Blick aus ihren grauen Augen wurde hart wie Stahl, als ihr die Tragweite dessen, was Judith ihr gerade berichtete, nur allzu bewusst wurde. Dinah war schon zu alt, um noch die lebensverlängernden Prolong-Behandlungen der Manticoraner erhalten zu können, trotzdem hatte sie von der deutlich fortschrittlicheren Medizin der Manticoraner profitiert. Das Herzleiden, das sie während der Flucht von Masada beinahe das Leben gekostet hatte, war mittlerweile vollständig kuriert. Nachdem nun also ihr Herz nicht mehr so schwach war – was ihre ansonsten unbeugsame Stärke empfindlich vermindert hatte –, wirkte Dinah beinahe ein ganzes Jahrzehnt jünger als zuvor. Sie hatte jetzt mehr Ähnlichkeit mit einer grauhaarigen, grauäugigen, ein wenig rundlichen Taube als mit der verhärmten alten Frau, zu der sie achtunddreißig Jahre Ehe mit Ephraim Templeton gemacht hatten.
»Ich war keine fünf Minuten weg«, schloss Judith ihren Bericht. »Als ich wieder ins Apartment zurückgegangen bin, kam mir irgendetwas ein bisschen sonderbar vor. Ich habe nachgeschaut, ob Ruth vielleicht aus ihrem Bettchen geklettert ist – darin wird sie Tag für Tag geschickter –, aber sie war fort.«
»Du hast überall nachgeschaut.« Dinahs Worte waren eine Feststellung, keine Frage. Sie kannte Judith besser als jeder andere Mensch, daher wusste sie auch, wie gründlich ihre jüngere Freundin war. Manchmal grenzte diese Gründlichkeit fast schon an Besessenheit. Aber genau dieser Charakterzug Judiths hatte ihnen in der Vergangenheit gute Dienste geleistet.
»Natürlich.«
»Aber du würdest es mir nicht übel nehmen, wenn ich selbst noch einmal schaue?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Gut. Dann mache ich das gleich. Sprich du währenddessen mit den Nachbarn! Frag sie, ob sie Ruth vielleicht gesehen haben! Und frag sie auch nach dieser Mitarbeiterin vom Sozialdienst!«
Judith drückte Dinah gerade die Schlüssel des Apartments in die Hand, als ihr klar wurde, wie sonderbar diese letzte Empfehlung war.
»Nach der? Warum denn das?«
»Du hast mir doch gerade erzählt, welche Fragen sie dir gestellt hat. Es wundert mich einfach, dass sie nicht auch bei mir geklingelt hat. Ich war in den letzten Stunden die ganze Zeit zu Hause – ich musste ja noch die Texte für den morgigen Gottesdienst vorbereiten.«
Judith runzelte die Stirn. Das war wirklich sonderbar. Auch wenn die Flucht von Masada letztendlich nur dank Judiths eigener Fähigkeiten möglich gewesen war, bestand doch keinerlei Zweifel daran, wer die eigentliche Anführerin ihrer Gemeinschaft war – und wer die Leitung des Bundes der Schwestern Barbaras innegehabt hatte, schon lange bevor sie Masada selbst hinter sich ließen. Diese neue Mitarbeiterin des Sozialdienstes hätte sich Dinah doch wenigstens vorstellen müssen!
»Dann werde ich auch danach fragen«, versprach Judith. Eigentlich hatte sie geglaubt, noch mehr Angst könne sie überhaupt nicht verspüren, doch Dinahs Worte hatten jene Furcht, die tief in Judiths Herzen geschlummert hatte, in einen scharfkantigen Kristall verwandelt.
Sie wartete nicht auf den Lift, sondern rannte die Treppe hinab.
»Oh, Michael!«
Eine Frauenstimme, recht hoch, aber doch melodisch. Sie klang weich, voller Herzlichkeit. Trotzdem beschleunigte Michael Winton, Lieutenant Senior Grade, zugeteilt Ihrer Majestät Schiff Diadem, seine Schritte noch, statt langsamer zu werden.
Michael versuchte so zu tun, als gälte dieser Ruf einer anderen Person, die ebenfalls diesen Vornamen trug, nicht etwa ihm. Doch obwohl sein Name in seinen verschiedensten Schreibweisen im Sternenkönigreich alles andere als selten war, galt doch selbiges nicht für sein Äußeres. Michaels Haut war so dunkelbraun, wie es bei allen Wintons nun einmal der Fall war; bei den meisten anderen Manticoranern im Sternenkönigreich war es im Laufe der Jahre zu einer genetischen Durchmischung der verschiedenen Ethnien gekommen. Auch wenn Michael seit mehr als zwei Jahren seine Heimat nicht mehr aufgesucht hatte, bezweifelte er doch ernstlich, dass man ihn nicht mehr erkannte – obwohl er in der Zwischenzeit ein wenig gewachsen war und auch deutlich an Muskelmasse zugelegt hatte. Aber als effiziente Tarnung konnte man das gewiss nicht bezeichnen. Zum einen sah er seinem Vater einfach entschieden zu ähnlich – und ein Portrait Roger Wintons hing immer noch in vielen Büros und öffentlichen Räumen, obwohl der König bereits vor mehr als neun T-Jahren gestorben war.
Michaels Begleiter, ein junger Mann mit dunkelblondem Haar und funkelnden hellbraunen Augen, sog scharf die Luft durch die Zähne.
»Michael, was ist denn los mit dir? Die winkt dir doch zu! Seit wann läufst du denn vor hübschen Mädchen davon?«
Todd Liatt, ein gutaussehender Bursche mit markantem Kinn und einer der besten Freunde Michael Wintons, mühte sich bei jedem Landgang stets aufs Neue, den deutlich zurückhaltenderen Michael dazu zu bewegen, gemeinsam mit ihm dem schöneren Geschlecht nachzustellen.
Michael blickte sich um, suchte nach einem Ausweg, doch obwohl er sowohl die öffentlich zugänglichen als auch die privaten Bereiche von Mount Royal Palace ebenso gut kannte wie seine winzige Kajüte an Bord der Diadem, wusste er, dass er hier nicht entkommen konnte, solange er nicht zu offenkundiger Unhöflichkeit griff – und offenkundige Unhöflichkeit war eine Taktik, zu der zu greifen ihm schlichtweg nicht zustand.
Also verlangsamte er seine Schritte schließlich doch und unterdrückte einen gequälten Seufzer. Dann zwang er seine dunklen, jungenhaften Gesichtszüge zu einem höflichen Lächeln und wandte sich der jungen Dame zu, die ihm auf dem breiten Korridor entgegeneilte.
Ihre Haut hatte die Farbe von hellem Milchkaffee. Die Sommersprossen in ihrem Gesicht, an die er sich aus ihrer Kindheit erinnerte, waren fast verblasst, doch sie trug ihre langen honigblonden Locken nach wie vor offen; mittlerweile reichten sie ihr beinahe schon zur Taille. Diese Frau erschien ihm immer noch genauso niedlich wie damals, doch insgeheim musste sich Michael eingestehen, dass Todd tatsächlich recht hatte: Sie war wirklich hübsch, vielleicht sogar schön.
»Alice! Was für eine Überraschung!«
»Daddy hat heute eine Besprechung mit irgendeinem Komitee«, erklärte Alice und umschloss die Hand, die Michael ihr höflich entgegenstreckte, mit beiden Händen. Ihre goldenen Augen mit den reizvollen Bernsteinflecken funkelten schelmisch. »Seine Sekretärin ist im Urlaub, und ich darf sie vertreten. Was für ein Glück, dass er mir gerade, als du vorbeigekommen bist, gesagt hat, er würde mich vorerst nicht brauchen.«
Alice ließ Michaels Hand los und trat einen Schritt zurück. Bewundernd betrachtete sie Michael von Kopf bis Fuß. »Zumindest habe ich gleich gedacht, das könntest wirklich du sein, aber sicher war ich mir nicht. Groß bist du geworden – und in dieser Uniform siehst du so würdevoll aus!«
Sie hatten einander kaum noch zu Gesicht bekommen, seit Michael im zarten Alter von dreizehn T-Jahren andere Kurse belegt hatte, um sich ernstlich auf seinen Eintritt in die Flottenakademie vorzubereiten. Deswegen erschien Michael Alice’ Bemerkung darüber, er sei »groß geworden«, schlichtweg albern. Allerdings hatte er schon lange vor Beginn seiner Ausbildung an der Akademie gelernt, derlei Dinge niemals offen auszusprechen.
»Ich hätte dich sofort wiedererkannt«, gab er zurück. »Du trägst die Haare immer noch genauso wie früher.«
Erfreut lachte Alice auf. »Und du hattest früher immer so einen Spaß daran, daran zu ziehen. Ich weiß noch genau, du hast immer gesagt, es würde dir gefallen, wie sich die Locken wie Springfedern zusammenziehen.«
Kaum merklich schüttelte sie den Kopf, als wollte sie Michael auffordern, die alten Zeiten wiederaufleben zu lassen. Doch er verspürte nicht einmal den Hauch einer Versuchung. Eine kurze Bewegung neben ihm rief Michael ins Gedächtnis zurück, dass er seinen sozialen Verpflichtungen noch nicht vollständig nachgekommen war.
»Alice, ich darf dir meinen Freund Todd Liatt vorstellen. Todd war auf der Akademie mein Zimmergenosse, und jetzt teilen wir uns an Bord der Diadem eine Kajüte. Lieutenant Liatt, das ist Alice Ramsbottom. Wie Sie sich gewiss schon gedacht haben, sind wir zusammen zur Schule gegangen.«
Alice streckte Todd eine zierliche Hand entgegen und schenkte ihm ein höfliches Lächeln. An sich war Todd durchaus der Attraktivere der beiden, doch Alice’ Aufmerksamkeit galt nach wie vor ganz Michael. Leise lachte sie auf.
»Ach ja, die guten, alten Zeiten«, sagte sie mit zur Schau gestellter Affektiertheit. »Damals warst du natürlich ›Mikey‹, aber irgendjemand hat mir gesagt, mittlerweile würdest du ›Michael‹ vorziehen.«
Alice hielt inne, und mit nicht gelindem Schrecken begriff Michael, dass ihr Lächeln Unsicherheit verriet.
»Natürlich ist mir klar«, fuhr Alice fort, »dass ich dich eigentlich als ›Kronprinz Michael‹ oder ›Euer Hoheit‹ hätte ansprechen müssen, aber ich habe mich so gefreut, dich zu sehen, dass ich daran überhaupt nicht mehr gedacht habe. Ich hoffe, das stört dich nicht …«
Sie klimperte mit ihren langen Wimpern, und Michael war erleichtert – und das nicht zum ersten Mal –, dass man es angesichts seiner dunklen Hautfarbe nicht bemerkte, wenn er errötete.
»Nein. Klar. Ich meine, wir kennen einander doch schon so lange. Wie dem auch sei …« Erst jetzt begriff Michael, dass er eigentlich nur bedeutungslose Phrasen von sich gab. Aber diese Kombination von Alice’ Koketterie und Todds kaum verhohlener Belustigung waren einfach zu viel für ihn. »Ich meine, das mit ›Kronprinz‹ ist jetzt wirklich nur noch so eine Formalität, nachdem mein Neffe Roger sich derart vielversprechend entwickelt.«
»Prinz Roger ist wirklich ein Prachtjunge«, stimmte Alice zu. »Ich habe ihn jetzt schon bei allen möglichen Empfängen erlebt. Wenn er seine Ausgehuniform trägt, wirkt er geradezu erschreckend erwachsen. Und wie er den Tischherren für die kleine Prinzessin Joanna gibt! So ernsthaft! Wie alt ist der Prinz jetzt?«
»Sechs T-Jahre«, antwortete Michael sofort. »Er wird sogar bald schon sieben. Es dauert keine vier T-Jahre mehr, dann kann er die Prüfung ablegen, und er wird dann offiziell und ganz förmlich zum Thronerben ernannt. Nur ein paar Jahre später wird Prinzessin Joanna es ihm gleichtun, und dann ist der ›Prinz‹-Teil in meinem Titel endgültig das, was er eigentlich jetzt schon ist – eine reine Höflichkeit.«
»Du bist so bescheiden«, sagte Alice. »Als könnte irgendjemand jemals vergessen, dass du Königin Elizabeths einziger Bruder bist und ebenso ein Erbe des Hauses Winton.«
»Ich wünschte, es wäre anders«, murmelte Michael in seinen nicht vorhandenen Bart hinein.
Überrascht riss Alice die goldenen Augen auf. Doch ebenso wie Kronprinz Michael hatte auch sie bereits zu Zeiten, da sie noch nicht der Windel entwachsen war, gelernt, niemals das auszusprechen, was ihr als Erstes durch den Kopf ging.
»Na, auf jeden Fall ist es wirklich nett von dir, dass ich dich weiter mit deinem Vornamen ansprechen darf«, sagte Alice. »Du hast nicht zufällig Zeit für einen Kaffee, oder? Oh, das gilt natürlich auf für Lieutenant Liatt!«
Michael sah, wie Todd schon zustimmend nickte, und schritt hastig ein.
»Vielleicht ein andermal. Wir haben noch einen Termin.«
»Klar.« Alice blickte enttäuscht drein, doch Michael glaubte, in ihrem Blick noch kurz etwas anderes aufblitzen zu sehen – Erleichterung? Doch was auch immer es sein mochte, es war fort, bevor Michael sich ganz sicher sein konnte. »Wie dem auch sei, ich sollte jetzt wohl wieder nach Daddy schauen. Hast du noch länger Landgang?«
»Ein bisschen«, antwortete Michael. Ins Detail ging er nicht, denn er wollte nicht riskieren, dass Alice einen Termin für ein erneutes Treffen vorschlug.
»Na ja, ich muss heute Nachmittag noch nach Gryphon und für Daddy ein paar Kleinigkeiten erledigen. Aber wir sehen uns bestimmt wieder. Dann also erst einmal tschüss, Michael. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Lieutenant Liatt.«
Die beiden Männer verabschiedeten sich ebenfalls und wandten sich dann ab. Während sie den Korridor hinuntergingen, hörte Michael hinter ihnen leise Schritte.
Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass sie von Lieutenant Vincent Valless vom Palastschutz stammten, der persönlichen Leibgarde des Kronprinzen.
Seit Michael zur Navy gegangen war, hatte er sich daran gewöhnt, jederzeit überallhin gehen zu können, ganz wie es ihm beliebte, ohne dabei ständig verfolgt zu werden. Dahinter stand die logische Überlegung, dass man guten Gewissens die gesamte Besatzung des jeweiligen Schiffes als die Leibgarde des Kronprinzen ansehen konnte. Und genau deswegen beunruhigte ihn Valless’ Anwesenheit nun doch ein wenig.
Michael wusste, wie sehr sich die meisten seiner Schiffskameraden auf diesen Urlaub freuten, schließlich konnten sie so wenigstens eine Zeit lang jeglichen Formalitäten und Ritualen des Militärs entkommen.
Warum bin ich eigentlich der Einzige, dachte Michael und spürte in seinem Innersten einen Zorn aufflammen, den er eigentlich längst überwunden gewähnt hatte, der nie richtig Urlaub nehmen kann?
Todd hielt sich mit all jenen Fragen zurück, von denen Michael ganz genau wusste, wie sehr sie ihm auf der Zunge lagen, bis sie in dem Flugwagen saßen, den man Michael für seinen Landgang zur Verfügung gestellt hatte. Selbst noch während der Wagen Startfreigabe erhielt, schwieg der junge Lieutenant. Ein Stingship, das ihnen als Geleitschutz diente, folgte ihnen unauffällig.
Schließlich aber hielt Todd es nicht mehr aus. »Michael, warum bist du denn so vor ihr davongelaufen? Du warst beinahe schon unhöflich zu ihr!«
»Ja, und unhöflich bin ich nie«, erwiderte Michael ernsthaft. »Ich weiß.«
»Das ist doch keine Antwort. Wir haben noch mehrere Stunden Zeit, bis wir uns mit deiner Freundin da treffen sollen. Wir hätten gut noch einen Kaffee zusammen trinken können – oder was auch immer. Ich fand diese Alice wirklich niedlich, und sie hat sich ganz offensichtlich gefreut, dich wiederzusehen.«
»Was denn, mich?«, gab Michael zurück. Erneut verspürte er jenen irrationalen Zorn, und er musste sich ernstlich zusammennehmen, damit man ihm diese Emotion nicht anmerkte. »Mich, oder doch eher ›Kronprinz Michael‹? Sobald ich an Bord eines der Schiffe bin, vergesse ich fast, wie das Leben am königlichen Hof überhaupt ist. Seit dieser Geschichte auf Masada – damals war ich noch ein einfacher Kadett – akzeptieren mich die meisten Navy-Angehörigen für das, was ich tue und was ich kann, nicht für die Position, in die ich hineingeboren wurde.«
»Alice hat dich ›Michael‹ genannt«, rief ihm Todd ins Gedächtnis.
»Ja, ja. Irgendwie wäre mir das Ganze deutlich glaubhafter erschienen, wenn sie mich ›Mikey‹ genannt hätte, wie damals, als wir noch Kinder waren.«
»Damals warst du auch noch nicht der Kronprinz, oder?«
»Nö. Damals stand Elizabeth noch zwischen mir und der Verantwortung«, erwiderte Michael und bemühte sich nach Kräften, unbekümmert zu klingen. »Dann ist unser Dad gestorben, und Elizabeth wurde mit achtzehn T-Jahren zur Königin, und ab da war ich der Kronprinz. Aber damit hatte ich nie gerechnet, weißt du? Dad war noch jung genug, um sich auch einer Prolong-Behandlung unterziehen zu können. Ich war damals noch klein und wollte erst einmal für mich selbst herausfinden, was ich eigentlich später werden wollte. Und plötzlich war ich der Zweite in der Thronfolge des Sternenkönigreichs von Manticore!«
Natürlich wusste Todd das alles, aber sonderbarerweise hatten sie nie zuvor darüber gesprochen. Todd hatte leichthin akzeptiert, dass Michael Winton einfach nur ein ganz gewöhnlicher Student an der Flottenakademie sein wollte – nicht mehr, nicht weniger –, und genau das hatte ihre Freundschaft auch gefestigt. Im Laufe der Jahre hatte es diese Freundschaft auch nicht geschwächt, dass sie für ihre Kadettenfahrt auf unterschiedliche Schiffe abkommandiert worden waren. Auch ihre ersten Stellen als Subalternoffiziere hatten sie auf unterschiedlichen Schiffen erhalten.
Todd hörte sich an, was Michael zu sagen hatte, dann wandte er leise ein: »Das muss ziemlich hart gewesen sein. Aber du wirst nun einmal ewig Elizabeths kleiner Bruder bleiben, ganz egal, wie viele andere irgendwann zwischen dir und dem Thron stehen mögen. Wird es nicht langsam Zeit, dass du dich damit abfindest?«
»Ich dachte, das hätte ich schon längst geschafft«, erwiderte Michael. Im Laufe seiner Ausbildung hatte sich Todd für eine Karriere als Taktischer Offizier entschieden, und so war er nicht umhingekommen, das eine oder andere darüber zu lernen, wann und wie man eine Schlacht zu führen hatte. Deswegen war er auch vernünftig genug, das Thema zu wechseln.
»Erzähl mir doch mal etwas über deine Freundin, die wir nachher besuchen wollen. Du hast sie während dieser Masada-Geschichte kennengelernt, oder?«
Michael nickte. »Judith war eine der Rädelsführerinnen: gerade einmal sechzehn Jahre alt, im dritten Monat schwanger, und ganz schön getrieben.«
»So eine richtige Wildkatze, was?«
»Nein. Ganz im Gegenteil! Völlig ruhig. Immer sehr beherrscht. Aber in ihrer Seele brannte trotzdem ein unstillbares Feuer. Das klingt zwar völlig unglaublich, aber Judith hat es geschafft, sich selbst beizubringen, wie man ein Raumschiff steuert, alleine mit Hilfe von VR-Simulatoren – keinerlei Ausbilder, keine Übungsflüge! Und das hat sie getan, obwohl sie genau wusste, was passieren würde, wenn jemand davon erführe: Man hätte sie übelst verprügelt oder sogar umgebracht.«
»Diese Masadaner sind echte Barbaren«, merkte Todd an. »Ich bin wirklich froh, dass die Regierung sich dafür entschieden hat, sich lieber an die Graysons zu halten. Deine Freundin war nicht die Einzige, die damals von Masada entkommen ist, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass es ein ganzes Schiff voller Flüchtlinge gegeben hat.«
Angesichts der Erinnerung an damals grinste Michael, auch wenn ihm eigentlich nach Lächeln überhaupt nicht zumute war.
»Ungefähr vierhundert Frauen und Kinder. Nur ein paar von denen konnten überhaupt ansatzweise lesen oder hatten ein bisschen Mathematik gelernt. Und selbst diejenigen, die sich tatsächlich geringfügiges technisches Wissen angeeignet hatten, mussten feststellen, dass das nach unseren Begriffen alles völlig veraltet war.«
»Und was haben sie gemacht?«, fragte Todd nach.
»Das Sternenkönigreich hat ihnen Asyl gewährt, und als das Schiff, mit dem sie entkommen sind, verkauft wurde …«
»Ich wette, das Schiff wurde nicht einfach abgewrackt«, sagte Todd. »Der Nachrichtendienst konnte es doch wohl kaum erwarten, das Ding in die Hände zu kriegen.«
»Und das gleich aus mehrerlei Gründen«, bestätigte Michael. Jetzt klang er deutlich entspannter, sogar regelrecht fröhlich. »Wie sich herausstellte, war Judiths Entführer – ich weigere mich einfach, ihn als ihren ›Ehemann‹ zu bezeichnen – nicht nur Händler, sondern auch Pirat. Das Schiff und die Bordcomputer haben mehr als nur einen Fall aufgeklärt, in dem es um ›verschwundene Schiffe‹ ging.«
»Und was machen Judith und ihre Gefährten jetzt?«, fragte Todd weiter.
»Man hat ihnen hier auf Manticore eine Unterkunft in einer hübschen Wohnsiedlung verschafft. Die meisten wissen gar nicht, dass es beim Sozialdienst eine ganze Abteilung gibt, die sich darauf spezialisiert hat, Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Aber Dad hat das alles sehr unauffällig organisiert, als bei uns so viele Flüchtlinge von all den Welten eingetroffen sind, die von den Havies erobert wurden. Der Sozialdienst hat reichlich Erfahrung damit, einen Kulturschock nach Kräften abzudämmen. Deswegen wurde uns damals empfohlen, wir sollten für die Flüchtlinge von Masada einen Ort finden, an dem sie nicht gleich völlig von unserer Kultur überwältigt würden. Vergiss nicht, die Gesellschaft auf Masada ist völlig antitechnologisch eingestellt. Natürlich waren selbst unsere ›Vorstadt-Türme‹ für die Flüchtlinge anfänglich ganz schön überwältigend. Aber wenigstens geht es im Friedman’s Valley doch deutlich ruhiger und entspannter zu als an manchen anderen Orten – zum Beispiel der City von Landing.
Seitdem konnten Judith und ihre Gefährten eine anständige Ausbildung genießen und wurden zunehmend in unsere Gesellschaft integriert. Einige von denen sind immer noch als Berater für den Nachrichtendienst tätig. Sie liegen also dem Steuerzahler nicht auf der Tasche – nur für den Fall, dass dir dieser Gedanke gekommen sein sollte. Der Verkauf des Schiffes damals hat jeder Einzelnen von ihnen ein ordentliches Startkapital eingebracht. Und nach allem, was sie getan haben, um endlich von Masada entkommen zu können, legen sie immensen Wert darauf, nie wieder von jemand anderem abhängig zu sein.«
»Das kann ich mir vorstellen«, stimmte Todd zu. »Ich meine, wenn die es darauf angelegt hatten, nach wie vor bloß barfuß herumzulaufen und hin und wieder schwanger zu werden, dann hätten sie ja Masada gar nicht verlassen. Weißt du, ich bin auf deine Judith wirklich gespannt.«
»Das ist nicht ›meine Judith‹«, widersprach Michael – vielleicht ein wenig arg schnell. »Die steht ganz gut auf eigenen Beinen. Wenn Judith irgendjemandem gehört, dann wohl ihrer Tochter Ruth. Die wird dir gefallen. Unfassbar süß, und im Köpfchen hat sie auch was …«
Michael warf einen Blick auf das Chronometer im Armaturenbrett des Flugwagens und zuckte mit den Schultern.
»Wir werden ein bisschen früher als erwartet eintreffen, aber auch nicht gerade übermäßig. Eigentlich könnten wir schon loslegen.« Kurz blickte er zu Valless hinüber. »Oder haben Sie ein Problem damit, Vincent?«
»Ganz und gar nicht, Sir.«
»Todd? Wie ist’s bei dir?«
»Wenn du meinst, dass wir da nicht stören«, antwortete Todd, »dann soll mir das nur recht sein. Wie ich schon sagte: Ich bin auf diese Judith wirklich gespannt.«
Für jeden Außenstehenden passten George und Babette Ramsbottom überhaupt nicht zusammen.
George war ein eingefleischter Konservativer, Babette stand ganz offen zu ihrer äußerst liberalen Einstellung. Obwohl keiner der beiden einen Adelstitel führte, waren beide äußerst wichtige Persönlichkeiten: Sie waren immens wohlhabend und einflussreich und gehörten den aktivsten, wichtigsten Kreisen der Gesellschaft des Sternenkönigreichs an.
Wenn George nicht gerade in dem einen oder anderen Ministerium mit hochrangigen Aufgaben beschäftigt war oder vor dem Parlament als Experte für Fragen der Gesetzgebung auftrat, verbrachte er seine gesamte Freizeit damit, sich auf seine zahlreichen und lukrativen geschäftlichen Interessen zu konzentrieren.
Babette hingegen hatte schon mehrmals für ein Amt kandidiert, stets unterstützt von ihrer Partei. Mehr als einmal hatte sie dabei den von ihrem Ehemann bevorzugten Kandidaten ausgestochen. Und ebenso wie George hatte auch sie schon so manchen Posten bekleidet, der vielleicht nicht ganz so öffentlichkeitswirksam war, dabei aber nicht weniger einflussreich. Wenn Babette sich nicht gerade auf dem Gebiet der Politik umtrieb, war sie stets im Kreise der vielzitierten Oberen Zehntausend präsent und schien es darauf anzulegen, das Geld ihres Ehemannes ebenso rasch auszugeben, wie dieser es verdienen konnte.
Schon oft hatte man erlebt, wie die beiden sich in Streitgesprächen ergingen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch dann, wenn sie sich unbeobachtet wähnten. Ihre Gegner fragten sich, warum sich das Paar nicht einfach scheiden ließ. Wer mit dem einen oder der anderen befreundet war – gemeinsame Freunde hatten sie kaum –, stellte andere Theorien darüber auf:
George und Babette blieben zusammen, weil keiner der beiden das Risiko eingehen wollte, den Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zu verlieren. Außerdem wollte George Babette keinen Unterhalt zahlen müssen. Babette wiederum sah nicht ein, auf das Geld zu verzichten, das George anscheinend mühelos einnahm. Eine andere, ebenfalls beliebte, Theorie lautete: Keiner der beiden war bereit, das beträchtliche historische Ramsbottom-Anwesen aufzugeben – ein Anwesen, auf dem sie beide nach wie vor residierten, aller Feindseligkeiten zum Trotze.
Angesichts all der Gerüchte und der unverhohlenen Versuche, der Wahrheit auf den Grund zu gehen – und das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, legal oder nicht –, war es erstaunlich, dass keine dieser Spekulationen zutraf. Das hatte einen einfachen Grund: Wer auch immer sich in diesen Spekulationen erging, übersah stets eine wichtige Information. Sie fehlte ihm einfach.
George und Babette Ramsbottom waren mitnichten erbitterte Gegner. Vielmehr waren sie nicht nur ein Ehepaar, sondern auch enge Freunde – und Verbündete. Das vermochten sie selbst vor ihren eigenen drei Kindern zu verbergen – vor allem dadurch, dass sie die Kinder auf Internate und zu teuren Ausbildungsstätten schickten und sie stets nur getrennt voneinander besuchten. Dabei erfolgten besagte Besuche sehr häufig: Keinem der beiden konnte man vorwerfen, sie würden ihre elterlichen Pflichten vernachlässigen.
Auf dem Ramsbottom-Anwesen gab es auch eine ausgedehnte Dienerschaft, doch selbst diesen Dienern gegenüber hielten George und Babette ihre Scharade stets aufrecht. Und was hatte es schon zu bedeuten, dass das gesamte Anwesen – vor allem die privaten Arbeitszimmer und das eheliche Schlafgemach – ebenso undurchdringlich abgeschirmt wurde wie die sichersten Bereiche von Mount Royal Palace? Immer und immer wieder hatte man George sagen hören, er werde nicht zulassen, dass Babette sein Geschäftsleben ausspionierte. Stets hatte sie darauf erwidert, sie werde ihm ganz gewiss nicht ihre Privatangelegenheiten anvertrauen.
Sicherlich war es lässlich, wenn niemand bemerkte, dass die gleichen Sicherheitsvorkehrungen auch das Abhören jeglicher privater Gespräche zwischen George und Babette verhinderten. Niemand wusste besser als George und Babette Ramsbottom, dass das Volk kaum etwas so sehr schätzte wie ein Ehepaar, das sich stets und in aller Öffentlichkeit stritt. Und außerdem war es ja allgemein bekannt, dass niemand nach etwas sucht, das es unmöglich geben kann.
»Wann rufen wir an?«, fragte Babette.
»In drei Minuten«, erwiderte George.
»Und wenn Judith Newland nicht da ist?«
»Sie wird ihr Com bei sich haben.«
George sprach mit der gleichen Zuversicht, die es ihm gestattete, so viele Geschäfte erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen. Doch als die drei Minuten verstrichen waren und sie tatsächlich anriefen, nahm niemand das Gespräch entgegen.
»Also hat sie ihr Com nicht mitgenommen«, merkte Babette an, und in ihrer Stimme schwang ein Hauch jener beißenden Schärfe mit, die sie so effizient in der Öffentlichkeit zum Einsatz brachte. »Vergiss nicht: Diese Frau ist eine echte Barbarin! Wahrscheinlich denkt sie an so etwas überhaupt nicht.«
Mürrisch verzog George das Gesicht. Er selbst nahm sein Com sogar mit ins Badezimmer. Die Vorstellung, irgendjemand könne es anders halten – gerade angesichts dieser Krise –, erschien ihm völlig fremdartig.
»Mach dir keine Sorgen«, fuhr Babette fort und klang nun wieder deutlich sanfter. »Früher oder später wird sie schon daran denken, einen Blick auf ihr Com zu werfen.«
»Aber ich wollte sie erreichen, bevor Prinz Michael eintrifft …«
»Mach dir keine Sorgen!«
Als George einen zweiten Versuch unternahm, sie zu erreichen, bekam er eine Frauenstimme zu hören – die Stimme kannte er schon aus den Überwachungsaufzeichnungen. Kurz darauf erschien ein Bild auf dem Display.
Eine junge Frau, schlank und anmutig; ihr dichtes kastanienbraunes Haar trug sie streng zurückgebunden. Selbst wenn die Gesichtszüge der Frau nicht vor Sorge angespannt und verhärmt gewirkt hätten, wäre niemand auf die Idee gekommen, Judith Newland als »hübsch« zu bezeichnen. Andererseits war es ein Gesicht, nach dem man sich auch noch ein zweites und ein drittes Mal umdrehen mochte, lange nachdem deutlich hübschere Gesichter längst vergessen wären.
Das lag an ihren Augen: Das auffallende Grün ihrer Iris war von einem hellbraunen Ring umgeben; anders als bei den meisten anderen Menschen waren die Farben nicht einfach vermischt. Und der Blick aus diesen bemerkenswerten Augen war so scharf und konzentriert wie der eines Raubvogels.
Babette ertappte sich dabei, ein wenig zurückzuweichen, als der Blick auf dem Bildschirm auf sie fiel, obwohl sie genau wusste, dass George ein Dummy-Programm zwischengeschaltet hatte. Dieses Programm sorgte dafür, dass ihre Gesprächspartnerin auf ihrem Display nur zwei geschlechts- und gesichtslose Schatten zu sehen bekam. Diese Schatten waren auch noch miteinander verschmolzen, und so war der Gesamteindruck deutlich bedrohlicher, als das bei einem einfach nur schwarzen Bildschirm der Fall gewesen wäre.
»Ja?«
»Sind Sie alleine?«
Babette hörte ihre Worte zweimal hintereinander: einmal mit ihrer eigenen Stimme, einmal mit der computergenerierten Flüsterstimme, die das Avatar-Programm bereitstellte.
»Ja. Hat dieser Anruf etwas mit dem Verschwinden meiner Tochter zu tun?«
Obwohl Babette bei allen bisherigen Nachforschungen in Erfahrung gebracht hatte, dass Judith Newland eine bemerkenswert zähe junge Frau war, überraschte sie die Gefasstheit ihrer Gesprächspartnerin doch. Bei besagten Nachforschungen hatte Babette auch herausgefunden, dass es im ganzen Universum wahrscheinlich nur eine einzige Person gab, die Judith Newland ohne jede Einschränkungen und Vorbehalte liebte: ihre kleine Tochter Ruth. Babette hatte erwartet, Judith weinen und schreien zu sehen oder wenigstens Tränen in diesen eigentümlichen grünen Augen zu erkennen. Mit dieser eisernen Selbstbeherrschung hatte Babette jedoch nicht gerechnet.
Doch George lachte leise in sich hinein. Ohne ein Wort zu sagen, deutete er auf eine kleine Zahlenreihe am unteren Rand des Bildschirms. Mit Hilfe von Infrarot-Scannern und einigen äußerst leistungsfähigen Analyseprogrammen strafte der Computer Judiths vermeintliche Gelassenheit Lügen: Der Puls der jungen Frau war beschleunigt, und als George einen Farbfilter aktivierte, zeigten grün-schwarze Markierungen die Stellen an Judiths Haut an, bei denen die Körpertemperatur ungewöhnlich hoch war. Das alles verriet, wie aufgebracht diese scheinbar so ruhige Frau in Wirklichkeit war.
Babette entspannte sich. George nickte.
»Hat er. Hier sind unsere Bedingungen. Ruth lebt noch, und es geht ihr gut – vorerst zumindest.«
Auf dieses Stichwort hin wurde ein Bild von Ruth übermittelt: die Datums/Uhrzeit-Kennung der Datei war aktuell (allerdings war diese Kennung gefälscht). Nur quälend kurz, eine halbe Sekunde lang, wurde das Bild gezeigt: In eine blassrosa Decke gehüllt, lag Ruth auf der Seite. Sie schlief tief und fest. Eine Hand hatte sie zu einem Fäustchen geballt; es lag unmittelbar vor ihren rosenroten, klassisch geschnittenen Lippen.
Selbst Babette, die ansonsten wahrhaftig nichts für kleine Kinder übrig hatte, musste zugeben, dass Ruth wirklich entzückend war.
George sprach weiter.
»Wenn Sie Ruth lebendig und gesund wiedersehen wollen, müssen Sie Ihren Freund Michael Winton dazu bringen, sich öffentlich in einer Art und Weise zu verhalten, die seinem Stande gänzlich unangemessen ist. Obszönität in der Öffentlichkeit wäre da genau das Richtige. Wenn man ihn auf sein Verhalten anspricht …«
Und dass genau das geschieht, dafür werden wir schon sorgen, dachte Babette selbstgefällig. Sie hatte auch bereits einen geeigneten Reporter ausgewählt und auf die Gelegenheit vorbereitet.
»… dann hat er anzumerken, dass er ein Winton ist, und dass die Wintons schon immer genau das getan haben, wonach ihnen gerade der Sinn stand. Er wird darauf hinweisen, dass nichts und niemand und schon gar nicht ein Haufen abergläubischer, prüder Barbaren etwas daran ändern wird – auch wenn besagte Barbaren die Bewohner einer Welt sind, die jüngst ein Bündnis mit dem Sternenkönigreich eingegangen ist.«
Für einen kurzen Augenblick verriet Judiths unbewegte, ausdruckslose Miene aufrichtige Verwirrung.
»Warum glauben Sie denn, er würde auf mich hören?«
»Tun Sie’s einfach«, erwiderte George streng; seine zischende Avatar-Stimme war mit einem wahrhaft beängstigenden Echo unterlegt. »Und vergessen Sie nicht: Sollte irgendjemandem gegenüber erwähnt werden, dass Ruth verschwunden ist, würde das mindestens ebenso großen Schaden anrichten wie alles, was Prinz Michael sagen kann. Es ist ja ganz offensichtlich: Wenn die Wintons nicht einmal diejenigen beschützen können, die auf einer ihrer eigenen Welten wohnen, wie sollen sie denn dann jene beschützen, die in anderen Sonnensystemen leben?«
Judiths Miene wurde wieder reglos; ihr Gesicht hätte aus Holz geschnitzt sein können. »Und wenn ich tue, was Sie von mir verlangen? Was dann?«
»Am gleichen Tag, an dem Prinz Michael seine ›Erklärung‹ abgegeben hat, wird man Sie informieren, wo Sie Ruth finden können.«
»Und wenn ich mich weigere?«
»Dann wird Ruth jemandem übergeben, der sie sehr, sehr gerne wiederhaben möchte – ihrem Vater, Ephraim Templeton.«
Nun war es um Judiths Gefasstheit geschehen.
»Das können Sie doch nicht machen!«
»Einem Vater seine Tochter zurückgeben? Einem Vater, der noch nie die Möglichkeit hatte, seine Tochter im Arm zu halten und ihr über das weiche blonde Haar zu streicheln? Also, ich finde das etwas ganz Wunderbares! Nehmen Sie sich bloß nicht zu viel Zeit, Ms Templeton. Die Vorstellung, eine solche Familienzusammenführung zu ermöglichen, treibt mir wirklich die Tränen der Rührung in die Augen.«
Judith stammelte noch irgendetwas Zusammenhangloses, doch George unterbrach die Verbindung.
»So«, sagte er sehr zufrieden. »Nachricht überbracht. Ich habe mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, wie Judith darauf reagieren wird, wenn ich andeute, sie könne Prinz Michael dazu bewegen, sich so völlig untypisch zu verhalten – und gänzlich konträr zur Politik seiner Schwester. Wir können uns doch unmöglich getäuscht haben …«
»Du meinst damit, wie nahe Prinz Michael und Judith Newland zueinander stehen?«, schlussfolgerte Babette. Entschlossen schüttelte sie den Kopf. »Ganz und gar nicht! Vergiss nicht, ich bin doch überhaupt erst auf diese Idee gekommen, nachdem ich sie letztes Jahr zusammen gesehen habe. Prinz Michael hat zwar versucht, sich nichts anmerken zu lassen, aber ich habe doch sofort bemerkt, dass für ihn die grünen Augen dieser unattraktiven Barbarin Sonne, Mond und Sterne sind!«
Kurz streckte sich Babette wie eine Katze und sprach dann weiter. »Und seitdem habe ich ein bisschen recherchiert. Die beiden schreiben einander regelmäßig. Er schickt ihr kleine Präsente. Sie lässt ihm Bilder der Kleinen zukommen. Ich habe seine Privatsekretärin ein wenig ausgehorcht – und das ziemlich geschickt, wie ich anmerken möchte. Diese Sekretärin kümmert sich um Prinz Michaels Terminkalender, wann immer er sich gerade wieder einmal im System befindet und dienstfrei hat. Es hat sie ziemlich belustigt, dass das Allererste – und auch das Einzige –, worauf Prinz Michael stets besteht, immer nur ist, genug Zeit zu haben, einer gewissen Judith Newland einen Besuch abzustatten.
Aber viel wichtiger ist noch etwas anderes: Bevor Prinz Michael diese Judith Newland kennengelernt hat, war er ein völlig normaler, aktiver, heterosexuell orientierter junger Mann. Seit es Judith gibt, ist er keinerlei Beziehungen mehr eingegangen – er flirtet nicht einmal mehr! Ich habe auch keine brauchbaren Hinweise darauf gefunden, dass er irgendwelche Freudenhäuser aufgesucht hat – und welcher Flottenangehörige tut das bei einem Landgang nicht?«
»Ein Flottenangehöriger«, gab George zu bedenken, denn er war wirklich konservativer und sittenstrenger als seine Gemahlin, »der Wert auf seinen Ruf legt und auch auf den seiner Familie.«
»Ja, das stimmt wohl«, erwiderte Babette, beugte sich vor und gab George einen Kuss auf die Nasenspitze. »Und genau deswegen wird es die Allgemeinheit so unendlich schockieren, wenn Prinz Michael plötzlich jegliches sittliche Verhalten in der Öffentlichkeit vermissen lässt. Er war doch immer ein so guter, braver Junge …«
»Und wenn er sich weigert?«
»Das wird er nicht tun«, versetzte Babette sehr zuversichtlich. »Er liebt Judith – und dieses Balg auch. Selbst wenn Prinz Michael nicht so reagiert, wie ich mir das überlegt habe, haben wir ja immer noch das Kind. Dann werden unsere Helfer die kleine Ruth eben Ephraim Templeton aushändigen und die Übergabe auf Video aufzeichnen. Das dürfte ziemlich unschön werden. Templeton hasst die Mutter der Kleinen aus tiefstem Herzen. Es sollte mich überhaupt nicht überraschen, wenn er das Kind erst einmal ordentlich durchprügelt, sobald er es in die Finger bekommt …«
»Und genau dieses Verhalten«, griff George den Gedanken auf, »lässt sich gewiss für unsere Zwecke nutzen. Nicht nur, dass alle Bewohner des Sternenkönigreichs dann mit eigenen Augen sehen, was für Untiere diese Masadaner sind, nein, nein! Dann begreifen die Graysons auch endlich, dass ein Sternenkönigreich, das nicht einmal ein einzelnes Kind zu beschützen vermag, wahrhaftig ein schwacher Verbündeter ist.«
»Und dann …«, fuhr Babette fort, und ihre Miene wurde mit einem Mal sehr viel ernsthafter. In ihren Augen funkelte jetzt der Eifer einer echten Reformerin. »Ja, dann können wir das Sternenkönigreich endlich wieder auf den rechten Weg bringen. Dann hat es ein für alle Mal ein Ende mit jeglichen Bündnissen mit fremden Staaten, und das Sternenkönigreich verschwendet auch nicht mehr all unsere Ressourcen darauf, deren primitive Technologie auf einen halbwegs akzeptablen Stand zu bringen.«
»Ganz genau«, stimmte George zu. »Es bedarf nur eines bisschen Klatschs und Tratschs, dann kann die kleine Ruth wieder zurück zu ihrer Mama, und die Politik des Sternenkönigreiches kann sich endlich wieder auf ihren Eigenbedarf konzentrieren.«
Bis der Flugwagen auf dem Landeplatz des Wohnturms aufsetzte und Michael ausstieg, hatten die Ereignisse der letzten Stunde Judith völlig überwältigt. Sie hatte ganz vergessen, dass ihr bester Freund auf ganz Manticore für diesen Tag seinen Besuch angekündigt hatte.
Entsprechend war Judith auch völlig erstaunt ob dieses vermeintlichen Zufalls. Dann meldete sich eine eisige, unerbittliche Stimme aus der Tiefe ihrer Seele zu Wort. Die Entführer hatten gewusst, dass er sie besuchen würde. Sie hatten es ganz genau gewusst und sowohl Ruths Entführung als auch diesen Anruf so aufeinander abgestimmt, dass Judith gleich Michaels Besuch dazu ausnutzen konnte.
Sie warf einen Blick auf ihr Chronometer. Michael war mindestens eine halbe Stunde zu früh. Je nachdem, wie genau die Entführer informiert waren, mochte Michaels verfrühtes Eintreffen ihnen durchaus einen Knüppel zwischen die Beine werfen.
Judith lief auf den Flugwagen zu, versuchte gar nicht erst, ihren Eifer zu verbergen, und hoffte darauf, dass man ihr nicht anmerkte, wie verzweifelt sie war. Als auf der Beifahrerseite noch ein zweiter junger Mann aus dem Flugwagen stieg, verlangsamte Judith ihre Schritte ein wenig. Dank der Bilder, die Michael ihr geschickt hatte, erkannte sie Todd Liatt sofort. Sie wusste, dass er einer von Michaels engsten Freunden war. Natürlich fragte sie sich sofort, was Todd wohl denken würde, wenn sie Michael bat, ihre Königin und deren gesamte interstellare Außenpolitik zu verraten, bloß um ein kleines Mädchen zu retten.
Wieso glauben die Entführer überhaupt, Michael würde so etwas tun? Er gehört dem Militär an! Es muss doch schon Dutzende von Situationen gegeben haben, in denen er oder seine Vorgesetzten entschieden haben, es sei erforderlich, einige Menschen sterben zu lassen, damit andere überleben können! Wenn wir unser Bündnis mit Grayson verlieren, reißt das ein entsetzliches Loch in unsere Verteidigung gegen die Volksrepublik.
Als Judith begriff, was es bedeutete, dass sie hier über »unsere« Verteidigung nachdachte, blieb sie abrupt stehen. Das Sternenkönigreich lag nicht alleine in Michaels Verantwortung. Sie selbst, Judith Newland, hatte ebenfalls ihre Verantwortung zu tragen – ihre Verantwortung als Bürgerin ebendieses Sternenkönigreichs. Sie mochte ja vielleicht keine Sternenschiffe und keine Geschützbatterien befehligen, und sie bekleidete auch kein Amt in der Politik, doch trotzdem wusste sie, dass auch sie Verantwortung trug.
Ich kann von Michael nicht verlangen, sein Volk zu verraten – unser Volk. Nicht einmal für Ruth. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass Ruth zu Ephraim zurückgebracht wird!
Während Judith noch ganz in diese Überlegung vertieft war, hatte Michael Winton sie erreicht. Todd Liatt hielt sich ein Stück weit hinter ihm. Außerdem stand drei Schritte hinter dem Kronprinzen ein gedrungener dunkelhaariger Mann, dessen wachsame Haltung so deutlich »Leibwächter« verkündete, dass die Uniform des Palastschutzes überhaupt nicht erforderlich gewesen wäre.
Hinter dem Kronprinzen, dachte Judith und ließ den Blick von dem Leibwächter zu dem Stingship hinüberwandern, das auch jetzt noch über ihnen am Himmel stand und nur als winziger Punkt zu erkennen war. Das ist nicht einfach nur irgendein Lieutenant Michael Winton.
Sie streckte die Hand aus und umschloss Michaels dunkle Finger.
»Michael, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dich zu sehen.« Erleichtert bemerkte Judith, dass ihre Stimme überhaupt nicht zitterte. »Und Sie müssen Todd sein – Verzeihung, ich meine natürlich ›Lieutenant Liatt‹. Nach allem, was mir Michael in seinen Briefen erzählt hat, habe ich das Gefühl, ich würde Sie schon längst persönlich kennen.«
Todd grinste und schüttelte ihr nun ebenfalls höflich die Hand. »›Todd‹ ist voll und ganz in Ordnung. Aber nennen Sie mich bloß nicht ›Gevatter Todd‹, so wie unser gemeinsamer Freund es hin und wieder tut.«
Michael wandte sich ein wenig ab und deutete auf seinen Leibwächter. »Und das ist Lieutenant Vincent Valless.«
Judith reichte der Leibwache nicht die Hand – sie hatte festgestellt, dass es ihr auch jetzt noch ernstliche Anstrengung abverlangte, einen fremden Mann zu berühren. Dafür jedoch schenkte sie ihm ein freundliches Lächeln.
»Gehen wir doch in mein Apartment, ja? Ein paar Erfrischungen stehen schon bereit.«
Michael blickte sich um. »Wo ist denn Ruth? Du hast geschrieben, dass sie jetzt nicht mehr krabbelt, sondern schon laufen kann. Ich habe fest damit gerechnet, von ihr ganz dolle gedrückt zu werden!«
»Die werden wir schon finden«, sagte Judith und hoffte inständig darauf, diese Worte seien wahrhaft prophetisch.
Michael versuchte nicht einmal, seine Überraschung zu verbergen, als er an der Eingangstür zu Judiths Apartment von Dinah begrüßt wurde – und von Ruth keine Spur zu sehen war. Sorgenfalten hatten sich in das Gesicht der älteren Frau gegraben, und Michael spürte deutlich, dass Judith und sie gerade jetzt lautlos miteinander kommunizierten.
Dann berührte Judith ihn sanft am Arm und brachte ihn so dazu, sich zu ihr herumzudrehen.
»Ich muss unbedingt mit dir sprechen«, sagte sie. »Geht das auch, ohne dass er« – sie blickte zu Vincent Valless hinüber – »jedes Wort mitbekommt?«
Michael stockte das Herz. »Ich weiß nicht recht. Wenn wir im Mount Royal Palace wären, ginge das sicher, aber das hier ist ja ›ungesichertes Gebiet‹ …«
Judith stieß einen Seufzer aus. Es war kein Zeichen der Verärgerung, sondern der puren Verzweiflung. Dann warf sie einen Blick auf ihr Chronometer.
»Wir können nicht länger warten. Ich kann nicht mehr warten. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen … Michael, kannst du wenigstens Todd und den Lieutenant bitten, sich auf keinen Fall einzumischen?«
»Wenn du nicht gerade geplant hast, die Regierung zu stürzen«, erwiderte Michael bewusst leichthin.
Zu seiner immensen Überraschung füllten sich Judiths Augen mit Tränen. Er hatte miterlebt, wie man sie zum Tod ihrer Eltern befragt hatte, zu ihrer Gefangenschaft bei den Masadanern, zu der grausamen Behandlung, die sie über sich hatte ergehen lassen müssen, solange sie sich in Ephraim Templetons Gewalt befunden hatte. Doch nie hatte Judith auch nur eine einzige Träne vergossen. Ja, soweit sich Michael erinnerte, hatte er Judith nur ein einziges Mal weinen sehen: Als sie geglaubt hatte, Dinah liege im Sterben.
Michael widerstand dem Impuls, ihr die Träne von der Wange zu wischen, schließlich wusste er, dass Judith auch jetzt noch jeglichen Körperkontakt in der Öffentlichkeit, von unpersönlichen Gesten der reinen Höflichkeit abgesehen, als zutiefst geschmacklos empfand. Stattdessen trat er einen Schritt zur Seite, um sie vor den Blicken der anderen abzuschirmen, solange sie noch um Beherrschung rang.
Lange dauerte es nicht. Drei tiefe Atemzüge später waren die Tränen wieder verschwunden. Dann warf Judith einen weiteren Blick auf das Chronometer und wandte sich wieder ihren Besuchern zu.
Todd und Dinah hatten sich einander mittlerweile verlegen vorgestellt und taten so, als würden sie die Anspannung der beiden anderen nicht bemerken. Vincent Valless war äußerlich gänzlich teilnahmslos – das hatte er seiner strengen Ausbildung zu verdanken –, doch Michael war sich sicher, dass auch sein Leibwächter angesichts dieser unerwarteten Wendung immens erstaunt war.
Judith deutete auf den runden Tisch, der in einer Ecke des makellos sauberen, spärlich möblierten Apartments stand.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz! Ich hole gerade noch etwas aus der Küche, aber ich werde gleichzeitig schon mit der Erklärung anfangen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit wirklich drängt.«
Dinah, Todd und Michael traten an die Stühle heran. Valless blieb stehen und positionierte sich so, dass er Fenster und Tür gleichermaßen im Blick behalten konnte. Währenddessen ging Judith in die kleine Küche hinüber, und während sie nach einer Servierplatte mit kleinen Sandwiches und einigen Süßigkeiten griff, begann sie mit ihrer Erklärung.
»Ruth wurde entführt«, sagte sie und hob dann abwehrend die Hand, als sie das entsetzte Keuchen ihrer Gäste hörte. »Ja, ich bin mir sicher. Ich war gerade von den Nachbarn unter mir zurückgekommen, weil ich wissen wollte, ob sie Ruth vielleicht gesehen haben, als die Entführer mich angerufen haben.«
Dinah nickte. »Was Judith sagt, stimmt. Ich war hier, als das Com zum ersten Mal geklingelt hat, aber ich wollte das Gespräch nicht annehmen. Und als Judith dann wieder zurück war und abgenommen hat, wurde sie gefragt, ob sie allein sei.«
»Und da habe ich gelogen«, sagte Judith. »Ich wollte, dass noch jemand hier ist – nur für den Fall, dass ich vielleicht irgendein Detail vergesse.«
»Sonderbar, dass die so einen Anruf über ein öffentliches Com führen«, merkte Michael an. »Und dann fragen sie dich auch noch, ob vielleicht noch andere Zeugen anwesend sind, und glauben dir einfach …«
Schiere Verzweiflung stand in Judiths grünen Augen zu lesen. »Eigentlich glaube ich ja, dass es denen völlig egal war, ob es nun Zeugen gab oder nicht. Wahrscheinlich wäre ihnen das sogar lieber gewesen. Warte ab! Wenn ich dir erkläre, was sie verlangt haben, verstehst du bestimmt, warum ich das denke.«
Mit klinischer Präzision wiederholte sie das ganze Gespräch. Doch als sie die Bedingungen für Ruths Freilassung erklärte, schoss ihr das Blut in die Wangen.
»Gut, dann mache ich das«, sagte Michael sofort.
Zwei Stimmen gleichzeitig verhinderten, dass er noch etwas hinzusetzte.
Voller Entsetzen erklärte Todd: »Michael, das kannst du unmöglich tun!«
Judiths Stimme klang sogar noch entschlossener, als sie sagte: »Das lasse ich nicht zu.«
Michael starrte sie an.
»Das lasse ich nicht zu«, wiederholte Judith. »Ich habe keine Ahnung, warum sie glauben, ich hätte irgendeinen Einfluss auf dich, aber ich werde nicht zulassen, dass du ein entscheidendes Bündnis und deinen eigenen Ruf ruinierst.«
Ach, du hast also keine Ahnung, ja?, dachte Michael. Ich schon. Todd scheint es auch verstanden zu haben. Dinah weiß es auf jeden Fall. Ich wette, sogar Vincent hat zumindest eine gewisse Vermutung. Dann habe ich es wohl wenigstens dir gegenüber besser geschafft, mir meine Gefühle nicht anmerken zu lassen, als ich es selbst für möglich gehalten hätte.
Aber das sprach Michael nicht aus. Stattdessen fragte er ungläubig: »Du willst doch wohl nicht, dass Ruth wieder diesem Ephraim Templeton in die Hände fällt, oder?«
Heftig schüttelte sie den Kopf; wie ein seidiger Wasserfall umspielte ihr kastanienbraunes Haar ihre Schultern.
»Natürlich nicht! Ich werde Ruth finden und sie zurückholen. Und wenn ich sie wiederhabe, dann werde ich die alle dermaßen fertigmachen, dass sie so etwas nie, nie wieder versuchen!«
Diese Reaktion überraschte Michael nicht im Mindesten, doch er bezweifelte ernstlich, dass Judith tatsächlich in der Lage wäre, Ruth zu finden. Und er würde nicht zulassen, dass sie sich und ihr Kind zerstörte, wenn es in seiner Macht stand. Allerdings wusste er auch, dass jedes Gegenargument hier reine Zeitverschwendung war.
»Wenn du nach den Entführern suchen willst, helfe ich dir.« Michael wandte sich um und blickte seinen Leibwächter an. »Und Sie werden mir jetzt einfach vertrauen müssen, Vincent. Es geht hier um das Leben eines kleinen Mädchens. Und nach den Forderungen, die Judith uns gerade erklärt hat, sieht das doch ganz nach einem politischen Motiv aus. Aber wir wissen überhaupt nicht, wer diese Leute sind – noch nicht. Bis wir mehr darüber wissen, dürfen wir es nicht riskieren, mit irgendjemandem darüber zu sprechen.«
»Sämtliche Masadaner im Exil hier könnten durchaus schon vermuten, dass Ruth verschwunden ist«, gab Vincent vorsichtig zu bedenken.
»Das weiß ich auch«, erwiderte Michael, »aber außer Judith und Dinah weiß noch niemand, dass sie entführt wurde.«
»Eigentlich«, sagte Judith, »war Dinah schon vor mir äußerst misstrauisch. Als ich bei den Nachbarn nachfragen wollte, hat sie etwas angemerkt, was mich sehr stutzig gemacht hat. Als die Nachbarn mir dann gesagt haben, dass Ruth nicht bei ihnen sei, hatte ich noch vermutet, sie sei inzwischen zu Dinah hinübergelaufen. Deswegen habe ich erst noch dort nachgeschaut. Und als ich dann wieder hierher zurückgekommen bin, um Dinah davon zu berichten, kam dieser Anruf.«
Dinah lächelte und schob ihren Stuhl ein wenig zurück. »Dann gehe ich jetzt noch einmal nach unten und sage, du hättest vergessen, Milch zu holen, aber die brauchen wir jetzt doch für den Tee. Und unten erzähle ich dann, wie aufgeregt Ruth war, ›Onkel Michael‹ wiederzusehen.«
Als Dinah den Raum verlassen hatte, wandte sich Michael wieder Vincent Valless zu.
»Vincent, ich weiß sehr wohl, dass es Ihre Aufgabe ist, mich vor jeglicher physischen Gefahr zu beschützen. Wenn ich Ihnen verspreche, auch wirklich in Deckung zu gehen, wenn Sie mir das sagen, arbeiten Sie dann hierbei mit mir zusammen?«
»Wenn Sie mir Ihr Wort geben«, erwiderte Vincent. »Aber es wäre mir doch deutlich lieber, wenn ich diese Änderung der Lage meinen Vorgesetzten melden dürfte – vor allem, wo es hier doch deutlich um eine politische Angelegenheit zu gehen scheint.«
»Ich weiß«, sagte Michael. »Geht mir ja genauso. Aber es gibt da ein Problem: Solange wir nicht wissen, wer Ruth entführt hat, dürfen wir keinen unserer Kommunikationskanäle als sicher ansehen. Natürlich bin ich fest davon überzeugt, dass Elizabeth damit nichts zu tun hat …«
»Das will ich doch wohl hoffen! Dass Sie fest davon überzeugt sind, meine ich, Sir!« Vincent war ernstlich schockiert ob der Vorstellung, irgendjemand könnte Ihrer Majestät der Königin die Mittäterschaft an einer derartigen Untat unterstellen.
»Sicher. Aber ich weiß nicht, ob nicht irgendjemand hier die Finger im Spiel hat, der ihr sehr nahesteht. Vielleicht hat ja jemand die Kommunikationskanäle vom Mount Royal Palace angezapft. Oder die ganze Situation ist viel, viel einfacher: Möglicherweise steckt jemand dahinter, der sich ganz in der Nähe aufhält und praktisch allgegenwärtig ist – ein Diener vielleicht, den man dafür bezahlt hat, sofort Bericht zu erstatten, falls gewisse Themen angesprochen werden oder falls ich innerhalb der nächsten Stunden Elizabeth anrufe.«
»Ich verstehe«, gestand Vincent ein. »Mir gefällt zwar ganz und gar nicht, was das für Konsequenzen haben könnte, aber ich weiß sehr wohl, was Sie meinen.«
»Das dachte ich mir«, erwiderte Michael. »Wenn alle Menschen immer ehrlich zueinander wären und es nirgends in der Welt Gefahren gäbe, dann bräuchte ich ja auch nicht jemanden wie Sie, der mich stets beschützt. Wie dem auch sei: Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich mich nicht in Gefahr begebe. Und ich werde auch keine Ihrer Anweisungen missachten, wenn Sie zu dem Schluss kommen, ich befände mich bereits in Gefahr.«
Todd, dessen aufmerksames Schweigen Michael erneut ins Gedächtnis zurückrief, dass sein Freund die Taktik-Schulungen absolvierte, um eines Tages ein eigenes Schiff befehligen zu können, wandte sich an Judith. »Auf mich können Sie ebenfalls zählen. Bei mir wurden sämtliche nur erdenklichen Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt, schließlich war ich nicht nur einmal Michaels Stubenkamerad, sondern sogar zweimal. Mir können Sie voll und ganz vertrauen.«
»Ich tue das auf jeden Fall«, warf Michael ein. »Selbst ohne die ganzen Sicherheitsüberprüfungen.«
»Dann werde auch ich Ihnen vertrauen«, erwiderte Judith. »Wenn Michael das sagt.«
Vincent Valless räusperte sich. »Ich habe die Berichte dieser Sicherheitsüberprüfungen gelesen. Sie vertrauen da wirklich dem Richtigen.«
Ob dieses gänzlichen Vertrauens war Todd hoch erfreut und peinlich berührt gleichermaßen. Er errötete. Doch Michael bemerkte es nicht einmal. Er hatte sich bereits erneut Judith zugewandt. »Danke, dass du so geduldig bist! Mir ist klar, dass du es kaum noch aushalten kannst und endlich etwas unternehmen willst.«
»Ja, das stimmt«, erwiderte sie. »Aber wir haben doch keine Ahnung, wo wir ansetzen können. Bloß aufgescheucht hin und her zu rennen hilft weder Ruth noch uns weiter.«
Aus dem Augenwinkel sah Michael, dass Vincent angesichts dieser beinahe unfassbaren Selbstbeherrschung bewundernd den Kopf schüttelte.
Du solltest sie mal auf der Brücke eines Raumschiffs erleben – mitten im Gefecht, dachte Michael.
Judith, die von diesen Reaktionen nichts mitzubekommen schien, sprach weiter. »Natürlich ist der erste Anhaltspunkt für uns diese Frau vom Sozialdienst, die mich heute aufgesucht hat. Sie hat mir sogar einen Namen genannt: Dulcis McKinley.«
»Der wird wahrscheinlich falsch sein«, merkte Todd an. »Aber besser als gar nichts.«
»Wie sah diese Dulcis McKinley denn aus?«, fragte Michael.
»Ungefähr eine Handbreit größer als ich«, antwortete Judith sofort, »und dabei auffallend schlank. Helles Haar, blasse Haut, hellblaue oder hellgraue Augen – das weiß ich nicht mehr genau. Ihr Haar war ziemlich kurz, im Nacken beinahe schon ausrasiert. Trotzdem wirkte sie im Ganzen überhaupt nicht unweiblich. Ihre Lippen waren sehr voll, und ich weiß noch genau, dass ich sie um ihre Wangenknochen richtig beneidet habe: sehr hoch, sehr elegant.«
»Kurzes Haar ist im Augenblick nicht gerade in Mode«, erklärte Todd mit der Überzeugung eines Mannes, der einen Großteil seiner Landgänge darauf verwandt hatte, sämtliche Frauen zu begutachten, die nicht der Navy angehörten. »Die einzigen Berufszweige, bei denen Kurzhaarfrisuren ewig beliebt sind, dürften wohl die sein, bei denen man einen Raumanzug oder vergleichbare Schutzkleidung tragen muss. Da stören lange Haare nur.«
Michael nickte und fuhr sich geistesabwesend durch die eigenen kurzgeschorenen Locken. »Okay. Also möglicherweise jemand, der regelmäßig Außeneinsätze im All durchführt.«
Michael hatte seinen Minicomp mitgebracht, denn eigentlich hatte er Judith und Ruth Aufnahmen von einigen Orten zeigen wollen, die er seit seinem letzten Brief aufgesucht hatte. Jetzt zog er das kleine Gerät aus der Tasche. »Ich werde erst einmal diesen Namen überprüfen«, sagte er.
»Ist das ratsam?«, fragte Judith sofort nach. »Vielleicht hat jemand ein Programm aktiviert, das ihn warnt, sobald jemand nach genau diesem Namen sucht.«
»Eigentlich«, widersprach Michael, »wäre es angesichts der Situation deutlich ungewöhnlicher, wenn man auf eine solche Suche verzichten würde. Aber lass mich dafür deinen Comp nehmen. Vielleicht machen die sich ja nicht die Mühe, nach Kennungen zu suchen, aber trotzdem …«
Die Suche führte sie zwar nicht zu der gewünschten Person, aber sie stießen trotzdem auf eine recht interessante Information. Dulcis McKinley war der Name einer Nebenfigur in Herzen am Himmel, einer romantischen Komödie, die vor etwa fünfzehn T-Jahren äußerst beliebt gewesen war.
»Deswegen kam mir der Name so bekannt vor!«, merkte Todd an. »Meine Schwester war völlig verknallt in den Hauptdarsteller. Wochenlang hat sie sich das Ding immer und immer wieder angeschaut – natürlich auf dem größten Bildschirm, den wir nur hatten. Wahrscheinlich kann ich das Ding von vorne bis hinten mitsprechen!«
»Im Augenblick hilft uns das nicht weiter«, sagte Michael. »Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Und jetzt …«
Erneut wandte er sich Judith zu. »Meinst du, du könntest versuchen, zusammen mit Todd ein Bild dieser Dulcis McKinley zu rekonstruieren?«
»Und was machst du?«, fragte Todd.
»Zunächst einmal baue ich ein paar Störfelder auf, damit niemand mitbekommt, was wir hier treiben.«
»Merkt das denn niemand?«, fragte Judith besorgt nach.
»Nicht, wenn ich vorsichtig vorgehe«, antwortete Michael. »Bei der Navy habe ich gelernt, Informationen aus Menschen und Maschinen gleichermaßen herauszuholen, ohne dass diese das überhaupt bemerken. Und wenn ich das ganz ohne Unbescheidenheit sagen darf: Ich bin darin wirklich außergewöhnlich gut. Falls irgendjemand hier herumschnüffelt, findet er Störfelder in genau dem richtigen Ausmaß. Und dahinter entdeckt dieser Schnüffler dann aufgebrachte Gespräche, Schluchzen und alles, was sonst so dazugehört.
Vincent«, fuhr Michael fort, »schauen Sie doch währenddessen bitte, ob Sie irgendwelche Fahrzeuge zurückverfolgen können. Die Frau vom Sozialdienst muss schließlich irgendwie hierhergekommen sein, und Ruth hat man ja auch nicht einfach fortgezaubert. Ich weiß, dass Sie auf die Satellitenaufzeichnungen sämtlicher Verkehrsbewegungen zugreifen können. Meinen Sie, Sie finden einen glaubwürdigen Vorwand, weswegen Sie genau diese Gegend ein wenig unter die Lupe nehmen müssten?«
Vincent wirkte beinahe schon aufgeregt. »Da weiß ich sogar noch etwas Besseres! Ich komme an Aufzeichnungen über den gesamten Wohnturm ran und auch an die der beiden Nachbargebäude. Dieses gesamte Gelände wird rund um die Uhr bewacht.«
Fragend hob Michael eine Augenbraue, und sein Leibwächter schüttelte den Kopf. »Damit hatten wir überhaupt nichts zu tun, Hoheit! Ich weiß das überhaupt nur, weil es nun einmal zu meinem Job gehört, über derlei Dinge Bescheid zu wissen, bevor ich Sie irgendwohin reisen lasse. Aber auf jeden Fall gibt es hier diese Aufzeichner.«
Noch während Valless sprach, kam Dinah wieder herein, in der Hand eine Tasse Milch. Vorsichtig schloss sie hinter sich die Tür, und als wollte sie eine Frage beantworten, sagte sie: »Genau. Als wir damals hier angekommen sind, haben sich viele der Frauen Sorgen um räuberische Männer gemacht. Das war natürlich völlig albern, aber mit ein paar überneugierigen Gestalten hatten wir tatsächlich anfangs ein paar Probleme. Also wurden diese Kameras aufgestellt, und dabei ist es dann eben auch geblieben.«
»Trägheit«, merkte Michael an, »kann auch etwas Gutes haben.«
Vincent hatte bereits seinen Minicomp gezückt. »Meine Anfrage sollte eigentlich ohne jegliche Schwierigkeiten durchgehen. Vor und während eines heiklen Personentransports ist es ohnehin fast Standard, die Verkehrsbewegungen zu überprüfen.«
»Man möchte ja schließlich wissen, wer sich vielleicht ein bisschen übermäßig lange in der Gegend herumtreibt«, bestätigte Michael. »Gut. Dann legen Sie mal los!«
»Und was machst du, wenn das Störfeld erst einmal aufgebaut ist?«, erkundigte sich Todd.
»Ich werde mir den Chip anschauen, den Judith hier hat«, sagte Michael. »Du hast das Gespräch doch aufgezeichnet, oder?«
»Ja, aber was bringt es denn, sich das anzuschauen?«, fragte Judith. »Ich habe dir doch erzählt, dass die irgendeine Art Avatar-Programm verwendet haben.«
»Ich weiß«, gab Michael zurück. »Vertrau mir! Das wird bestimmt keine Zeitverschwendung sein!«