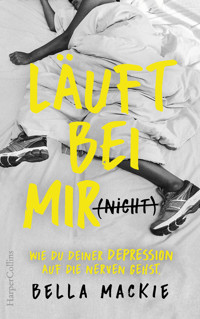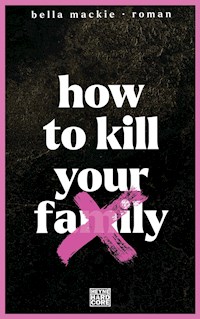
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
PLATZ 1 DER SUNDAY TIMES BESTSELLERLISTE
»Seit Beginn der Pandemie hatte ich Mühe, meine Leselust wiederzufinden. Dieses Buch hat sie wieder zum Leben erweckt ...« Jojo Moyes
Grace ist eine Serienmörderin und sie mordet aus gutem Grund. Grace rächt sich bei ihrer Familie. Dafür dass sie beiseitegeschoben wurde, weil sie unehelich ist. Dafür dass sie nicht reingepasst hat in die feine, reiche Familie ihres Vaters. Aber noch mehr rächt Grace ihre Mutter, die es nie verkraftet hat, zuerst mit allen Mitteln verführt und dann schäbig vergessen worden zu sein. Eine ebenso zynische wie umwerfende Antiheldin, die scharf beobachtet und noch schärfer urteilt. Und manchmal mordet. Doch egal, was sie anstellt, unsere Sympathie ist ihr sicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Du kannst dir deine Familie nicht aussuchen, aber du kannst sie töten
Ich habe etliche Menschen umgebracht (manche brutal, andere in aller Stille), aber im Gefängnis schmachte ich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe.
Wenn ich daran denke, was ich wirklich getan habe, empfinde ich deshalb vor allem Enttäuschung. Dass nie jemand von meiner komplexen Strategie und meinem raffinierten Vorgehen erfahren wird, stimmt mich traurig.
Selbstverständlich wäre mir nichts lieber, als ungestraft davonzukommen, aber wenn ich schon lange nicht mehr bin, wird vielleicht jemand einen alten Safe öffnen und darin dieses Geständnis vorfinden. Das gäbe zweifellos einen gewaltigen Aufschrei in der Öffentlichkeit.
Denn dass jemand im zarten Alter von achtundzwanzig Jahren in aller Seelenruhe sechs Familienmitglieder umgebracht und dann, ohne Reue zu empfinden, weitergelebt hat, als wäre nichts geschehen, dürfte für die meisten Menschen unbegreiflich sein.
»Smart, lustig und bitterböse.« Elle
Zur Autorin
Bella Mackie, Journalistin und Autorin, hat für den Guardian, die Vogue und das Vice Magazine geschrieben. »How To Kill Your Family« ist ihr erster Roman, der bereits kurz nach Erscheinen die britischen Bestsellerlisten stürmte. Bella Mackie ist mit dem BBC-Radiomoderator Greg James verheiratet und lebt in London.
bella mackie
how
to kill
your
family
roman
Aus dem Englischen
von Stephan Glietsch
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel How to kill your family bei Borough Press, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
@heyne.hardcore
Copyright © 2021 by Bella Mackie
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Kirsten Naegele
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock/Nadia Chi,
© Bigstock/Amadey/ART
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28475-6V002
Für meinen Dad,
der mir Hunderte von mörderischen Gutenachtgeschichten vorlas.
Für meine Mum,
die mir Hunderte von heiteren Geschichten vorlas.
Ich verspreche, keinen von euch umzubringen.
Entweibt mich hier. Füllt mich von Wirbel bis zur Zeh’,
randvoll, mit wilder Grausamkeit! Verdickt mein Blut.
William Shakespeare, Macbeth
prolog
Das Gefängnis von Limehouse ist grauenvoll – wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Nur können Sie es sich vermutlich gar nicht vorstellen. Nicht so richtig. Spielekonsolen und Flachbildfernseher gibt es dort nicht. Das haben Sie bestimmt in der Zeitung gelesen. Dort existiert kein freundliches Miteinander, kein schwesterlicher Zusammenhalt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt, fürchterlich laut, und man hat immerzu den Eindruck, jeden Moment könnte ein Kampf ausbrechen. Ich bemühte mich von Anfang an, nicht aufzufallen. Zwischen den Mahlzeiten, die sich mit viel Wohlwollen und auch nur mitunter als genießbar beschreiben lassen, bleibe ich in meiner Zelle. Ich meide meine Mitbewohnerin – wie sie penetranterweise genannt werden will.
Kelly ist eine Frau, die gerne mal ein »Schwätzchen« hält. Als ich vor vierzehn langen Monaten hier ankam, setzte sie sich zu mir auf die Pritsche und krallte ihre schrecklich langen Fingernägel in mein Knie, um dann zu erklären, dass sie wisse, was ich getan hätte, und dass sie es fantastisch finde. Dieser Zuspruch war so unerwartet wie willkommen, denn als ich die drohend aufragenden Tore dieses schäbigen Ortes durchschritt, tat ich das in der sicheren Erwartung gewalttätiger Übergriffe – die naive Vorstellung eines Menschen, der das Gefängnis nur aus einer billig produzierten Fernsehserie kennt. Nachdem sie sich auf diese Weise vorgestellt hatte, erkor sie mich zu ihrer neuen besten Freundin. Schlimmer noch: Sie erkannte, dass ich eine Zellengenossin war, mit der sich prächtig angeben ließ. Beim Frühstück drängelt sie sich zielstrebig zu mir durch, hakt sich bei mir unter und tuschelt drauflos, als wären wir in ein vertrauliches Gespräch vertieft. Bei Unterhaltungen mit anderen Häftlingen senkt sie die Stimme zu einem angedeuteten Flüstern, wenn sie damit prahlt, dass ich ihr mein Verbrechen in allen Einzelheiten gestanden habe. Wer sollte ihr bei den anderen Frauen den Respekt und den Einfluss verschaffen, nach dem sie dürstet, wenn nicht die berüchtigte Morton-Mörderin? Das ist extrem nervig.
Ich habe zwar gerade geschrieben, dass Kelly behauptet, alles über mein Verbrechen zu wissen, aber vielleicht stellt das Wort »Verbrechen« mein Licht unter den Scheffel. In meinen Ohren klingt es schäbig und gewöhnlich. Ladendiebe begehen Verbrechen. Wer zu Beginn eines weiteren öden Tages im Büro mit sechzig Stundenkilometern durch eine verkehrsberuhigte Zone brettert, um sich einen lauwarmen Caffè Latte zu holen, der begeht ein Verbrechen. Ich tat etwas sehr viel Anspruchsvolleres. Ich tüftelte und führte einen so komplexen wie umsichtigen Plan aus. Seine Ursprünge reichten zurück bis weit vor die unerfreulichen Umstände meiner Geburt. Da es in diesem schlimmen und reizlosen Käfig für mich kaum etwas zu tun gibt (ein verwirrter Therapeut legte mir nahe, einen Poetry-Slam-Kurs zu besuchen, worauf mir derart die Gesichtszüge entglitten, dass er so etwas zu meiner Zufriedenheit nie wieder vorschlug), habe ich beschlossen, meine Geschichte zu erzählen. Was gar nicht so einfach ist, wenn mir nicht der gewohnte Laptop zur Verfügung steht. Als mein Anwalt mir kürzlich versicherte, es gebe einen Lichtschimmer am Ende des Tunnels, erschien es mir angebracht, meine Zeit hier drinnen zu nutzen und einiges von dem niederzuschreiben, was ich getan habe. Ein Ausflug in den Speisesaal versorgte mich mit einem dünnen Notizblock und einem abgenutzten Kuli, die mich fünf Pfund meines wöchentlichen Taschengeldes von 15,50 Pfund kosteten. Vergessen Sie die Zeitschriftentipps, die Ihnen weismachen wollen, dass Sie Geld sparen können, indem Sie beim Coffee-to-go knausern. Wenn Sie richtiges Haushalten lernen wollen, verbringen Sie etwas Zeit in Limehouse. Mag sein, dass diese Schreiberei witzlos ist, aber ich muss mich irgendwie beschäftigen, um etwas gegen die lähmende Langeweile hier zu unternehmen. Wenn Kelly und ihre »Ladys« – wie sie die Mitglieder ihrer endlosen Entourage nennt – mitkriegen, dass ich zu tun habe, hören sie vielleicht auf, mich ständig zu löchern, ob ich mit ihnen im Aufenthaltsraum Doku-Soaps glotze. Das hoffe ich zumindest. »Sorry, Kelly«, werde ich sagen, »ich gehe gerade meinen Fall durch und mache mir wichtige Notizen für die Berufung, lass uns doch später quatschen.« Ich wette, sie wird mich schon bei der kleinsten Andeutung, ich könnte ihr ein saftiges Detail meiner Biografie verraten, mit dem verschwörerischen Zwinkern einer überzeichneten Krimi-Figur meiner Arbeit überlassen.
Natürlich ist nichts davon für Kellys Ohren bestimmt. Ich bezweifle, dass sie über die intellektuelle Kapazität verfügt, meine Motive zu verstehen. Meine Geschichte ist genau das: meine Geschichte. Obwohl ich mir sicher bin, dass die Leser sie verschlingen würden, sollte ich sie je veröffentlichen – was ich niemals könnte. Trotzdem ist es gut zu wissen, dass die Leute ihre Nase in das Buch stecken würden. Es wäre ein Bestseller, und die Menschen würden scharenweise in die Läden strömen, um mehr über das tragische Schicksal der attraktiven jungen Frau zu erfahren, die so etwas Schreckliches getan hat. Die Boulevardblätter bringen schon seit Monaten Storys über mich. Offenbar bekommt die Leserschaft den Hals nicht voll von den bereitwilligen Ferndiagnosen der Schmalspurpsychologen oder den Kommentaren vereinzelter Querdenker, die meine Tat trotz Shitstorm bei Twitter rechtfertigen. Die Leute sind so fasziniert von mir, dass sie sich sogar eine hastig zusammengeschusterte Channel-5-Dokumentation über mich ansehen, in der ein fetter Astronom behauptet, angesichts meines Sternzeichens sei mein Verbrechen absehbar gewesen. Das Sternzeichen war leider falsch.
Ich weiß also, dass die Menschen sich auf meine Geschichte stürzen würden. Ich habe bislang keinen Versuch einer Erklärung oder gar Richtigstellung unternommen – dennoch ist mein Fall bereits in aller Munde. Und die Ironie an der Sache ist, dass kein Mensch von meinen wahren Verbrechen weiß. Das hiesige Justizsystem ist ein Witz, und nichts macht dies deutlicher als die folgenden Worte: Ich habe etliche Menschen umgebracht (manche brutal, andere in aller Stille), aber im Gefängnis schmachte ich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe.
Gesetzt den Fall, dass die tatsächlich von mir verübten Verbrechen jemals bekannt werden, würde ich garantiert für Jahrzehnte in Erinnerung bleiben, vielleicht sogar für Jahrhunderte – sollte die Menschheit überhaupt noch so lange existieren. Dr. Crippen, Fred West, Ted Bundy, Lizzie Borden und ich, Grace Bernard: eine illustre Gesellschaft, in der ich mich jedoch ehrlich gesagt nicht richtig aufgehoben fühle. Denn ich bin keine Dilettantin, und ich bin auch nicht schwachsinnig. Ich bin eine Frau, der Sie auf der Straße bewundernde Blicke zuwerfen würden. Gut möglich, dass Kelly deshalb wie eine Klette an mir hängt, statt mich – wie erwartet – windelweich zu prügeln. Sogar hier drinnen bewahre ich mir eine Eleganz und eine Reserviertheit, an der manche Mithäftlinge – vor allem die, die mir nicht gewachsen sind – regelmäßig verzweifeln.
Ich habe gehört, dass ich trotz oder sogar gerade wegen meiner Tat säckeweise Fanpost erhalte. Briefe, in denen mir die Menschen ihre Liebe und Bewunderung gestehen oder nach dem Kleid fragen, das ich am ersten Verhandlungstag trug. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Es ist von Roksanda. Leider zeigte sich die schreckliche Frau des Premierministers nur einen Monat später in einem ganz ähnlichen Modell. Ich bekomme allerdings auch Drohbriefe. Und manchmal einfach nur wirres Zeug, zum Beispiel von Leuten, die überzeugt sind, ich würde ihnen telepathische Botschaften senden. Offenbar wollen die Menschen mich besser kennenlernen, mich beeindrucken und mir nacheifern – wenn schon nicht in meinem Verhalten, dann zumindest in Modefragen. Doch das ist irrelevant, denn ich lese keinen einzigen dieser Briefe. Mein Anwalt sammelt und entsorgt sie für mich. Warum sollte ich etwas darauf geben, was irgendwelche traurigen Gestalten von mir halten, die nichts Besseres zu tun haben, als mir zu schreiben?
Schon möglich, dass ich mir die Leute da draußen schönrede, indem ich ihnen eine vielschichtigere Gefühlswelt zugestehe, als realistisch wäre. Vielleicht lässt sich das anhaltende und fieberhafte Interesse an mir schlicht und einfach mit Ockhams Rasiermesser erklären – jener Theorie, die besagt, dass die naheliegende Antwort gewöhnlich auch die richtige ist. In dem Fall wäre der eigentliche Grund für das Überdauern meines Namens auch nach meinem Tod leider denkbar prosaischer Natur: das schmuddelige Drama, das die Menschen gewöhnlich mit einer Dreiecksbeziehung verbinden. Wenn ich daran denke, was ich wirklich getan habe, empfinde ich deshalb vor allem Enttäuschung. Dass nie jemand von meiner komplexen Strategie und meinem raffinierten Vorgehen erfahren wird, stimmt mich traurig. Selbstverständlich wäre mir nichts lieber, als ungestraft davonzukommen, aber wenn ich schon lange nicht mehr bin, wird vielleicht jemand einen alten Safe öffnen und darin dieses Geständnis vorfinden. Das gäbe zweifellos einen gewaltigen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Denn dass jemand im zarten Alter von achtundzwanzig Jahren in aller Seelenruhe sechs Familienmitglieder umgebracht und dann, ohne Reue zu empfinden, weitergelebt hat, als wäre nichts geschehen, dürfte für die meisten Menschen unbegreiflich sein.
kapitel 1
Beim Aussteigen aus dem Flugzeug schlägt mir dieser wunderbare Schwall heißer Luft entgegen, der allen Briten einen Ausruf der Überraschung entlockt, wenn sie bei der Landung an einem heißen Ort daran erinnert werden, dass der Rest der Welt sich eines Klimas erfreut, das nicht nur zwischen grau und kalt schwankt. Ich bin Expertin im schnellen Durchqueren von Flughäfen, und heute lege ich mich besonders ins Zeug, denn ich will meinen leidigen Sitznachbarn abhängen.
Amir stellte sich vor, kaum dass ich angeschnallt war. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig. Sein Hemd war so eng, dass sich darunter – fast wie im Comic – seine Brustmuskeln abzeichneten. Dazu trug er aus unerfindlichen Gründen eine glänzende Jogginghose. Das Schlimmste an seinem Outfit, sozusagen das Sahnehäubchen auf dieser stillosen Torte, waren die Schlappen an seinen Füßen. Badelatschen von Gucci mit dazupassenden Socken. Um Gottes willen. Ich spielte mit dem Gedanken, die Stewardess um einen anderen Sitzplatz zu bitten, doch sie war nirgendwo zu sehen. Also war ich zwischen dem aufgetakelten Superhelden und dem Fenster gefangen, als das Flugzeug zur Startbahn rollte.
Amir reiste nach Marbella – genau wie ich, auch wenn ich ihm das niemals verraten hätte. Er sagte, er sei achtunddreißig, im Disco-Geschäft, und sprach ständig davon, irgendwas »groß aufzuziehen«. Während er vom Lifestyle in Marbella ganz allgemein und speziell dem in Puerto Banús schwärmte und davon schwafelte, wie schwer es sei, seine Lieblingsautos für die Sommersaison nach Spanien zu überführen, schloss ich gelangweilt die Augen. Obwohl meine Körpersprache mehr als eindeutig war, gab mein Sitznachbar keine Ruhe und drängte mir schließlich doch noch ein Gespräch auf. Ich wolle meine beste Freundin besuchen, erzählte ich ihm. Nein, sie wohne nicht direkt im Viertel Puerto Banús, sondern weiter landeinwärts, und dass wir in die Stadt kämen, um uns im Glitter-Club zu amüsieren, sei deshalb eher unwahrscheinlich.
»Brauchst du ein Auto?«, fragte der Muskelprotz. »Ich könnte dir eine krasse Karre klarmachen. Sag einfach Bescheid, und ich besorg dir einen schicken Benz für den Urlaub.« Ich lehnte höflich ab, gab ihm dann entschieden zu verstehen, dass ich noch zu arbeiten hatte, und klappte mein Notebook auf.
Mit Beginn des Landeanflugs nutzte Amir die Gunst der Stunde: Er ermahnte mich, meinen Laptop zu schließen, und verwickelte mich erneut in ein Gespräch, wobei ich sorgsam darauf achtete, weder meinen Namen noch andere persönliche Informationen preiszugeben. Die unnötige Aufmerksamkeit machte mich wütend. Ich hatte mich bewusst für eine schwarze Hose, eine Bluse und gegen Make-up entschieden, um auf dem Flug nicht aufzufallen. Kein Schmuck. Keinerlei persönlicher Touch. Nichts, woran man sich bei einer Vernehmung erinnern könnte. Zu der es allerdings nie kommen wird, denn ich bin bloß eine junge Frau auf dem Weg in den Urlaub – wie so viele andere auch.
Amir hatte seine Chance, und zwar gegen meinen Willen. Noch eine wird er nicht bekommen. Deshalb drängele ich mich an der Passkontrolle mit einem entschuldigenden Lächeln bis zum Schalter vor und marschiere geradewegs zur Gepäckausgabe. Als die Halle sich füllt, verschwinde ich hinter einer Säule und starre auf mein Handy. Nach ein paar Minuten erspähe ich meine Tasche. Ich fische sie vom Förderband und eile dann schnurstracks Richtung Ausgang. Da kommt mir ein Gedanke.
Als Amir die Abfertigungshalle verlässt, lehne ich draußen am Geländer. Er zieht den Bauch ein, pumpt die Brust auf und winkt mir strahlend zu. An seinem Handgelenk funkelt eine goldene Uhr.
»Ich hab dich schon gesucht!«, sagt er.
»Sorry, ich will mittags bei meiner Freundin sein, deshalb bin ich ziemlich in Eile, aber ich möchte mich wenigstens verabschieden.«
»Dann lass uns doch mal zusammen ausgehen«, probiert er es erneut. »Gib mir deine Nummer, und wir schließen uns kurz.« Keine Chance! Aber ich muss ihn bei Laune halten, um das zu kriegen, was ich von ihm will.
»Sorry, ich hab ein neues Handy und kann mir die Nummer einfach nicht merken«, erwidere ich lächelnd und berühre ihn sanft am Arm. »Weißt du, was? Du gibst mir einfach deine Nummer, und dann melde ich mich bei dir.« Als ich sie notiert habe, will er mich bei meiner Freundin absetzen. Ich lehne dankend ab, verabschiede mich, gehe ein paar Schritte und drehe mich dann doch noch einmal um.
»Amir«, rufe ich ihm nach. »Dein Angebot mit dem Auto, steht das noch?«
•
Nicht ganz zwei Stunden später erreiche ich nach einer einigermaßen entspannten Mietwagenfahrt die Ferienwohnung. Ich habe sie bei Airbnb gefunden, aber mit der Vermieterin abgesprochen, dass ich bar bezahle. Als ich ihr die doppelte Summe anbot, war sie sofort einverstanden, den Deal unter der Hand zu regeln. Indem ich auf diese Weise die Registrierung im Internet umging, konnte ich es vermeiden, meinen richtigen Namen anzugeben. Die Miete ist unfassbar teuer, besonders in der Hauptsaison, aber ich habe auf der Arbeit nur diese Woche freibekommen. Die Gelegenheit, endlich meinen von langer Hand vorbereiteten Plan umsetzen zu können, war mir das viele Geld wert. Die Wohnung ist winzig und stickig. Die Einrichtung erinnert an eine Achtzigerjahre-Kosmetikklinik – dekoriert mit Porzellanpuppen. Ich würde mir liebend gerne die Beine vertreten und runter ans Meer gehen, aber meine Zeit hier ist knapp bemessen, und es gibt enorm viel zu tun.
Ich habe alles recherchiert, was sich über zwei alte Heuchler mit einem absurd kleinen Online-Fußabdruck in Erfahrung bringen lässt. Daher bin ich mir ziemlich sicher, wo ich die beiden heute Abend finden werde. Die spärlichen Einträge auf Kathleens Facebook-Seite (das arme Ding hat einen öffentlichen Account, und Privatsphäre-Einstellungen sind für alte Leute Gott sei Dank ein Buch mit sieben Siegeln) verraten mir nicht nur, dass sich das Ehepaar Artemis über die vielen Spanier in Spanien aufregt, sondern auch, dass die beiden Senioren einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, zwischen einem direkt an der Uferpromenade gelegenen Restaurant namens Villa Bianca und einem Casino im Umland zu pendeln. Ich habe für heute Abend einen Tisch im Restaurant reserviert.
Nur damit das klar ist: Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich bin jetzt vierundzwanzig. Ich hatte jahrelang Zeit, darüber nachzudenken, wie ich meine Mutter am besten räche. Und gerade unternehme ich den ersten großen Schritt, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Bisher beschränkten sich meine Bemühungen darauf, die Karriereleiter hochzuklettern, Geld beiseitezulegen, Nachforschungen zu meiner Familie anzustellen und Wege zu finden, wie ich an sie herankomme. Alles hilfreich, aber todlangweilig. Ein Opfer, das ich gerne bringe, um an mein Ziel zu gelangen. Doch es ist verdammt hart, so zu tun, als könnte ich mich für Kundenbefragungen erwärmen. Oder für die After-Work-Drinks, zu denen sich die Belegschaft jeden Freitag trifft und die nur dem Wort nach »unverbindlich« sind. Hätte ich gewusst, dass ich einmal Jägermeister-Red-Bull mit Menschen trinke, für die es das höchste der Gefühle ist, im Marketing zu arbeiten, dann hätte ich ein zweites Loch im Hintern als ernst zu nehmende Alternative betrachtet. Vielleicht habe ich es mit der Umsetzung dieses ersten Schritts deshalb so eilig, weil ich mir unbedingt beweisen will, dass ich vorankomme und tatsächlich schaffen werde, was ich mir mit dreizehn in den Kopf gesetzt habe. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich viel zu schlecht vorbereitet bin. Dabei wollte ich zum Zeitpunkt meiner Ankunft in Marbella längst eine wasserdichte Taktik, eine exakte Route, einen detaillierten Zeitplan und eine ausgebuffte Verkleidung in petto haben. Stattdessen hocke ich in einer Wohnung, in der es riecht, als wäre der Familienhamster unter einem Schrank krepiert, und die ahnungslose Mutter hätte den ominösen Gestank sechs Monate lang mit Unmengen von Bleiche bekämpft. Ich habe einen Plan im Kopf, aber keine Ahnung, ob es mir gelingen kann, ihn zu verwirklichen. Die Perücke, die im Neonlicht des Beauty-Shops in Finsbury Park noch überzeugend aussah, erscheint mir unter der Sonne Spaniens bedenklich leicht entflammbar. Wegen der mangelhaften Vorbereitung habe ich zwar regelmäßige Panikschübe, doch inzwischen erfasst mich auch eine gewisse Vorfreude. Beim Schminken und Aufsetzen der Perücke fühle ich mich wie vor einem tollen Date und keineswegs so, als stünde ich im Begriff, meine Großeltern zu töten.
•
Das ist natürlich überzogen. Heute Abend werde ich sie noch nicht umbringen, denn das wäre nicht besonders schlau. Ich muss mir erst einen persönlichen Eindruck von ihnen verschaffen und ihre Unterhaltungen belauschen, um vielleicht den einen oder anderen Hinweis darauf zu bekommen, was sie diese Woche so vorhaben. Ich muss die Strecke zu ihrer Villa abfahren, am besten gleich mehrfach, und deshalb brauche ich unbedingt den Wagen, den mir Amir versprochen hat. Dieses Auto ist entweder ein Zeichen, dass ich hoffnungslos chaotisch bin und meine Pläne besser verschieben sollte, oder es ist eine Fügung des Schicksals. Wir werden sehen!
Ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass Kathleen und Jeremy Artemis die Ersten sein werden, die uns verlassen müssen, und zwar aus mehreren Gründen. Allen voran, weil sie alt sind. Das macht sie entbehrlich. Alte Leute, die nichts tun, außer ihre Rente zu verprassen und in ihrem Lieblingssessel zu verblöden, sind meiner Meinung nach nicht unbedingt das beste Aushängeschild für die Menschheit. Schön und gut, dass Menschen dank medizinischer Hilfe, Fitness und gesunder Ernährung heute sehr viel länger leben als noch vor einigen Jahren. Nur leider sind sie zu nichts mehr nütze, blockieren Krankenhausbetten und werden immer engstirniger, bis sie nur noch geifernde Nervensägen sind, die das künftige Arbeitszimmer okkupieren.
Jetzt tun Sie doch nicht so schockiert – ich weiß genau, dass Ihnen dieser Gedankengang auch nicht fremd ist. Wir sollten unser Leben genießen, um dann mit siebzig das Zeitliche zu segnen – nur ausgesprochene Langweiler wollen auf Teufel komm raus hundert Jahre alt werden. Die Belohnung dafür besteht eh nur aus ein paar spärlichen Worten der Queen. Im Grunde tue ich uns allen einen Gefallen. Die beiden führen ein unglaublich sinnentleertes Leben: ein Glas Wein zum Mittag, dann ein Nickerchen und ein kurzer Shoppingtrip in die Stadt, um dort grässlichen Schmuck oder eine protzige Armbanduhr zu kaufen. Er spielt Golf, und sie verbringt eine Menge Zeit damit, sich ihr Gesicht aufspritzen zu lassen, was zu dem grotesken Ergebnis führt, dass sie mehr und mehr wie ein greises Kleinkind aussieht. Das ist die reinste Verschwendung von Lebenszeit – und außerdem sind sie üble Rassisten. Überlegen Sie doch mal: Die beiden leben in Marbella, sprechen aber kein Wort Spanisch. Muss ich dazu noch mehr sagen?
Natürlich handele ich nicht uneigennützig. Ich bin kein Harold Shipman, der Senioren umbringt, wo er geht und steht. Ich will nur zwei von ihnen töten, der Rest kann unbehelligt Emmerdale glotzen und geschmacklose Mitbringsel für die langweiligen Besuche bei den armen Enkeln kaufen. Diese beiden sind meine Großeltern, und trotzdem haben sie mir noch keine einzige Toblerone gekauft, denn wir sind uns nie begegnet. Dabei wissen sie durchaus von mir.
Ich erkläre es Ihnen: Über viele Jahre war ich völlig ahnungslos, denn ich dachte, mein Vater Simon hätte mich erfolgreich verschwiegen. Doch neulich war Helene in London. Sie ist eine alte Freundin meiner Mutter, und bei einer Flasche Wein gestand sie mir, dass sie den beiden einen Besuch abgestattet hatte. Das war kurz vor ihrem Umzug nach Paris, der auch schon eine Ewigkeit zurückliegt. Sie hatte damals das Gefühl, dass sie der Freundschaft zu meiner wunderschönen Mutter nicht gerecht wurde – weil sie mich in England zurückließ. Arme tote Marie. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, war Helene nichts Besseres eingefallen, als das Internet nach meinen Großeltern zu durchforsten. Im Handelsregister hatte sie schließlich ihre Londoner Adresse gefunden.
Ich war verrückt auf jedes neue Puzzleteil, mit dem ich meine Erinnerungen vervollständigen konnte. Deshalb wäre ich fast über den Tisch geklettert, um zu hören, was die beiden Helene zu sagen hatten. Natürlich war ich schon einige Male bei ihrem Haus gewesen, bevor sie ganz nach Spanien umsiedelten. Stundenlang hatte ich dort auf der Lauer gelegen. Hin und wieder war ich ihnen gefolgt, wenn ihr Fahrer sie mit der Limousine irgendwohin kutschiert hatte. Doch mit ihnen zu sprechen … das war noch mal etwas völlig anderes. Ich war beeindruckt von Helenes Courage, allerdings war ich auch sauer, dass sie diese Begegnung nie zuvor erwähnt hatte.
Mir zu erzählen, wie schrecklich dieses Treffen verlaufen war, fiel ihr offenkundig schwer – sie konnte mir kaum in die Augen sehen. Meine Großeltern hatten ihr damals die Haustür vor der Nase zugeschlagen, kaum dass Helene ihnen gesagt hatte, wer sie war. Doch da sie sich nicht abwimmeln ließ, gewährten sie ihr schließlich widerwillig Einlass. Nachdem sie ihnen von mir erzählt hatte, hatten die beiden ihr ungerührt eröffnet, dass sie über mich und meine »grässliche« Mutter genau im Bilde seien.
Während ich das Gehörte sacken ließ, kratzte ich mir mit fiependen Ohren den Hals, als könnte ich den immer dicker werdenden Kloß auf diese Weise lösen. Sie waren über mich informiert, seit ihr »armer« Sohn eines Nachts ungewöhnlich spät bei ihnen aufgetaucht und nervös im Wohnzimmer auf und ab getigert war, um ihnen schließlich zu gestehen, er stecke in der »Patsche«. Laut Jeremy, der wohl die meiste Zeit sprach, während Kathleen stocksteif auf der Sofakante hockte und an einem Gin Tonic nippte, hatte Simon seiner Frau Janine wohl ursprünglich die Wahrheit sagen und seine Eltern darum bitten wollen, mich finanziell zu unterstützen.
»Zumindest was das betrifft, beabsichtigte er also offenbar, das Richtige zu tun«, murmelte Helene beinahe entschuldigend, nestelte in ihrem Haar herum und trank einen Schluck Wein. Ich ignorierte die Bemerkung und bat sie fortzufahren. Die armseligen Versuche dieses Mannes, sein Gewissen zu beruhigen, interessierten mich nicht im Geringsten.
Jeremy hatte Helene selbstgefällig erzählt, dass er und seine Frau stundenlang auf ihren Sohn eingeredet hätten, um ihm diese Ideen auszutreiben und ihn zu überzeugen, dass Marie von Anfang an bloß auf sein Geld scharf gewesen wäre und Janine sich von diesem Schock nie wieder erholen würde. »Simon hat einen dummen Fehler gemacht, wie viele andere junge Männer auch«, hatte er zu Helene gesagt. »Und es tut mir leid, dass dieses junge Mädchen ohne Eltern aufwachsen muss, aber es gibt viele Menschen, die Schlimmeres erlitten haben. Ich selbst habe in jungen Jahren meine Mutter verloren und trotzdem niemals fremde Leute um Almosen angebettelt.«
Helene hatte entgegnet, dass Marie von Simons Vermögen anfangs genauso wenig gewusst habe wie von seiner Ehe, und war schließlich sogar laut geworden. Doch bei meinen Großeltern war sie damit auf taube Ohren gestoßen. »Diese Frau wollte unseren Sohn aus Geldgier ruinieren«, hatte Kathleen sie angebrüllt und war echauffiert vom Sofa aufgesprungen. »Wenn Sie wirklich glauben, wir würden es zulassen, dass die Tochter Ihrer Freundin uns mit diesem Nonsens erneut behelligt, dann sind Sie genauso naiv wie diese Marie.« Und damit war das Gespräch mehr oder weniger vorbei gewesen. Wie Helene, nachdem sie das Glas Wein geleert hatte, gestenreich schilderte, war Kathleen plötzlich in lautes Schluchzen ausgebrochen und hatte mit den Fäusten auf die Brust ihres Mannes eingetrommelt. Worauf Jeremy seine Frau an den Handgelenken gepackt und mit Gewalt genötigt hatte, sich wieder zu setzen, um sich anschließend erneut Helene zuzuwenden. »Das haben Sie jetzt davon: Sie haben meine Frau aufgeregt und uns den Abend verdorben. Verlassen Sie sofort mein Haus und denken Sie nicht einmal im Traum daran, diese Nummer bei meinem Sohn abzuziehen. Dann bekommen Sie es so schnell mit unseren Anwälten zu tun, dass Sie obdachlos sind, bevor es zur Verhandlung kommt.«
»Da hatte ich wirklich weiche Knie«, erinnerte sich Helene. »Denn plötzlich sah er richtig irre aus. Sein akkurat frisiertes graues Haar war ganz wirr, und seine Augen traten hervor. Aber das Merkwürdigste war, dass er mit einem Mal ganz anders sprach. Am Anfang klang er noch wie ein waschechter Gentleman, aber als ich ging, war seine Aussprache so hart, dass er mich an die Marktschreier in meiner Heimatstadt erinnerte. Das alles tut mir schrecklich leid, Grace. Ich habe es ehrlich versucht. In der Hoffnung, dass Simons Eltern aufgeschlossener und mitfühlender wären. Meine Güte, ich habe wirklich geglaubt, dass sie ihre wunderschöne Enkeltochter sicher gerne kennenlernen würden! Von wegen. Mag ja sein, dass diese Leute es im Leben zu etwas gebracht haben, aber hinter dieser Fassade sind sie nicht besser als gewöhnliche Strauchdiebe.«
Sie sind also alt, sie sind gemein, und sie nehmen Platz weg, der in dieser Welt immer kostbarer wird. Das allein wäre Grund genug, sie ihrem Schöpfer auf ungemütlichere Weise zuzuführen, als dieser es ursprünglich für sie angedacht hatte. Aber wenn ich ehrlich bin, war für mich vor allem der Umstand entscheidend, dass die beiden von Anfang an Bescheid wussten. Sie wussten von meiner Mutter. Sie wussten von mir. Und sie haben nicht nur tatenlos zugesehen, sondern ihren Sohn bewusst indoktriniert, die Verantwortung ausschließlich bei Marie, Helene, den Clubs und seinen Freunden zu suchen, die ihn vom rechten Weg abgebracht hatten. Sie beschuldigten so ziemlich jeden außer Simon. Der entzog sich seinen väterlichen Pflichten, und seine Familie unterstützte ihn dabei nach Kräften. Ich dachte stets, sie wären ahnungslos gewesen, dass ihr Sohn sein Kind verleugnet und dessen Mutter im Stich gelassen hatte. Aber nein, sie haben es so gewollt. Und das gab am Ende den Ausschlag für meine Entscheidung: Sie müssen als Erste sterben.
•
Ich gehe davon aus, dass meine Großeltern es wie die meisten alten Leute halten und früh zu Abend essen. Deshalb bin ich um achtzehn Uhr am Strandrestaurant. Ich habe um einen Tisch auf der Terrasse gebeten, doch das Restaurant ist deutlich größer, als es im Internet wirkt, und ich befürchte, sie könnten sich so weit wegsetzen, dass ich kaum ein Wort verstehe. Ich bestelle ein Glas Weißwein (ich trinke gerne mal ein Glas Wein, und weil die Latimers immer schon großen Wert auf einen guten Tropfen legten, entscheide ich mich für einen Rioja) und schlage das Buch auf, das ich extra mitgebracht habe, damit nicht allzu offensichtlich wird, dass ich lausche. Der Graf von Monte Christo ist zwar eine etwas zu offensichtliche Wahl, beim Einpacken konnte ich mir das Schmunzeln dennoch nicht verkneifen. Ich muss nicht lange warten, bis das Ehepaar Artemis eintrifft: Kaum habe ich die erste Seite umgeblättert, bemerke ich aus den Augenwinkeln Bewegung an der Bar. Meine Großeltern sind nicht allein: Vier ältere Herrschaften werden von zwei Kellnern Richtung Terrasse geführt. Ich verharre mucksmäuschenstill und wage es nicht, den Blick zu heben, höre aber, dass sie näher kommen. Dann ertönt eine laute Stimme: »Nein, nicht diesen Tisch, Andreas, der steht in der prallen Sonne. Wir nehmen den dahinten.« Die Gruppe dreht ab und bewegt sich zur anderen Terrassenseite. Fick dich doch, Kathleen.
Nachdem sie Platz genommen haben, nörgeln sie ausgiebig über den Wind, bevor sie schließlich die Getränkebestellung aufgeben, was sich dank ihrer Entscheidungsschwierigkeiten ebenfalls endlos in die Länge zieht. Schließlich riskiere ich einen Blick. Das Ehepaar Artemis sitzt mit dem Gesicht und das befreundete Paar mit dem Rücken zu mir. Kathleens Föhnwelle würde selbst Joan Collins vor Neid erblassen lassen. Diese aschblonde Betonfrisur wirkt so wehrhaft, dass der gefürchtete Wind sich nicht einmal in die Nähe wagen würde. Die diversen kosmetischen Eingriffe in ihrem Gesicht sind selbst aus einiger Entfernung nicht zu übersehen. Dieser leicht überraschte Ausdruck ihrer Augen soll wohl kokett wirken, sieht jedoch einfach nur geisteskrank aus. Sie trägt eine beigefarbene Hose zur beigefarbenen Tunika. Ihre obszön große Chanel-Tasche thront mitten auf dem Tisch. Um ihren Hals hängt eine dicke Kette aus … ich kann die Steine nicht genau erkennen, vermute aber mal, dass es keine Zirkonia-Klunker sind. Da alle vier in die Speisekarten vertieft sind, kann ich es mir erlauben, ein wenig genauer hinzuschauen. Ich frage mich gerade, ob ich wohl irgendwelche Ähnlichkeiten mit dieser frustriert dreinblickenden Alten habe, da klatscht sie in die Hände, und ich sehe ihre Fingernägel: spitz gefeilt und in einem klassischen Feuerwehrrot lackiert. Na danke, Kathleen. Im Gegensatz zu ihren Händen sind meine, in denen ich immer noch das zwischenzeitlich vergessene Buch halte, lang und schlank. Doch meine Nägel sind ebenfalls spitz und knallrot.
Nachdem ich ein paar Minuten so getan habe, als wäre ich in mein Buch vertieft, winke ich den Kellner herbei und frage höflich nach einem Platz im Schatten. Keinen Moment zu früh, denn allmählich beschleicht mich die Befürchtung, meine Perücke könnte in dieser Hitze schmelzen. Die Terrasse ist gut besucht, aber nicht ausgebucht, und ich werde tatsächlich zu einem Tisch geführt, der direkt neben dem meiner Großeltern steht. Viel besser. Ich will hören, worüber sie reden. Klar, sie sind viel zu borniert, als dass ich aus ihren Gesprächen etwas Interessantes oder Aufschlussreiches über ihren Charakter lernen könnte, aber vielleicht kann ich in Erfahrung bringen, was sie diese Woche vorhaben. Da ich nur fünf Tage freibekommen habe, bleibt mir nicht viel Zeit. Ich bestelle eine Auswahl an Tapas, dazu ein weiteres Glas Wein und schlage abermals mein Buch auf. Jeremy mustert mich mit einem Blick, wie ihn jede Frau kennt. Mit Gönnermiene goutiert der alte Sack meine jugendliche Erscheinung und hat vermutlich keine Ahnung, was für ein trauriges Bild er dabei abgibt. Ich werfe ihm ein kurzes Lächeln zu. Zum einen, weil es mich amüsiert, dass mein Großvater ein Auge auf mich wirft, zum anderen, um ihn glauben zu lassen, ich fände Gefallen daran. Doch da kommen auch schon die Kellner und servieren ihnen das Essen. Beim Blick auf die Teller wird mir klar, warum keiner der vier eine Bestellung aufgegeben hat: Die ganze Gruppe bekommt Steak mit Pommes frites. Vermutlich kam kein anderes Gericht auf der Karte infrage. Steak mit Pommes muss es sein. Bloß nichts probieren, was man nicht kennt. Bloß nichts Neues wagen. Was für schäbige Kleingeister. Und das alles verrät mir ein Steak. Was mir da wohl erst ihre Bücherregale erzählen könnten. Nur ein Scherz – die haben ganz sicher keine Bücher im Haus.
Die Gruppe diskutiert über gemeinsame Freunde aus dem Golfklub und lästert über einen gewissen Brian, der sich bei einer Benefizauktion offenbar gründlich blamiert hat. Armer Brian, wie demütigend muss es sein, von der Gemeinschaft der grenzsenilen Auswanderer ausgeschlossen zu werden. Kathleen und die andere Frau, die aussieht wie eine dickere Kathleen mit einer kleineren Chanel-Tasche, schimpfen über einen Friseur, der wohl ewig lange Wartezeiten hat und ihrer Freundin letzten Montag keinen Termin geben wollte. Meine Konzentration schwindet. Ich will so viel wie möglich in Erfahrung bringen – aber halleluja, diese Leute machen es mir nicht einfach.
Ob ich mir noch einen Wein erlauben kann? Oder sabotiere ich damit meine eigene Mission? Ach, was soll’s. Ich bestelle ein weiteres Glas und stochere in den restlichen Tapas herum. Mein Essen ist irritierend gummiartig und sieht aus, als wäre es nicht aus dem Meer gefischt, sondern in einem Lagerhaus neben der Autobahn gezüchtet worden. Vielleicht hat die Gruppe am Nachbartisch, die inzwischen beim Kaffee angelangt ist, mit dem Steak alles richtig gemacht. Kathleen echauffiert sich über einen Fleck auf Jeremys Schlips, einer Klubkrawatte mit einem wappenartigen Logo darauf. Ich wette, Jeremy ist Freimaurer. Das würde wie die Faust aufs Auge passen. Der Mann der fetten Freundin fragt, wann die Artemis mal wieder ins Casino gehen, und erwähnt dabei einen Umtrunk am kommenden Donnerstag.
»Ja, da wollen wir hin«, sagt Jeremy gereizt und wischt die von Kathleen angebotene Serviette brüsk zur Seite. »Wir sind um halb acht mit den Beresfords zum Essen verabredet und schauen auf dem Rückweg dort vorbei.«
»WOGEHTIHRESSEN?«, will ich sie anschreien. Doch statt das weiter auszuführen, verlangt Jeremy mit einem schroffen Wink nach der Rechnung. Als diese gebracht wird, greift der andere Mann sofort nach der Untertasse mit dem Beleg. »Wir übernehmen das«, sagt er zu meinen Großeltern. »Ich bin mir sicher, dass wir an der Reihe sind – nein, bitte, ich bestehe darauf.« Eine goldene Kreditkarte wird auf den Teller geworfen, und nach einem halbherzigen Einspruch gibt Jeremy kommentarlos klein bei. Als er erneut zu mir herüberblickt, senke ich den Kopf. Er soll sich mein Gesicht nicht einprägen. Nicht, dass mir das große Sorgen bereiten würde, denn vermutlich verbringt er viel Zeit mit dem Angaffen von Frauen, die jung genug sind, um seine Enkeltöchter zu sein. Ich schätze, nur die wenigsten sind es tatsächlich, aber in Anbetracht von Simons Trefferquote bei Auswärtsspielen bin ich mir da gar nicht so sicher.
Als die Gruppe aufbricht, kann ich Jeremys Krawatte genau inspizieren. Ich lag falsch. Er ist kein Freimaurer. Auf dem grünen Signet prangen in Gelb die Lettern »R« und »C«. Eine rasche Googlesuche verrät mir, dass es sich um das Logo des Regency Clubs handelt. Ein im Jahre 1788 im Londoner Stadtteil Mayfair gegründeter, sogenannter Gentlemen’s Club, wo die Herren – bevorzugt reich und von Adel – unter sich sind, wenn sie sich mal ohne ihre Frauen treffen wollen. Fast muss ich lachen. O ja, Jeremy, ich weiß um deine bescheidenen Anfänge in einer Zwei-Zimmer-Absteige in Bethnal Green – die Mutter Näherin, der Vater ein Versager, der sich verpisst hatte, noch bevor du fünf warst. Simon hat in Interviews voller Stolz darüber gesprochen. Denn seiner Meinung nach zeigt es, dass eure Familie hart gearbeitet hat, um es in der Welt zu etwas zu bringen. Da stehst du nun mit deiner Krawatte und bildest dir ein, sie wäre ein Symbol für deinen Status und das Prestige – das du dir mit deinem vielen Geld erkauft hast. Manche finden so was bewundernswert. Ich auch, denn schließlich habe ich dasselbe Ziel: der Armut zu entkommen und die Karten, die mir bei meiner Geburt gegeben wurden, neu zu mischen. Aber ich kenne dich. Ich weiß, wie sehr du deine Herkunft verabscheust, egal wie sehr du sie verbrämst. Als du gebeten wurdest, deinem eigenen Fleisch und Blut aus ganz ähnlichen Verhältnissen herauszuhelfen, da hast du den Schwanz eingekniffen, denn du hast in mir deine eigene Vergangenheit gesehen. Helene hatte recht. Du bist bloß ein gewöhnlicher Strauchdieb; das können auch deine Privatklubs und teuren Klamotten kaum verschleiern. Aber trag du ruhig deine Krawatte spazieren – bis Donnerstag ist es nicht mehr lange.
Auf dem Rückweg in die Ferienwohnung beobachte ich das Treiben auf der Promenade von Puerto Banús. Die Boutiquen sind voll: tratschende Freundinnen, die mit reich verzierten Kleidern vor den Spiegeln posieren. Schnatternde Teenagermädchen laufen vorbei, das einzige Thema ist ihr sonnengebräunter Teint. Ich frage mich, ob ich im Schoß der Familie Artemis wohl auch zu so einer leeren Hülle herangewachsen wäre. Ich lese Bücher, ich verfolge das Weltgeschehen, ich habe eine Meinung – und das nicht nur zu Schuhen und Golfklubs. Kein Zweifel: Ich bin besser als diese Leute, doch sie scheinen glücklich zu sein – trotz ihrer Beschränktheit. Oder vielleicht gerade deswegen. Warum sollten sie sich den Kopf zerbrechen? Keiner dieser Idioten sorgt sich wegen des Klimawandels. Ihre Sorge gilt der Frage, was sie morgen auf der Jacht anziehen sollen. Das ist faszinierend zu beobachten, aber meine Zeit ist leider knapp bemessen. Nach getaner Arbeit werde ich nicht mehr an diesen Tummelplatz der oberen Zehntausend zurückkehren. Vielleicht sollte ich mir ein Souvenir kaufen. Ich betrachte die Schaufenster mit überteuertem Schrott. Ich habe weder das nötige Geld noch das Bedürfnis, mir ein pelzbesetztes Kaftankleid zuzulegen – nicht mal als Gag. Außerdem weiß ich schon, was für ein Andenken ich mitnehmen werde, und das wird mich nichts kosten.
Am nächsten Morgen gehe ich zum Strand, um zu joggen. Anschließend statte ich dem Haus meiner Großeltern einen Besuch ab. Gut versteckt vor dem Pöbel, steht die imposante Villa in einer gesicherten Wohnanlage, geschützt durch große Tore und einen gelangweilten Sicherheitsmann in einer Pförtnerloge. Zu seinen Aufgaben gehört es vermutlich auch, die Besucher zu kontrollieren. Trotzdem winkt er mich anstandslos durch, als ich behaupte, ich käme von der Boutique Afterdark, um Mrs. Lyle in der Nummer 8 ihr Kleid zu bringen. Ich habe darauf spekuliert, dass kontinuierlich Fahrzeuge das Tor passieren, weil die gelangweilten Damen in ihren makellos weißen Villen sich regelmäßig neue Klamotten oder die Nageldesignerin ins Haus kommen lassen. Für den Fall, dass später jemand Fragen stellt, erwähne ich den Namen Artemis mit keinem Wort.
Das Gebäude mit der Nummer 9 sieht den Villen mit den Hausnummern 8 und 10 zum Verwechseln ähnlich: strahlend weißer Putz, Terrakotta-Fliesen bis zur Haustür, eine palmengesäumte Veranda. Der perfekt gemähte Rasen ist trotz der sengenden Hitze saftig grün. In einer Anlage wie dieser, wo die Menschen abgeschirmt vom Rest der Gesellschaft leben, sind Bewässerungsverbote wohl allenfalls Empfehlungen. Ich nehme den Fuß vom Gaspedal und rolle langsam am Haus vorbei, aber es gibt absolut nichts zu sehen. Auf den breiten Alleen ist kein Mensch unterwegs, keine Mutter mit Kinderwagen, kein Hundebesitzer, der Gassi geht. So viel Geld, und alles, was man dafür kriegt, ist Stille. Wobei ich Stille durchaus zu schätzen weiß. Jeder, der an einer Hauptstraße in London aufwächst, träumt davon, eines Tages ein Zuhause ohne Nachbarn zu haben, die entweder knallharten Sex haben oder laut schluchzend den Soundtrack von Les Misérables hören. Doch diese Stille ist künstlich – sie fühlt sich flach und öde an, wie geschaffen für Menschen, die das wahre, laute Leben gänzlich ausblenden wollen. Das Haus meiner Großeltern sagt mir nur insofern etwas über seine Besitzer, als es absolut nichtssagend ist. Ein Haus für reiche Leute, denen Design völlig egal ist, Status und Sicherheit aber über alles geht. Lynn und Brian haben in dieser Anlage ein Haus gekauft? Dann kaufen wir eben ein größeres! So simpel ist das. Es gibt nicht den leisesten Hauch einer persönlichen Note oder irgendeinen Hinweis auf Aktivität – nur antiseptische Konformität. Als ich den Rückweg antrete, fühle ich mich leicht deprimiert. Ich teile die Hälfte meiner DNA mit diesen Menschen. Überkommt mich deshalb ebenfalls irgendwann ein Bedürfnis nach beigefarbenen Teppichen und einem Dienstmädchen, an dem ich meinen Frust auslassen kann? Gegen ein Dienstmädchen hätte ich prinzipiell nichts einzuwenden, aber diese Tristesse, die unweigerlich von ihnen ausgeht, empfände ich vermutlich als sehr bedrückend. Für Kathleen dürfte das ein Pluspunkt sein: ständig jemanden vor Augen zu haben, der noch miesepetriger ist als sie.
Von der Wohnanlage fahre ich zum Casino, die etwa dreißigminütige Strecke führt über eine ziemlich abenteuerliche Straße. Auf einer Seite fällt ein felsiger Hang steil ab in eine … Schlucht? Einen Canyon? Keine Ahnung. Wie ich schon sagte, bin ich an einer Hauptstraße aufgewachsen und hatte immer schon eine – wie ich finde – gesunde Abneigung gegen weite Landschaften. Die freie Natur überfordert mich, und zu Hause würde ich dreißig Minuten Autofahrt als Zumutung empfinden, ganz egal, wohin es geht. Hin und wieder überkommt mich das Verlangen nach einem kurzen Tête-à-Tête mit einem Mann (ja, ich spreche von Sex, das Stirnrunzeln können Sie sich schenken), oder ich verschwende meine Zeit mit stumpfsinnigen Dating-Apps. Bei Mackertypen, die vor einem BMW posieren, scrolle ich sofort weiter. Als wären teure Autos ein Indiz dafür, dass diese Kerle es »geschafft« haben, und kein klarer Hinweis darauf, dass sie dumm genug sind, Leasing für ein gutes Geschäft zu halten. Dennoch sind eine Protzkarre und ein T-Shirt mit V-Ausschnitt nicht zwangsläufig Ausschlusskriterien. Schließlich habe ich nicht vor, mit diesen Männern mein Leben zu verbringen. Sie sind mir nicht mal den Versuch wert, ihre Namen im Kopf zu behalten. Allerdings gibt es eine klare rote Linie. Wer mehr als ein paar Kilometer weit weg wohnt, hat keine Chance. Meine Stimmung schlägt schnell um, und ich warte nicht, bis jemand in King’s Cross umgestiegen ist oder mich per SMS informiert, dass er wegen Bauarbeiten auf der Strecke den Ersatzbus nehmen muss. Das spanische Hinterland ist für mich also eine fremde Welt und das steil abfallende Ding neben der Straße eine verdammte Schlucht. Es geht höllisch tief runter, und der Hang ist auch noch mit stacheligem Gestrüpp überwuchert. Auf der ganzen Strecke ist keine Menschenseele zu sehen. Perfekt. Die Sonne scheint, und der warme Fahrtwind streicht mir über den Arm im offenen Fenster. Ich schalte das Radio ein. Ein lokaler Sender spielt »God Only Knows« von den Beach Boys. Der Sound erfüllt den kleinen Mietwagen, während ich im Schneckentempo dem Casino entgegenkurve. Natürlich glaube ich nicht an Gott. Wir leben im Zeitalter der Wissenschaft, der Ära der Kardashians – gute Gründe, mich an den gesunden Menschenverstand zu halten. Ein ernst zu nehmender Gott, einer, der über echte Macht verfügt, hätte mich außerdem niemals mit diesen Leuten zusammengeführt und mir eine solche Berufung aufgebürdet. Kein Gott also. Trotzdem überkommt mich das Gefühl, als würde jemand mit einem Lächeln auf mich herabblicken.
Wo wir gerade bei Gott sind: Es gibt in der Bibel diese Geschichte … na gut, da moderne Technik darin eine gewisse Rolle spielt, stammt sie vermutlich nicht aus der Bibel. Zumindest nicht direkt. Eigentlich kenne ich sie aus einem Film. Sie geht ungefähr so: Ein Mann lebt viele Jahre glücklich und zufrieden in einem kleinen Häuschen, bis eines Tages jemand vom Katastrophenschutz bei ihm auftaucht und sagt: »Sir, ein Sturm zieht auf. Wir müssen Sie evakuieren.« Darauf erwidert der Mann: »Ich danke Ihnen, aber ich bin ein gläubiger Mensch und habe Gottvertrauen. Der Herr wird mir beistehen.« Der andere Mann geht wieder, und der Sturm zieht auf. Rund um das Haus steigt das Wasser, ein Schiff kommt vorbei. »Sir«, sagt der Kapitän, »kommen Sie mit uns, das Wasser wird weiter ansteigen.« Doch der Mann antwortet: »Ich danke Ihnen, aber ich bin ein gläubiger Mensch und habe Gottvertrauen. Der Herr wird mir beistehen.« Als sein Haus überflutet wird, muss der Mann aufs Dach klettern. Ein Hubschrauber kommt angeflogen. »Sir, klettern Sie diese Leiter hoch, wir können Sie in Sicherheit bringen.« Der Mann winkt ab. »Ich danke Ihnen, aber ich bin ein gläubiger Mensch und habe Gottvertrauen. Der Herr wird mir beistehen.« Später ertrinkt der Mann. Als er in den Himmel kommt und vor Gott steht, sagt er zu ihm: »Herr, ich war voller Gottvertrauen. Ich habe fest an dich geglaubt und treu zu dir gestanden. Warum hast du mich im Stich gelassen?« Gott sieht ihn verärgert an (warum auch nicht, schließlich war der Mann ein Idiot) und sagt: »David, ich habe dir den Katastrophenschutz, ein Boot und einen Hubschrauber geschickt. Was machst du hier?«
Mir hat jemand den dämlichen Muskelprotz Amir mit seinen PS-Monstern, eine gefährliche, kurvenreiche Straße und den glücklichen Umstand geschickt, dass meine Großeltern dort spätabends unterwegs sein werden. Im Gegensatz zu dem Volltrottel aus dem Gleichnis bin ich fest entschlossen, diese Chancen bestmöglich zu nutzen.
•
Mir bleiben etwas mehr als sechsunddreißig Stunden, um meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich könnte die Zeit dazu nutzen, meine Großeltern zu beschatten, um mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Aber ehrlich gesagt sind sie dafür einfach nicht interessant genug. Also verbringe ich den restlichen Nachmittag an einem Privatstrand auf einer Sonnenliege, trinke Rosé und lese ein Buch über eine Frau, die nach Jahren des Psychoterrors und des emotionalen Missbrauchs ihren Mann umbringt. Der Graf von Monte Christo war mir doch etwas zu heftig. Allerdings habe ich bis nach hinten durchgeblättert und einen Blick auf die letzten Seiten geworfen. Fraglos eine schlechte Angewohnheit, doch meine Schummelei wurde mit der folgenden Zeile belohnt: »Alle menschliche Weisheit liegt in den zwei Worten ›harren und hoffen‹.«
Harren und hoffen. Seit ich ein Teenager bin, lebe ich nach dieser Devise, und bald ist es endlich vorbei mit dem Harren. Ich lege die Hand auf meine heiße Brust, um zu fühlen, ob mein Herz schneller schlägt als gewöhnlich. Aber nein, mein Puls ist ganz normal. Ich atme so ruhig, als wäre heute ein Tag wie jeder andere und als stünde ich nicht im Begriff, ein schreckliches Verbrechen zu begehen. Seltsam. In Gedanken gehe ich immer wieder den Plan durch. Ich stehe vor lauter Erwartung so unter Dampf, dass er mir eigentlich aus den Ohren schießen müsste. Trotzdem liege ich hier, getarnt mit einer dunklen Brille, und mein Herz verrät mich nicht, indem es mir aus der Brust springt. Mein Körper ist bereit, auch wenn sich mein Hirn verhält wie ein Teenager vor dem ersten Date.
Später am Abend, bevor ich zu Bett gehe, schicke ich Amir eine Textnachricht von meinem neu erworbenen Wegwerfhandy. Eines dieser Telefone, die man laut Edward Snowden kauft, wenn man nicht geortet werden will. In meinem Fall ist das vielleicht ein wenig übertrieben, schließlich kenne ich keine Staatsgeheimnisse. Dennoch habe ich den Tipp dankbar angenommen: Ein zwanzigminütiger Ausflug in einen weniger gepflegten Stadtteil Londons und sechzig Pfund bar auf die Hand brachten mir dieses altmodische Klapphandy ein, auf das ich mir an Ort und Stelle ausreichendes Guthaben geladen habe, um damit auch Textnachrichten zu verschicken. Obwohl es sich als überaus nützlich erweist, wird es nicht mit nach England zurückkehren. Ich frage Amir, ob er morgen in der Gegend ist und mir für ein paar Tage ein Auto organisieren kann. Ich begründe meine Bitte damit, dass ich am Abend aufs Land rausfahren und mich mit einem größeren Fahrzeug einfach sicherer fühlen würde, was auf gewisse Weise ja auch stimmt. Die überzeugendsten Lügen enthalten immer ein Körnchen Wahrheit. Das macht es einem leichter, bei seiner Story zu bleiben und sich nicht in Widersprüche zu verstricken. Mein Freund Jimmy ist ein ganz schlechter Lügner. Man sieht es ihm sofort im Gesicht an. Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem Feixen, wenn er schwindelt. Das ist irgendwie liebenswert, macht es aber unmöglich, ihm etwas anzuvertrauen. Denn darauf angesprochen, würde er sofort auffliegen.
Nach dem Aufwachen werfe ich als Erstes einen Blick aufs Telefon. Wie vermutet hat Amir in den frühen Morgenstunden geantwortet. Sieht nach einer langen Nacht im Glitter aus. Ich schreibe sofort zurück, bedanke mich für seine erneute Einladung zu einem gemeinsamen Klubabend und lehne sie dann mit der Begründung ab, dass ich bereits am Nachmittag aufbrechen müsse. Mir ist klar, dass ich nicht mit einer simplen Schlüsselübergabe davonkommen werde, also schlage ich ihm vor, dass wir uns um vierzehn Uhr vor einer Eisdiele an der Calle Ribera treffen. Da er beim Feiern sicher literweise Champagner getrunken hat, werde ich wohl frühestens am Mittag von ihm hören, also springe ich unter die Dusche und schlüpfe dann in ein leichtes Sommerkleid, das mich für Amirs Geschmack hoffentlich ein wenig zu unscheinbar wirken lässt. Zumindest kommt es völlig ohne Stretch und Glitzerkram aus. Verglichen mit solchen Fummeln, wie sie die hiesige Damenwelt bevorzugt, ist es also praktisch ein Blaumann. In meiner kurzen Zeit in Marbella habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Kombination von Pailletten, Goldknöpfen und Animalprint hier eine Art inoffizielle Uniform ist. Das und natürlich diese aufgepumpten Schlauchbootlippen, mit denen die Frauen aussehen, als hätten sie eine heftige allergische Reaktion auf den Iced Coffee, an dem beim Sonnenbaden alle nuckeln.
Obwohl ich die Ferienwohnung bis Samstag gemietet habe, rechne ich nicht damit zurückzukommen. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich kann mir in diesem entscheidenden Moment einfach keine Zweifel erlauben. Ich räume auf, stecke die Bettwäsche in die Waschmaschine und wische sämtliche Oberflächen ab. Ich packe meine kleine Reisetasche und lege mir dann alles zurecht, was ich für den Rest des Tages benötigen werde. In meine Gucci-Umhängetasche, die ich mir zum Start meines neuen Jobs geleistet habe und mit der ich vermutlich sogar bei den Ladys in Marbella Eindruck schinden könnte, packe ich mein Wegwerfhandy, Bargeld, die Perücke, ein Paar Segeltuchschuhe, eine Taschenlampe, Gummihandschuhe, ein Parfümfläschchen mit Flüssigkeit und eine Schachtel Streichhölzer. Alles andere – auch mein richtiges Handy, der Reisepass und die Kreditkarten – wandert in die Reisetasche.
Ich schließe die Wohnungstür ab und stecke den Schlüssel ein – man kann ja nie wissen. In einem Anflug von Paranoia wische ich mit dem Ärmel über den Türknauf. Schlagartig wird mir klar, dass ich noch immer zu nachlässig bin – das muss sich ändern. Wenn ich das durchziehen will, ohne geschnappt zu werden, dann reicht es nicht aus, mal eben halbherzig über die Oberflächen zu wischen. Okay, betrachten wir das einfach als einen Testballon. Das Auto parkt gut dreißig Minuten entfernt, in sicherer Entfernung vom Rummel der Hauptstraße. Ein gebührenpflichtiger Parkplatz wäre nicht infrage gekommen, da man dort womöglich das Nummernschild des Wagens erfasst hätte, und näher an der Wohnung gab es kaum Stellplätze, an denen nicht die Gefahr bestand, abgeschleppt zu werden.
Schon jetzt ist es brütend heiß, der Schweiß läuft mir über die Brust in den BH. Ich verstaue die Reisetasche unter dem Fahrersitz und prüfe von allen Seiten, ob sie auch wirklich nicht zu sehen ist. Dann laufe ich zurück in die Stadt. Ich biege aus Versehen falsch ab und lande am Meer. Nachdem ich ein paar Stunden lang die Zeit in einem Café totgeschlagen habe, wo eine Tasse Kaffee fünf Euro kostet, kommt endlich eine Textmessage von Amir: Hi bb, muss noch 1 bisschen chillen nach letzter Nacht. Du hast krass was verpasst! Um 3 gehts im Klub Oceania weiter. Komm doch um 4 auf 1 Drink vorbei, dann kriegst du 1 Karre von mir! :)
Seine Antwort lässt mich fast einen Rückzieher machen. Ich kann mich nicht mit einem Menschen abgeben, der offenbar nicht imstande ist, die elementarsten Regeln der Rechtschreibung zu berücksichtigen. Das ist einfach schlechter Stil und impliziert zudem ein Maß an Ignoranz, das bei einem Teenager vielleicht entschuldbar, bei einem Erwachsenen aber einfach haarsträubend ist. Mit mangelnder Bildung lässt sich nicht alles entschuldigen. Meine Schule war weit davon entfernt, ein zweites Hogwarts zu sein, doch ich habe trotzdem die Zeit gefunden, den Unterschied zwischen Ziffern und Lettern zu lernen. Amir augenscheinlich nicht. Ich frage mich nicht zum ersten Mal, womit er eigentlich so viel Geld verdient – ganz koscher ist es vermutlich nicht. Aber wer bin ich, anderen Leuten moralische Vorhaltungen zu machen? Ich überlege kurz, meinen kleinen Mietwagen zu nehmen, entscheide mich dann allerdings dafür, auf Amirs Angebot einzugehen. Ich muss mich bloß zusammenreißen, darf mich nicht auf alkoholische Getränke einladen lassen und sollte abhauen, sobald ich die Autoschlüssel habe. Puh. In einer Angelegenheit, die eigentlich von mir und mir ganz alleine erledigt werden sollte, auf die Hilfe eines Mannes (noch dazu eines Mannes, der Panorama-Sonnenbrillen trägt) angewiesen zu sein, widerstrebt mir zutiefst, aber ich muss realistisch bleiben. Außerdem springt für Amir dabei nichts raus. Wenn alles nach Plan läuft, ist er danach genauso klug wie zuvor. Geht es in die Hose, hat er höllische Probleme am Hals. Das hebt meine Laune, und ich trinke den Kaffee aus.
Kurz vor fünfzehn Uhr treffe ich am Klub Oceania ein. Der Laden ist riesengroß. Ein Palast der geistlosen Frivolität. Aber eigentlich ist er nur eine aufgemotzte Bar, eine Riesenkneipe auf Anabolika. Die Zufahrt steht voller Sportwagen in schreienden Farben, die einer nach dem anderen von gehetzt aussehenden Parkservice-Mitarbeitern in weißen Jacketts abgefertigt werden. Den Eingang blockiert ein Rolls-Royce mit dem Nummernschild »BO55 BO1«. Ich warte am Empfang, während die Rezeptionistin, für deren tiefe Bräune mindestens zwei Sonnen nötig waren, im breitesten Slang telefoniert. Ich nehme an, dass meine Sandalen ohne Absätze und mein braunes Haar ohne Extensions in ihren Augen nicht gerade »Hier!« schreien, doch schließlich erbarmt sie sich meiner. Ich trage roten Lippenstift, wie ich ihn immer trage, wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte so etwas wie einen Schutzschild, abgesehen davon halte ich es eher schlicht. Ich mag es schlicht. Ich habe ein recht hübsches Gesicht und empfinde es nicht als arrogant, das auch zu sagen. Wenn Frauen mal über die Lippen kommt, dass sie sich für attraktiv halten, rudern die meisten sofort wieder zurück, weil ihnen die Männer immer schon vorhalten, dass sie zu sehr von sich eingenommen sind. Seien Sie immer so schön, wie Sie können, aber achten Sie darauf, dass es niemals aussieht, als hätte Ihre Schönheit Sie Zeit und Mühe gekostet. Vor allem: Verlieren Sie niemals ein Wort darüber. Und nehmen Sie Reißaus, wenn Ihnen ein Mann unterstellt, Sie wüssten vermutlich gar nicht, wie schön Sie sind. Das ist nämlich genau der Typ Mann, der von Ihnen erwartet, ständig Lust auf Sex zu haben, aber keinen Finger krumm macht, damit Sie dabei auf Ihre Kosten kommen. Ich sehe ganz gut aus. Ich bin nicht groß, aber schlank und wohlproportioniert. Dunkles Haar, gleichmäßige Gesichtszüge, schöne volle Lippen, aber kein übertriebener Schmollmund. Obwohl ich mich gerne im Spiegel betrachte, bin ich nicht davon besessen. Ich weiß, dass mein Aussehen mir häufig zum Vorteil gereicht. Doch ich bin nicht meine Mutter, die sich zu sehr auf ihre Schönheit verlassen hat und dann achtlos fallen gelassen wurde, als diese nicht mehr genug war. Im Vergleich mit den aufgeplusterten Hühnern, die hier wie die Pfauen umherstolzieren, muss ich für die Männer in Marbella eine herbe Enttäuschung sein.
Coco Chanel hat mal gesagt, dass eine Frau, bevor sie aus dem Haus geht, eines ihrer Accessoires ablegen sollte. Eher würden diese Weiber mit ihren Acrylnägeln der guten alten Coco die Augen auskratzen.
Ich informiere Fräulein Solarium, dass ich mit Amir verabredet bin, der augenscheinlich ein geschätzter Kunde ist, denn bei der Erwähnung seines Namens zeigt ihr Gesicht tatsächlich so etwas wie eine Regung. Sie führt mich durch marmorverkleidete Korridore und vorbei an einem Bibliothekszimmer, das mit Buchattrappen und Dingen vollgestopft ist, die zwar alt aussehen, aber hundertprozentig Dutzendware von einem Großhändler sind, der diesen Schrott an Leute verramscht, die einen Antik-Look haben wollen, sich für die Herkunft der Stücke jedoch kein bisschen interessieren.
Wir treten hinaus ins grelle Sonnenlicht und befinden uns in einer Art Freizeitpark für Erwachsene. Es gibt mehrere miteinander verbundene Pools, alle mit einer Bar in der Mitte, wo die Badenden unter Strohschirmen Cocktails schlürfen. Laute House-Musik schallt über das Gelände. Zwischen den Strandliegen eilen Kellner umher und servieren Getränke. Manche Gäste lümmeln rauchend und quatschend auf großen Betten mit Baldachinen herum. Kein Mensch hat mehr als seine Badeklamotten am Leib – abgesehen von mir, und ich habe nicht vor, es ihnen gleichzutun. Ungläubig fällt mein Blick auf ein Bauchkettchen: Wem der Platz ausgeht, um Edelmetall und Diamanten zur Schau zu stellen, der hängt sich das Zeug halt um die Taille. Das ist dann wohl wahres Hüftgold. Coco Chanel würde sich im Grabe umdrehen.
»Mr. Amir ist noch nicht hier. Machen Sie es sich doch bequem und trinken Sie etwas.« Ich werde regelrecht auf die Sonnenliege gedrückt, wo ich wie auf dem Präsentierteller hocke. In der Hoffnung, dass Amir es für einen Longdrink hält, bestelle ich ein Tonic Water und warte. Mein neuer Freund ist nur vierzig Minuten zu spät. Die verbringe ich damit zu beobachten, wie die sonnengebräunten Mädels ihre ohnehin schon winzigen Bikinis runterschieben, um noch mehr Sonne abzukriegen, während sie die Kerle anhimmeln, die mit rasierter Brust und Minigürteltaschen vor ihnen herumgockeln – offenbar vor allem, um ihre Geschlechtsgenossen zu beeindrucken.
Schließlich erspähe ich Amir, der durch die Reihen der Liegen auf mich zukommt. In seinen neonorangefarbenen Shorts ist er schwer zu übersehen und umgeben von einer Entourage an Typen, die allesamt aussehen, als hätten sie im Leben ein Ziel: ihren Anführer bestmöglich zu kopieren. Von allen Seiten schwärmen Kellner herbei und bringen Handtücher, Gläser, Eiskübel und bizarrerweise eine Kokosnuss.
Amir bleibt vor meiner Liege stehen und starrt über die Ränder seiner Sonnenbrille hinweg zu mir hinunter. »Hallo, meine Schöne! Darf ich bekannt machen: Das sind Stevie, JJ, Fettwanst, Cooper und Nige.« Mit einer ausladenden Handbewegung deutet er auf seine Kumpels, die mir unmotiviert zunicken und sich nur für die Bikinischönheiten nebenan interessieren. Ich frage mich, womit »Fettwanst« den fiesen Spitznamen verdient hat – sein Körperfettanteil bewegt sich allenfalls im einstelligen Prozentbereich. Ich sehe nichts als Muskeln. Mehr Muskeln, als sie einem Menschen zustehen, der keiner schweren körperlichen Arbeit nachgeht. Und ich wage zu bezweifeln, dass Fettwanst überhaupt jemals arbeitet.
Amir schnappt sich die Kokosnuss und wirft sie dem Kerl zu, den er als Nige vorgestellt hat. Unter den Anfeuerungsrufen seiner Kumpels schlägt Nige sie sich gegen die Stirn. Mit dem Ergebnis offenbar nicht zufrieden, wiederholt er das Spektakel, und diesmal bricht die Kokosnuss auseinander. Er steigt auf eine Sonnenliege, und unter dem lautstarken Jubel der Bikinischönheiten und Muskelprotze reckt er beide Hälften in die Luft.
»Sein bester Trick«, erklärt Amir stolz. »Er hat acht Jahre lang jeden Sommer geübt, bis er das draufhatte. Wir wollen, dass er damit in dieser Talentshow mit den zaubernden Hunden auftritt.« Bei der Vorstellung, den ganzen Nachmittag an einem vermutlich mit Öl, Bräunungsmittel und Zigarettenasche verdreckten Pool zu verbringen und diesen Leuten bei ihren Brunftritualen zuzuschauen, verspüre ich einen leichten Anflug von Panik. Ich muss meine Mission durchziehen und darf nicht zulassen, dass Amir meinen Zeitplan durcheinanderbringt.
Mit frisch erstarkter Entschlossenheit greife ich nach seinem Handgelenk und nötige ihn, mir seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. »Tut mir echt leid, aber ihr seid ein bisschen spät dran, und mir bleibt nur noch eine Stunde, bevor ich weitermuss. Hast du den Wagen mitgebracht?«
Er starrt mich eine knappe Minute lang an, dann wirft er den Kopf in den Nacken und lacht. Seine muskelbepackte Entourage fällt sofort in Amirs Schnauben mit ein, obwohl sie eindeutig zu weit entfernt steht, um überhaupt hören zu können, was er gesagt hat. Wer die Drinks bezahlt, verfügt offenbar rund um die Uhr über ein Heer von Jubelpersern.
»Kleines, ich weiß ja nicht mal deinen Namen! Komm mal schnell wieder runter. Ich hab ’ne Karre für dich hier, aber lass uns erst mal ’ne Runde chillaxen und Fun haben, okay?« Bei diesem Blödsinn schüttelt es mich innerlich. Reflexhaft lasse ich meine Schultern hängen, reiße mich jedoch sofort wieder zusammen.
»Ich heiße Amy«, erwidere ich lächelnd, »und fürs Chillaxen bin ich immer zu haben.«
Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, aber einfach ist das nicht: Am Ende verbringe ich fast zwei Stunden mit Amir und seinem weiter anwachsenden Hofstaat, dessen Mitglieder mit Champagner herumspritzen, Mädchen anbaggern und den DJ ein ums andere Mal auffordern, die Musik lauter zu machen. Amirs Aufmerksamkeitsspanne ist beschränkt, und das ist sehr zurückhaltend formuliert. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als geduldig zu warten, während er alle paar Minuten aufspringt – häufig bloß, um lauthals »Meganummer!« zu brüllen – und sich wieder hinsetzt.