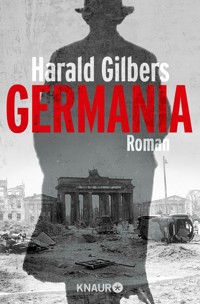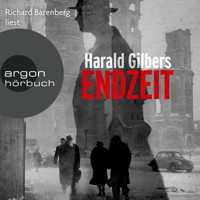9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Hungerwinter, Nazi-Schleuser und ein scheinbarer Fall von Notwehr: Der 5. historische Krimi mit dem jüdischen Kommissar Oppenheimer spielt 1947 in Berlin zu Beginn des Kalten Krieges. 1947 wird Kommissar Oppenheimer mitten im Berliner Winter zum Schauplatz eines Verbrechens gerufen. Anscheinend gibt es nicht viel zu ermitteln: Der Tote ist ein Einbrecher, der vom Hausherrn überrascht wurde. Notwehr. Doch Oppenheimer hat Zweifel am Tathergang, die sich schnell bestätigen. Als kurz darauf sein Kollege Billhardt spurlos verschwindet, wird Oppenheimer bewusst, in welches Labyrinth aus Verrat und Täuschung er sich vorgewagt hat. Und die Verschwörung reicht bis in die Reihen der Kripo … Mit seiner historischen Krimi-Reihe um den jüdischen Kommissar Oppenheimer zeichnet der Historiker Harald Gilbers ein packend-realistisches Bild der 40er Jahre in Berlin. Kriegswirren und Bombennächte, der Zusammenbruch des NS-Reiches, Hungerwinter und das Tauziehen der alliierten Siegermächte um Berlin im Kalten Krieg werden atmosphärisch so dicht beschrieben, »dass der Leser sich geradezu im zerbombten Berlin […] wähnt.« BR 5 Aktuell Für den ersten Band der Krimi-Reihe wurde Harald Gilbers mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Die historischen Krimis um Kommissar Oppenheimer sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Germania« (1944) - »Odins Söhne« (1945) - »Endzeit« (1945) - »Totenliste« (1946) - »Hungerwinter« (1947)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Harald Gilbers
Hungerwinter
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1947 wird Kommissar Oppenheimer mitten im Berliner Hungerwinter zum Schauplatz eines Verbrechens gerufen, bei dem es eigentlich nicht viel zu ermitteln gibt: Der Tote ist ein Einbrecher, der vom Hausherren überrascht wurde. Ein klarer Fall von Notwehr? Oppenheimer hat Zweifel – die sich bestätigen, als in der Unterkunft des Toten ein Pass gefunden wird, der auf denselben Namen lautet wie der des Täters.
Als kurz darauf Oppenheimers Kollege Billhardt tot aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf Selbstmord hin, doch auch das kommt dem Kommissar unwahrscheinlich vor. Er kann nicht ahnen, dass er einem Nazi-Schleuserring in der Quere gekommen ist, der ehemalige SS-Mitglieder mithilfe des Vatikans auf der sogenannten »Rattenlinie« nach Argentinien schmuggelt. Noch immer haben die Nazis Unterstützer in mächtigen Positionen – auch im Berliner Polizeidienst …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Nachwort
Literaturhinweise
1
Donnerstag, 6. November 1947 – Freitag, 7. November 1947
Nichts war kälter als der Tod. Bei diesem Gedanken zog Ursula die Strickjacke um sich zusammen. In den Kriegsjahren war sie im Krankenhausdienst häufig Zeugin davon geworden, wie ein Mensch starb. Die letzten Zuckungen, das Entweichen der Luft aus der Lunge, das die Stimmbänder aktivierte und deshalb wie ein Seufzer klang, das allmähliche Erkalten des Körpers – das alles war nicht neu für sie. Bislang war das lediglich Fremden geschehen, während Ursula ihrem Beruf nachging.
Seit wenigen Minuten existierte diese unsichtbare Grenze nicht mehr. Denn jetzt hatte sich in ihrer eigenen Wohnung ein jäher Gewaltausbruch zugetragen. Fassungslos starrte Ursula auf das Schauspiel im Wohnzimmer. Da sie keinen Balkon besaß, hatte sie quer im Raum dünne Seile aufgespannt, um über Nacht die Kochwäsche zu trocknen. Ein weißer Himmel aus feuchten Bettlaken, darunter eine heruntergerissene Leine mit einem zusammengeknüllten Laken. Und genau vor ihren Füßen lag im Licht der nackten Glühbirne eine gekrümmte Leiche.
Ursulas Atem ging immer noch stoßweise. Was war nur mit Konrad, ihrem Mann, geschehen? Wie hatte es so weit kommen können?
»Es wird alles wieder gut«, flehte die Männerstimme.
Das Entsetzen über die Geschehnisse war so groß, dass sie erst mit einiger Verspätung den Sinn des Gesagten verstand.
Sicher, er wollte sie beruhigen. Nur passten die Worte nicht zu dem blutverschmierten Messer in seiner Hand. Seine aschblonden Haare waren zerzaust, das Gesicht war so stark gerötet, dass er förmlich zu glühen schien. Der Mann, von dem sie geglaubt hatte, dass er ihr Seelenverwandter war, kam Ursula unvermittelt wie ein Fremder vor.
Plötzlich hörte sie etwas hinter ihrem Rücken. Feste Schläge gegen massives Holz. Jemand hämmerte an ihre Wohnungstür. Jemand wollte herein.
»Is alles in Ordnung bei euch?«, fragte eine dumpfe Stimme im Treppenhaus.
Ursula dachte daran, wie verfänglich ihre Situation war. Falls der Nachbar sie beide zusammen mit dem Toten entdeckte, würde er die falschen Schlüsse ziehen und einen kaltblütigen Mord vermuten. Das durfte nicht geschehen. Wenn die Leute erst einmal damit anfingen, indiskrete Fragen zu stellen und sich das Maul zu zerreißen, dann wäre es schnell vorbei. Ihr Leben in Geborgenheit, das Ursula doch gerade erst kennengelernt hatte.
Fest entschlossen, das nicht zuzulassen, hastete sie durch die dunkle Diele und lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Tür. Vielleicht ließ sich das Unheil ja aufhalten, wenn sie ihm den Zugang verwehrte.
Ihr Liebster trat an sie heran und zischte: »Ich habe schon abgeschlossen, sicher ist sicher.« Dann richtete er seine stahlgrauen Augen auf Ursula.
»Wir haben nicht viel Zeit. Wirst du mir helfen?«
»Das weißt du doch«, antwortete sie mit tonloser Stimme.
Oppenheimer musste täglich vom britisch besetzten Schöneberg in den sowjetischen Teil der Stadt pendeln, da sich seine Dienststelle in der Nähe des alten Polizeipräsidiums am Alexanderplatz befand. Noch in den letzten Kriegsmonaten war die Respekt einflößende Zentrale durch Bomben fast vollständig zerstört worden, und die derzeit laufenden Renovierungsarbeiten kamen derart schleppend voran, dass sich Oppenheimer keine Illusionen mehr machte. Er glaubte nicht daran, dass er in seiner Funktion als Mordkommissar jemals wieder einen Schritt in den weitläufigen Bürotrakt der sogenannten roten Burg setzen würde.
Mittlerweile waren die Verwaltung und die Dienststellen auseinandergerissen. Das offizielle Polizeipräsidium befand sich jetzt in der Nähe des Rosenthaler Platzes und damit ebenfalls im sowjetischen Sektor, dort beschäftigte man sich aber hauptsächlich mit der Verwaltung des Polizeiapparates. Oppenheimer gehörte zu den Fachkräften, die in einem ehemaligen Lagergebäude des Karstadt-Konzerns untergekommen waren. Es war ein großer Gebäudekoloss, der zwischen der Keibel- und der Neuen Königsstraße lag, sich für die Zwecke des Warenhausinhabers als viel zu weitläufig herausgestellt hatte und deshalb an das Reichsfinanzministerium verkauft worden war. Erst einige Monate nach seinem Arbeitsantritt war Oppenheimer auf die Tatsache aufmerksam geworden, dass in den Büros nach 1936 das Statistische Reichsamt untergebracht war, das unter anderem für Hitlers Regierung die Judenzählungen durchgeführt hatte. Zweifelsohne waren auch seine Daten hier gelandet. Man hatte die Unterlagen hier verarbeitet, sortiert, und in einem dieser anonymen Büros hatte jemand über Oppenheimers Schicksal entschieden. Und jetzt bewegte er sich frei durch das Gebäude, war sogar wieder eine Respektsperson. Manchmal konnte er es selbst nicht glauben.
An diesem Abend war er beim Mordbereitschaftsdienst zur Nachtschicht eingeteilt. Und bis zum ersten Einsatz sollte es nicht lange dauern. Viertel nach ein Uhr in der Nacht wurde er von Kriminalanwärter Wenzel aus dem Dämmerschlaf gerissen, weil sie in den Stadtbezirk Treptow mussten. Bereits wenige Minuten später saß Oppenheimer auf dem Beifahrersitz des Dienstfahrzeugs und starrte auf die nächtlichen Straßen. Er schätzte, dass es jetzt gegen halb zwei war. Eine funktionierende Armbanduhr war immer noch eine Rarität, und die Schwarzmarktpreise erreichten schwindelerregende Höhen, die sich Oppenheimer mit seinem mageren Gehalt beim besten Willen nicht leisten konnte.
Die Wischer ihres Autos kratzten über die Windschutzscheibe. Jedes Mal, wenn auch nur ein einzelner Tropfen auf das Glas fiel, schaltete Wenzel diese verdammten Scheibenwischer an, sodass sich einzelne Schlieren über die Scheibe zogen.
Um zu ihrem Ziel, einem Wohnblock an der Köpenicker Landstraße, zu kommen, mussten sie die Spree überqueren. Das ging am besten auf der Schillingbrücke. Trotz Hitlers Befehl, beim Anrücken des Feindes strategisch wichtige Infrastruktur zu zerstören, war sie in der Endphase nicht gesprengt worden.
Auf dem Weg zu ihrem Einsatz durchquerten sie am südlichen Spreeufer auf knapp zwei Kilometern den amerikanischen Sektor. Als am Straßenrand das weiße Schild an ihnen vorbeizischte, auf dem in schwarzen Buchstaben stand, dass sie den sowjetischen Einflussbereich verließen, spürte Oppenheimer eine gewisse Erleichterung. Die währte jedoch nicht lange, denn bereits wenige Minuten später erschien im Scheinwerferlicht ein weiteres Schild, und sie tauchten wieder in den Ostsektor ein.
Und schon wurde Oppenheimer erneut von der altbekannten Beklemmung erfasst.
Tagtäglich pendelten unzählige Berliner zwischen den Besatzungszonen hin und her, ohne sich dabei etwas zu denken. Ähnlich wie Oppenheimer gingen sie im benachbarten Sektor zur Arbeit oder besuchten die mittlerweile enttrümmerten Flaniermeilen der Innenstadt. Die Grenzen der Einflusssphären waren praktisch unsichtbar. Man konnte beinahe ein friedliches Miteinander der Besatzungsmächte vermuten.
Für die Bewohner der westlichen Sektoren, zu denen auch Oppenheimer zählte, war der Ostteil der Stadt jedoch zunehmend ein weißer Fleck auf der Karte. Wenn es sich vermeiden ließ, zog man es vor, nicht in den sowjetischen Teil zu fahren. Denn in den letzten Monaten hatte sich herumgesprochen, dass Menschen dort spurlos zu verschwinden pflegten.
Die Gerüchteküche brodelte, und die Zeitungsberichte der westlich orientierten Presse taten ihr Übriges. Die Leute sprachen von illegalen Verhaftungen und generalstabsmäßig geplanten Entführungen. Und neben allen Übertreibungen und Zuspitzungen gab es die harten Zahlen. So hatte die Berliner SPD-Fraktion ausgerechnet, dass bisher mehr als fünftausend Personen verschwunden waren. Dass ein derart großer Anteil der Stadtbewohner als vermisst galt, war auch das Thema, das in der Stadtverordnetenversammlung zurzeit die größten Kontroversen auslöste. Doch außer hitzigen Reden war bislang nicht viel geschehen. Die Abgeordneten der kommunistischen Einheitspartei SED unterstützten in dieser Sache demonstrativ den Polizeipräsidenten Markgraf. Ihm wurde vorgeworfen, nichts gegen die Massenverschleppungen zu unternehmen. Da Markgraf die Führung der Polizei mit dem Segen der Sowjetischen Militäradministration übernommen hatte, war es nicht verwunderlich, dass er keine großen Anstrengungen unternahm, die Vermisstenfälle aufzuklären.
»Wir sind gleich da«, sagte Wenzel und stieß dabei einen Schwall blauen Zigarettenrauchs aus. Oppenheimer brummte zustimmend. Immer noch ein wenig schläfrig, lehnte er den Kopf nach hinten und ließ die Häuserzeilen an sich vorbeitreiben. Vielleicht konnte er auf den letzten hundert Metern ja noch ein wenig Kraft tanken. Es hieß, dass die Leute mit zunehmendem Alter immer weniger Schlaf benötigten. Oppenheimer musste da wohl eine Ausnahme sein. Er war jetzt Ende vierzig und benötigte mehr Ruhepausen als je zuvor. Wenzel machte es mit seinen dreißig Lenzen hingegen nicht viel aus, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und doch sah er älter aus, als er war. Die Haut war genauso grau wie die Asche seiner gerauchten Zigaretten. Die Kriegserlebnisse und die Mangelernährung hatten Wenzel tiefe Furchen ins Gesicht gegraben. Wie immer klebte eine brennende Zigarette in seinem Mundwinkel.
Oppenheimer wunderte sich, dass so viele Leute rauchten. Irritierenderweise schienen jetzt sogar noch mehr Berliner dem Tabakkonsum zu frönen als früher, und das, obwohl die Rauchwaren mittlerweile schier unbezahlbar waren. Die offiziellen Zuteilungen waren denkbar bescheiden. Ein erwachsener Mann bekam pro Monat zwölf Zigaretten zugebilligt, Frauen sogar nur die Hälfte. Wenzel hätte mit seiner mageren Ration nicht einmal einen halben Tag überstanden.
Wenzels flatternde Kleidung ließ erahnen, dass er spindeldürr war. Vermutlich teilte er das schwere Los der Vielraucher, die den Großteil der Lebensmittelmarken auf dem Schwarzmarkt für Zigaretten eintauschten, sodass nicht mehr viel zum Essen übrig blieb. Auch er versuchte, sich mit dem Trick über Wasser zu halten, nur die russische Zigarettenmarke Drug zu rauchen, die mit zwei Mark pro Glimmstängel sogar noch um zwei Drittel billiger war als die illegal importierten US-Zigaretten, die über Polen den Weg auf Berlins Schwarzmarkt fanden. Oppenheimer gefiel es, dass diese Zigaretten nach dem russischen Wort für Freund benannt worden waren. Wesentlich besser roch das Kraut dadurch leider nicht.
Trotz des verhärmten Aussehens hatte er Wenzel in den letzten Monaten als zuverlässigen Assistenten schätzen gelernt, denn er besaß eine schnelle Auffassungsgabe. Auf den äußeren Eindruck konnte man sich in diesen Zeiten sowieso nicht verlassen. Oppenheimer machte sich nichts vor, vermutlich sah er ebenso mitgenommen aus wie Wenzel. Obwohl er seine Lebensmittelmarken nicht für Zigaretten vergeudete, kam er mit seinen Rationen nicht aus. Die Zuteilungen waren, wie das Sprichwort besagte, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.
Hinter dem Treptower Park verlangsamte Wenzel die Geschwindigkeit. Auf Oppenheimers Seite zeigte sich ein dreigeschossiger Wohnblock. Die gelben Bogenlampen erhellten nur die unteren Stockwerke, der Rest verlor sich in der Dunkelheit des Nachthimmels.
Ehe Oppenheimer ausstieg und sich der feuchten Nachtkälte aussetzte, schlug er den Mantelkragen hoch. Er lief das Rasenbeet entlang bis zu einem niedrigen Backsteinsockel, auf dem eine Steinskulptur thronte – ein Vater mit drei Kindern. Amüsiert registrierte Oppenheimer, dass bei dieser archetypischen Darstellung der heilen Familie ausgerechnet eine Ziege als Haustier abgebildet war. Hinter der Skulptur verlief ein breiter Weg zu drei großen Arkaden, die in den Hinterhof führten. Etwas weiter links davon befand sich der Hauseingang.
Im erhellten Treppenhaus drängelte sich ein halbes Dutzend Anwohner vor einer Wohnungstür. Ein Schutzpolizist mit glänzendem schwarzem Tschako auf dem Kopf versuchte, die Schar heftig gestikulierend fernzuhalten. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der junge Schupo trotz seiner beeindruckenden Größe von fast zwei Metern hoffnungslos überfordert. Oppenheimer fragte sich, wo man für einen solchen Riesen eine passende graublaue Uniform aufgetrieben hatte. Statt einer umständlichen Erklärung reckte er dem Polizisten seine Kripomarke entgegen. Der Schupo stutzte kurz, dann blitzte in seinen Augen etwas auf. Auch Oppenheimer hatte den Eindruck, dass er dem baumlangen Polizisten früher schon einmal begegnet war, aber es ging alles so schnell, dass er nicht dazu kam, sich an die genauen Umstände zu erinnern. Als der Schupo ihn und Wenzel in die Wohnung durchwinkte, war diese kurze Irritation wieder vergessen. In seinen Gedanken war Oppenheimer schon mit dem Fall beschäftigt, der ihn hier erwartete.
Von der Diele aus konnte man die komplette Wohnung überblicken. Und es gab nicht gerade viel zu sehen. Links und rechts an den Schmalseiten der Diele führten Türen zur Küche und zum Bad. Gegenüber der Wohnungstür lag das Schlafzimmer, und gleich daneben befand sich das Wohnzimmer, in dem einige Personen versammelt waren.
Aufmerksam betrat Oppenheimer den Raum. Seine Mattigkeit war wie weggeblasen, denn er wusste, wie wichtig der erste Eindruck von dem Fundort einer Leiche war. Neben der Zimmertür bewachte ein Schupo zwei verschreckte Gestalten. Eine Frau stand händeringend vor dem einzigen Sofa. Auf dem Sitzmöbel lag ein Mann mit entblößtem Oberkörper und gab Schmerzenslaute von sich. Ein älterer Herr mit einem grauen Schnauzer verarztete gerade dessen blutende Wunde.
Als der Arzt Oppenheimers Schritte hörte, wandte er sich kurz um und knurrte: »Ist diese vermaledeite Ambulanz endlich da?«
»Noch nicht«, antwortete Oppenheimer. Da er den Arzt nicht einordnen konnte, flüsterte er dem Schupo zu: »Das ist wohl nicht der Rechtsmediziner?«
»Ein Arzt von nebenan«, antwortete der Polizist. »Die Nachbarn haben ihn geholt.«
Oppenheimer nickte und näherte sich dem anderen Mann, für den jegliche ärztliche Hilfe zu spät kam.
Der Tote lag seitlich auf einem heruntergerissenen Bettlaken. Der Stoff war blutrot verfärbt. Der Mann war mit einer alten Uniform bekleidet. An einigen Stellen ragten abgerissene Fäden aus dem Stoff, die letzten Spuren der militärischen, jetzt verbotenen Abzeichen, die offensichtlich entfernt worden waren.
»Was ist denn vorgefallen?«, fragte Oppenheimer mit gesenkter Stimme.
Der Schupo nickte zu dem verwundeten Mann auf dem Sofa. »Das dort ist Herr Hinze. Seine Frau behauptet, dass sie einen Einbrecher überrascht haben. Er war mit einem Messer bewaffnet. In die Enge gedrängt, stürzte er sich auf Herrn Hinze. Bei der Rangelei wurde der Ehegatte schwer verletzt und der Einbrecher tödlich getroffen.«
»Also Notwehr?«, schaltete sich Wenzel ein.
Der Polizist nickte. »Alles deutet darauf hin. Die Nachbarn haben die Auseinandersetzung gehört. Ich war gerade mit einem Kollegen auf Fahrradstreife unterwegs. In der Eichbuschallee hörten wir eine Signalpfeife. Wir sind nur wenige Minuten nach der Tat eingetroffen.«
Oppenheimer stutzte. »Wer hat denn da gepfiffen? Etwa ein anderer Schupo?«
»Nein, nein. Es war ein Hausbewohner. Im Hinterhof befinden sich Gemüsebeete. Die Pfeifen werden von den Polizeidienststellen verteilt. Zum Schutz der Anpflanzungen.«
»Und beim Eintreffen habt ihr die Wohnung genauso vorgefunden?«
»Im Prinzip schon. Herr Hinze lag verletzt auf dem Sofa. Der Arzt kam dann etwas später.«
Nachdenklich brummte Oppenheimer vor sich hin. Dann holte er aus der Innentasche der Anzugjacke seine Zigarettenspitze und steckte sie sich zwischen die Lippen. Wenzel sah schweigend zu, denn er wusste mittlerweile, dass es Oppenheimers Marotte war, auf dem leeren Mundstück herumzukauen, wenn er sich auf einen Fall konzentrierte.
Abgesehen von der schäbigen Kleidung und den zerzausten schwarzen Haaren, wirkte der Tote recht gepflegt. Das Kinn war glatt rasiert, die vollen Wangen verrieten, dass er recht gut genährt war. Die erloschenen Augen waren noch weit geöffnet und starrten ins Leere. Oppenheimer beugte sich nach vorn, sodass er im Unterleib des Toten das Griffstück des eingedrungenen Messers erspähte.
»Vielleicht ein heimkehrender Soldat auf der Durchreise«, mutmaßte der Polizist und wies auf den Uniformmantel.
Wenzel runzelte die Stirn. »Könnte sein. Andererseits werden fast alle Uniformen wiederverwendet. Sogar meine Frau trägt eine umgearbeitete Feldbluse.«
Oppenheimer richtete sich auf und blickte auf das zertrümmerte Wohnzimmerfenster. »Ist der Tote durch das Fenster eingedrungen?«
»Sieht danach aus«, bestätigte der Schupo.
Die Spurensicherung war noch nicht eingetroffen, also wagte Oppenheimer nur, das Fenster aus gebührender Distanz zu betrachten. Es war ein ganz gewöhnliches Doppelfenster, wie man es fast in jeder Wohnung finden konnte. Vom Hinterhof wehte eine kühle Brise herein, denn die äußere Scheibe war zertrümmert. Das schmale Sims zwischen innerer und äußerer Scheibe fungierte als Kühlschrankersatz. Die in Wachspapier eingeschlagenen Lebensmittel waren mit funkelnden Glassplittern übersät.
»Er ist also durch den Hinterhof gekommen«, stellte Oppenheimer fest.
Der Polizist schmunzelte. »Ein Hof ist es nicht gerade, eher schon ein Park.«
»Oder mit anderen Worten: Brachland«, murmelte Oppenheimer. »Brachland, das jetzt als Ackerfläche genutzt wird.«
Nachdem sie alles begutachtet hatten, widmete sich Oppenheimer wieder dem Ehepaar Hinze. Mittlerweile war die Ambulanz eingetroffen. Herr Hinze hatte eine tiefe Schnittwunde abbekommen und musste unverzüglich zum nächsten Krankenhaus transportiert werden. Seine Gattin war schreckensbleich, ihr brünetter Dutt schimmerte in der künstlichen Beleuchtung. Damit sie nicht ständig den Toten vor Augen hatte, führte Oppenheimer sie ins Schlafzimmer.
Offensichtlich hatte ihr Mobiliar die Kriegswirren nicht überstanden, denn es gab bei den Hinzes kein Bett, sondern nur ein improvisiertes Nachtlager aus Decken. In einer Ecke des Zimmers stapelten sich Maggikisten mit Kleidern, außerdem befanden sich noch zwei Stühle im Schlafzimmer, die als Stumme Diener umfunktioniert waren. Oppenheimer ließ Frau Hinze auf einem davon Platz nehmen.
»Ich weiß, dass es ein Schock ist«, begann Oppenheimer. Er wollte sich nicht auf die fremden Kleider setzen, also ging er vor Frau Hinze in die Hocke. »Bitte versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Können Sie mir erklären, was vorgefallen ist?«
Ursula Hinze brauchte eine Weile, bis sie es schaffte, zusammenhängende Sätze zu formulieren. »Ein Albtraum«, stammelte sie. »Ein wahrer Albtraum. Plötzlich war er da. Ich hab ihn im Wohnzimmer gehört, wie er unsere Sachen durchwühlte. Da hab ich meinen Mann geweckt. Ich dachte, Konrad ruft die Nachbarn oder die Polizei, aber nein, er musste ja den Helden spielen. Ist ins Wohnzimmer, um den Einbrecher zu überrumpeln. Als ich kam, haben sie miteinander gerungen. Ein paar Sekunden später brach der Einbrecher zusammen. Tot. Und Konrad blutete.« Bei diesem Gedanken presste sie die Lippen zusammen.
Wenzel stand an den Türrahmen gelehnt und notierte Frau Hinzes Aussage. Bei ihrer letzten Angabe zog er die Brauen zusammen. Oppenheimer verstand sofort, was ihm aufgefallen war. Die Nachbarn hatten das Handgemenge gehört und die Polizei gerufen. Selbst in der Nacht musste ein lautstarker Streit recht lange andauern, ehe er auffiel.
»Können Sie sich daran erinnern, wie lange es dauerte, bis Sie Ihrem Mann ins Wohnzimmer folgten?«, hakte Oppenheimer nach.
Frau Hinze zuckte mit den Schultern. Fahrig murmelte sie: »Ich weiß nicht. Das ist …« Sie verstummte. »Ich kann mich nicht erinnern. Ihm geht es doch gut?« Frau Hinze warf Oppenheimer einen flehentlichen Blick zu und zerknüllte das tränenfeuchte Taschentuch in der Hand.
»Er befindet sich schon auf dem Weg ins Krankenhaus«, erklärte Oppenheimer. Er ahnte, dass er heute nicht weiterkommen würde. Frau Hinze war noch zu durcheinander, um auf seine Fragen klare Antworten zu geben.
»Haben Sie Bekannte, bei denen Sie unterkommen können?«, erkundigte er sich. Frau Hinze warf ihm einen verständnislosen Blick zu, also präzisierte er: »Die Spurensicherung wird Ihre Wohnung für einige Stunden blockieren, befürchte ich. Es wird ein ziemlicher Trubel. Ich würde Ihnen raten, woanders zu übernachten.«
Frau Hinze zog ihre Stirn kraus. »Vielleicht bei Erika. Erika Schimmelpfennig heißt sie. Sie wohnt in der Baumschulenstraße. Aber sie schläft jetzt sicher.«
»Keine Sorge, darum kümmern wir uns«, redete Oppenheimer ihr gut zu. Ein kurzer Blick zu Wenzel genügte, und schon holte dieser einen der Streifenpolizisten, um Frau Hinze zu ihrer Bekannten zu eskortieren.
Am folgenden Tag begannen für Oppenheimer die Routinearbeiten, die bei jeder Ermittlung anfielen. Also zog er sich in sein Büro zurück, um die nächsten Schritte zu planen. Gedankenversunken starrte er durch die großen Fenster in den bewölkten Himmel. Zusammen mit der hohen Zimmerdecke ließen sie das Büro großzügiger wirken, als es vom Grundriss her war.
Gegen Mittag bestellte er die zwei Streifenpolizisten zu sich. Sie waren als Erste am Tatort gewesen, und nur mithilfe ihrer Aussagen ließ sich abklären, ob Frau Hinzes spärliche Angaben korrekt waren.
Beim Betreten von Oppenheimers Büro sahen die Polizisten genauso schneidig aus wie wenige Stunden zuvor am Tatort. Die Zeiten, in denen Hungergestalten lediglich mit einer handgemalten Polizei-Armbinde versehen die Staatsgewalt vertraten, waren endgültig vorbei. Seit diesem Jahr waren Polizisten wieder militärisch eingekleidet, mit den altbekannten Tschakos, auf denen der Berliner Bär prangte, Uniformen aus graublauem Stoff, Dienstgradabzeichen mitsamt Schulterstücken, breiten Reiterhosen und einem schwarzen Ledergürtel, an dem ein Schlagstock oder Waffen befestigt werden konnten.
Oppenheimers Augen waren verquollen. Er hatte in den frühen Morgenstunden nur noch ein kurzes Nickerchen machen können, und mit einem zerstreuten »Nehmen Sie doch Platz« wies er auf die Stühle vor seinem Schreibtisch. Als sich die beiden Uniformierten hinsetzten, war deutlich zu hören, wie ihre neuen Stiefel knarzten.
»Dann gehen wir am besten die Ereignisse der vergangenen Nacht durch«, schlug Oppenheimer vor, klappte sein Notizheft auf und zückte den Bleistift.
»Also, Sie beide waren auf einer Fahrradstreife unterwegs und hörten eine Signalpfeife.«
Der eine Polizist war ein magerer Mann mit kantigem Kinn. Mit ihm zusammen hatte Oppenheimer in der Nacht den vermutlichen Tatort inspiziert. »Wir drehen immer dieselbe Runde«, bestätigte er. »In der Nähe des Treptower Parks gibt es einige Schrebergärten und Gemüsebeete. Wir fahren zu festen Zeiten bestimmte Kontrollpunkte ab. Die Anwohner haben Wachposten aufgestellt, um ihre Ernte zu sichern. Lebensmittel ziehen eben Räuber an.«
»Und an diese Wachposten wurden die Signalpfeifen verteilt?«
»Richtig. Jetzt ist die Haupternte ja bereits vorbei, und wir sind nicht mehr ganz so häufig unterwegs. Jedenfalls war es ein glücklicher Zufall, dass wir gerade vor Ort waren, als der Einbruch geschah.«
Oppenheimer notierte sich die Namen der Wachleute im Wohnblock der Hinzes, um sie später zu befragen. Abgesehen davon bestätigten die Schupos, was Oppenheimer bereits vor Ort in Erfahrung gebracht hatte. Die Polizisten gaben an, nach dem Pfeifensignal maximal fünf Minuten gebraucht zu haben, bis sie die Wohnung der Hinzes betraten.
Oppenheimer zog seine Notizen aus der Nacht zurate und rechnete die Zeitangaben zusammen. »Der Nachbar mit der Signalpfeife erklärte, Lärm in der Wohnung der Hinzes gehört zu haben, dann kleidete er sich rasch an und lief ins Treppenhaus, wo bereits andere Mitbewohner standen. Dann wurde er sofort losgeschickt, um Hilfe zu rufen. Es scheint mir realistisch, dass Sie vielleicht fünfzehn Minuten nach der Tat eingetroffen sind. Sagen wir mal, Viertel vor eins geschah die Tötung, die Gerichtsmediziner werden das später noch präzisieren.«
»Wenn Sie das sagen«, meinte der Polizist.
»Wir mussten die Tür aufbrechen«, warf der baumlange Polizist ein, der aufgepasst hatte, dass kein neugieriger Nachbar in die Wohnung schlich. Er hatte seinen Stuhl in die Nähe des Ofens gerückt und rieb sich die klammen Hände.
»Die Tür war also abgeschlossen«, sinnierte Oppenheimer. »Das bedeutet, dass sich in der Wohnung nur das Ehepaar Hinze und der Einbrecher befanden. Und keiner hat Ihnen aufgemacht?«
Beide Polizisten verneinten.
»Als wir die Wohnung betraten, war Frau Hinze mit ihrem verletzten Mann beschäftigt«, gab der magere Polizist zu bedenken.
Oppenheimer runzelte die Stirn. »Aber warum hat sie keine Hilfe geholt? Das wäre doch die normale Reaktion. Stattdessen bleibt sie in der verschlossenen Wohnung.«
Schweigend hing Oppenheimer seinen Gedanken nach und blätterte dabei durch seine Aufzeichnungen. Irgendetwas störte ihn an Frau Hinzes Verhalten, aber momentan konnte er es noch nicht benennen.
Das laute Knacken der brennenden Holzscheite lenkte Oppenheimers Aufmerksamkeit auf den Ofen. Der lange Polizist nahm seinen Tschako ab, um sich mit einem Taschentuch die feuchte Stirn abzutupfen. Als Oppenheimer ihn zum ersten Mal ohne Kopfbedeckung sah, erinnerte er sich.
Er kannte den jungen Mann tatsächlich.
Zuerst war Oppenheimer sprachlos. Es war der Kleene Hans, einer der Handlanger des Schweren Ede. Der Ganove versuchte mittlerweile, auf seine alten Tage nur noch seriöse Geschäfte zu machen, aber Oppenheimer zweifelte nicht daran, dass er noch das eine oder andere krumme Ding drehte. Hans war eines seiner Bandenmitglieder. Und jetzt saß er als Polizist verkleidet vor Oppenheimer.
Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Obwohl auch Hans ihn erkannt hatte, spielte er im Beisein seines Kollegen die Unschuld vom Lande. Auf jeden Fall war es keine gute Idee, Hans einfach nur erstaunt anzustarren. Um Zeit zu schinden, räusperte sich Oppenheimer und warf einen ausführlichen Blick auf seine Notizen.
Wenn er Hans darauf ansprach, was er ausgerechnet im Polizeidienst zu suchen hatte, riskierte er, dass seine eigene Verbindung zu Ede herauskam. Ursprünglich hatte Oppenheimer den alteingesessenen Gauner als Spitzel eingesetzt. In den Kriegsjahren und den ersten Monaten nach der Eroberung Berlins war Ede – eine ironische Wendung des Schicksals – eine der wenigen Konstanten in Oppenheimers Leben gewesen. Der Ganove hatte ihm sogar das Leben gerettet, indem er ihn in einem seiner Warenlager versteckt hielt. Dass Oppenheimer als Jude die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten überleben konnte, hatte er nicht zuletzt auch Ede zu verdanken. Trotz seiner Dankbarkeit war er sich bewusst, dass er als wiedereingestellter Kripokommissar keine allzu große Nähe zu verbrecherischen Elementen mehr suchen durfte.
Immer noch etwas irritiert, versuchte Oppenheimer, sich wieder auf den Fall zu konzentrieren.
»Gibt es Hinweise auf einen Mittäter?«, fragte Oppenheimer und sprach damit den letzten wichtigen Punkt an. »Sind euch gestern Nacht zufällig in der Umgebung verdächtige Personen aufgefallen?«
Hans und sein Kollege verneinten. Daraufhin entließ Oppenheimer sie und griff nach seinem Mantel.
Draußen vor dem Bürofenster fiel aus grauem Himmel Schneeregen. Bald würde es wieder dunkel werden, also beschloss Oppenheimer, das letzte Tageslicht zu nutzen, um die Wohnung der Hinzes genauer zu inspizieren.
2
Freitag, 7. November 1947 – Samstag, 8. November 1947
Eine halbe Stunde später stand Oppenheimer mit Wenzel auf der rückwärtigen Seite des langen Wohngebäudes an der Köpenicker Landstraße und starrte auf das zertrümmerte Fenster des Wohnzimmers der Hinzes. Er versuchte, sich vorzustellen, wie der Einbrecher emporgeklettert war, um sich Zugang zu verschaffen. Das Fenster befand sich in etwa zwei Metern Höhe. Nach Angaben der Kollegen von der Spurensicherung hatte hier eine verschrammte Leiter an der Hauswand gelehnt, mit dem Fußende im Gartenbeet.
Das einstmals parkähnliche Gelände hinter dem Haus ähnelte einem Schrebergarten. Wie auch an anderen Stellen Berlins hatte man hier die Erde umgegraben und versuchte, Obst und Gemüse zu ziehen. Nach Ende der Kriegsaktivitäten war schnell klar geworden, dass sich Berlin nicht autark versorgen konnte. Eine groß angelegte Brachlandaktion sollte die desolate Lage wenigstens ein bisschen verbessern. Und so hatte die Stadtverwaltung Gartenbauinspektoren losgeschickt, um Grundstücke aufzulisten, auf denen Ackerbau möglich erschien. Nicht nur Parks und öffentliche Grünflächen wurden erfasst, sondern auch verwahrloste Gärten und Trümmergrundstücke. Allerdings erwies sich die Planung als viel zu optimistisch, denn in der bevölkerungsreichen Berliner Innenstadt waren Freiflächen kaum zu finden. Außerdem war der zur Verfügung stehende Boden oftmals miserabel. Monatelange Knochenarbeit war nötig, um ihn in einen brauchbaren Zustand zu bringen. Die Aufzucht der Erdfrüchte war nur mit massivem Einsatz von Düngemitteln möglich, die jedoch manchmal gar nicht geliefert wurden. Privatleuten wurde in Aussicht gestellt, dass sie die Ernte behalten konnten, ohne dass sie auf die Lebensmittelkarten angerechnet wurde. Wenn man berufstätig war, fehlte allerdings die Zeit, um neben dem stundenlangen Schlangestehen vor den Geschäften auch noch Gemüse anzubauen. Und so ließen die Erfolge all dieser Bemühungen immer noch auf sich warten.
Selbst der schmale Streifen Erde vor der Rückwand des Wohnhauses wurde zum Anbau von Essbarem genutzt. Und so befanden sich die Abdrücke der Leiter inmitten von grünen Blättern, unter denen die weiß-violetten Knollen der Steckrüben aus dem Boden hervorlugten.
Wenzel ging in die Hocke, um die Erde genauer zu untersuchen. Nach einigen Minuten schnaubte er auf.
»Mit Fußspuren ist hier völlige Fehlanzeige«, brummte er. »Außerdem gefallen mir die Abdrücke der Leiter nicht.«
Oppenheimer nickte. »Obwohl der Boden von der Feuchtigkeit aufgeweicht ist, kann man sie kaum erkennen. Und nicht nur das: Bis auf die Stelle, an der die Leiter stand, ist bei dem Gemüse nicht mal ein einziges Blättchen abgeknickt worden.«
Wenzel stellte sich an den Rand des Beets und machte einen großen Schritt auf die imaginäre Leiter zu. Seine Schuhe sanken prompt in die schwarze Erde ein.
»Keine Chance«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Um zur Leiter zu gelangen, muss man mindestens einen Schritt auf dem Beet machen.«
»Das bedeutet also, dass niemand auf der Leiter stand«, folgerte Oppenheimer. Dann schritt er auf dem knirschenden Splitt des Gehwegs Muster ab, die nur für ihn einen Sinn ergaben.
»Wie ist der Getötete dann hineingelangt?«
Bei Wenzels Frage hielt Oppenheimer inne. Er sog die feuchte Luft ein und antwortete: »Er kam durch die Wohnungstür. Wie denn sonst? Die Hinzes wollen uns für dumm verkaufen.« Er warf seinem Assistenten einen Blick zu. »Jetzt ist nur die Frage, warum sie uns diese Lüge auftischen.«
Mit einem amüsierten Funkeln in den Augen meinte Wenzel: »Vielleicht wird diese Untersuchung ja doch interessant.«
Während Wenzel die Nachbarn befragte, die als Wachposten des Hinterhofgartens eingeteilt waren, fuhr Oppenheimer mit seinem Fahrrad zur Baumschulenstraße, in der Hoffnung, dort Frau Hinze bei ihrer Bekannten vorzufinden.
Mit Fahrzeugen war die Kripo immer noch spärlich ausgestattet. Wenn nicht gerade ein dringender Einsatz anstand, war es schwierig, bei den zuständigen Stellen einen Polizeiwagen zu organisieren. Daher verließen sich Oppenheimer und Wenzel im Zweifelsfall lieber auf ihre Drahtesel, wenn sie irgendwohin mussten, selbst wenn es wie an diesem Tag bedeutete, sich dem feuchten Schneeregen auszusetzen.
Das Innenlager eines Pedals gab ein markerschütterndes Quietschen von sich. Oppenheimer konnte es ölen, so viel er wollte, nichts änderte sich daran. Er nahm sich vor, demnächst nach einem Ersatzteil Ausschau zu halten. Nur halb im Scherz hatte Wenzel Oppenheimers fahrbaren Untersatz mal ein Frankenstein-Monster von einem Fahrrad genannt. Doch im Gegensatz zur Kreatur von Mary Shelleys größenwahnsinnigem Wissenschaftler war sein Drahtesel nicht aus Leichenteilen, sondern aus den Überresten anderer Räder zusammengebaut worden.
Frau Hinze war in den frühen Morgenstunden bei ihrer Freundin Erika Schimmelpfennig untergekommen, deren Wohnung wenige Hundert Meter von der S-Bahn-Station Baumschulenweg entfernt war. Nachdem Oppenheimer geklingelt hatte und zwei Treppen emporgestiegen war, öffnete ihm ein mürrischer Herr mit einer Hornbrille und schütterem Haar.
»Entschuldigung«, begann Oppenheimer, »ist Frau Hinze zufällig anwesend?« Der Mann stutzte. Der Name schien ihm nichts zu sagen. »Ich meine die Dame, die gestern Nacht bei Ihnen untergekommen ist.«
»Weeß ick nich«, erwiderte der Mann. »Hier jeht et zu wie in ’nem Taubenschlag. Mir sacht ja keene Sau wat.«
Oppenheimer vermutete, dass es sich um einen Mitbewohner handelte. Bei dem Mangel an Wohnraum war es in Berlin nicht unüblich, dass die wenigen intakten Wohnungen mit mehreren Familien belegt waren.
»Könnte ich dann vielleicht Frau Schimmelpfennig sprechen?«
Bei der Nennung dieses Namens zuckte der fremde Herr zusammen. Sein Gesicht verfinsterte sich.
»Pah!«, stieß er hervor und knallte die Tür vor Oppenheimers Nase zu, noch ehe dieser die Möglichkeit hatte, seine Polizeimarke aus der Hosentasche zu angeln.
Zuerst war Oppenheimer zu überrascht, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Dann begann er, gegen die Tür zu klopfen.
»Bemühen Sie sich nicht«, sagte eine helle Stimme hinter ihm. Eine Frau kam die Treppe hoch, deren müde Schritte nicht zu ihrem attraktiven Äußeren passten. Sie mochte vielleicht Ende dreißig sein, der Nerzmantel sah so abgeschabt aus, dass er vermutlich beide Weltkriege überstanden hatte. Aber das kecke Hütchen auf dem Kopf entsprach der neuesten Mode, und die blonden Locken waren kunstvoll nach oben gekämmt.
»Zu wem wollen Sie denn?«
»Ich komme von der Kriminalpolizei«, antwortete Oppenheimer, um diesen wichtigen Punkt vorwegzunehmen, »und bin auf der Suche nach Frau Hinze.«
»Zu Ursula wollen Sie? Die hat sich heute früh gleich auf den Weg gemacht zu ihrem Mann ins Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass sie schon zurück ist.«
»Entschuldigung, und Sie sind?«
»Erika. Erika Schimmelpfennig. Aber kommen Sie doch herein.«
Mit einem Schlüssel, der an einem klimpernden Schlüsselbund hing, schloss sie die Wohnungstür auf. Die Zustände in der Wohnung entsprachen Oppenheimers Erwartung. Drei verriegelte Zimmer wurden von jeweils unterschiedlichen Mietparteien beansprucht. Der Durchgang zur Küche stand weit offen, ein Zeichen dafür, dass sie als neutrales Terrain galt.
Frau Schimmelpfennig bot Oppenheimer einen Platz am Küchentisch an. Wie sich herausstellte hatte sie in der Nacht vor lauter Besorgnis um ihre Freundin Ursula kaum ein Auge zugetan und war nun ein wenig früher von ihrer Arbeit in einem Damensalon heimgekehrt. Obwohl sie übernächtigt war, ließ sie es sich als gute Gastgeberin nicht nehmen, Oppenheimer eine Tasse Tee zuzubereiten.
»Ursula ist völlig mit den Nerven am Ende, das können Sie sich ja vorstellen.« Um diesen Punkt zu unterstreichen, riss Frau Schimmelpfennig die Augen auf.
Seitlich an dem Holzherd war ein Wasserschiff angebracht. Frau Schimmelpfennig betätigte den Hahn und ließ dampfendes Wasser in einen Emaillebecher laufen. Dann öffnete sie eine Blechdose, schaufelte mit dem Löffel etwas von dem Inhalt hinein, rührte kurz um und stellte den Becher vor Oppenheimer auf den Tisch.
»Den müssen Sie aber lange ziehen lassen, sonst schmeckt er nicht.«
Neugierig beäugte Oppenheimer die bräunlichen Stücke im Wasser. War diese Brühe der berüchtigte Gesundheitstee, der in den Zeitungen für die Selbstversorgung angepriesen wurde? Der Tee ließ sich aus heimischen Kräutern herstellen und bestand im Wesentlichen aus den Blättern von Beerensträuchern. Nur die Fermentation war ein sehr aufwendiger Prozess, mit dem eine Hausfrau gleich mehrere Tage beschäftigt war. Oppenheimer bedankte sich und wärmte sich die Hände an dem Becher, solange der Tee zog.
Es stellte sich heraus, dass Frau Schimmelpfennig mit Frau Hinze seit knapp drei Jahren befreundet war. »Ihr armer Mann«, sagte sie. »Dabei hat er doch schon so viel mitgemacht. Und jetzt auch noch mit dem Messer verletzt zu werden.« Sie seufzte.
»Was ist denn mit Herrn Hinze geschehen?«, hakte Oppenheimer nach, um den Mitteilungsdrang seiner Gesprächspartnerin auszunutzen.
»Er ist doch erst vor vier Monaten wieder zurückgekommen.«
»Aus der Kriegsgefangenschaft?«, fragte Oppenheimer.
Frau Schimmelpfennig nickte eifrig. »Ursulas Mann wurde vor fast sieben Jahren bei einem Lufteinsatz über England abgeschossen. Seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Er galt bereits als tot. Und dann stand er plötzlich vor ihrer Tür. Können Sie sich das vorstellen?«
Oppenheimer murmelte zustimmend, obwohl er diese Geschichte nicht besonders ungewöhnlich fand. Mehr als zwei Jahre nach dem Kriegsende befanden sich bei den Westalliierten immer noch mehrere Hunderttausend Kriegsgefangene in Haft. Und nach einer langen Zeit der Ungewissheit hatte der sowjetische Außenminister Molotow im März schließlich verkündet, dass sich 890532 deutsche Gefangene in russischen Lagern aufhielten. Bis spätestens Ende 1948 sollten alle deutschen Soldaten wieder freigelassen werden. Die kernigen Landser aus Hitlers Propagandafilmen hatten sich in Geistergestalten verwandelt. Oftmals kehrten sie in eine Heimat zurück, in der es für sie keinen Platz mehr zu geben schien. Oppenheimer konnte die Eifersuchtsdramen kaum noch zählen, mit denen er ständig konfrontiert wurde, nur weil vereinsamte Ehefrauen in der Zwischenzeit einen neuen Lebenspartner gefunden hatten.
Während Frau Schimmelpfennig aus dem Nähkästchen ihrer Freundin plauderte, nippte Oppenheimer an seinem Tee. Er fand, dass diese fade Brühe auch nach längerem Ziehen nicht aromatisch wurde. Man hätte ebenso gut Daunenfedern mit heißem Wasser übergießen können.
Das Eheleben der Hinzes wurde von Frau Schimmelpfennig als harmonisch bezeichnet. Angeregt schilderte sie, wie froh Ursula gewesen sei, als ihr Mann wieder aufgetaucht war. Bei all dem konnte Oppenheimer nicht verhindern, dass seine Gedanken abschweiften. Dass der Tote ein fremder Einbrecher war, hielt er mittlerweile für unwahrscheinlich.
Just in diesem Moment wurde die Wohnungstür geöffnet. Mit schweren Schritten durchquerte jemand die Diele. Der Neuankömmling war ein Herr mit Hut und Mantel. Bei Frau Schimmelpfennigs Anblick leuchtete sein Gesicht auf. Er nahm den Hut ab, um sie auf die Wange zu küssen.
»Du bist schon da?«, sagte er erfreut.
»Ich durfte früher nach Hause, wegen der ganzen Aufregung um Ursula«, erklärte Frau Schimmelpfennig. »Und ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Herr Oppenheimer ist von der Polizei. Um ein Haar hätte ihn Dirk nicht reingelassen.«
Oppenheimer stand zu Begrüßung auf.
»Schimmelpfennig«, sagte der Mann und gab Oppenheimer die Hand. Mit seinen dunklen Augen und den grau melierten Haaren war er eine ausgesprochen markante Erscheinung.
»Kennen Sie ebenfalls die Hinzes?«, erkundigte sich Oppenheimer.
Herr Schimmelpfennig lächelte. »Also, kennen ist zu viel gesagt. Wir waren ein paarmal bei ihnen zu Besuch, mehr nicht.«
Abrupt gefror das Lächeln in Herrn Schimmelpfennigs Gesicht. Auch seine Gattin wirkte plötzlich pikiert. Erst als sich Oppenheimer zur Seite wandte, erkannte er den Grund für diesen Stimmungsumschwung.
Der unfreundliche Mitbewohner mit der Hornbrille war wieder erschienen. Er stand unbeweglich im Durchgang zur Diele und warf den Eheleuten einen abschätzigen Blick zu. Dann setzte er sich in Bewegung. Provozierend langsam umkreiste er den Küchentisch, um zum Kochherd zu gelangen. Als er dabei Oppenheimer passierte, kam es diesem so vor, als würde hinter seinem Rücken eine Welle der Missgunst vorbeitreiben.
Unter lautem Scheppern holte der Mann eine Tasse aus dem Hängeschrank und ließ heißes Wasser hineinlaufen. Die Schimmelpfennigs taten so, als würden sie ihn nicht beachten, doch ihr angestrengtes Schweigen strafte sie Lügen. Schließlich verschwand der Mann namens Dirk auf demselben Weg und ebenso gemächlich, wie er aufgetaucht war. Oppenheimer glaubte, bei dem Unruhestifter den Anflug eines triumphierenden Lächelns zu erkennen.
Frau Schimmelpfennig bestand darauf, Oppenheimer bei der Verabschiedung zur Tür zu bringen. Im Treppenhaus warf sie rasch einen Blick über die Schulter und murmelte dann vertraulich: »Bitte entschuldigen Sie das Verhalten meines Mannes.«
Oppenheimer runzelte die Stirn. »Ich befürchte, da habe ich etwas wohl nicht mitbekommen?«
Frau Schimmelpfennig blickte Oppenheimer groß an. Dann setzte sie an: »Nein, ich meine nicht meinen jetzigen Mann, sondern den anderen.«
Jetzt verstand Oppenheimer noch weniger, was sie ihm sagen wollte.
»Ich hieß nicht immer Schimmelpfennig. Erst seit einem Jahr, da habe ich Peer geheiratet. Der andere Herr, der Sie nicht in die Wohnung lassen wollte, das ist Dirk, mein erster Mann.«
Oppenheimer begriff erst nach einer Weile, welche Komplikationen ein solches Arrangement mit sich brachte. »Wohnen Sie etwa zusammen?«, fragte er ungläubig.
Seufzend zuckte Frau Schimmelpfennig mit den Schultern. »Gezwungenermaßen. Als ich mich von Dirk scheiden ließ, wollte er nicht ausziehen, weil er meinte, dass er so eine gute Wohnung nicht noch einmal bekommt. Dann lernte ich Peer über den Liebeskiosk kennen und habe ihn später auch geheiratet, aber Dirk wollte immer noch nicht aus seinem Zimmer raus. Das geht jetzt schon seit fast einem Jahr so. Er spielt lieber die beleidigte Leberwurst und verdirbt uns allen die Laune.«
»Liebeskiosk?«, wiederholte Oppenheimer.
»Ein Ehevermittlungsinstitut am Ku’damm. Es wurde mir von einer Bekannten empfohlen. Wie soll man heutzutage sonst ledige Herren im richtigen Alter kennenlernen? Die meisten sind doch an der Front geblieben. Und ich will mich auch nicht einem Ausländer an den Hals werfen, nein, so ein loses Frauenzimmer bin ich nicht.« Der Fußboden knarzte, als sich Frau Schimmelpfennig verschwörerisch zu Oppenheimer vorbeugte. »Auch Ursula habe ich die Adresse vom Liebeskiosk gegeben. Ich konnte nicht mit anschauen, dass sie als Kriegerwitwe versauert. Aber dann ist ihr Konrad ja noch rechtzeitig zurückgekommen. Ehe es Komplikationen gab, wissen Sie. Stellen sie sich vor, sie hätte einen Liebhaber gehabt, als ihr Mann zurückkam – nicht auszudenken.«
Für die Berliner war es ein klarer Fall. Sie behaupteten, dass ihre Stadt im Krieg verschüttet worden sei. Und wie das zerstörte Pompeji müsse man nun eben das alte Berlin unter den Geröllmassen wieder ausgraben. Statt Archäologen benötigte man dafür allerdings Bauarbeiter.
In einem Rundfunkbeitrag, der die Tüchtigkeit der Trümmerfrauen pries, wurde unlängst die Behauptung aufgestellt, dass Berlin trotz seiner großen Zerstörungen eine der aufgeräumtesten und saubersten Städte in ganz Deutschland sei. Als er das hörte, war es Oppenheimer schwergefallen, diese Darstellung ernst zu nehmen. Jedes Mal, wenn er mit seinem Drahtesel die altvertrauten Straßen entlangfuhr, hatte er genau den gegenteiligen Eindruck. Selbst wenn man berücksichtigte, dass ihm Vergleichsmöglichkeiten fehlten, da er seit dem Kriegsbeginn in keiner anderen Großstadt gewesen war, klang diese Jubelmeldung verdächtig nach einem von oben verordneten Zweckoptimismus. Fortschritte mochte es geben, nur gingen die Aufräumarbeiten derart langsam vonstatten, dass kaum absehbar war, wann die Stadt einmal ihre alte Pracht zurückerlangen würde. Unverändert gaben aufgerissene Hauswände den Blick auf nackte Stahlträger und verbogene Rohre frei. Nur in den seltensten Fällen waren die Hausfassaden ausgebessert worden, und die abgedichteten Notdächer fungierten mittlerweile als Dauerprovisorium. Oppenheimer fuhr von seinem Gespräch mit Frau Schimmelpfennig zurück zum Wohnhaus der Hinzes, um nachzusehen, ob er Wenzel unterstützen konnte. Dabei trat er so stark in die Pedale, dass er trotz des scharfen Windes zu schwitzen begann.
Es stellte sich heraus, dass sein Assistent immer noch damit beschäftigt war, die Nachbarn zu befragen. Als Oppenheimer in den zweiten Stock hinaufging, konnte er beobachten, wie Wenzel rückwärts aus einer Wohnungstür trat und abwehrend gestikulierte.
»Nein, nein, besten Dank, aber ich brauche keine.«
Ein kleinwüchsiger Herr mit Schnurrbart folgte ihm bis zur Türschwelle. Von seinem erhobenen Arm baumelten einige Hosenträger herab.
»Aber ich sage Ihnen doch, Qua-li-täts-ware«, pries der Mann seine Kleidungsutensilien an. »Prüfen Sie selbst.«
»Leider habe ich jetzt keine Zeit«, vertröstete Wenzel ihn. Oppenheimers Anwesenheit gab ihm die Möglichkeit, sich von dem aufdringlichen Verkäufer zu verabschieden.
»In der Nacht will niemand eine verdächtige Gestalt gesehen haben«, fasste er zusammen. »Aber die Wachleute für das Gartenbeet machen nur zu jeder geraden Stunde ihre Runde.«
»Der nächste Kontrollgang wäre dann also um zwei Uhr gewesen?«
Wenzel nickte, denn er war damit beschäftigt, sich eine Zigarette anzuzünden.
»Im Sommer sind sie häufiger unterwegs«, erklärte er, während er einen Schwall blauen Dunstes ausstieß. »Dann gibt es auch mehr vom Acker zu stehlen. Jedenfalls war bei der Runde um Mitternacht alles mucksmäuschenstill. Keine Vorkommnisse.«
Gegen die Wand gelehnt, zog Oppenheimer diese Neuigkeit in Erwägung. »Selbst wenn wir nicht glauben, dass unser Einbrecher durchs Fenster kam, könnte er trotzdem allein unterwegs gewesen sein.«
Wenzel schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, das passt absolut nicht. Für einen Dieb hat er sich zu auffällig verhalten. Denn jetzt kommt das Beste: Am Tag vor seinem Tod haben gleich mehrere Anwohner hier in der Nähe einen Mann gesehen, der auf die Beschreibung des Opfers passt. Einen Nachbarn hat er sogar angesprochen und sich bei ihm ausdrücklich nach Frau Hinze erkundigt.«
»Ein Zufall war es also nicht, dass er in die Wohnung kam«, spann Oppenheimer den Gedanken weiter. »Und nach einem Einbrecher klingt es tatsächlich nicht. Hat der Mann sonst noch etwas erzählt?«
»Er war sogar recht gesprächig. Zuerst hatte er wohl sein Glück bei Frau Hinzes alter Wohnung in Moabit versucht, in der sie vor vier Jahren ausgebombt wurde. Dort sagte man ihm, dass sie jetzt in diesem Wohnblock lebt, allerdings konnte man ihm die Hausnummer nicht nennen. Er wusste gerade mal so viel, dass sie in dieser Wohnanlage untergekommen ist.«
»Interessant. Er hat also nur von Frau Hinze gesprochen, und nicht von ihrem Mann. Seine Verbindung zu ihr hat er nicht zufällig verraten?«
Wenzel schmunzelte bedauernd. »Nein, das wäre auch zu schön gewesen. Alles in allem klingt es danach, als hätte Frau Hinze das Opfer in ihre Wohnung gelassen. Schließlich kannte sie ihn. Das ist die einzige Lösung.«
»Allerdings müssen wir das beweisen«, wandte Oppenheimer ein. »Ich werde Frau Hinze heute noch befragen. Vorhin war ich auf der nächsten Polizeiwache und habe die Dienststelle angerufen. Man wird sie im Krankenhaus abholen. Mit ihrer Verbindung zu dem Toten haben wir wenigstens einen neuen Ansatzpunkt.«
Wenzel warf Oppenheimer einen scharfen Blick zu. »Dieses Ehepaar dürfen wir nicht mehr aus den Augen lassen.«
»Definitiv nicht«, bekräftigte Oppenheimer.
Den nächsten Morgen verbrachte Oppenheimer gezwungenermaßen in seinem Büro. Ungeduldig auf die Tischplatte klopfend, starrte er auf die Uhr über der großen Wandkarte der Berliner Innenstadt. Ihr Ticken war kaum wahrnehmbar, da gerade ein Regenschauer gegen die Fensterscheibe prasselte. Oppenheimer überlegte, ob er sich eine vierte Tasse Muckefuck gönnen sollte, entschied sich jedoch dagegen.
Gestern hatte er am späten Nachmittag noch eine fruchtlose Befragung von Frau Hinze durchgeführt. Mittlerweile hatte sie den ersten Schock verarbeitet, sodass es ihr gelang, die Vorgänge in der fraglichen Nacht nachvollziehbar zusammenzufassen. Abgesehen von einigen Ausschmückungen, wich sie in keinem Punkt von ihrer ursprünglichen Darstellung ab. Vor allem aber behauptete Frau Hinze, dem Toten noch nie in ihrem Leben begegnet zu sein. Nach zwei Stunden hatte Oppenheimer schließlich kapituliert und sie zu ihrer Freundin Frau Schimmelpfennig zurückgeschickt.
Aus seinen langen Jahren bei der Mordkommission wusste Oppenheimer, dass die Chancen, einen Fall zu lösen, deutlich abnahmen, wenn er nicht innerhalb der ersten Tage aufgeklärt wurde. Danach wurde die Untersuchung eine zähe Angelegenheit, die nur mit äußerster Beharrlichkeit abgeschlossen werden konnte. Trotz allem hatte Oppenheimer die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Todesfall rasch aufzuklären. Die Kollegen von der Spurensicherung waren wohl auf Unstimmigkeiten gestoßen, anders ließ es sich nicht erklären, dass sie erst am frühen Nachmittag ihren Bericht vorlegen wollten.
Ungeduldig hatte sich Oppenheimer bereits zweimal nach den Fortschritten erkundigt, bekam aber nur Vertröstungen zu hören. Der verantwortliche Kriminaltechniker war Oppenheimers alter Bekannter Bernhard Hergesheimer, der bereits in den Zwanzigerjahren mit Berlins erstem Mordbereitschaftswagen die Tatorte aufgesucht hatte, um die Spuren zu sichern. Hergesheimer mochte ein Korinthenkacker sein, aber Pingeligkeit war in seiner Profession genau das richtige Charaktermerkmal. Erst wenn seiner Ansicht nach alles Erdenkliche unternommen worden war, um auch die letzten Zweifel auszuräumen, ließen sich ihm Hinweise entlocken.
Fasziniert über die Nachforschungen, vergaß Hergesheimer mitunter sogar sein Zeitgefühl. Es war üblich, dass er bis in die frühen Morgenstunden über seinen Testreihen brütete. Oppenheimer ahnte, dass es auch diesmal länger als angekündigt dauern würde, bis Hergesheimer ihm seine Resultate mitteilte.
Und dann gab es da noch diese andere Angelegenheit, die Oppenheimer ständig durch den Kopf ging. Dass der Kleene Hans ausgerechnet bei der Polizei untergekommen war, mochte absurd wirken, auf den zweiten Blick war es aber keine große Überraschung. Es hatte sich herausgestellt, dass in den ersten Monaten nach dem Kriegsende so manche zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt in den Polizeidienst eingetreten waren. Die Besoldung ließ freilich zu wünschen übrig. Selbst ein Kriminalanwärter erhielt im Monat nur ein Nettogehalt von hundertachtzig Reichsmark, was in der alternativen Zigarettenwährung etwa einer Packung von den Rauchwaren entsprach. Und so waren die schwarzen Schafe schon bald auf die Idee gekommen, im Schutz der Uniform illegale Geschäfte abzuwickeln.
Die alarmierte Polizeiverwaltung war bemüht, diese ungeeigneten Mitarbeiter durch moralisch und politisch einwandfreie Personen zu ersetzen. Nicht nur Ganoven, sondern auch nachweislichen Nazianhängern sollte es dabei an den Kragen gehen. Die Direktive 24 des Alliierten Kontrollrats schrieb vor, dass Kriegsverbrecher, ranghohe Mitglieder der NSDAP, hauptamtlich bei den Parteiverbänden tätige Personen sowie vorbelastete Beamte und Juristen aus den Ämtern und verantwortlichen Stellen entfernt werden sollten. Diese Regelung wurde auch auf Personen ausgeweitet, die den Bestrebungen der Alliierten feindlich gegenüberstanden.
Diese scheinbar klaren Vorgaben waren bei der Kriminalpolizei in der Realität nur schwer umsetzbar, denn die meisten fähigen Spezialisten hatten auch während der Nazizeit ihren Dienst verrichtet. Und so wurde in Einzelfällen auch die Einstellung ehemaliger Polizeibeamter toleriert, wobei die endgültige Entscheidung bei Personalangelegenheiten üblicherweise beim Polizeipräsidenten lag.
Da mittlerweile ein Großteil der Strafregisterauszüge wieder vorlag, wurde der Polizeiapparat noch einmal gründlich durchleuchtet. Und was dabei teilweise zum Vorschein gekommen war, hatte für einige Verblüffung gesorgt. So war bei der Präsidialwache ein Mann eingestellt worden, der eine Haftstrafe verbüßt hatte. Nach eigenem Bekunden war er eingekerkert worden, weil er vom Naziregime politisch verfolgt wurde. Tatsächlich stellte sich später heraus, dass er wegen Mordes vorbestraft war. Und selbst die oberste Führungsriege war vor peinlichen Enthüllungen nicht gefeit. Der ranghöchste Nazianhänger in den Reihen der Polizeikräfte war bislang Heinz Kionka gewesen, seines Zeichens Vizepräsident der Berliner Polizei. Als im März 1946 bekannt wurde, dass Kionka während des Krieges in Rumänien für die Gestapo tätig gewesen war, wurde er hochkant gefeuert.
Die allmähliche Enttarnung von Verbrechern und Altnazis war ein immer noch andauernder Prozess und die Hauptursache dafür, dass es bei der Polizei wie in einem Taubenschlag zuging. Ständig kamen neue Kollegen hinzu, und andere wurden von einen Tag auf den anderen entlassen. Wie viele von Oppenheimers momentanen Mitarbeitern tatsächlich auf die eine oder andere Weise belastet waren, ließ sich nicht mit absoluter Sicherheit beantworten. Bei Polizeiangehörigen, die aus der Region östlich der Oder-Neiße-Linie stammten, konnten leider keine Strafregisterauszüge mehr beschafft werden. Und ob jeder Neubewerber bei der Einstellung in den Polizeidienst seine richtige Identität angegeben hatte, durfte ebenfalls bezweifelt werden.
Oppenheimer rieb sich die schmerzende Stirn. Die Sache mit Hans ließ ihm keine Ruhe. Vielleicht wusste ja Kommissar Billhardt, seit wann er bei der Schutzpolizei war. Oppenheimer rechnete sich zwar keine reellen Chancen aus, dass sein alter Kollege tatsächlich eine Ahnung hatte. Aber mit Billhardt konnte er wenigstens offen reden. Außerdem war er froh, einen Vorwand zu haben, um aus seinem Büro zu verschwinden.
Billhardts Schreibstube lag wenige Meter entfernt. Zu seiner Enttäuschung fand Oppenheimer dort nur Arthur Ziehm vor. Wie auch mit den übrigen Kriminalanwärtern in ihrer Dienststelle hatte er bereits gelegentlich mit Ziehm zusammengearbeitet. Er erledigte seine Aufgaben zufriedenstellend. Wie es mit Ziehms Eigeninitiative bestellt war, konnte Oppenheimer allerdings nicht sagen, da er ihn bislang nur für Laufarbeiten und Observierungen eingesetzt hatte. Er mochte Ende zwanzig sein und war immer noch ledig. Wie üblich hingen ihm schwarze Haarsträhnen in die Stirn. Dies und sein sonniges Gemüt trugen dazu bei, dass Ziehm auf Oppenheimer stets den Eindruck eines leidlich gealterten Lausbuben machte, der unermüdlich neuen Schabernack ausheckte.
Auf Billhardt angesprochen, schüttelte Ziehm den Kopf. »Er nimmt gerade einen neuen Fall auf. In Charlottenburg. Unser Kunde liegt am Fuß des Funkturms.«
Oppenheimer zog die Brauen hoch. »Etwa ein Springer?«
»Na, eine Pilzvergiftung wird es wohl nicht sein.« Ziehm kicherte. Oppenheimer rang sich ein müdes Lächeln ab. Tatsächlich war die Zahl der Pilzvergiftungen in der letzten Zeit drastisch gestiegen. Aufgrund der schlechten Ernährungslage war die Versuchung allzu groß, in der freien Natur sammeln zu gehen, um an eine Zusatzversorgung zu kommen. Und natürlich gab es auch zahlreiche findige Händler, die einfach irgendwelche Pilze auf dem Schwarzmarkt versilberten. Jetzt rächte sich, dass die Stadtbewohner eher selten über die nötigen Kenntnisse verfügten, um einschätzen zu können, welche Sorten essbar waren. Insbesondere im Herbst kam es immer wieder zu Todesfällen wegen des Verzehrs giftiger Pilze. Wurden 1937 in Groß-Berlin im gesamten Jahr lediglich drei derartige Fälle bekannt, war die Zahl allein im September 1946 auf sechsundvierzig hochgeschnellt, ehe der eisige Winter dem Pilzsammeln ein Ende setzte. Wenngleich zur Aufklärung der Bevölkerung jetzt offizielle Pilzwanderungen und Lehrgänge organisiert wurden, befürchtete Oppenheimer, dass diese Vergiftungsfälle noch eine längere Zeit zur Polizeiroutine gehören würden.
»Nein, aber jetzt im Ernst«, fuhr Ziehm fort. »Auf der Aussichtsplattform des Funkturms will niemand etwas gesehen haben. Plötzlich fiel er vom Himmel, und patsch, auf das Trottoir. Gerade hat man mir gesagt, dass ich nachkommen soll. Aber denken Sie, dass ich ein Auto kriege? Von wegen! Da bleibt mir nur die S-Bahn, aber das dauert doch eine Ewigkeit.«
»Was halten Sie von meinem Gepäcksattel?«, fragte Oppenheimer scherzhaft. Er hatte sich längst dazu entschieden, Billhardt am Funkturm eine Visite abzustatten.
Ziehms Gesicht hellte sich auf. Offenbar nahm er den Vorschlag ernst.
3
Samstag, 8. November 1947
Das Messegelände wurde von einem großen Bauwerk dominiert, dessen Fassade mit vertikalen Pfeilern aus Muschelkalkstein untergliedert war. Auf der Seite zum Messedamm begrenzten zwei runde Kopfbauten das lang gezogene Gebäude. Die oberen Fensterbänder verliehen dem Steinklotz rein optisch sogar so etwas wie Leichtigkeit, die hoch aufragende Haupthalle an der Masurenallee mit ihrem weit ausgreifenden Vorbau war jedoch das komplette Gegenteil. Hier war er am ehesten wieder sichtbar, der typische monumentale Baustil der Dreißigerjahre, wie man ihn auch anderswo in Berlin vorfand. Eingepfercht ragte hinter den Messebauten der Funkturm in die Höhe. In diesem Umfeld wirkte die solide Stahlkonstruktion geradezu filigran.
Ziehm mochte leicht wie eine Feder sein, doch als ungeübter Mitfahrer war er so unruhig, dass er das Zweirad mehr als einmal fast aus der Balance brachte.
Während Oppenheimer die letzten hundert Meter die Masurenallee entlangfuhr, um dann nach rechts zum Messedamm einzubiegen, fiel ihm auf, wie unüblich still es hier war. Die weiten Flächen vor dem Messegelände waren verwaist, keine Menschen drängten sich vor dem Foyer. Nur einige Kübelwagen mit sowjetischen Schildern waren zu sehen, und die wenigen Personen, die gegen den Schneeregen ankämpften, strebten auf das gegenüberliegende Haus des Rundfunks zu. Während das dunkelbraun geklinkerte Gebäude die Kriegswirren praktisch völlig intakt überstanden hatte, gab es bei den Messebauten immer noch so starke Schäden, dass ein geregelter Betrieb vorläufig nicht zur Debatte stand. Auch der Funkturm war nicht verschont geblieben. Kurz vor Kriegsende waren Projektile eingeschlagen, wobei eines der vier Stahlbeine beschädigt wurde und das Restaurantgeschoss ausbrannte. Die drei verbliebenen Beine waren zum Glück stabil genug, um das Bauwerk vor dem Einsturz zu bewahren. Kurzfristig wurde von den verantwortlichen Stellen ein kompletter Abriss in Betracht gezogen, ehe der Entschluss getroffen worden war, die Schäden auszubessern. Jetzt sollte ein neu errichtetes Kassenhäuschen wieder Ausflügler anlocken, die von den beiden oberen Aussichtsplattformen aus das Stadtpanorama genießen wollten.
Wenn man sich dem Stahlskelett näherte, konnte man kaum anders, als den Blick nach oben zu richten. Die Männer am Fuß des Turms blickten allerdings nach unten. Oppenheimer bremste ab und rollte die letzten Meter langsam auf sie zu. In dunkle Wintermäntel gehüllt, umringten alle dieselbe Stelle. Einer von ihnen baute gerade ein Kamerastativ auf, während zwei weitere Männer auf dem Boden Markierungen anbrachten. Zwischen ihnen war eine graue Plane ausgebreitet, an deren Seiten dunkelbraune Flecken zu erkennen waren. Unwillkürlich spürte Oppenheimer den altbekannten Stich in seinem Inneren, als ihm bewusst wurde, dass es sich um getrocknetes Blut handelte. War die etwa zehn Kilometer lange Fahrt zum Funkturm mit dem unruhigen Beifahrer schon kein Vergnügen gewesen, machte es ihm noch viel weniger Spaß, dort einen zerschmetterten Körper betrachten zu müssen.
Noch ehe Oppenheimer sein Fahrrad zum Stehen gebracht hatte, sprang Ziehm vom Gepäckträger. Billhardts zweiter Assistent Reinmann war bereits am Fundort und lief geschäftig zum benachbarten Kassenhaus mit den markanten abgerundeten Ecken. Reinmanns tropfenförmige Nase war gerötet, er verlangsamte seine Schritte, kramte in der Manteltasche und blieb dann kurz stehen, um in ein Taschentuch zu schnäuzen. Als Reinmann erkannte, dass sein Kollege Ziehm zusammen mit Oppenheimer eingetroffen war, nickte er ihm freundlich zu, ehe er noch einmal seine Nase abwischte und in dem Kassengebäude verschwand.
Billhardt war an diesem Tag schlecht gelaunt. Er trat aus der Runde der geschäftigen Kriminaltechniker zurück und warf Oppenheimer einen verdrossenen Blick zu. »Und das kurz nach dem Mittagessen.«
»Ich dachte, du bist schon längst abgehärtet«, bemerkte Oppenheimer.
»An manche Dinge gewöhnt man sich eben nicht.« Billhardt zeigte zur Spitze des Turms. »Kein schöner Anblick, wenn jemand von da oben runterfällt.«
Oppenheimer runzelte die Stirn. »Oder er ist gesprungen«, formulierte er die andere Alternative. Beides schien nicht sehr wahrscheinlich. Er selbst war zweimal auf der Aussichtsplattform gewesen und konnte sich deutlich daran erinnern, dass sie mit Eisenstangen gesichert war. »Ich frage mich, wie er das geschafft haben soll. Die zwei Plattformen an der Turmspitze scheiden praktisch aus. Und selbst wenn er einen Weg gefunden hätte, die Barrieren dort irgendwie zu überwinden, dann wäre er ziemlich sicher auf dem Dach des Zwischengeschosses gelandet.« Oppenheimer taxierte die Turmkonstruktion. »Eine bessere Möglichkeit bieten die Treppenaufgänge. Gut, die sind bis zur Kopfhöhe gesichert, aber mit etwas athletischem Geschick ist das Metallgitter möglicherweise überwindbar.«
Billhardt verzog das Gesicht. »So weit sind wir auch schon gekommen. Immerhin hat der Tote ein Billett in der Tasche. Anhand der Nummer können wir recht genau eingrenzen, dass er gegen Mittag eingetroffen ist. Eine halbe Stunde später wurde seine Leiche entdeckt. In der Zeit waren fast vierzig Leute da oben. Und niemand will etwas gesehen haben.«
»Geht doch die Ticketnummern der übrigen Gäste durch. Wer in etwa zur selben Zeit eingetroffen ist, dürfte auch am ehesten etwas mitbekommen haben.«
Billhardts Augen blitzten auf, denn er verstand sofort, dass diese Herangehensweise eine Arbeitserleichterung versprach. »Gute Idee«, stimmte er zu. Seine Miesepetrigkeit war wie weggeblasen. »Aber du bist doch nicht hergekommen, nur um mir Tipps zu geben?«
Oppenheimer stutzte. Bei all seinen Spekulationen um die Todesumstände hatte er völlig vergessen, weswegen er Billhardt ursprünglich aufsuchen wollte.
»Es geht um einen Polizisten, den ich aus einem, nun ja, anderen Umfeld kenne«, begann Oppenheimer vorsichtig.
Billhardt war von dieser Andeutung unbeeindruckt. Er lachte gutmütig und hob dabei seinen verstümmelten Arm, dessen unteren Teil er an der Ostfront zurückgelassen hatte. »Als Polizist wurde niemand geboren.« Zwinkernd fügte er hinzu: »Außer du vielleicht.«
Ohne klüger zu sein, kehrte Oppenheimer eine Stunde später zur Polizeidienststelle zurück. Wenig überraschend hatte sich herausgestellt, dass Billhardt den Kleenen Hans nicht kannte und sich auch nicht an einen Polizisten erinnern konnte, auf den dessen Beschreibung passte. Dafür traf Oppenheimer in seinem Büro auf den Kriminaltechniker Hergesheimer, der sich gerade mit Wenzel unterhielt.
»Ah, da bist du ja, Richard«, sagte er, stand von seinem Stuhl auf und reichte Oppenheimer die Hand. »Sehr gut, das erspart es mir, die Ergebnisse ein zweites Mal durchzugehen.« Mit dem vollen Haarkranz erinnerte er Oppenheimer immer ein wenig an das Bild von Julius Caesar in seinem alten Lateinbuch. Nur die Brille passte nicht dazu.
»Die Hinzes sind nicht so unbescholten, wie sie vorgeben«, fasste Wenzel die Untersuchungsergebnisse vorab zusammen und grinste Oppenheimer zufrieden an.
Dem gerade entfachten Holzofen war es noch nicht gelungen, das Büro aufzuheizen, also behielt Oppenheimer den Mantel an. Er setzte sich hinter den Schreibtisch und zückte sein Notizheft. »Dann schieß mal los.«
Hergesheimer blätterte in seiner Heftmappe. »Das Messer, mit dem der Tote erstochen wurde, stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von ihm. Es handelt sich dabei um ein Fleischmesser mit stark abgerundeter Spitze, Klingenlänge elf Zentimeter, am Heft achtzehn Millimeter breit und verjüngt sich nahe der Spitze bis auf vierzehn Millimeter. Derartige Messer sind zum Stechen eher ungeeignet, am besten lässt sich mit ihnen schneiden. Der Griff besteht aus Horn, es befinden sich Fingerabdrücke des Toten darauf und auch die von Herrn Hinze. Die Klinge war nicht komplett in den Körper eingedrungen. Unmittelbar unter dem Heft haben wir auf dem freiliegenden Metall einen partiellen Abdruck von Frau Hinze gefunden.«
»Frau Hinze lügt also«, platzte Wenzel heraus. »Ihrer Behauptung zufolge hat der Einbrecher ein Messer gezückt. Ihr Mann stürzte sich auf den Eindringling und hat mit ihm darum gerungen. Keinerlei Erwähnung, dass sie es selbst angerührt hat.«
Oppenheimer ließ sich diese Argumentation durch den Kopf gehen. »Das scheint mir tatsächlich schwerwiegend zu sein. Andererseits kam sie erst später ins Wohnzimmer. Es spricht nichts dagegen, dass sich der Einbrecher erst in der Wohnung bewaffnet haben könnte.«
»Doch auch die Geschichte mit dem eingeschlagenen Fenster ist nicht stimmig«, wandte Wenzel ein.
»Etwa wegen der fehlenden Fußabdrücke im Gartenbeet?«
»Wegen der Glassplitter«, schaltete sich Hergesheimer ein. Er rückte die Brille auf der Nase zurecht und blickte in seine Aufzeichnungen. »An der Kleidung des Toten ließen sich keinerlei Glaspartikel nachweisen. Dafür haben wir auf einem Tuch feine Splitter gefunden. Es lag in der benachbarten Küche in der Spüle.«
»Ist doch klar, was geschehen ist«, sagte Wenzel. »Die Hinzes haben den Tatort nachträglich so präpariert, dass es nach einem Einbruch aussieht. Bestimmt haben sie selbst die Leiter an die Hauswand gestellt – einfach das Fenster geöffnet und sie runtergelassen. Vermutlich gehört sie ihnen. Die Leiter ist gerade mal zwei Meter lang, ließe sich also problemlos in der Wohnung aufbewahren.«
Oppenheimer fragte: »Gibt es denn Fingerabdrücke auf der Leiter?«
Hergesheimer schüttelte den Kopf. »Nur einige verwischte Abdrücke, nicht zu gebrauchen. Auf den Sprossen lassen sich auch keine Schuhprofile identifizieren.«
Zurückgelehnt auf dem Stuhl, versuchte Oppenheimer, sich den Tathergang vorzustellen. »Sagen wir mal, dass der Todesfall nicht geplant war. Das würde erklären, dass die Hinzes Fehler machten. Sie hatten nicht genügend Zeit, sich eine Strategie zurechtzulegen.«
»Oder sie waren einfach doof.«
Auf Wenzels Kommentar hin musste selbst der dröge Hergesheimer lächeln.
»Immerhin, Dummheit ist noch nicht strafbar«, fuhr Oppenheimer fort, »kann uns jedoch die Arbeit erleichtern. Also gut, nehmen wir an, dass die Hinzes ihre eigene Leiter von innen durch das Wohnzimmerfenster hinablassen, dann nimmt einer von ihnen das Küchentuch, um das Fenster einzuschlagen, ohne eine Schnittverletzung zu riskieren.«
»So in etwa«, stimmte Wenzel zu.
Oppenheimer hob den Zeigefinger. »Wurde Herr Hinze auch wirklich im Handgemenge mit dem Opfer verletzt?«
Wenzel kniff die Augen zusammen, während er Oppenheimers Gedankengänge nachvollzog. Erstaunt riss er sie wieder auf. »Sie meinen, dass sich der Hinze die Verletzung selbst zugefügt hat? Damit es nach einem Angriff aussieht?«
»Herr Hinze hat unfassbares Glück gehabt. Die Schnittwunden an den Handflächen sind nicht tief und können durchaus von dem Handgemenge herrühren. Die Stichverletzung hat sowohl die Organe als auch die Arterien verfehlt. Das ist schon einigermaßen verdächtig. Fett- und Muskelgewebe wurden durchtrennt, und Herr Hinze hat natürlich stark geblutet, bleibende Schäden sind aber nicht zu erwarten. Der behandelnde Arzt will ihn ein paar Tage zur Beobachtung dabehalten, und das war’s auch schon.«
»Wenn man also eine Stichwunde kassiert, dann am besten auf diese Weise«, sinnierte Wenzel. »Benötigt man dazu nicht medizinisches Fachwissen? Damit kein lebenswichtiges Organ verletzt wird?«