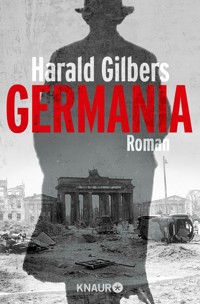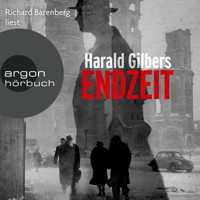9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Fesselnd, authentisch, hoch atmosphärisch: Kalter Krieg in Berlin und ein perfider Frauenmörder In »Tanzpalast«, dem 8. Band der historischen Krimi-Reihe von Harald Gilbers, jagt Kommissar Oppenheimer einen Serienmörder, der seine weiblichen Opfer als Heilige inszeniert. Berlin, 1950: Eine junge Frau, die als vermisst gemeldet war, wird schließlich ermordet aufgefunden, ihre Leiche inszeniert wie eine Heiligenikone. Das Brisante: Sie hatte eine Affäre mit einem amerikanischen Offizier. Gab es ein persönliches Motiv, sollte eine »Volksverräterin« bestraft werden, oder stecken gar die Russen hinter dem Mord? Kommissar Oppenheimer und seine scharfsinnige neue Assistentin Fräulein Murr werden bei dem undurchsichtigen Fall vom afroamerikanischen Zeugen Eugene Peters unterstützt. Doch obwohl das ungleiche Trio unter Hochdruck verschiedenen Spuren folgt, kommen die Ermittlungen nicht recht voran. Dann verschwindet die Ehefrau eines zweiten US-Offiziers, und der Fall spitzt sich dramatisch zu … Harald Gilbers wurde für seine Krimi-Reihe um den jüdischen Kommissar Richard Oppenheimer mit dem Friedrich-Glauser-Preis und dem Prix Historia ausgezeichnet. Die historischen Kriminalromane machen das Berlin der letzten Kriegsjahre und der Nachkriegszeit hochspannend und hautnah erleb- und begreifbar. Die Krimis um Kommissar Oppenheimer in chronologischer Reihenfolge: - Germania (1944) - Odins Söhne (1945) - Endzeit (1945) - Totenliste (1946) - Hungerwinter (1947) - Luftbrücke (1948) - Trümmertote (1949) - Tanzpalast (1950)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Harald Gilbers
Tanzpalast
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin, 1950: Eine junge Frau, die als vermisst gemeldet war, wird schließlich ermordet aufgefunden, ihre Leiche inszeniert wie eine Heiligenikone. Das Brisante: Sie hatte eine Affäre mit einem amerikanischen General. Gab es ein persönliches Motiv, sollte eine »Volksverräterin« bestraft werden, oder stecken gar die Russen hinter dem Mord?
Kommissar Oppenheimer und seine scharfsinnige neue Assistentin Fräulein Murr werden bei dem undurchsichtigen Fall vom afroamerikanischen Zeugen Eugene Peters unterstützt. Doch obwohl das ungleiche Trio unter Hochdruck verschiedenen Spuren folgt, kommen die Ermittlungen nicht recht voran. Dann verschwindet die Ehefrau eines US-Offiziers, und der Fall spitzt sich dramatisch zu …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Nachwort des Autors
Literaturhinweise
1
Dienstag, 23. Mai 1950 – Mittwoch, 24. Mai 1950
Jeder wusste, dass die Wüste Propheten und Skorpione hervorbrachte. Er fragte sich, was das für die Einöden der Neuzeit bedeutete, die nicht aus Sand, sondern aus Trümmern bestanden. Was brachte zum Beispiel der Moloch namens Berlin hervor? Das Beste oder das Schlimmste? Oder beides gleichzeitig?
Mit hochgeklapptem Kragen und in die Stirn gezogenem Hut schlenderte der Mann den regenfeuchten Ku’damm entlang und hing diesen Gedanken nach. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Ein warmer Tag kündigte sich an. Obwohl die Temperaturen angenehm waren, fiel unentwegt Regen aus den Wolkenmassen. Ziellos streifte der Mann durch die Stadt. Die Angestellten würden frühestens in einer Stunde zur Arbeit strömen. Die leeren Gehsteige kamen ihm gerade recht. Die Unruhe in seinem Inneren war zu groß, um sich auf den Weg zu konzentrieren und Kollisionen zu vermeiden.
Das Gefühl ließ sich schlecht einordnen. Vielleicht war es ja nicht Unruhe, sondern Vorfreude darüber, dass die Frau bald wieder erwachen würde? Dass er eine neue Mission gefunden hatte, die seiner würdig war? Die Straßen waren überfüllt von Götzendienerinnen wie dieser Frau. Wahllos eine von ihnen zu ergreifen fand der Mann jedoch indiskutabel. Es gab den einfachen Weg, und es gab den richtigen Weg. In seinem Leben hatte er sich nie gescheut, den richtigen zu wählen, auch wenn er noch so beschwerlich war.
Im Vorfeld sicherzustellen, dass sein nächster Gast für ihn alle Voraussetzungen erfüllte, war nur der erste Schritt von vielen. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Ergreifung der Frauen. Es musste rasch geschehen und durfte kein Aufsehen erregen. Diese Fertigkeit hatte sich der Mann mittlerweile angeeignet. Doch das allein gab ihm keine Befriedigung. Schließlich handelte es sich dabei nur um die unabdingbare Vorarbeit. Die Ouvertüre zu dem eigentlichen Stück. Erst danach folgte die Phase, auf die es ihm wirklich ankam.
Die Gedanken des Mannes kreisten um die Frage, was geschehen würde, wenn die Frau erkannte, dass sie sich in seinem Gewahrsam befand. Er machte sich keine Illusionen. Zweifellos würde sie es nicht verstehen, genau wie alle anderen vor ihr. Er stellte sich das Entsetzen in ihrem Gesicht vor, wenn sie sich in dem kahlen Zimmer wiederfand und vergeblich an der Tür rüttelte.
Das Licht von Scheinwerfern erfasste den Mann. Ein Auto raste dicht neben ihm durch eine Pfütze und bespritzte seine Beine mit Regenwasser. Viel zu spät sprang der Mann zur Seite. Als er sich mit nassen Schuhen erneut der Straße zuwandte, erkannte er einige Hundert Meter vor sich den Altarraum der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Vor dem blassen Morgenhimmel waren die zerklüfteten Mauern mehr zu erahnen als zu sehen. Die Fensterhöhlen waren leer, das Dach eingestürzt. Zwei der ehemals drei schmalen Seitentürme standen noch und erinnerten an marode Zahnhälse. Allerdings hatte nicht Karies die Löcher in die Fassade gerissen, sondern schwere Geschütze. Zwischen den beiden Zinnen ragte der massive Hauptturm in die Höhe, nur fehlte dort oben die Spitze mit dem Kruzifix.
Der Mann erstarrte mitten in der Bewegung. Die Sonne würde bald aufgehen. Als er seinen Arm hob, um auf die Armbanduhr zu blicken, begriff er, dass er seit fast einer Stunde unterwegs war. Die Wirkung des Beruhigungsmittels würde in Kürze nachlassen. Schon bald würde die Frau aufwachen. Er musste sich sofort auf den Rückweg machen, wenn er das mitbekommen wollte.
Der Mann beschleunigte seine Schritte. Er liebte es, dabei zuzusehen, wie seine Gäste allmählich ihr Bewusstsein wiedererlangten. Die ersten Stunden nach dem Erwachen waren die wichtigsten. Auf den ersten Blick mochten ihre Reaktionen ähnlich sein, und doch hatte der Mann mit der Zeit ein besonderes Gespür dafür entwickelt, hinter die Fassade des Entsetzens zu blicken. Es gab wertvolle Hinweise darauf, ob seine Arbeit mit den Götzendienerinnen schwerfallen oder einfach sein würde. Letztendlich war es eine Frage der richtigen Herangehensweise. Der Mann hatte unterschiedliche Methoden entwickelt. Selbst wenn die Frauen noch so verstockt sein mochten, bislang war er immer ans Ziel gelangt.
Aus seinen beschleunigten Schritten wurde ein Traben. Schließlich begann er zu rennen. Falls er doch jemandem auf dem leeren Prachtboulevard auffallen sollte, gab es immer noch den plausiblen Grund, dass er in dem prasselnden Regen trocken nach Hause kommen wollte.
Niemand würde die Frage stellen, was dort auf ihn wartete.
Am folgenden Nachmittag fuhr Oppenheimer den Ku’damm entlang. Mit seinem Rad war irgendetwas nicht in Ordnung. Seine Waden brannten wie die Hölle, denn auf den letzten Metern hatte er tüchtig in die Pedale treten müssen, um sich überhaupt noch fortzubewegen. Es begann wieder zu schütten, also schlug er kurzerhand den Lenker ein und bremste in einer überdachten Hofeinfahrt ab.
Wenigstens konnte er hier geschützt vor dem Regen die Reifen begutachten. Ein wenig ungelenk beugte er sich nach vorn und bekam seinen Verdacht augenblicklich bestätigt. Der hintere Reifen war platt. Und mit der Luftpumpe ließ sich da auch nichts mehr machen. In dem Profil klaffte ein langer Riss, sogar der Luftschlauch war durchstochen.
Oppenheimer fluchte still in sich hinein. An dem zusammengeflickten Drahtesel musste er nun ein weiteres Bauteil ersetzen. Von dem ursprünglichen Fahrrad waren nur noch der Rahmen und der Gepäcksattel übrig. Auf jeden Fall konnte er so nicht weiterfahren. Er verwarf seine Idee, das Fahrrad durch den Regen nach Hause zu schieben. Die Rio Bar seines guten Freundes Ede erschien ihm als eine bessere Lösung. Sie lag nur wenige Hundert Meter entfernt, und Ede würde ihm sicher erlauben, das fahruntüchtige Rad vorübergehend im Hinterhof abzustellen.
Während Oppenheimer noch den Reifen betrachtete und sich ausrechnete, was ein neuer wohl kosten würde, glitt unweit von ihm eine Limousine an den Straßenrand. Rasch warf er einen Blick zur Seite. Zuerst sah er nur seine eigene Reflexion auf dem polierten schwarzen Lack. Dann erkannte er hinter dem Steuer die scharf umrissene Kontur eines Chauffeurs mit Schirmmütze. Den Fahrer schien es nicht zu kümmern, dass er mit seinem Luxusschlitten die Einfahrt blockierte.
Oppenheimer packte mit beiden Händen den Lenker seines Fahrrads und wollte sich bereits auf den Weg zur Rio Bar machen, als ihn eine Frauenstimme zurückhielt.
»Richard? Bist du das?«
Fragend richtete er sich auf. Die hintere Autotür war geöffnet. Eine Dame in einem weißen Kleid beugte sich ihm entgegen.
Erst als unter dem Hut die feuerroten Haare aufblitzten, erkannte Oppenheimer die Frau.
»Rita«, rief er erstaunt. »Wo kommst du denn her?«
Rita winkte ihn zu sich ins Auto. »Ich hab dich gesucht. Komm, mach ’nen Satz!«
Er wies auf sein Rad. »Mir ist gerade ein Malheur passiert. Ich wollte das Rad bei Ede abstellen.«
Rita überlegte kurz. »Also gut. Treffen wir uns eben dort!« Sie lehnte sich zurück und zog mit der gleichen Bewegung die Tür zu.
Ritas Chauffeur musste die breite Straße zunächst weiterfahren, bis er eine Möglichkeit fand, die Schienen der Straßenbahn zu überqueren. Als der Wagen vor der Rio Bar anhielt, erwartete Oppenheimer sie bereits. Ohne auf eine erneute Einladung zu warten, sprang er durch den Regen und stieg rasch ein.
Rita grinste. »Kompliment! Hurtig wie eine Gazelle.«
»Mach dich nur lustig über mich.« Oppenheimer seufzte. Er war Ritas Frotzelei gewohnt. Seitdem sie in der Rio Bar ihr Geld als Stripteasetänzerin verdient hatte, schien sich das nicht geändert zu haben.
Oppenheimer bemerkte die Ledersitze. Sofort machte er Anstalten, seinen feuchten Mantel auszuziehen, doch Rita winkte ab.
»Lass mal. Nachher wischt Marius drüber, dafür wird er ja bezahlt.«
Damit schien sie den Chauffeur zu meinen, der Oppenheimer im Rückspiegel auch prompt einen strengen Blick zuwarf. Er schloss die Tür, und Marius ließ die Kupplung kommen. Eingeschüchtert lehnte sich Oppenheimer zurück und warf Rita einen langen Seitenblick zu. Ihre grünen Augen blitzten verschmitzt. In einer derart eleganten Aufmachung hatte er sie bislang noch nie gesehen. Er kannte sich mit Kleidern nicht aus, doch der schimmernde Stoff war keine Billigware.
Die Narbe auf Ritas Wange war dick überschminkt, sodass sie im gedämpften Licht des Regentags kaum auffiel. Damals war sie in eine Konfrontation zwischen Ede und einer Bande russischer Deserteure um die Kontrolle der Unterwelt geraten. Wie bei allen Berlinern hatte das Kriegsende auch bei Rita Spuren hinterlassen. Doch aufkeimende Gedanken an die unschöne Vergangenheit wurden von ihnen meistens ignoriert. Und vor allem jetzt, wo sich das Leben in der Stadt wieder ein wenig normalisiert hatte.
Nachdem die Sowjetadministration vor etwas mehr als einem Jahr die Blockade der westlichen Stadtsektoren aufgehoben hatte, wurde Ende September schließlich auch die Luftbrücke offiziell wieder eingestellt. Obwohl die Versorgungstransporte nach Berlin auf ihrer Route quer durch das sowjetisch kontrollierte Territorium auch weiterhin behindert wurden, durfte fortan alles verkauft werden, was in die Läden gelangte. Die Lebensmittelrationierung, die seit Beginn des Krieges den Alltag weitgehend bestimmt hatte, war endlich vorbei.
Überschattet wurden diese Erleichterungen allerdings unverändert von der Konfrontation der Großmächte. Oppenheimer ahnte, dass die Einstellung der Blockade nur eine Galgenfrist bedeutete, bis die Feindseligkeiten von Neuem hochkochen würden. Mittlerweile gab es offiziell zwei deutsche Staaten: im Westen die Bundesrepublik Deutschland und im Osten die Deutsche Demokratische Republik. Eine Wiedervereinigung der zerstrittenen Brüder zu einem gesamtdeutschen Staat wurde von der Bevölkerung zwar herbeigesehnt, erschien jedoch zunehmend unwahrscheinlich. West und Ost hatten sich in den letzten Jahren politisch und wirtschaftlich ohnehin auseinanderentwickelt. Diese Spaltung war jetzt auch formal endgültig besiegelt.
Oppenheimer war nicht wirklich überrascht, Rita plötzlich mitten in Berlin in einer teuren Limousine zu begegnen. Schließlich war sie eine Überlebenskünstlerin. Und doch wunderte er sich, wie es dazu gekommen war.
»Du bist also auf die Butterseite gefallen?«, fragte er.
»Wie man es nimmt«, antwortete Rita leichthin. »Ich hab ’nen Sponsor gefunden. Er ist ein ganz hoher Offizier von den Amis. It’s really a big deal! Jetzt muss ich mich nicht mehr vom fremden Pöbel anglotzen lassen. Ich gebe nur noch Privatvorstellungen!«
Beifall heischend wandte sie sich ihm zu. Oppenheimer fiel auf Anhieb keine intelligente Antwort ein, also stellte er fest: »Du hast also einen Liebhaber der schönen Künste gefunden.«
»Na ja, ’n Zuckerschlecken isset auch nicht grade. Die Männer sind alle gleich gestrickt. Whatever, wenigstens ist mein Ami nicht nur anspruchsvoll, sondern auch spendabel.«
Oppenheimer freute sich für Rita und auch für sich selbst, da ihm das Schicksal nun im strömenden Regen eine unerwartet komfortable Mitfahrgelegenheit bescherte. Hinter den Seitenfenstern glitt der Boulevard des Ku’damms vorbei. Weil der Chauffeur einfach stur geradeaus fuhr, fragte Oppenheimer: »Wohin fahren wir überhaupt?«
»No idea«, antwortete Rita ihm auf Englisch. »Musst du wohin?«
Oppenheimer zuckte mit den Schultern. »Eigentlich bin ich auf dem Nachhauseweg.«
Rita ließ sich die Adresse geben und beugte sich dann vor, um ein paar Worte mit Marius zu wechseln, dann sank sie wieder in den weichen Sitz zurück. »Schon erledigt! Wir sind auf dem Weg.«
Einige Augenblicke später setzte ihr Fahrer bereits den Winker und bremste ab, um zum Fehrbelliner Platz abzubiegen.
Rita fuhr im Plauderton fort: »Und was ist mit dir? Bei Ede arbeitest du nicht mehr?«
Oppenheimer schüttelte den Kopf. Unmittelbar nach dem Krieg hatte er ein paar Monate bei Edes Stripteaseshows als Beleuchter gearbeitet, und das auch nur, weil es keine andere Stelle für ihn gegeben hatte. »Nein, ich bin schon längst wieder bei der Kripo. Du hast mich grade an meinem freien Tag erwischt.«
Die weiteren Details ersparte er Rita. Nach einem besonders vertrackten Mordfall hatte er vom Dienststellenleiter Seeßlen endlich die Erlaubnis bekommen, einen Teil seiner angesammelten Urlaubstage zu nehmen. Trotzdem stand ihm an diesem Wochenende ein außerplanmäßiger Einsatz bevor, weil im Ostteil der Stadt ein dreitägiges Deutschlandtreffen der kommunistischen Jugendorganisation FDJ angesetzt war. Es waren große Propagandaveranstaltungen geplant, die Teilnehmerzahl wurde vorab auf eine halbe Million geschätzt. Hartnäckige Gerüchte kursierten, dass auch ein Aufmarsch in den westlichen Stadtsektoren auf dem Programm stand, was zweifelsohne eine Menge Stunk verursachen würde. In dieser aufgeheizten Situation erschien alles denkbar, selbst handgreifliche Auseinandersetzungen. Und so waren Oppenheimer und einige seiner Kollegen zum Bereitschaftsdienst verdonnert worden.
Rita nickte. »Du bist also wieder Bulle? Sehr gut, darauf hatte ich gehofft.«
Oppenheimer stutzte, denn ihm war nicht bewusst gewesen, dass Rita von seinem angestammten Beruf überhaupt eine Ahnung hatte.
»Du musst mir helfen«, fuhr sie fort. Plötzlich klang sie nicht mehr so unbeschwert. »Du hast ja sicher gute Kontakte, nicht wahr? Eigentlich geht es nicht um mich, sondern um eine Freundin.«
»Ich bin bei der Mordkommission.« Als er Ritas bestürztes Gesicht sah, lachte er auf. »Ich möchte nicht hoffen, dass du einen dringenden Bedarf hast, der in mein Metier fällt. Aber natürlich kann ich mich für dich umhören. Worum handelt es sich?«
»Ich habe keine Ahnung, ob es sich um einen Mord dreht. Und genau das ist es ja. Ich weiß gar nichts und werde langsam verrückt!«
Oppenheimer legte ihr die Hand auf den Arm, woraufhin sie sich wieder beruhigte.
»Meine Freundin Lotte ist verschwunden. Am Montagabend habe ich sie noch gesehen. Heute wollte ich sie treffen, aber sie ist nicht aufgetaucht. Das sieht ihr nicht ähnlich, also habe ich mich bei Bekannten erkundigt. Seit gestern hat sie niemand mehr gesehen.«
Rita war bisher immer ausgesprochen optimistisch gewesen. Wenn sie jetzt den Teufel an die Wand malte, musste die Angelegenheit tatsächlich ernst sein. Wie auch sonst in einer solchen Situation versuchte Oppenheimer instinktiv zu beschwichtigen.
»Ihr Verschwinden könnte viele Gründe haben. Vielleicht wollte sie in den Ostsektor und wurde dort aufgehalten. Oder sie ist überraschend verreist.«
Rita schüttelte entschieden den Kopf. »Lotte verreist nicht, ohne alles drei Monate im Voraus zu planen. Sie ist keine spontane Person. Deshalb verstehe ich es nicht. Wenn sie ein Treffen arrangiert und dann ohne einen Pieps nicht auftaucht, das ist schon verflucht merkwürdig, wenn man Lotte kennt!«
Oppenheimer nickte. »Wir können sofort auf der nächsten Polizeiwache eine Vermisstenanzeige aufgeben. Das müsstest du in jedem Fall selbst machen, weil du eine Bekannte von Lotte bist.«
»Und bringt das auch was?«
»Das kann man nicht wissen. In den meisten Fällen ist es nur ein Missverständnis, und die Vermissten tauchen nach einer kurzen Zeit wieder auf. Es gibt einfach zu viele Fälle, um sie alle lückenlos zu bearbeiten. Eine Fahndung wird normalerweise nur bei der begründeten Annahme eingeleitet, dass sich die vermisste Person in Lebensgefahr befindet. Gibt es denn einen Hinweis für eine solche Gefahr? Ich nehme an, dass Lotte nicht hilflos oder suizidgefährdet ist?«
Mit gerunzelter Stirn starrte Rita ihn an. »Nein, das gerade nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist.«
»Wurde etwa in Lottes Wohnung eingebrochen?«
Erneut schüttelte Rita den Kopf. »Sie ist in einer Position, die andere Leute ausnützen könnten.« Sie beugte sich vor und sagte mit gesenkter Stimme: »Sie hat sich auch ’nen Ami geangelt. Na ja, du weißt ja, was die Leute so denken. Alles Idioten, Amis sind in deren Augen ja sofort steinreich und so …«
»Du gehst also von einem Erpressungsversuch aus?«
Rita erhob entschuldigend die Hände. »Einen anderen Reim kann ich mir darauf nicht machen!«
Oppenheimer schob den Hut in den Nacken und rieb sich die feuchte Stirn. Der Chauffeur lenkte das Auto gerade über die Kolonnenbrücke. Nur noch wenige Hundert Meter trennten sie von Oppenheimers Einzimmerwohnung in der Villa seiner guten Freundin Hilde. Kurz entschlossen rückte er auf die vordere Kante des Sitzes und klopfte an die Trennscheibe. Mit einer routinierten Bewegung schob Marius das Glas zur Seite.
»Wir fahren jetzt doch weiter«, kündigte Oppenheimer an. »Zum Polizeipräsidium in der Friesenstraße!«
Bereits eine Stunde später befanden sie sich wieder auf der Rückfahrt. Es war Oppenheimer gelungen, die Angelegenheit schnell zu regeln. In der Polizeiwache wurde ihm bestätigt, dass Lottes Hausverwalter bereits eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Seinen Kollegen bei der Kripo wiederum war nichts von einer Lösegeldforderung bekannt.
Oppenheimer nutzte die Abgeschiedenheit der geräumigen Limousine, um sich bei Rita nach weiteren Details über ihre verschwundene Freundin zu erkundigen. Ihren Angaben zufolge hieß Lottes Liebhaber Wharton und bekleidete den Rang eines Lieutenant Colonel. Wenn es sich bei der Angelegenheit tatsächlich um einen erpresserischen Menschenraub handelte, würden die Entführer zuerst ihn kontaktieren. Zur Westberliner Kripo war nichts durchgesickert, also mutmaßte Oppenheimer, dass Wharton entweder stillschweigend zahlen wollte oder bereits die amerikanische Militärpolizei eingeschaltet hatte.
Rita konnte diese Frage nicht beantworten.
»Den Wharton habe ich vielleicht zwei- oder dreimal bei einem Dinner gesehen«, erklärte sie. »Wir haben nur ein paar Floskeln gewechselt. Er scheint recht knickrig zu sein. Lotte hat sich wiederholt beklagt, wie knapp sie bei Kasse ist. Wenigstens zahlt er ihre Miete. Obwohl sie nicht zusammenleben, ist Lotte für ihn hier in Berlin so eine Art Zweitfrau. Gelegentlich begleitet sie ihn sogar zu offiziellen Anlässen.«
Oppenheimer runzelte die Stirn. »Und die anderen Offiziere denken sich nichts dabei?«
»Die Jungs sind doch fern der Heimat!« Rita lachte auf und schüttelte über Oppenheimers Naivität den Kopf. »Fast alle von ihnen halten das so. Gentleman’s Agreement, verstehste?«
»Auf jeden Fall scheint Wharton nicht jemand zu sein, der freiwillig einen großen Geldbetrag hinlegt. Selbst wenn seine Begleiterin entführt wird.«
»Kann sein. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht so gut.«
Das alles hörte sich für Oppenheimer so an, als würde er von Wharton persönlich wohl die besten Hinweise bekommen.
Unruhig rutschte er auf dem Ledersitz herum. »Wie komme ich an diesen Wharton heran? Wie ich dich kenne, hast du sicher Kontakte, die du anzapfen könntest.«
»Du willst den Fall also übernehmen?«
»Nicht so eilig. Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt ein Fall ist. Aber ich werde mir die Sache mal anschauen.«
Als Rita laut jauchzend Oppenheimer um den Hals fiel, rutschte ihm fast der Hut vom Kopf.
2
Mittwoch, 24. Mai 1950
In Hildes Villa angekommen, hängte Oppenheimer seinen regenfeuchten Mantel sofort an die Garderobe. Die holzgetäfelte Vorhalle, in der er stand, war seiner Meinung nach eine Monstrosität. Aber das traf auf nahezu alles in diesem Haus zu, denn der verblichene Erbonkel seiner guten Freundin hatte beim Bau des riesigen Kastens an nichts gespart. Um von einem Zimmer zum nächsten zu gelangen, musste man lange Korridore entlangwandern. Selbst für eine Großfamilie war die Villa zu groß, in den zahlreichen Einzelzimmern wiederum gab es gerade mal ausreichend Platz für zwei Personen und ein Doppelbett. Auch Hilde hatte das als frischgebackene Eigentümerin der Villa rasch erkannt und die beste Lösung gefunden. Sie selbst war in das viel gemütlichere Chauffeurhäuschen nebenan gezogen, um die einzelnen Zimmer im Hauptgebäude vermieten zu können.
Oppenheimers Mitbewohner waren an diesem Nachmittag nicht zu sehen. Vermutlich befanden sie sich in ihren Zimmern oder in der Kellerküche, dem eigentlichen Treffpunkt für die Mieter. Da Oppenheimer sich nach seiner Radfahrt im Regen immer noch etwas klamm fühlte, lief er über die Holztreppe ins erste Stockwerk, um sich in seinem Zimmer trockene Kleidung anzuziehen. Lisa würde bald kommen, und er wollte seine freie Zeit nutzen, um mit seiner Frau gemeinsam zu Abend zu essen. Oppenheimer freute sich auf diesen ungewohnten Luxus, denn meistens hielten ihn seine Ermittlungen so sehr auf Trab, dass er unterwegs aß, wenn er gerade mal daran dachte.
An sich hätte er dünn wie eine Spargelstange sein müssen. In der langen Zeit der Rationierungen hatte es für die Bevölkerung meistens nur künstliche Ersatzlebensmittel und Kartoffeln in allen erdenklichen Varianten gegeben. Und Oppenheimer hatte während des Dritten Reichs als Jude extra geringere Zuteilungen bekommen, ehe er schließlich mit Hildes Unterstützung untergetaucht war, was ihn vor den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten rettete. Jetzt war in den Läden alles wieder zu bekommen, und Oppenheimer fand, dass es viel nachzuholen gab. In der letzten Zeit hatte er eine verhängnisvolle Vorliebe für Kuchenbrot entwickelt, das prächtig zu rabenschwarzem Kaffee passte. Sein Bild im Spiegel des Kleiderschranks zeigte immer noch eine kantige Schulterpartie, allerdings gesellte sich mittlerweile knapp über dem Hosenbund ein Rettungsring dazu.
Lisa bewahrte ihre Vorräte nicht in der Kellerküche auf, sondern in ihrem Zimmer. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sogar diese Vorsichtsmaßnahme die Langfinger unter den Nachbarn nicht abschreckte, war es Oppenheimer zu bunt geworden, und er hatte die begehrten Lebensmittelkonserven aus den CARE-Paketen seiner Schwester bei Hilde verstaut, sodass sich in ihrem Zimmer nur noch angebrochene Waren und Essensreste befanden, die später aufgewärmt wurden. Oppenheimer öffnete die Kommode, in der sie gelagert waren. In der abgedeckten Kasserolle befand sich der Rest der gestrigen Graupensuppe. Bereits bei dem Gedanken daran lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Aber es würde für sie beide nicht mehr ganz ausreichen, und von dem Brot war nur noch ein schmales Endstück übrig.
Oppenheimer beschloss, eine kurze Stippvisite beim Bäcker zu machen, um einen neuen Laib zu kaufen. Eine Dreiviertelstunde später kehrte er mit einem vollen Einkaufsnetz zurück, denn er hatte noch andere Leckereien gefunden, auf die er nicht verzichten wollte.
Er verstaute die Backwaren in seinem Zimmer und lief dann nach unten mit der Absicht, in der Kellerküche eine Kanne Ersatzkaffee aufzubrühen. Oppenheimer kam nur bis in die Vorhalle, denn dort wartete Besuch auf ihn.
»Ah, Herr Oppenheimer«, schallte ihm bereits auf der Treppe die Stimme seiner Mitbewohnerin Frau Schmude entgegen. »Besuch für Sie. Ich wollte Sie gerade holen!«
Die Frau war Mitte vierzig und eine elegante Erscheinung. Mit ihrer aufrechten Haltung und den hochtoupierten blonden Haaren war ein größerer Kontrast zu ihrem Begleiter kaum denkbar. Es handelte sich um einen grauen Herrn mit einer Augenklappe und einer penibel gebundenen Krawatte.
Oppenheimer blieb überrascht stehen und lachte auf.
»Herr Furmannek, was führt Sie hierher?«
Furmannek wirkte eigenartig bedrückt. An diesem Tag ähnelte er mehr wie sonst einem Leichenbestatter. »Herr Oppenheimer, ich bin hier, um eine Angelegenheit zu regeln.« Nach einem raschen Seitenblick zu Frau Schmude fügte er hinzu: »Eine Behördenangelegenheit, vertraulich.«
Frau Schmude verstand den Wink mit dem Zaunpfahl, entschuldigte sich und verschwand in den Keller.
Vor vier Jahren hatte Oppenheimer eine Weile für den Deutschen Suchdienst gearbeitet, der Kriegsheimkehrer mit ihren Familien zusammenführte, und Furmannek war dort sein Kollege gewesen. Oppenheimer bekam ein flaues Gefühl im Magen, denn er ahnte, dass sich die Angelegenheit nur um ihr Ziehkind Theo drehen konnte.
In der Küche war es sicher für ein vertrauliches Gespräch zu voll, also führte er Furmannek notgedrungen in sein Zimmer.
Um Konversation zu machen, fragte er auf der Treppe: »Und arbeiten Sie immer noch beim Suchdienst?«
Furmannek seufzte schwer. »Die Arbeit geht uns leider nicht aus. Die Westmächte haben die deutschen Kriegsgefangenen mittlerweile zurückgeschickt, und doch bleiben immer noch viele verschollen. Die Sowjets behaupten, dass sie ebenfalls alle Deutschen freigelassen hätten, aber nur zwei Millionen sind zurückgekehrt. Also sind anderthalb Millionen Männer spurlos verschwunden. Das gibt Anlass zu den schlimmsten Befürchtungen.«
Oppenheimer brummte zustimmend. Da er in einem Speziallager für feindliche Elemente die Willkür des stalinistischen Staatsapparates am eigenen Leib erfahren hatte, wunderte es ihn nicht, dass viele Gefangene eine solche Tortur nicht überlebten und der Kreml alles daransetzen würde, um das zu vertuschen.
In seinem Zimmer bot er Furmannek einen Stuhl an dem kleinen Tisch vor dem Dachfenster an. Als guter Gastgeber holte Oppenheimer das in Wachspapier eingeschlagene Gebäck hervor. Noch ehe er Furmannek ein Stück anbieten konnte, sagte dieser: »Es geht um Ihr Ziehkind. Theo Kallinich heißt er, wenn ich mich recht entsinne?«
Oppenheimer blieb, ein Stück Kuchenbrot in der Hand, stehen und starrte Furmannek an. Dieser sagte erst einmal nichts mehr, also fragte er: »Hat sich etwa ein Familienmitglied gemeldet?«
»Es scheint zumindest so«, antwortete Furmannek vorsichtig. Er rückte den steifen Kragen seines Hemds zurecht, obwohl dieser tadellos saß. »Ein Mann ist aus Russland zurückgekommen, ein gewisser Meinolf Kallinich. Er behauptet, dass Theo sein Sohn ist.«
Plötzlich wurde es Oppenheimer schwindlig. Es fühlte sich so an, als würde die ganze Energie aus ihm entweichen. Im letzten Augenblick ergriff er die Lehne des zweiten Stuhls und ließ sich darauf fallen.
Furmannek war aufgesprungen und stand bereits neben ihm. »Mein Gott, Herr Oppenheimer, geht es Ihnen gut?«
Oppenheimer rang keuchend nach Luft. In seinem Brustkorb stach es.
»Es geht schon«, ächzte er. »Ich muss nur ein bisschen sitzen. Könnten Sie mir vielleicht aus dem Bad ein Glas Wasser holen?«
Furmannek brauchte nicht lange, um einen gefüllten Zahnputzbecher zu bringen. Oppenheimer trank einen Schluck und atmete tief durch. Konfrontiert mit Furmanneks besorgtem Blick, wiegelte er ab: »Dieses verrückte Wetter. Mein Kreislauf macht das nicht mit.«
Furmannek nickte, doch er schien nicht überzeugt zu sein.
Mit heiserer Stimme fragte Oppenheimer: »Ist es sicher? Dass dieser Mann Theos Vater ist? Wurden die Personalien überprüft? Kann er überhaupt Papiere vorlegen?«
Ehe er antwortete, setzte sich Furmannek wieder auf seinen Platz. »Nur keine unnötige Aufregung, Herr Oppenheimer. Die Überprüfung steht noch aus, und Sie wissen ja, wie gründlich wir vorgehen. Zumindest seine bisherigen Angaben stimmen so weit. Herr Kallinich wird nach Berlin kommen, und dann gehen wir alles durch.«
Oppenheimer schaute aus dem Fenster nach draußen. Aus dem wolkenverhangenen Himmel fielen wieder Regentropfen.
»Ich hatte doch für Theo bereits eine Anfrage gestartet«, murmelte er. »Seine Mutter wurde noch nicht aufgespürt?«
Furmannek runzelte die Stirn. »Weder die Mutter noch andere Verwandte haben sich bei uns gemeldet. Herr Kallinich ist unser erster Kontakt.«
Nachdem Furmannek versprochen hatte, ihn auf dem Laufenden zu halten, verabschiedete er sich. Oppenheimer hatte den ersten Schock so weit verarbeitet, dass er wieder klar denken konnte. An sich war damit zu rechnen gewesen, dass sich früher oder später ein Verwandter von Theo melden würde. Jetzt war das Unvermeidliche eben geschehen, und sie mussten das Beste daraus machen.
Der Schwächeanfall war vorüber, und Oppenheimer ahnte, dass er sich doch nur wieder aufregen würde, wenn er in seinem Zimmer blieb und düsteren Gedanken nachhing. Eine viel bessere Idee war es, nach unten zu gehen und den Ersatzkaffee aufzusetzen.
Noch ehe das Wasser zu kochen begann, erschien Lisa in der Kellerküche. Wie üblich trug sie noch die dunkelblaue Uniform der britischen Luftfahrtgesellschaft British European Airways. Oppenheimer fand, dass sie mit dem steifen Pillbox-Hut auf ihren dunkelbraunen Haaren überaus vornehm wirkte. Lisa war am Flughafen Gatow eingesetzt und musste jeden Tag fast drei Stunden in der Bahn zubringen, um zur Arbeit und zurück zu kommen. Trotz ihrer Erschöpfung zuckte sie bei Oppenheimers Anblick zusammen.
»Warum bist du so bleich?«, fragte sie.
Frau Schneider befand sich mit ihren zahlreichen Kindern ebenfalls in der Küche. Sie stand am Herd und bereitete das Essen zu, was sie aber nicht daran hinderte, neugierig die Ohren zu spitzen. Trotz der indiskreten Zuhörerin glaubte Oppenheimer, Lisa eine Erklärung schuldig zu sein. Noch ehe er eine Andeutung machen konnte, drängelte bereits Theo um sie herum. Der Junge polterte zu seinem angestammten Platz am langen Küchentisch.
Oppenheimer stand auf, strich mit der Hand über Theos Wuschelkopf und näherte sich Lisa. Er küsste sie auf die Wange und wisperte dann: »Der Furmannek war hier.«
Lisa riss die Augen auf, denn sie wusste genau, was dieser Besuch zu bedeuten hatte. Oppenheimer bestätigte ihren Verdacht mit einem angedeuteten Nicken und ging dann zu dem pfeifenden Wasserkessel, um den Ersatzkaffee aufzugießen.
Es gelang Lisa, ihren Schrecken zu überspielen. Nach einer Tasse von dem Muckefuck verschwand sie nach oben, um sich umzuziehen, und kam mit der Graupensuppe und dem frischen Brot zurück. Ahnungslos schaufelte Theo das Essen in sich hinein. Zwischen den einzelnen Happen erzählte er von den Abenteuern, die er an diesem Tag erlebt hatte.
Er war jetzt um die zwölf Jahre alt, mehr wussten sie nicht, denn auf Theos Flucht aus Ostpreußen waren in Berlin mit seiner Mutter und der Schwester auch alle Papiere verloren gegangen. Um sich etwas Taschengeld dazuzuverdienen, betrieb er am Potsdamer Platz einen privaten Postdienst. Er hatte mittlerweile zahlreiche Kunden, für die er Briefe über die Sektorengrenze transportierte und dort in die Briefkästen warf, was eine große Zeitersparnis mit sich brachte und die Zensoren im Ostsektor umging. Ein Großteil seines Geschäfts bestand mittlerweile darin, Zeitschriften aus dem Westsektor zu schmuggeln, für die im Ostteil der Stadt ein offizielles Verkaufsverbot galt. Allerdings war dieses Geschäftsmodell nicht ganz ungefährlich. Obwohl ein fixes Kerlchen wie Theo unverdächtig aussah, bestand doch die reale Gefahr, von einem Grenzpolizisten geschnappt zu werden. Oppenheimer hatte gehofft, dass ihm der Nebenerwerb mit der Zeit langweilig werden würde, doch aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Ost und West begann Theos Geschäft jetzt erst so richtig zu florieren.
Mit einem nachsichtigen Lächeln hörte Lisa ihrem Schützling zu. Nur der unstete Blick verriet ihre Anspannung. Zweifelsohne plagten sie dieselben Gedanken wie Oppenheimer. Ihre kleine Ersatzfamilie, an die sie sich in den letzten dreieinhalb Jahren gewöhnt hatten, war jetzt bedroht.
Oppenheimer versuchte, es positiv zu sehen. Anstatt Trübsal zu blasen, sollten sie lieber für Theo froh sein, dass er seinen leiblichen Vater wiedersehen konnte.
Andererseits wussten sie nichts über diesen Mann. Niemand konnte garantieren, dass der Vater überhaupt dazu geeignet war, seinen Sohn großzuziehen. Und auch für Theo würde er mittlerweile ein Fremder sein, an den er sich nicht mehr erinnern konnte. In diesem Fall war es für den Jungen womöglich am besten, bei ihnen zu bleiben.
Sosehr Oppenheimer auch nach einem Ausweg suchte, über ihnen hing jetzt wie ein Damoklesschwert die Einsicht, dass die Zeit des unbeschwerten Zusammenlebens abgelaufen war.
Lotte schrak auf. Ihr Gesicht war zu einer Maske des Entsetzens verzerrt. Das Herz raste. Ihre Arme und Beine waren angewinkelt in der Erwartung, dass sich eine Nachtgestalt über sie beugte und nach ihren Beinen griff, um sie in die Unterwelt zu zerren.
Doch sie war allein. Zumindest vorläufig.
Als sich ihr Körper wieder entspannte, vernahm sie unter sich das Quietschen rostiger Bettfedern. Und jetzt spürte Lotte auch wieder das schmerzhafte Pulsieren in ihrem linken Fußknöchel.
Mit etwas Verspätung kam ihr auch das kahle Zimmer bekannt vor. Das Verlies, in dem sie eingesperrt war.
In ihrem Gedächtnis gab es Lücken, insbesondere konnte sich Lotte nicht mehr genau an die Einzelheiten ihrer Entführung erinnern. Sie war bereits das zweite Mal in Gefangenschaft wach geworden. Der Sonnenschein hinter dem vergitterten Fenster warf ein helles Rechteck an die gegenüberliegende Wand. Der langsam wandernde Lichtfleck war der einzige Hinweis darauf, dass die Stunden vergingen. Leider konnte Lotte nicht hinaussehen, denn das Fenster befand sich in mehr als zwei Metern Höhe. Sie war von der Außenwelt abgeschnitten. Allein und doch nicht allein.
Denn es gab noch ihn. Den Beobachter.
Bei dem Gedanken begann Lotte zu frösteln. Obwohl sie zu entkräftet war, um sich aufzurichten, strengte sie sich an, ihren Kopf so weit zu bewegen, dass sie die Tür im Auge behalten konnte. Sie bestand aus Holz und war mit Metallbeschlägen verstärkt. Auf Augenhöhe befand sich eine verschließbare Scharte und direkt über dem Boden eine zweite.
Als sie das erste Mal aufgewacht war, um sich in einer fremden Umgebung wiederzufinden, hatte der Mann bereits hinter der Tür verharrt. Durch die geöffnete Luke waren seine Augen starr auf Lotte gerichtet und registrierten die geringsten Bewegungen von ihr. Obwohl sie bis auf das Augenpaar nichts von ihrem Entführer gesehen hatte, war es ihr so vorgekommen, als amüsierten ihn ihre Furcht und Orientierungslosigkeit. Der Mann vor der Tür konnte nur ihr Entführer sein. Sonst kam niemand anders infrage.
Heute stand er nicht dort. Die Scharte war verschlossen.
Die Öffnung am Boden hingegen war immer noch weit geöffnet. Lotte erinnerte sich daran, dass ihr der Entführer gestern einen Teller mit einer Mahlzeit und einen Becher Wasser dort hindurchgeschoben hatte. Der Durst und der Hunger waren so groß gewesen, dass sie das Essen restlos vertilgte.
Dabei war ihr zum ersten Mal bewusst geworden, dass etwas nicht zusammenpasste. Denn das war keine karge Gefängniskost gewesen, sondern Corned Beef – für die ausgehungerten Berliner eine begehrte Delikatesse. Der Gedanke schien geradezu absurd, die kostbare Fleischkonserve an eine Gefangene zu verschwenden.
Lotte fühlte sich eigenartig matt und vermutete, dass etwas im Essen gewesen war. Wahrscheinlich Beruhigungsmittel, denn kurz darauf hatte der Schlaf sie wieder übermannt.
Die Gedanken in ihrem Kopf waren noch ein wenig ungeordnet. Auf der Seite liegend, strengte sie ihr Gedächtnis an. Wie war sie überhaupt in diese Lage geraten? Sie ging zurück bis zu ihrem letzten Tag in der Freiheit. Bis zu der Nacht, die schlagartig alles änderte.
Sie wusste noch so viel, dass sie vor ihrer Wohnung gestanden hatte. Es war das letzte Bild, an das sie sich entsinnen konnte. Von den Geschehnissen danach waren nur noch einzelne Bruchstücke übrig geblieben. Am klarsten war dabei noch die Erinnerung an das schiere Entsetzen. Vor irgendjemandem war sie fortgelaufen. Der schmerzende Fußknöchel ließ erahnen, dass sie nicht weit gekommen war. Lotte fand es merkwürdig, dass ausgerechnet das Bild ihres Entführers vorerst im Dunkeln blieb. Wer hatte sie derart in Furcht versetzt, dass sie kopflos davongestürmt war?
Sie griff nach dem Kopfende des eisernen Bettgestells und zog sich in eine sitzende Position. Ihr Entführer war gerade nicht anwesend. Diese Chance musste sie ausnutzen. Vielleicht konnte sie durch die untere Öffnung in der Tür spähen. Vielleicht gab es ja eine Fluchtmöglichkeit.
Lotte nahm sich Zeit, um ihre Kräfte zu sammeln. Als sie schließlich glaubte, die drei Meter bis zur Tür überwinden zu können, schob sie sich von der morschen Matratze. Sowie sie das Gewicht auf die Füße verlagerte, begann der Knöchel wieder zu schmerzen. Lotte hielt kurz inne, dann humpelte sie, die Zähne zusammengebissen, zu der Tür.
Gegen die Wand gestützt kniete sie sich hin und beugte sich nach vorn, bis sich der Kopf direkt vor der Öffnung befand.
Der Anblick war ernüchternd. Hinter der Tür befand sich nichts weiter als ein dunkler Korridor. Und am Ende des Gangs zeichnete sich ein schwarzes Rechteck ab. Bestimmt war es eine weitere verschlossene Tür.
Trotz ihrer Enttäuschung versuchte Lotte, sich diese Eindrücke so gut wie möglich einzuprägen. Vielleicht würde es einmal wichtig werden.
Sie war bereits auf dem Rückweg zum Bett, als sie draußen Schritte vernahm. Eine Tür knarrte, ein Schalter klickte. Durch die untere Luke fiel Licht.
Lotte beeilte sich, zum Bett zu kommen. Jetzt achtete sie nicht einmal mehr auf ihren schmerzenden Knöchel. Gerade noch rechtzeitig ließ sie sich auf das Bett fallen.
Holz schlug gegen Holz. Die obere Luke in der Tür wurde geöffnet. Das Augenpaar ruhte wieder auf Lotte.
Obwohl der Entführer das Knarren der Bettfedern mitbekommen haben musste, schien er nicht alarmiert zu sein. Er fühlte sich sicher. Auch seine Stimme, die Lotte zum ersten Mal hörte, klang ruhig.
»Es sind Dinge zu erledigen«, kündigte der Mann an. Da die Tür sie trennte, bemühte er sich, die Worte klar zu artikulieren. »Bevor wir dazu kommen, muss ich deinen Fuß sehen.«
Verständnislos hob Lotte ihre Brauen.
»Der Fußknöchel. Wahrscheinlich ist er nicht gebrochen. Aber ich muss ihn mir ansehen. Ich habe was gegen die Schwellung.«
Lotte war zu eingeschüchtert, um zu antworten. Der Mann klang für einen Entführer viel zu freundlich. Trotz des auffällig rollenden »R« konnte sie seinen eigentümlichen Akzent nicht verorten. Lotte blickte einfach starr auf die Tür und sagte nichts. Damit beging sie wenigstens keinen Fehler.
Ein Schlüssel wurde außen ins Schloss gesteckt und herumgedreht. Der Mann öffnete die Tür einen Spaltbreit und trat ins Zimmer.
Jetzt erkannte Lotte ihren Entführer. Sie öffnete den Mund, brachte jedoch keinen Laut heraus. Für einen Moment dachte sie, dass alles nur ein dummer Streich sei.
Aber der Gesichtsausdruck des Mannes sagte etwas anderes. Es war ihm todernst. Er trug eine Metallschale, bedeckt von einem weißen Tuch, stellte sie auf dem Boden ab und verschloss sorgfältig die Tür hinter sich. Dann hob er die Schale wieder auf und trat zu Lotte.
Endlich konnte sie sich erklären, warum sie bei ihrer Entführung so heftig reagiert hatte. Sie hätte niemals geglaubt, dass dieser nette Mann zu so etwas fähig war. Jetzt wusste sie es besser. Als er nach ihr gegriffen hatte, war Lotte schlagartig bewusst geworden, dass es harmlose Männer nicht gab.
3
Donnerstag, 25. Mai 1950
Lieutenant Colonel Wharton führte in Berlin ein vergleichsweise komfortables Leben. In Dahlem war er mit anderen Offizieren in der ehemaligen Kameradschaftssiedlung der SS untergebracht, einer der besten Wohnlagen von Berlin. Die Einfamilienhäuschen lagen inmitten einer idyllischen Waldgegend. Mehrstöckige Wohnblöcke schirmten die privilegierten Bewohner von dem Lärm und Treiben auf der benachbarten Argentinischen Allee ab. Im Westen luden die Gewässer Krumme Lanke und Schlachtensee und das Naherholungsgebiet Grunewald zu Spaziergängen ein. Auch ungeachtet dieser Vorzüge war der Standort dieser Siedlung für die US-Offiziere optimal, denn das Hauptquartier der US-amerikanischen Armee befand sich nur einen Katzensprung entfernt.
Das unschöne Detail, dass das nationalsozialistische Rasse- und Siedlungshauptamt die etwa sechshundert Wohneinheiten ursprünglich für die Angehörigen von Hitlers völkischer Elite errichtet hatte, war den neuen Bewohnern vermutlich nicht einmal bewusst. Oppenheimer spürte eine gewisse Schadenfreude darüber, dass ausgerechnet die militärischen Feinde des Nationalsozialismus diese Vorzeigeimmobilien bewohnten.
Von der nächstliegenden U-Bahn-Station musste er einen Fußmarsch von etwa einem halben Kilometer zurücklegen, um zum Führerplatz zu kommen. Einem Straßenschild zufolge hatte man ihn mittlerweile in Selmaplatz umgetauft. Oppenheimer bog nach links ein und betrat durch einen schmalen Durchgang in der Front der Wohnblöcke die Siedlung.
Wie versprochen hatte Rita ihm Whartons Adresse besorgt und gleich einen Termin für eine Befragung ausgemacht.
Der Weg dorthin war von langen Kolonnen von Reihenhäusern gesäumt. Oppenheimer hatte ausreichend Zeit, um sich zu vergegenwärtigen, dass ihn mit der Kameradschaftssiedlung eine gemeinsame Vergangenheit verband. Das kleine Häuschen, in dem er vor exakt sechs Jahren unter der Bewachung von Hauptsturmführer Vogler daran gearbeitet hatte, im Auftrag der SS einen Massenmörder zu schnappen, befand sich jedoch in einem anderen Teil der Siedlung.
Oppenheimer folgte dem sanft geschwungenen Weg und zählte dabei die Hausnummern ab. Nach einer Weile fand er Whartons Doppelhaushälfte und betätigte die Klingel an der Haustür.
Fast augenblicklich wurde von innen geöffnet. Ein Schrank von einem Mann stand vor ihm. Wharton empfing ihn in einer makellos gebügelten Offiziersuniform. Oppenheimer schätzte ihn auf Mitte dreißig. Seine tiefschwarzen Augenbrauen wirkten wie mit dem Kajalstift gezogen. Obwohl das quadratische Kinn glatt rasiert war, lag schon wieder ein bläulicher Schimmer auf den Wangen.
»Sie sind dieser Polizist?«
Bei Whartons Frage atmete Oppenheimer auf. Er konnte deutsch sprechen, zusammen mit Oppenheimers gebrochenem Englisch ließ sich bestimmt eine Unterhaltung bestreiten, selbst wenn es für Feinheiten erst mal nicht reichte.
»Kommissar Oppenheimer«, stellte er sich vor. »Ich wollte mit Ihnen über Fräulein Tieken reden?«
Wharton warf ihm einen fragenden Blick zu, bis er sich daran erinnerte, dass es der Familienname seiner verschwundenen Freundin war. Er ließ Oppenheimer eintreten und nickte in die Richtung einer geöffneten Zimmertür. Diese lässige Geste wirkte bei Wharton eigenartig ruppig.
Das Hausinnere war makellos geputzt, er schien ein Dienstmädchen oder eine Haushälterin zu beschäftigen. Die verschnörkelten Bauernmöbel und karierten Deckchen passten nicht zu dem amerikanischen Offizier. Er hatte die Einrichtung vermutlich komplett zusammen mit dem Haus übernommen. Selbst beim Durchqueren des eigentümlich fremdartigen Wohnzimmers strahlte Wharton eine Selbstsicherheit aus, die schon arrogant wirkte.
»Ich habe zwanzig Minuten. Also schnell.« Mit dieser Ankündigung nahm er auf einem Holzstuhl Platz. Ansonsten gab es hier nur Polstermöbel, also ließ sich Oppenheimer in einen niedrigen Sessel sinken. Emotionslos schaute Wharton auf ihn hinab, als Oppenheimer sich bemühte, sein Schulheft und den Stift aus der inneren Manteltasche zu angeln.
Ihre Unterredung hatte sich Oppenheimer anders vorgestellt, doch er versuchte, das Beste aus der knappen Zeit zu machen. Normalerweise unterhielt sich Oppenheimer mit den Leuten erst einmal, um sie besser kennenzulernen. Das erleichterte ihm, ihre Aussagen einzuschätzen. Doch jetzt übersprang Oppenheimer diesen Teil und begann mit einer direkten Frage.
»Wann haben Sie Fräulein Tieken das letzte Mal gesehen?«
Whartons knappe Antwort kam prompt. »Sonntagabend. Wir waren bei einem Dinner.«
Das musste der Tag vor Lottes Verschwinden gewesen sein.
»Und wie sind Sie auseinandergegangen?«
»Mein Fahrer hat sie zu ihrer Wohnung gebracht. Ich blieb noch auf der Party.«
Oppenheimer stutzte. »Ist das üblich? Mir wurde erzählt, dass Fräulein Tieken Sie zu offiziellen Anlässen begleitet. Ich verstehe das so, dass sie zusammen mit Ihnen erscheint und Sie beide sich dann auch wieder zusammen verabschieden.«
Whartons Mundwinkel zuckten. »She’s my companion«, begann er auf Englisch. »Ich kenne das deutsche Wort nicht. Ich weiß nicht, was in Deutschland normal ist. Lotte kann kommen und gehen, wann sie will.«
»Fräulein Tieken ist also vor Ihnen gegangen. Können Sie sich an die ungefähre Uhrzeit erinnern?«
»Twenty-one hundred oder twenty-two hundred hours.«
»Also neun bis zehn Uhr abends«, rekapitulierte Oppenheimer und schrieb die Angabe in sein Heft. »Das erscheint mir bei einer Abendgesellschaft recht früh.«
»Die anderen Gäste können das genauer sagen.«
Nach Whartons hingeworfener Bemerkung blickte Oppenheimer auf. Wharton räusperte sich kurz und sagte dann: »Okay, kein Zweck, es zu verschweigen. Sie hat sich mit mir gestritten. Vor den Leuten. Es wurde sehr laut.«
»Worum ging es dabei?«
»Ich habe Schluss mit ihr gemacht, und sie wollte mehr Geld. To get by.«
Mit gerunzelter Stirn überlegte Oppenheimer, wie er den nächsten Punkt möglichst taktvoll ansprechen konnte. Whartons Andeutungen genügten nicht, er brauchte eine Bestätigung. »Und in welcher Beziehung stehen Sie genau zu ihr? Ist Fräulein Tieken offiziell bei Ihnen angestellt?«
Wharton war sichtlich genervt. Plötzlich schnauzte er los: »I fuck her, for Christ’s sake! And I pay very well for that privilege! Sie können das notieren!«
Danach sprach er sehr rasch in einer Mischung aus Deutsch und Englisch. Oppenheimer verstand so viel, dass Wharton bald seine Gattin in Berlin erwartete, die sich in den Kopf gesetzt hatte, in der fremden Stadt dauerhaft an seiner Seite zu bleiben. Für ein Techtelmechtel war da kein Platz mehr. Wharton tat sich nicht schwer mit dem Schlussstrich, denn die Übereinkunft mit Lotte verstand er in erster Linie als finanzielle Transaktion. In der Zeit ihres Beisammenseins hatte er nicht nur Lottes Wohnungsmiete übernommen, sondern ihr auch noch Geschenke gemacht. Ritas Einschätzung, dass Wharton knauserig sei, schien nicht so recht ins Bild zu passen, aber vielleicht verglich sie ihn ja auch mit ihrem eigenen amerikanischen Gönner.
Jedenfalls wollte Lotte laut Whartons Aussage noch um eine weitere Jahresmiete feilschen, ehe sie abserviert wurde. Nur mit dieser Gegenleistung war sie bereit, ihm keinen Ärger zu bereiten. Oppenheimer wertete das als kaum verhüllten Erpressungsversuch.
Die Dinnergäste mussten die Auseinandersetzung zwischen Wharton und Lotte mitbekommen haben, sonst hätte er das kaum freiwillig angesprochen. Er schien Angriff für die beste Verteidigung zu halten. Wharton besaß durchaus ein Motiv, seine Gespielin verschwinden zu lassen, aber Oppenheimer hielt es für zu schwach. Die einfachste Option war für den Offizier, stillschweigend zu bezahlen.
»Zu einer Einigung sind Sie mit Fräulein Tieken bislang noch nicht gekommen«, führte Oppenheimer den Gedanken weiter.
Wharton bestätigte dies mit einem knappen Kopfschütteln.
»Und Ihnen ist nicht aufgefallen, dass sie seitdem verschwunden ist?«
»Ich bin froh, wenn sie mich in Ruhe lässt. Ich habe genug Arbeit, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, Lotte meldet sich sowieso, wenn ihr das Geld ausgeht.«
Obwohl Wharton seine Verärgerung jetzt wieder unter Kontrolle hatte und den Sachverhalt emotionslos schilderte, wirkte er wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Es folgten Routinefragen, die Oppenheimer auch jedem anderen Zeugen gestellt hätte. Damit seine nächste Erkundigung nicht wie ein direkter Vorwurf wirkte, hielt er den Blick auf die rot karierten Gardinen gerichtet.
»Die letzten Tage nach diesem Dinner, waren Sie die ganze Zeit hier in Berlin?«
Wharton runzelte unheilvoll die Stirn und richtete sich auf dem Stuhl auf.
»Was wollen Sie damit sagen?«
Es war noch nicht sicher, ob mit Lotte überhaupt etwas geschehen war. Also brachte es nichts, auf Konfrontation zu gehen. So harmlos wie möglich antwortete Oppenheimer: »Mir geht es nur darum, diese Fragen abzuhaken. Damit ich später nicht mehr darauf zurückkommen muss.«
Wharton verzog seinen Mund. »Mit anderen Worten wollen Sie ein Alibi von mir. Das kann ich Ihnen geben. Die ganze Woche hatte ich abends Einladungen. Ich war unterwegs. Dutzende Leute haben mich getroffen. Soll ich eine Liste schreiben?«
Oppenheimer winkte ab. »Besten Dank für Ihr Entgegenkommen. Vorerst wird das nicht nötig sein. Hoffen wir, dass Fräulein Tieken unversehrt wieder auftaucht. Sie hatten von ihrem Verschwinden nichts geahnt, wenn ich das richtig verstehe, also ist bei Ihnen auch keine Lösegeldforderung eingetroffen?«
»Ransom money?« Wharton ließ sich die Frage durch den Kopf gehen und sagte nachdenklich: »Wenn jemand Lotte entführt hat, dann macht er einen schlechten Deal. Sie bedeutet mir nichts. Ich werde sicher nicht zahlen.«
Oppenheimer nahm dies ohne große Überraschung zur Kenntnis. Wharton war ihm von Anfang an unsympathisch gewesen. Ihre Unterredung hatte diesen Eindruck nur bestätigt.
Unruhig rückte der Colonel auf dem Stuhl herum und blickte auf seine Armbanduhr.
»Ich habe keine Zeit mehr. Let’s make it short. Sie fragen, ob Lotte entführt wurde? Wahrscheinlich ja. Aber dabei geht es nicht um Lösegeld.«
Von dieser Enthüllung wurde Oppenheimer kalt erwischt. Zuerst starrte er Wharton wortlos an, schließlich fragte er: »Was steckt denn sonst Ihrer Meinung nach dahinter?«
Wharton zuckte mit den Schultern und sagte wie selbstverständlich: »Die Commies. Sie versuchen alles, um uns zu infiltrieren. Besonders hier in Berlin. Joe Stalins Gangster stehen doch an jeder Ecke. Sie kümmern sich nicht um die Sektorengrenzen. Kommen rein und raus, wie es ihnen gefällt. Sicher schmuggeln sie auch Spione ein. Bei uns im Westen gibt es viele innere Feinde. Sie agieren verdeckt, einige Behörden sind komplett unterwandert. Dasselbe mit den Wissenschaftlern. Was meinen Sie, warum die Russen schon die Atombombe haben? Selbst sind sie doch viel zu dämlich, um sie zu entwickeln. Nein, das Atomgeheimnis wurde verraten. Es hat bereits erste Verhaftungen in den Staaten gegeben, und noch weitere Köpfe werden rollen.«
Oppenheimer ließ sein Heft sinken. Es war sehr informativ, eine Lageeinschätzung aus erster Hand zu bekommen. Whartons Ausführungen mochten nicht viel mit dem Verschwinden von Lotte zu tun haben, und doch spitzte er die Ohren. Der Offizier hatte einen Punkt angesprochen, der die Berliner Bevölkerung, die jede Verschlechterung der Beziehungen zwischen Ost und West am eigenen Leib zu spüren bekam, besonders stark beschäftigte.
Seit fast einem Jahr lebten sie in einem neuen Zeitalter. Die große Aufregung nach der Zündung der ersten Atombomben in Japan war zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten. Das amerikanische Atomarsenal war seitdem nicht mehr eingesetzt worden, also war die verheerende Zerstörungsgewalt der neuen Waffentechnologie zumindest im Westen kein großes Thema mehr gewesen. Doch als die UdSSR am 29. August 1949 in der kasachischen Steppe mit der erfolgreichen Zündung einer eigenen Atombombe nachgezogen hatte, war den westlichen Verbündeten ein harter Schlag versetzt worden. Von einem Tag auf den anderen waren sie militärisch nicht mehr überlegen und mussten lernen, mit einer Drohkulisse zu leben. Die Waffengleichheit zwischen den großen Mächten glich einem Tanz auf dem Drahtseil. Ein falscher Schritt konnte jetzt verheerende Folgen haben.
Wharton war dermaßen in Fahrt gekommen, dass er sogar sein enges Zeitfenster vergaß. Er lehnte sich zurück und fuhr fort: »Aber mit der Atombombe ist das Spiel noch längst nicht zu Ende. Die Commies wollen auch weiterhin geheime Informationen bekommen, um sie gegen uns zu verwenden. Das geht schon seit ein paar Jahren so. Im Zweiten Weltkrieg haben die Russen von uns schweres Kriegsgerät erhalten und andere Unterstützung gegen Hitler, das Scheunentor stand die ganze Zeit weit offen. Während dieser Zeit wurden wir unterwandert. Und jetzt sind wir konfrontiert mit noch anderen inneren Feinden. Ich meine die Sympathisanten, Schriftsteller, Professoren, diese Leute. Die Russen nennen sie Intelligenzija, aber besonders clever können die nicht sein. Sie posaunen nur Moskaus Propaganda heraus. Und sie tun das nicht im Geheimen, sondern ganz offen. Roosevelt war das egal, er sah die Gefahr nicht. Was sollte man von ihm auch erwarten, er war doch selbst ein Commie. Und seine Frau ist noch viel schlimmer.«
Oppenheimer war überrascht, wie verächtlich Wharton über den verstorbenen amerikanischen Präsidenten sprach. Der Vorwurf, dass Roosevelt ein Kommunist gewesen sei, kam ihm geradezu absurd vor. Soweit er die amerikanische Innenpolitik verstand, hatte der Präsident einen Kurs verfolgt, der am ehesten der europäischen Sozialdemokratie nahekam. Mit Kommunismus hatte das überhaupt nichts zu tun, doch diese Feinheiten schienen Whartons Fassungsvermögen zu übersteigen. Zuerst hatte Oppenheimer noch gebannt zugehört, doch mittlerweile ahnte er, dass man Whartons Einschätzung nicht in allen Punkten für bare Münze nehmen konnte.
Düster schloss der Offizier: »Anyway, West und Ost, im Krieg hatten wir einen gemeinsamen Feind: Hitler. Stalin nutzte unsere Militärhilfen, um Osteuropa zu besetzen. This is not the end. He wants to spread communism everywhere. Der nächste Schritt ist ganz Europa, bis hin nach Portugal, dann folgt der Sprung über den großen Teich, bis er auch Amerika unterjocht hat. Berlin ist das letzte freie Fleckchen im Sowjetreich. Wir verteidigen hier Gott und unser Vaterland. Die Gegenseite setzt jedes schmutzige Mittel ein. Dazu gehört auch Kidnapping.«
Oppenheimer verstand nicht so recht, wie dies alles mit Lottes Verschwinden zusammenhing. Er fasste zusammen: »Ihrer Meinung nach wurde Fräulein Tieken also von russischen Spionen entführt. Und das alles, um aus Ihnen Informationen zu erpressen? Haben Sie konkrete Hinweise für diese Theorie?«
Wharton stand auf und wies zur Haustür.
»Ich werde als Erstes mit der Militärpolizei sprechen. Lotte ist ein Druckmittel in den Händen der Sowjets, da gibt es keinen Zweifel.«
Oppenheimer gab Whartons demonstrativem Drängen nach und begab sich zur Haustür. Der Offizier öffnete und schob ihn dann mit sanftem Druck hinaus.
»Unsere Jungs werden der Bande das Handwerk legen«, sagte er.
Als Oppenheimer sich vor der Hausschwelle umwandte, nickte Wharton ihm zum Abschied kurz zu.
»Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Aber überlassen Sie diesen Job besser unseren Profis.«
Mit dieser Ankündigung schloss Wharton die Tür vor Oppenheimers Nase.
Oppenheimer war etwas enttäuscht von der Unterredung mit dem Offizier, denn es war ihm nicht gelungen, den Zeitraum von Lottes Verschwinden genauer einzugrenzen. Um an bessere Informationen zu kommen, beschloss er, sich noch einmal mit Rita zu unterhalten.
Es war bereits später Nachmittag, als er sich ihrer Adresse näherte. Er hielt das für den optimalen Zeitpunkt, denn seines Wissens war Rita immer eine Langschläferin gewesen. Und er zweifelte, dass sich daran etwas geändert hatte.
Von der U-Bahn-Station Boddinstraße musste Oppenheimer nur wenige Meter zurücklegen. Rita wohnte in der Nähe des Flughafens Tempelhof, aber das Eckhaus lag so weit nördlich, dass es sich nicht in der Einflugschneise der lärmenden Flugzeuge befand. Dennoch war für Abwechslung gesorgt, denn gleich um die Ecke gab es einige Theater und Kinos.
Das Gebäude, in dem Rita residierte, verfügte über fünf Stockwerke, in die Hauswand waren Balkone eingelassen. Nicht nur von außen machte das Mietshaus einen gepflegten Eindruck, auch im Inneren fand Oppenheimer einen glänzenden Steinboden vor. Er stieg die Treppe zum dritten Stockwerk hinauf, suchte an den Türschildern, bis er Ritas Namen fand, und klingelte. Während er wartete, überlegte Oppenheimer, ob dies wohl der sprichwörtliche goldene Käfig war, in dem es sich Gespielinnen wie Rita gut gehen ließen.
Es wurde geöffnet, und eine schwarzhaarige junge Frau mit Schürze und Häubchen fragte vorsichtig: »Ja, bitte?«
»Ich bin Kommissar Oppenheimer. Ich möchte Rita« – er korrigierte sich – »ich meine natürlich Frau Woltmann sprechen.«
Das Dienstmädchen runzelte die Stirn. »Einen Moment, da muss ich fragen.«
Mit dieser Ankündigung ließ sie Oppenheimer im Flur stehen. Die Tatsache, dass ihm nun bereits zum zweiten Mal an diesem Tag die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, ärgerte ihn. Einige Augenblicke später öffnete das Dienstmädchen wieder die Tür. Wie ein Zerberus stand sie neben der Pforte und nickte ins Innere der Wohnung. Kaum war er in den Flur getreten, raunte ihm die junge Frau bereits zu: »Und die Straßenschuhe ausziehen.«
Oppenheimer erstarrte. Diese Vorsicht war angebracht, denn überall lagen dicke Teppiche auf dem Boden. Beeindruckt öffnete er die Schuhbänder und streifte seine Treter ab. Das Dienstmädchen zeigte mit dem Finger auf eine leere Schuhwanne direkt neben der Tür. Oppenheimer stellte seine Schuhe dort ordentlich nebeneinander.
Um sich nicht weiter herumkommandieren zu lassen, rief er in die Wohnung. »He, Rita, wo steckst du?«
Ihre gedämpfte Stimme drang zu ihm.
»Lass dir von Silke nicht den Tag vermiesen! Die ist immer so ein Muffel. Komm einfach rein!«
Als einzigen Kommentar zog ihr Dienstmädchen Silke einen Mundwinkel nach oben und verschwand durch die gegenüberliegende Glastür. Schmunzelnd folgte Oppenheimer Ritas Stimme zu einer geöffneten Schlafzimmertür.
Das überbreite Doppelbett war von Kleiderschränken und Plüschmöbeln umringt. Gegenüber dem Fußende hing ein wandhoher Spiegel. Rita stand vollkommen nackt davor. Im einfallenden Licht des Fensters schienen ihre roten Haare förmlich zu glühen – ein prägnanter Kontrast zu ihrer blassen Haut. Sie war vollauf damit beschäftigt, sich vor dem Spiegel zu drehen und ihre Rundungen zu inspizieren.
Als ehemalige Stripteasetänzerin war Rita keine schüchterne Person. Während Oppenheimers Beschäftigung als Beleuchter in der Rio Bar war sie an ihrem Arbeitsplatz die meiste Zeit über hüllenlos herumstolziert, und schon bald hatten ihn die nackten Tatsachen zu langweilen begonnen. Besonders Edes damalige Strip-Sensation Rita war ihm dermaßen häufig im Evakostüm begegnet, dass ihm jede einzelne ihrer Sommersprossen vertraut war.
Trotz allem fühlte er sich als Eindringling. Das hier war schließlich keine Garderobe oder Bühne, sondern ein Liebesnest. Also blieb er, die Hand auf der Klinke, im Türrahmen stehen und gab sich demonstrativ unbeeindruckt.
»Vornehm geht die Welt zugrunde, was?«, juxte Oppenheimer. »Du hast ein eigenes Dienstmädchen? Und wo ist denn der Chauffeur? Wohnt der etwa auch hier? So geräumig sieht die Bude eigentlich nicht aus.«
Ohne den Blick von ihrem Spiegelbild abzuwenden, winkte Rita ab. »Ach, den rufe ich per Telefon, wenn ich ihn brauche.«
»Soso, ein praktisches Arrangement.« Da von Rita nichts mehr kam, fragte Oppenheimer: »Ist das jetzt der Punkt, an dem du behauptest, nichts zum Anziehen zu haben?«
Rita warf ihm einen verdutzten Seitenblick zu. Andere Dinge beschäftigten sie.
»Komm, sag mir, bin ich fett?«, fragte sie mit Nachdruck. »Hab ich zugelegt?«
Dazu war Oppenheimer überfragt. »Du meinst seit der Zeit in der Rio Bar?«
»Hast du mich danach etwa noch mal nackt gesehen?«
»Nicht dass ich wüsste, aber ich könnte es auch nicht beschwören.«
Rita schaute immer noch, als würde sie von ihm eine ernsthafte Antwort erwarten. Er ahnte, was sie hören wollte, also strengte er sich an, ihre Zweifel zu zerstreuen. »Nein, ich finde nicht. Du bist immer noch sehr … proper.«
»Proper, ist das gut oder schlecht?«
Oppenheimer atmete tief ein. Er war gerade dabei, sich um Kopf und Kragen zu reden.
»Nein, du hast nicht zugelegt, soweit ich mich erinnern kann.«
Rita blickte wieder in den Spiegel. »Die Amis sind nicht so wie die deutschen Männer«, erklärte sie. »Die mögen ihre Mädchen schlank. Ich hab schon versucht, mehr zu rauchen, damit ich keinen so dollen Hunger habe, aber es klappt nicht.«
Darauf angesprochen, fiel Oppenheimer der überquellende Aschenbecher auf dem Nachttisch auf. Ritas Luxusleben besaß also doch gewisse Tücken. Wenn sie es sich allzu gut gehen ließ und dem Schönheitsideal ihres Colonels nicht mehr entsprach, würde diese Einkommensquelle versiegen.
»Mit dem Rauchen sollte man es sowieso nicht übertreiben«, sagte Oppenheimer leichthin. »Es gibt doch noch andere Methoden, um Gewicht zu verlieren. Wie wäre es mit Fahrradfahren? Oder Boxen? Gewichtheben? Mehr Ideen habe ich nicht.«
Rita lachte auf, riss sich endlich von ihrem Spiegelbild los und nahm ein durchsichtiges Negligé vom Bett. Oppenheimer hielt das hauchdünne Material für Nylon. Damenstrümpfe daraus waren in der Damenwelt heiß begehrt, am ehesten bekam man sie, wenn man amerikanische Bekannte hatte. Oppenheimer fand es ein interessantes Mysterium, dass die amerikanischen Truppen bei der Befreiung Europas ausgerechnet so viele Nylonstrümpfe mitgebracht hatten. Auch Ritas Negligé stammte bestimmt von ihrem Gönner. Im Prinzip hätte sie weiterhin nackt herumstolzieren können. Der teure Fummel enthüllte mehr, als er verhüllte, was vermutlich auch Sinn und Zweck war. Ausgerechnet jetzt, da sich Rita im halb bekleideten Zustand befand, fühlte sich Oppenheimer in ihrer Gegenwart zum ersten Mal verlegen.
Er spürte, dass sein Gesicht knallrot anlief. Rita tat so, als würde sie das nicht registrieren. Nur ein kurzes Blitzen in ihren Augen verriet, dass sie über ihre Wirkung zufrieden war.
Gutmütig sagte sie: »Komm, gehen wir ins Wohnzimmer. Sonst vermutet Silke gleich das Schlimmste. Sie ist ein wahres Schandmaul!«
Ehe sie in den Flur traten, raunte Oppenheimer ihr zu: »Aber warum behältst du sie dann?«
Rita zuckte mit den Schultern. »Ich bezahle sie ja nicht. Das tut Tim.« Vermutlich war das der Vorname ihres Offiziers. Vertraulich beugte sie sich vor und flüsterte: »Ich glaube, dass er mit Silke mal ein Verhältnis hatte. Vor meiner Zeit. Und statt sie abzuservieren, hat er ihr die Stelle hier gegeben. Tja, Tim hat eben ein viel zu gutes Herz.«
Oppenheimer runzelte die Stirn, denn er fand das alles höchst merkwürdig. In dem wallenden Negligé führte Rita ihn durch die Glastür in das Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen. »Puh, ich komme heute nicht in die Gänge. Dabei muss ich später noch auf ein Dinner.« Spielerisch klopfte sie neben sich auf das Sitzpolster. Oppenheimer verstand und setzte sich zu ihr.
»Und jetzt sag, was hast du rausgefunden?«
Oppenheimer seufzte schwer. »Nicht viel. Dieser Wharton hat gemauert. Für ihn ist das eine Sache der Amerikaner, und in die soll ich mich nicht einmischen. Jedenfalls behauptet er, keine Lösegeldforderung bekommen zu haben. Mit Lotte ist er im Streit auseinandergegangen. Letzte Woche hatte er in der Öffentlichkeit einen handfesten Krach mit ihr, weil er ihre, nun ja, Dienste nicht mehr benötigt.«
Rita nickte wissend. »Längst gehört. Das hat schon die Runde gemacht. Whartons Olle hat sich angekündigt und will ihn wieder an die Kandare nehmen. Für den ist jetzt Schluss mit lustig, aber für Lotte ist das tragisch. Nicht weil er ein Adonis wäre, aber wenn sich keine andere Lösung findet, ist es für sie existenzbedrohend.«
Das erklärte Lottes Erpressungsversuch, aber eine Entschuldigung war es Oppenheimers Meinung nach trotz allem nicht. Er hielt es für besser, diesen Punkt vorerst auszuklammern. Rita würde ihn durchschauen, wenn er Mitleid heuchelte, also fuhr er fort: »Wie auch immer. Jedenfalls komme ich so nicht weiter. Wharton will die Militärpolizei auf den Fall ansetzen. Er sieht überall kommunistische Verschwörer am Werk, und vielleicht hat er ja recht. Mit Sicherheit bekommt er bessere Informationen als unsereiner. Und doch klingt das nach meinem Geschmack alles zu aufgebauscht.«
Oppenheimer hatte mittlerweile vom vielen Reden einen trockenen Mund. »Entschuldigung, aber hast du was zu trinken? Ich bin schon ein paar Stunden unterwegs.«
»Aber klar, willst du was aus der Bar? Oder lieber aus dem Kühlschrank? Die Küche ist da hinten!« Rita zeigte auf eine Tür.
Es amüsierte Oppenheimer, dass sich Ritas legere Manieren nicht geändert hatten. Er hievte sich vom Sofa hoch und lief zur Küche. Kaum hatte er die Tür geöffnet, als ihm auch schon dicker Zigarettenqualm entgegenschlug. Silke saß am Küchentisch vor einer ausgebreiteten Zeitung und paffte, was das Zeug hielt. Als sich Oppenheimer räusperte, warf sie ihm einen eisigen Blick zu. »Was?«
»Ähm, etwas Kühles zu trinken?«, stammelte er.
Mit wiegenden Schritten schlenderte Silke zum Kühlschrank. Oppenheimer hatte reichlich Zeit, die Küche zu begutachten. Die Tischplatte war aus Resopal und hatte funkelnde Metallleisten als Verzierung. Die Geräte waren brandneu. Das windschnittige Design mit den gerundeten Kanten war unverkennbar amerikanisch.
Silke trat vor Oppenheimer und reichte ihm eine eiskalte Colaflasche. Ein Glas bekam er von ihr nicht. Also kehrte er mit der Flasche in der Hand zum Sofa zurück und ließ sich wieder in das Polster sinken. »Eine andere Herangehensweise ist wohl nötig. Am besten gibst du mir noch mehr Details über Lotte, damit ich weiter nachhaken kann. Was dir gerade so einfällt. Mit welchen Leuten verkehrte sie? Was hat sie so gemacht?«
Rita schmunzelte. »Aber du kennst Lotte doch! Das ist mir gerade erst eingefallen!«
Oppenheimer glaubte, sich verhört zu haben. »Wie bitte?«
»Du musst sie kennen. Lotte hat damals in der Rio Bar gearbeitet. Sie kam zur gleichen Zeit wie ich, kurz nachdem Ede den Schuppen aufgemacht hat.«
Obwohl sich Oppenheimer das Gehirn zermarterte, konnte er sich zu seiner Schande nicht an Lotte erinnern.